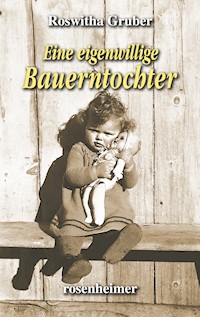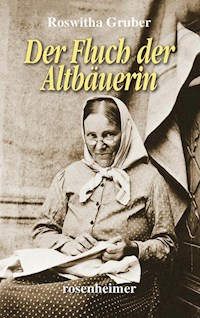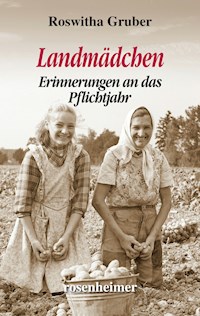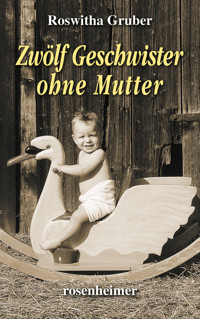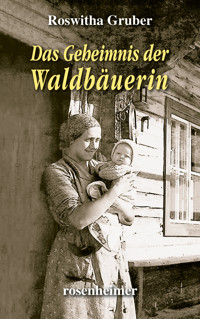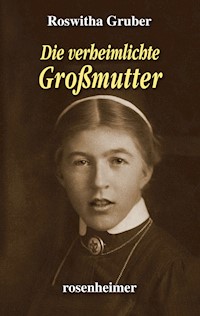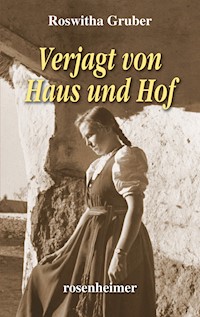16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im vierten Buch über die Berghebamme Marianne Feldmoser erzählt Roswitha Gruber erneut von deren bewegenden Erlebnissen. Oft musste Nanni, wie sie von ihren Schützlingen liebevoll genannt wurde, weite Wege bestreiten. Weder Eiseskälte noch tiefe Nacht konnten sie davon abhalten zu einer Geburt zu eilen. Ihr begegneten die unendliche Freude über den ersehnten Stammhalter sowie die Ängste der Eltern, wenn doch Komplikationen auftraten. So hat Nanni im Laufe ihres Arbeitslebens traurige, aber auch viele beglückende Momente erlebt. Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
LESEPROBE zu
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2014
© 2014 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: © Bundesarchiv, Bild 102-13429 / Fotograf: Georg Pahl
Lektorat und Bearbeitung: Gisela Faller, Stuttgart
Satz und Datenkonvertierung: SATZstudio Josef Pieper, Bedburg-Hau
E-Book ISBN 978-3-475-54277-0 (epub)
Für Johanna Trauner
Roswitha Gruber
Zu dritt im Ehebett
Im vierten Buch über die Berghebamme Marianne Feldmoser erzählt Roswitha Gruber erneut von deren bewegenden Erlebnissen. Oft musste Nanni, wie sie von ihren Schützlingen liebevoll genannt wurde, weite Wege bestreiten. Weder Eiseskälte noch tiefe Nacht konnten sie davon abhalten zu einer Geburt zu eilen. Ihr begegneten die unendliche Freude über den ersehnten Stammhalter sowie die Ängste der Eltern, wenn doch Komplikationen auftraten. So hat Nanni im Laufe ihres Arbeitslebens traurige, aber auch viele beglückende Momente erlebt.
Roswitha Gruber widmet sich der Schilderung starker Frauen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Für jeden ihrer Romane recherchiert sie ausführlich und nähert sich in langen, intensiven Gesprächen dem Schicksal ihrer Protagonistinnen an. Roswitha Gruber lebt und arbeitet in Reit im Winkl.
Vorwort
Von vielen Leserinnen wurde der Wunsch nach einem weiteren Band über die Berghebamme Marianne Feldmoser, genannt Nanni, an mich herangetragen. Deshalb machte ich vor einigen Monaten mal wieder einen Besuch bei ihr, um weitere Geschichten zu erfahren. Sie aber winkte ab: »Ich weiß nichts mehr. Ich hab dir schon alles erzählt.«
»Das kann doch nicht sein«, widersprach ich ihr. »Du hast über 3000 Kindern ans Licht der Welt verholfen, da muss es doch noch eine Menge Geschichten geben, die ich nicht kenne. Bisher hast du mir doch höchstens von 80 Fällen erzählt.«
»Das waren die aufregendsten Fälle. Von den anderen Entbindungen gibt es nichts zu erzählen, weil sie völlig unspektakulär verlaufen sind.«
Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es bei mehr als 3000 Entbindungen nicht mehr als 80 Fälle gegeben haben sollte, von denen es etwas Interessantes zu berichten gab.
»Ja, kann sein«, räumte sie ein. »Mir fällt aber nichts mehr ein.«
Damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. Für mich war es unvorstellbar, dass dieser Brunnen versiegt sein sollte. Sicher, man musste Nanni zugute halten, dass sie mittlerweile über achtzig war. Dennoch, sie war noch klar bei Verstand, es musste noch mehr an Erinnerungen in ihr stecken.
Da kam mir eine Erleuchtung. »Du hast doch über jede Entbindung Tagebuch führen müssen. Was ist aus diesen Tagebüchern geworden?«
»Die habe ich alle aufgehoben.«
Ein Lichtblick!
»Weißt du, wo du sie hast?«
»Freilich weiß ich das. Die sind auf dem Dachboden.«
Ich fragte, ob es möglich wäre, sie herunterzuholen.
Während sie die steile Treppe nach oben stieg, betrachtete ich die herrliche Aussicht, die man von ihrer Stube aus hat. Bei meinen bisherigen Besuchen war ich kaum dazugekommen, weil ich immer nur wie gebannt an ihren Lippen gehangen hatte. Über den gepflegten Vorgarten hinweg schweifte mein Blick zu den schmucken Häusern, die unterhalb ihres Anwesens angesiedelt waren. Jenseits des Dorfes ließ ich meinen Blick den mächtigen Berg hinaufwandern, der in seinem unteren Drittel weitgehend mit Wald bedeckt war. Dazwischen gab es Wiesen mit einzelnen Gehöften, die wirkten, als seien sie am Berg angeklebt. Das obere Drittel des Berges bestand aus nacktem Fels, den ganz oben – es war Ende Mai – noch immer eine weiße Kappe zierte.
Schon hörte ich Nanni zurückkommen. Sie schleppte schwer an einem braunen mittelkleinen Koffer, der schon lange aus der Mode gekommen war und ziemlich mitgenommen aussah. Gemeinsam wuchteten wir ihn auf den Tisch. Dann schnappten die beiden Schlösser auf, und die ganze Pracht lag vor mir. Fein säuberlich geordnet lagen die Tagebücher im Koffer, für jedes Jahr ihrer langen Dienstzeit ein eigenes.
»Das hätte ich nicht gedacht, dass ich die noch mal zur Hand nehmen werde«, erklärte Nanni lächelnd, als sie wahllos eines der Bücher – die eigentlich eher Hefte waren – herausgriff. Während sie darin blätterte, beobachtete ich aufmerksam ihr Gesicht. Auf einmal war es mir, als husche ein Ausdruck des Erinnerns darüber. Noch ehe ich fragen konnte, ob sie etwas Interessantes entdeckt habe, äußerte sie: »Ah, die Geschichte von der Sandnerbäuerin! Die scheint mir auch erzählenswert zu sein.« Und schon legte sie los. Geistesgegenwärtig drückte ich auf den Aufnahmeknopf meines Tonbandgerätes, damit mir nur ja kein Wort von Nannis Bericht entging.
Wenig später hatte ich meine erste Geschichte im Kasten. Als die Hebamme geendet hatte, ließ ich mir dieses Heft reichen. Neugierig blätterte ich darin herum, in der Erwartung, weitere interessante Geschichten darin zu entdecken. Ernüchtert stellte ich fest, dass dieses Tagebuch ganz anders geartet war als das, was man allgemein unter einem Tagebuch versteht. Da gab es keine zusammenhängenden Texte, wie man sie normalerweise in ein solches Buch einträgt, sondern auf jeder Seite standen kurze vorgedruckte Wörter mit einer freien Zeile, in welche die Hebamme ihre Eintragungen machen konnte, wie: Name des Kindes, Geburtsdatum, Uhrzeit, Gewicht, Länge, Kopfumfang, Wohnort, Name der Mutter, Name des Vaters und noch andere nüchterne Daten. Wenn es hochkam, befand sich in der Zeile »Besondere Vorkommnisse« auch noch ein Eintrag, wie zum Beispiel »primäre Wehenschwäche« oder »Steißlage«.
Doch beim Anblick solch einfacher Angaben auf weiteren Seiten und in weiteren ihrer Hefte setzte bei meiner Berghebamme das Erinnern wieder ein, und sie sprudelte los. Aber nicht nur durch diese nüchtern wirkenden Tagebücher, zu deren Führung sie während ihrer Dienstzeit verpflichtet gewesen war, bekam sie Erinnerungsanstöße, sondern auch durch ihre aufbewahrten Berichtshefte, die sie während ihrer Ausbildungszeit in der Hebammenlehranstalt hatte führen müssen.
Auf diese Weise kam ich an diesem und an einigen Folgetagen zu meinen Geschichten. Da inzwischen einige der handelnden Personen gestorben sind, traute sie sich sogar, solche Fälle zu erzählen, die sie bisher für zu heikel gehalten hatte.
Was dabei herausgekommen ist, können Sie auf den folgenden Seiten nachlesen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.
Roswitha Gruber
Besatzungskinder
Nach dem Zweiten Weltkrieg war unsere Region noch über zehn Jahre lang von amerikanischen Truppen besetzt gewesen. Die Auswirkungen davon bekamen wir sogar noch im Jahre 1957 zu spüren, als ich meine Ausbildung in der Hebammenlehranstalt zu Salzburg begann. Dort wurden wir nämlich nicht nur mit theoretischem Wissen vollgestopft, wir wurden auch immer wieder für einige Wochen auf verschiedenen Stationen des Krankenhauses eingesetzt, um möglichst viel Praxis mitzubekommen. Besonders die Einsätze im Kreißsaal waren interessant, dort profitierten wir am meisten für unseren zukünftigen Beruf. Unter Anleitung von erfahrenen Lehrhebammen wurden wir mit den unterschiedlichsten Situationen, die bei einer Entbindung auftreten können, vertraut gemacht. Denn in diese Lehranstalt wurden vor allem jene Frauen von ihrem Arzt oder von ihrer Hebamme geschickt, bei denen eine Komplikation zu befürchten war.
Wir hatten aber auch mit einer ganzen Reihe von »normalen« Geburten zu tun. Aus der Stadt kamen nämlich auch diejenigen Frauen zu uns, bei denen die Gegebenheiten für eine Hausgeburt nicht gerade ideal waren. So erinnere ich mich noch lebhaft an die erste Entbindung, die ich selbstständig durchführen durfte, allerdings unter den strengen Augen der Frau Schäfer, meiner Lehrhebamme. Bis dahin hatte ich nur einige Male zugeschaut, wie sie das machte, und hatte mich auf kleine Handreichungen beschränken müssen.
Es war an einem Samstagabend, Mitte März, als uns eine Krankenschwester eine Hochschwangere an der Tür des Kreißsaales übergab. Diese trug eine Reisetasche bei sich und war, da noch immer winterliche Temperaturen herrschten, in einen weiten Kamelhaarmantel gehüllt. Sowohl die Tasche als auch der Mantel, die schon ziemlich abgewetzt waren, ließen vermuten, dass die Frau aus bescheidenen Verhältnissen stammte. Die Kleidung, die nach Ablegen des Mantels zum Vorschein kam, bestätigte diese Vermutung. Auch die Frau selbst war nicht mehr »taufrisch«, sie musste schon Ende dreißig, Anfang vierzig sein.
Die Hebamme bedeutete mir, die Aufnahme zu machen. Zur Aufnahme gehörte nicht nur, dass man die Personalien abfragte, dazu gehörte auch die Anamnese. In der Anamnese erfährt man etwas über den Verlauf der Schwangerschaft und über durchgemachte Krankheiten der Gebärenden. Diese Kenntnisse können für den Geburtsverlauf sehr wichtig sein.
Stolz wie Oskar fragte ich zunächst – wie ich das bei meiner Lehrherrin in den vorangegangenen Tagen beobachtet hatte –, in welchem Abstand die Wehen kämen. Daran ließ sich nämlich ermessen, ob oder wie sehr ich mich bei der Anamnese beeilen musste. Die Frau warf einen Blick auf die große runde Uhr, die unübersehbar über dem Schreibtisch hing.
»Die letzte war vor ungefähr zehn Minuten«, antwortete sie. »Aber gerade geht es wieder los.«
Sie atmete so gekonnt ein und aus, als ob sie bereits Erfahrung mit Entbindungen hätte. Deshalb war meine nächste Frage, nachdem die Wehe abgeklungen war: »Das wievielte Kind ist dieses?«
»Das dritte«, war die Antwort. Ungefragt fügte sie hinzu: »Ich habe bereits zwei Dirndln, im Alter von acht und sechs Jahren.«
»Aha, dann ist dieses hier sozusagen ein Nachkömmling«, konstatierte ich und machte meine Notizen.
»Ja«, antwortete die Schwangere, »uns fehlt nur noch der Bub.«
Dann erfragte ich das Übliche: ihren Namen, ihr Geburtsdatum, die Adresse, Namen und Beruf des Ehemannes, den sie mit Obusfahrer angab.
Nachdem ich dies alles auf dem Erhebungsblatt notiert hatte, erkundigte ich mich noch nach dem Verlauf der beiden vorangegangenen Entbindungen, nach durchgemachten Krankheiten und ob sie irgendwelche Medikamente nehme.
Die Wehen kamen inzwischen in immer kürzeren Abständen, also wurde es Zeit für die Geburtsvorbereitungen. Das lief alles wie am Schnürchen. Und auch die eigentliche Entbindung verlief völlig glatt, zumal die erfahrene Mutter gut mitarbeitete. Als ich dann das Kind in Händen hielt, das erste, das ich selbstständig auf die Welt geholt hatte, das war schon ein stolzes Gefühl! Zu meiner großen Freude schrie es auch gleich aus Leibeskräften los. Nun kam der Augenblick, wo ich es abnabeln musste. Behutsam legte ich das Neugeborene zwischen den Oberschenkeln seiner Mutter ab. Dann nahm ich die bereitliegenden Klammern, um die Nabelschnur abzuklemmen. Die eine setzte ich ziemlich nah am Bauch des Kindes an, die andere in einigen Zentimetern Abstand dazu. Dann ergriff ich die Nabelschere. Statt aber die Nabelschnur zu durchtrennen, starrte ich unschlüssig darauf, weil ich das Blut darin noch pulsieren sah und spürte.
»Auf was wartest du denn?«, fragte mich meine resolute Lehrhebamme. »Irgendwann musst du es tun.«
Also gab ich mir einen inneren Ruck und schnitt die Verbindung zwischen Mutter und Kind durch, nach Ansicht meiner Lehrmeisterin jedoch zu zaghaft. »Richtig war es schon«, kommentierte sie, »aber nächstes Mal bitte etwas entschlossener. Es tut nämlich weder der Mutter noch dem Kind weh.«
Während ich den Nabelverband anlegte und noch bevor das Kind gewogen und gemessen war, ertönte vom Kopfende des Bettes die Stimme der Mutter: »Ist alles in Ordnung?«
»Ja, schon«, antwortete Frau Schäfer zögerlich. »Einen strammen Buben haben S’ gekriegt, aber …«
Noch ehe sie ihren Satz beendet hatte, fiel ihr die Wöchnerin ins Wort: »Ah, gut, da wird sich mein Mann riesig freuen.«
»Ich bin mir da nicht so sicher, dass er sich freuen wird«, schränkte die Hebamme ein.
»Wieso? Was ist?«, fragte die frisch Entbundene ungeduldig.
»Der Bub hat krause schwarze Haare, dicke Lippen, eine platte Nase und schwarze Hoden.«
»Ach so«, konstatierte die Frau ziemlich emotionslos, worüber wir uns sehr wunderten. Dann reichten wir ihr das Kind. »Aber weiß ist er schon«, stellte die Mutter sachlich fest.
»Ja, schon. Aber das wird er nicht lange bleiben. In einigen Tagen wird seine Haut dunkel sein, wie sehr, lässt sich nicht voraussagen.«
Auch diese Mitteilung nahm die Frau so gelassen zur Kenntnis, dass wir uns beide verdutzt anschauten. Für uns sah es ganz danach aus, als habe die Frau nicht begriffen, was die Lehrhebamme damit hatte andeuten wollen. Deshalb versuchte sie, ihr mit anderen behutsamen Worten zu erklären, was womöglich an Problemen auf sie zukommen könne. »Da Sie den Beruf Ihres Mannes mit Obusfahrer angegeben haben, gehe ich davon aus, dass er kein Amerikaner ist und schon gar kein farbiger.«
»Nein, ein Ami ist der nicht. Der ist so weiß wie Sie und ich. Er ist ein waschechter Salzburger.«
»Das hab ich mir gedacht. Wird er nicht blöd schauen, wenn Sie mit einem Negerkind daherkommen?«
Anders als heute empfand damals niemand das Wort »Neger« als beleidigend, und jeder verwendete dieses Wort ganz selbstverständlich, ohne etwas Schlimmes dabei zu denken. »Neger«, das war halt das Wort für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe.
»Nein, das wird er nicht. Ich habe ihm rechtzeitig erzählt, dass ich von einem Neger vergewaltigt worden bin.«
Ob das wirklich stimmte oder ob die Frau so schlau gewesen war, rechtzeitig eine Schutzbehauptung aufzustellen, dahinter sind wir nicht gekommen. Das ging uns im Grunde genommen aber auch nichts an. Wenn die Frau die Geburt eines Mischlings so gelassen nahm, dann würde sie mit ihrem Ehemann schon klarkommen. Wahrscheinlich machte ich mir über ihr Schicksal mehr Gedanken als sie selbst. Deshalb suchte ich in einer ruhigen Minute das Gespräch mit meiner Lehrhebamme. »Ist das in der Vergangenheit öfters vorgekommen, dass eine Ehefrau ein Besatzungskind zur Welt gebracht hat?«
»Das kannst glauben! Vermutlich häufiger, als man es gemerkt hat. Diese Frauen waren klug genug, sich nur mit einem weißen Ami einzulassen.«
»Die meine ich nicht. Ich meine, ob es weiße Ehefrauen gegeben hat, die ein farbiges Kind geboren haben?«
»Leider gab es auch solche Fälle«, seufzte Frau Schäfer.
»Das haben doch bestimmt nicht alle Mütter so gelassen hingenommen wie diese hier?«
»Nein, ganz gewiss nicht«, versicherte mir die Hebamme. »Die sind in Panik ausgebrochen, und eine wollte sich gar umbringen.«
»Und wie habt ihr darauf reagiert?«
»Wir haben diese Mütter beruhigen können, indem wir ihnen anboten, ihr Kind erst mal in einem Heim unterzubringen. Dann könnten sie in Ruhe überlegen, ob sie es zur Adoption freigeben wollen. ›Da brauche ich nicht lange zu überlegen‹, hatte eine von ihnen geantwortet. ›Machen Sie mit dem Kind, was Sie wollen. Hauptsache, Sie schaffen es irgendwie weg, damit mein Mann es nicht zu sehen kriegt.‹«
»Und wie hat der Mann darauf reagiert, dass die Frau nach der Entbindung kein Kind vorzuweisen hatte?«
»Sie hat behauptet, es sei tot zur Welt gekommen, und das Krankenhaus kümmere sich um die Beerdigung. Das war ihm gerade recht. So entstanden ihm weder Kosten noch Mühen. Aber nicht alle haben auf diese Weise reagiert. In einem anderen Fall hat mir die junge Mutter unter Tränen erzählt, ihr Mann habe gleich nach ihrem Geständnis die Scheidung eingereicht.«
Es stand mir nicht an, mich als Richter über diese Frauen aufzuspielen, dennoch konnte ich die Enttäuschung eines Ehemannes verstehen.
»Nach dem Krieg waren es aber meist junge Witwen und junge Mädchen, die ein Besatzungskind zur Welt brachten. Die hatten zwar keine Probleme mit einem Ehemann zu befürchten, aber mit der Reaktion ihrer Eltern oder der lieben Mitmenschen. Deshalb gaben sie ihre Mischlingskinder spontan zur Adoption frei«, erzählte meine Lehrhebamme weiter. »Es gab aber auch solche, die das Kind behalten haben, nämlich dann, wenn sich der dunkelhäutige Vater zu dem Kind bekannte. Dabei habe ich die Beobachtung gemacht, dass sich die farbigen Soldaten meist liebevoller um Mutter und Kind kümmerten als die weißen. Ihre Babys sahen aber auch zu süß aus. Einige dieser Besatzungssoldaten erklärten sogar spontan, dass sie die Kindsmutter heiraten wollten. Von ein paar dieser Mädchen habe ich tatsächlich gehört, dass die Kindsväter sie nach Ableisten ihrer Militärzeit mit in die USA genommen oder nachkommen lassen und dort geheiratet haben. Aber es gab natürlich auch die anderen Fälle. Eine Schwangere hat nicht einmal Kindswäsche mit in die Klinik gebracht. Als wir ihr erklärten, die benötige sie doch bei der Entlassung, antwortete sie kaltschnäuzig: ›Dafür brauche ich keine Wäsche, ich lasse das Kind doch hier.‹
Stell dir das nur nicht so einfach vor, dachte ich, sagte aber nichts. Am Tag der Entlassung, also am neunten Tag nach der Entbindung, würden wir schon darauf achten, dass sie ihr Kind auch mitnahm, notfalls in klinikeigener Wäsche. Aber wir hatten die Rechnung ohne diese Mutter gemacht. Am siebten Tage war sie verschwunden, und ihr Kind hatte sie zurückgelassen. ›Der werden wir helfen‹, sagte ich zu meiner Kollegin. ›Wir haben ja ihre Adresse.‹ Sehr schnell stellte sich aber heraus, dass die Adresse falsch war. Eine solche Anschrift existierte in ganz Salzburg nicht. Da saßen wir nun und hatten ihr Kind, einen süßen, schokoladenbraunen Buben, am Hals. Ihn zu ernähren, war kein Problem. Es gab genügend Mütter, die zu viel Milch hatten und die den Kleinen anlegten, nachdem ihr Kind gesättigt war. Er wurde bald der Liebling der ganzen Wöchnerinnenstation. Auf die Dauer konnten wir ihn jedoch nicht behalten. Spätestens wenn er ins Krabbelalter gekommen wäre, hätten wir im Säuglingszimmer ein Problem mit ihm gehabt. Das Jugendamt war in der Zwischenzeit aber nicht untätig gewesen. Während weißhäutige Kinder weggingen wie warme Semmeln, dauerte es bei unserem braunen Wonneproppen ein bisschen länger. Endlich hatten sie aber ein etwas älteres, kinderloses Ehepaar gefunden, das bereit war, unseren kleinen Liebling zu adoptieren.«
Mich interessierte natürlich, was aus meiner Wöchnerin, der Frau des Obusfahrers, und ihrem Kind werden würde. Deshalb war ich begeistert, als ich im Säuglingszimmer aushelfen durfte. Meine Aufgabe war es, der Säuglingsschwester zu helfen, die Kinder zum Stillen zu ihren Müttern zu bringen und sie hernach wieder einzusammeln. Bei dieser Gelegenheit fragte ich »meine Wöchnerin«, so leise, dass es ihre Bettnachbarinnen nicht hören sollten: »Wie hat Ihr Mann auf den Buben reagiert?«
»O, Sie brauchen gar nicht zu flüstern«, antwortete sie. »Alle hier im Raum haben mitgekriegt, wie begeistert er über seinen Buben war.«
»Ja, ist ihm denn an dem nichts aufgefallen?«, hakte ich nach.
»Doch. Er akzeptiert ihn so, wie er ist. Hauptsache gesund«, hat er gesagt.
»Zu so einem Prachtstück von Mann kann man Ihnen nur gratulieren.«
Neugierig, wie ich war, und »studienhalber« natürlich interessierte es mich, wie sich die Hautfarbe des Kindes verändern würde. Deshalb schlich ich in der Folgezeit jeden Tag an sein Bettchen, auch wenn ich ihn nicht zu versorgen hatte, und betrachtete ihn aufmerksam.
Zufällig bekam ich auch mit, wie der Obusfahrer, stolz wie ein Schneekönig, am zehnten Tag nach der Entbindung seine Frau und den Buben abholte, der mittlerweile tatsächlich braun war wie Milchschokolade.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?
Dann laden Sie sich noch heute das komplette eBook herunter!