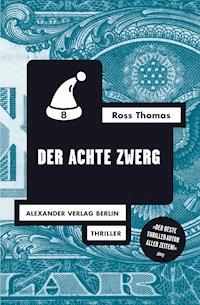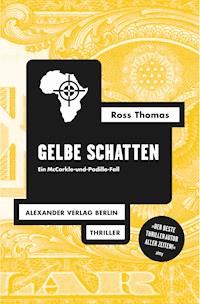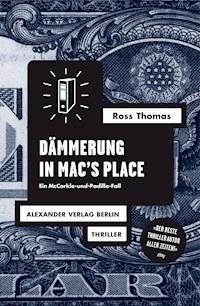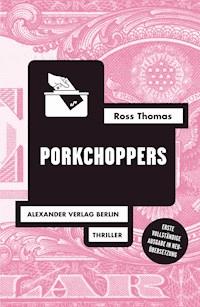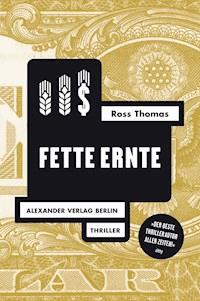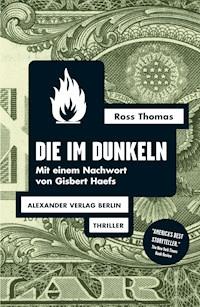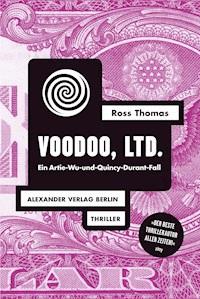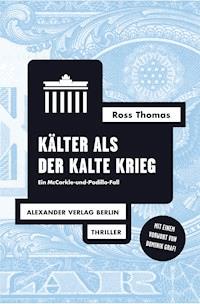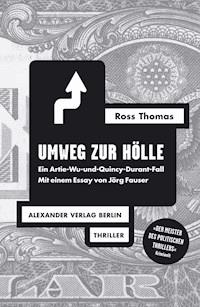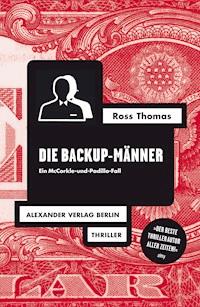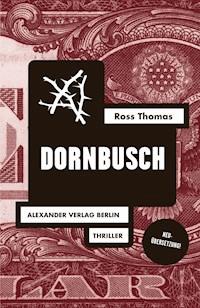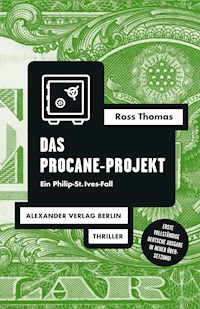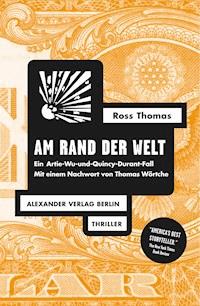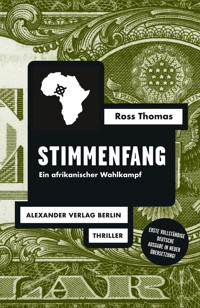14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alexander Verlag Berlin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ross-Thomas-Edition
- Sprache: Deutsch
Noch bevor Philip St. Ives das Angebot von Ned und Norbert Nitry angenommen hat, das sagenhafte Schwert Ludwigs des Heiligen wiederzubeschaffen, findet sich der professionelle Mittelsmann in einem Londoner Gefängnis wieder. Und das ist nur der Anfang. Das kostbare Schwert ist den »diskret« mit Kunstwerken handelnden Brüdern Nitry gestohlen worden und die Diebe verlangen einhunderttausend Pfund Lösegeld. Als St. Ives den Auftrag annimmt, gerät er in einen Reigen bizarrer Figuren, die auch vor Mord nicht zurückschrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ross Thomas, Zu hoch gepokert
Ross Thomas, geboren 1926 in Oklahoma, verarbeitete seine vielfältigen beruflichen Erfahrungen in seinen Politthrillern, in denen er vor allem die Hintergründe des (amerikanischen) Politikbetriebs entlarvt und bloßstellt. Ihm wurde zweimal der Edgar Allan Poe Award und mehrmals der Deutsche Krimipreis verliehen. Bis zu seinem Tod 1995 entstanden 25 Romane.
Ross Thomas
Zu hoch gepokert
Ein Philip-St. Ives-Fall
Aus dem amerikanischen Englisch von Gisbert Haefs
Alexander Verlag Berlin
Die Ross-Thomas-Edition im Alexander Verlag Berlin
Herausgegeben von Alexander Wewerka
Der Messingdeal. Ein Philip-St. Ives-Fall
Protokoll für eine Entführung. Ein Philip-St. Ives-Fall
Keine weiteren Fragen. Ein Philip-St. Ives-Fall
Das Procane-Projekt. Ein Philip-St. Ives-Fall
Umweg zur Hölle. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Am Rand der Welt. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Voodoo, Ltd. Ein Artie-Wu-und-Quincy-Durant-Fall
Kälter als der Kalte Krieg. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gelbe Schatten. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Die Backup-Männer. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Dämmerung in Mac’s Place. Ein McCorkle-und-Padillo-Fall
Gottes vergessene Stadt · Teufels Küche · Die im Dunkeln · Fette Ernte · Der Yellow-Dog-Kontrakt · Der achte Zwerg · Dornbusch · Porkchoppers · Der Mordida-Mann · Der Fall in Singapur · Dann sei wenigstens vorsichtig. Alle auch als eBook!
Erste vollständige deutsche Ausgabe in neuer Übersetzung.
Die gekürzte deutsche Erstausgabe erschien 1974 unter dem Titel Ein scharfes Baby im Ullstein Verlag, Frankfurt a. M./Berlin/Wien.
Die amerikanische Originalausgabe The Highbinders erschien 1973 unter Ross Thomas’ Pseudonym Oliver Bleeck.
© 1973 by Ross Thomas
Licensed with Ross E. Thomas, Inc.
© für diese Ausgabe by Alexander Verlag Berlin 2023
Alexander Wewerka, Fredericiastr. 8, D-14050 Berlin
[email protected] · www.alexander-verlag.com
Umschlaggestaltung: Antje Wewerka
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-89581-609-3 (eBook)
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1
Mit der Nelke kam ich mir albern vor. Es hätte eine rote sein sollen, der Blumenladen im Hilton hatte sie aber nur in Rosa, deshalb zahlte ich fünfzehn Pence für eine und ließ sie mir von der Verkäuferin ans Revers stecken.
»Na, wir sehen aber fein aus«, sagte sie. »Wollen Sie einen Spiegel?«
»Ich glaube, ich weiß noch, wie ich aussehe«, sagte ich, lächelte ihr zum Abschied zu und ging durch die Lobby zum Ausgang und einem Taxi. Niemand nahm von meiner Nelke Notiz, und ich fürchte, ich war ein bisschen enttäuscht.
Es war fünf Minuten nach halb sechs, Londoner Hauptverkehrszeit. Aber für nur zwanzig Pence pfiff mir der Türsteher des Hilton ein Taxi heran, hielt mir die Wagentür auf, fragte mich, wohin ich wollte, und wiederholte es für den Fahrer. »Black Thistle in der New Cavendish. Finden Sie das, Kumpel?«
»Will ich doch hoffen«, sagte der Fahrer, legte das Freizeichen um und fädelte sich in den Verkehr der Park Lane ein.
Es war keine lange Fahrt, höchstens ein Kilometer, aber bei dem dichten, zähflüssigen Verkehr erreichten wir das Black Thistle erst kurz vor sechs.
Ich habe mir nie viel aus Pubs gemacht. Der Grund ist vermutlich der, dass ich Cocktailpartys verabscheue und mich ein englischer Pub, direkt nach der Öffnungszeit um halb sechs, immer an eine amerikanische Cocktailparty erinnert, wenn der Gin knapp wird.
Das Black Thistle war ein Watney-Pub und schien ziemlich neu, jedenfalls die Inneneinrichtung mit reichlich glitzerndem Vinyl und zwei bestürzend hässlichen Wandgemälden. Ich drängte mich zur umlagerten Theke vor, bestellte einen großen Whisky, goss mir aus einem Krug etwas Wasser dazu und steckte das Wechselgeld ein. Als ich mich abwandte, wurde mir das Glas von einem grauen Tweed-Ellenbogen mit schwarzem Wildlederflecken aus der Hand geschlagen.
Der Ellenbogen gehörte einem Mann, der ein Bierglas schwenkte und mir den Rücken zukehrte. Als er sich zu mir umdrehte, sah ich, dass er über eins achtzig groß, Ende Zwanzig war und bereits einen Bauch hatte. Sein rundes, glattes, rosiges Gesicht lief rot an.
»Tut mir schrecklich leid«, sagte er. »War das Ihr Glas?«
»Macht nichts«, sagte ich.
Als er sich bückte, um das Glas aufzuheben, hatte ich einen guten Blick auf seinen blanken Schädel, der abgesehen von einer etwa fünf Zentimeter langen, dicken weißen Narbe genauso glatt und rosig war wie sein Gesicht. Spärliches, hellblondes Haar bedeckte die Seiten und den Hinterkopf; er trug es lang und zurückgekämmt, so dass es ihm über den Kragen des blaugemusterten Oberhemds hing.
Als er sich wieder aufrichtete, bat er mit einem Lächeln um Entschuldigung. »Was haben Sie getrunken, Whisky?«
»Stimmt.«
»Einen doppelten, wie? Ich hol Ihnen einen neuen.«
»Bemühen Sie sich nicht.«
Er lächelte wieder. Seine Zähne waren ein bisschen grau, aber es war trotzdem ein ganz nettes Lächeln. »Wenn einer meinen Drink verschüttet, darf der mir gut und gern ’nen neuen ausgeben. Bin in ’ner Sekunde wieder da.«
Es vergingen aber beinahe sechzig Sekunden, bevor er sich mit dem vollen Glas seinen Rückweg durch die plappernde Menge gebahnt hatte. Im Whisky schwamm sogar ein Eiswürfel. Dann bemerkte ich das vertraute Grau seiner Augen, konnte mich aber nicht erinnern, wo ich diesen Farbton vor kurzem gesehen hatte, bis er wieder lächelte und ich die Zähne sah. »Amerikaner, oder?«, sagte er und drückte mir das Glas in die Hand.
»Stimmt.«
»Dachte mir, Sie hätten gern Eis. Die meisten von euch mögen das so.«
»Danke.«
»Alles in Ordnung?«
»Alles bestens.«
Er lächelte sein graues Lächeln. »Also, dann noch viel Spaß.«
Ich nickte. Er wandte sich ab und drängte sich in die Menge. Ich drängte mich aus ihr heraus in Richtung Tür, wo niemand herumstand und jeder, der es wollte, die Nelke an meinem Revers bewundern konnte. Nach einem Probeschluck schaute ich auf meine Uhr. Es war fünf Minuten nach sechs; ich war noch immer zehn Minuten zu früh dran.
Ein doppelter Whisky in England entspricht ungefähr einem einfachen Whisky in einer leidlich anständigen New Yorker Bar, deshalb war ich mit meinem Drink schnell fertig und überlegte gerade, ob ich mir wirklich die Mühe machen sollte, noch einen zu holen, als die Krämpfe begannen. Sie packten mich direkt über der Gürtellinie, und es war, als hätte mir jemand ein Eisenrohr in den Bauch gerammt. Von innen.
Ich krümmte mich und ließ das leere Glas fallen. Es rollte über den Boden. Der nächste Anfall traf mich noch schlimmer als der davor; diesmal war es, als bohrten sich Eisenzinken in meinen Magen, rostige Eisenzinken. Was für ein Glück, dachte ich, dass die Harley Street mit ihren Ärzten nur drei Blocks entfernt war. Für die Leute der Harley Street wäre eine Blinddarmentzündung bloße Routine – wie sie es für den alten Dr. Marland gewesen war, der mir in dem Sommer, als ich fünfzehn war, den Blinddarm herausgenommen hatte.
Auf die Schmerzen folgte Brechreiz, und ich wusste, ich würde mich übergeben müssen. Weil ich eigentlich ein reinlicher Mensch bin, wollte ich meine Übelkeit lieber draußen im Rinnstein loswerden als auf dem hübschen lila Teppich des Black Thistle.
Ich drehte mich um und taumelte zur Tür. Die Krämpfe verschwanden fast so rasch, wie sie gekommen waren. An ihre Stelle trat außer dem Brechreiz ein sonderbares Gefühl des Wohlbehagens, das irgendwie den Frieden von Marihuana und die Verwegenheit von drei Martinis vereinigte. Aber es war besser als beide. Etwas Ähnliches hatte ich schon einmal flüchtig verspürt, als ich von zehn abwärts zählte, während mir ein Zahnarzt, bevor er mir einen eingeklemmten Weisheitszahn zog, eine Pentothal-Injektion in den linken Arm verpasste. »Sie werden nichts merken«, hatte er gesagt, und ich hatte nichts verspürt außer erhabenem Selbstvertrauen.
Genauso fühlte ich mich, als ich hinaustorkelte und im Rinnstein der New Cavendish Street eine Sauerei anrichtete. Es machte mir aber nichts aus, weil ich damit klarkam, und wenn ich nur einen Moment Ruhe hätte, könnte ich sogar den Generalschlüssel zum Universum finden.
Aber diese Chance bekam ich nie. Meine Arme wurden von hinten gepackt. Vor mir kamen zwei Männer und ein Mädchen aus dem Black Thistle. Sie starrten mich an. Das Mädchen verzog das Gesicht und kicherte, die beiden Männer grinsten breit und lachten dann. Ich beschloss, mich nicht niederschlagen und ausplündern zu lassen, nicht am hellen Tag auf der New Cavendish Street, London W. I. Nicht vor einem kleinen grinsenden und kichernden Publikum.
Ich riss den rechten Arm los und stieß den Ellenbogen heftig nach hinten. Er bohrte sich in etwas Weiches, und ich hörte ein sehr befriedigendes »Autsch!«. Eine Stimme sagte: »He, sachte«, deshalb trampelte ich mit dem linken Absatz hart auf etwas wie einen Spann. »Pack ihn, Bill!«, sagte eine andere Stimme. Ich wollte mich gerade umdrehen und Bill in die Eier treten, als harte Hände mein linkes Handgelenk packten und es hoch und nach hinten zwangen, bis meine eigene Hand zwischen den Schulterblättern war. Ein kleiner Ruck, und meine Schulter wäre dahin. Ich fand, dass es den Einsatz nicht wert war und dass ich statt zu zappeln lieber zetern sollte. »Verdammte Bastarde«, sagte ich.
»Na, aber«, sagte die erste Stimme. »So was sagt man doch nicht.«
Ich verrenkte mir den Hals, um einen Blick auf den Burschen zu werfen, den ich in den Bauch geboxt hatte. Er hatte ein hartes junges Gesicht mit einem rüden schmalen Mund und blassblauen Augen so freundlich wie die von Schlangen. Außerdem hatte er lange blonde Koteletten. Sein übriges Haar konnte ich nicht sehen, weil es von dem blauen Topfhelm bedeckt war, den Londoner Polizei-Constables normalerweise tragen.
2
Das Erste, was ich beim Erwachen sah, war die mattierte, schwächliche 25-Watt-Birne, gedreht in eine Fassung an der Decke, die an die sechs Meter hoch war. Vermutlich würde das Licht nie ausgehen, solange die Birne nicht durchbrannte.
Ich lag da und hatte Kopfweh. Es war aber etwas mehr als normale Kopfschmerzen, nämlich ein bösartiger Tumor, der unmittelbar über den Augen aus der Stirnhöhle bersten würde. Das war, fand ich, eine scheußliche Art zu sterben.
Aber statt zu sterben, stand ich auf. Jedenfalls brachte ich die Füße auf den Boden und raffte mich zu einer Art von zusammengesacktem Sitzen auf. Ich hatte auf einer Platte aus gelben Fliesen gelegen, die in einen Winkel des Raums etwa einen halben Meter über dem Boden eingefügt war. Es war ein Bett. Um es weicher zu machen, gab es zwei graue Decken, die sich anfühlten, als hätte man sie aus Holzfasern gewebt. Weiche Holzfasern vielleicht. Eine war zusammengefaltet, und ich hatte sie als Kissen benutzt. Ich konnte mich nicht erinnern, die Decke gefaltet zu haben. Nach dem Handgemenge mit den Schlägern, die sich als zwei Londoner Bobbys entpuppt hatten, konnte ich mich an gar nichts erinnern.
Sie mussten mich in eine Gefängniszelle gebracht haben, noch dazu in eine ziemlich geräumige. Meiner Schätzung nach war sie mindestens zwei Meter breit und vier Meter lang und offenbar für nur einen Insassen gedacht. Außer dem Fliesenlager bestand das Mobiliar aus einem Klosett ohne Brille, einem Ausguss mit Kaltwasserhahn, einer großen grauen Eisentür mit Guckloch und der an die Wand gekritzelten Notiz eines früheren Bewohners: »Gott, ist es hier scheußlich.« Fenster waren nicht vorhanden.
Ich hievte mich hoch, benutzte das WC, trank Leitungswasser und griff nach meinen Zigaretten. Sie waren nicht da. Ich durchsuchte meine Taschen, und sie waren leer. Ich schaute auf mein linkes Handgelenk. Die Armbanduhr war noch vorhanden und zeigte halb sechs. Vermutlich morgens. Man hatte mir die Uhr, meine Kleider, mein Kopfweh und die rosa Nelke gelassen. Die Nelke sah alt und müde und mitgenommen aus, und ich fand, dass wir viel gemein hatten, nur dass sie noch immer gut roch.
Ich war noch nie im Gefängnis gewesen. Nicht um zu bleiben. Nicht in einem Gefängnis, in dem man eine große Eisentür hinter einem zuknallte. Ich hatte einmal den Teil einer Nacht auf einem Revier in New York verbracht, aber da hatte man mich in einem Raum mit ein paar Schreibtischen und Stühlen und einem Fenster einquartiert, und man hatte mir meine Zigaretten und Streichhölzer und sogar einen Rest Würde gelassen.
Ich stand wohl längere Zeit mitten in der Zelle und sah mich um. Fünf Jahre Knast würde ich niemals überstehen, fand ich. Oder fünf Monate. Oder auch nur fünf Tage. Fünf Stunden waren ungefähr das Limit, und ich hatte schon mehr als das hinter mir, also ging ich zur Eisentür und bearbeitete sie mit Fußtritten.
Nach einer Weile kamen sie, um nachzusehen, was da los war. Nach vielleicht einer Woche oder zehn Tagen kam jemand, machte das Guckloch auf und sagte: »Hören Sie mit dem Krawall auf. Wir haben Leute hier, die schlafen wollen.«
»Ich wollte Sie bloß wissen lassen, dass ich wach bin.«
»Sie möchten raus, eh?«
»Stimmt.«
»Haben Sie Ihren Rausch ausgeschlafen?«
Wozu sollte ich mit ihm streiten? »Bin wieder stocknüchtern.«
Er beäugte mich gründlich durch das Guckloch. »Tja, mal hören, was Sergeant Matthews dazu meint.« Der Schieber knallte zu.
Es dauerte zwei Wochen, bis Sergeant Matthews zu einem Entschluss kam. Vielleicht waren es auch nur zehn Tage. Gefängniszeit natürlich. In Echtzeit, der auf meiner Uhr, dauerte es fünfzehn Minuten, bis der Schlüssel klirrte und sich im Schloss drehte. Die große Eisentür schwang auf, und ein junger Polizist stand da, ließ einen großen Schlüssel an einem großen Ring baumeln und nickte, als wäre ich ungefähr das, was er erwartet hatte; jedenfalls nichts Besseres.
»Hier lang«, sagte er, und ich folgte ihm durch einen Korridor, gesäumt von Zellentüren wie der, hinter der ich gesteckt hatte. Wir betraten einen Raum, der mehrere Schreibtische, eine Holzbank und ein paar Stühle enthielt. Hinter einem der Schreibtische saß ein Polizist mit drei Streifen am Ärmel. Sergeant Matthews, nahm ich an.
»Da ist er, Sergeant, Mr. Philip St. Ives«, sagte der junge Polizist, und der Sergeant musterte mich mit dreißig oder einunddreißig Jahre alten grünen Augen, die weder freundlich noch unfreundlich und nicht völlig uninteressiert, aber sicherlich gleichgültig waren.
»Setzen Sie sich, Mr. St. Ives«, sagte Sergeant Matthews.
Ich setzte mich. Er langte in eine Schublade, nahm einen großen gelben Umschlag heraus und legte den Inhalt auf die Platte. Es handelte sich um das, was in meinen Taschen gewesen war. Er hakte die einzelnen Posten auf einer Liste ab und schob sie mir hinüber. Als er zu meinen Zigaretten kam, sagte ich: »Haben Sie was dagegen, wenn ich rauche?«
»Überhaupt nicht, Sir«, antwortete er, ohne aufzublicken.
Ich steckte mir eine Pall Mall an und blies den Rauch in die Luft. Sie schmeckte in Ordnung, besser als erwartet, tat aber meinem Brummschädel nicht gut.
»Ihre Leute waren wohl Engländer, bei dem Namen«, sagte er.
»Oder Franzosen.«
»Ja?«
»Die Franzosen schreiben ihn mit einem Ypsilon.«
»Netter kleiner Ort. St. Ives, meine ich. Je da gewesen?«
»Nein.«
»Netter kleiner Ort.«
Damit schien das Thema erschöpft. Sergeant Matthews schob mir als Letztes ein Päckchen Banknoten und einige Münzen über den Schreibtisch. »Würden Sie bitte Ihr Geld zählen, Sir? Es müssen einunddreißig Pfund und neun Pence sein, plus ein paar amerikanische Münzen.«
Ich zählte das Geld und steckte es in die Brieftasche. »Alles da.«
Er nickte. »Bitte hier unterschreiben.«
Während ich unterschrieb, sagte er: »Ich muss sagen, ich habe Sie mir eine Nummer größer vorgestellt.«
»Wieso?« Ich gab ihm den Kugelschreiber zurück.
»Wegen der Art, wie meine Leute von Ihnen geredet haben, als ich zum Dienst gekommen bin. Haben behauptet, sie hätten einen amerikanischen Karateexperten festgenommen. Besonders Constable Wilson – ist zum Beweis mit ’nem schlimmen Fuß rumgehinkt.«
»Ich habe von Karate keine Ahnung«, sagte ich. »Ich dachte nur, es wäre ein Überfall.«
»Um sechs Uhr abends? Vor Sonnenuntergang?« Sergeant Matthews hob skeptisch die Brauen.
»Na ja, ich hatte vergessen, wo ich war, als mich die zwei von hinten gepackt haben.«
»Sie wohnen in New York, Sir?«
»Stimmt.«
»Schätze, dort warten sie die Dunkelheit nicht ab. Schläger, meine ich.«
»Tag oder Nacht ist denen ziemlich egal.«
»Muss ein interessanter Ort sein.«
»Wahnsinnig interessant«, sagte ich. »Wessen werde ich bezichtigt? Trunkenheit und ordnungswidriges Verhalten?«
»Nur Trunkenheit, Sir.«
Ich tippte mit dem Finger auf meine Brieftasche. »Reicht das, was ich hier drin habe, für die Geldstrafe?«
»Das ist Sache des Polizeirichters, Sir.«
»Kann ich nicht einfach eine Kaution hinterlegen und die Sache vergessen? Verfallen lassen, meine ich?«
Sergeant Matthews schüttelte den Kopf. Die Geschichte schien ihm ein bisschen leid zu tun. »Bedaure, Sir«, sagte er und gab mir ein amtlich aussehendes Formular. »Ihre Vorladung, Sir. Heute Morgen, neun Uhr, vor dem Amtsgericht in der Marlborough Street.«
Ich seufzte, faltete den Wisch zusammen und steckte ihn in die Tasche. »Und was, wenn ich nicht antrete?«
Sein Wohlwollen war wie weggeblasen. »Dann wird ein Haftbefehl gegen Sie ausgestellt.«
»Ich werde da sein«, sagte ich. »Kann ich jetzt gehen?«
»Gewiss, Sir.« Sergeant Matthews warf einen Blick auf die Wanduhr. »Sie sollten es noch schaffen, sich in Ihrem Hotel nochmal aufs Ohr zu legen, sich frischzumachen, anständig zu frühstücken, um pünktlich vor Gericht zu erscheinen.«
Ich stand auf. »Also, schönen Dank für alles, Sergeant.«
»Keine Ursache, Sir.«
»Wo finde ich am besten ein Taxi?«
»Auf die Straße, dann rechts bis zur nächsten Ecke. Da müssten gleich welche vorbeikommen.«
Ich nickte ihm zu, ging durch die Tür des Reviers und kam in eine Passage oder Gasse. Ohne mich umzublicken, schwenkte ich nach rechts und ging zur nächsten Ecke. Auf halbem Wege sah ich eine Mülltonne, machte die rosa Nelke ab und ließ sie im Vorbeigehen hineinfallen. Sie hatte ihren Zweck erfüllt. Jemand hatte mich eindeutig erkannt.
3
Nur zwei Tage vor dieser Nacht in einer Londoner Arrestzelle hatten Julia Child und ich mehrere Hühnerbrüste mit dem Fleischklopfer bearbeitet, als Myron Greene, mein Anwalt und neuerdings Millionär, an die Tür meiner »Luxus«-Einzimmerwohnung im achten Stockwerk des Adelphi in der East 46th Street hämmerte. Es gab einen elfenbeinfarbenen Klingelknopf an der Tür, den Myron Greene hätte drücken können, aber er wusste gut, dass die Klingel nicht funktionierte und in den letzten drei Jahren nie funktioniert hatte. Das Adelphi-Apartmenthotel gehörte zu dieser Sorte Etablissements.
Ich legte den Fleischklopfer aus rostfreiem Edelstahl auf den antiken Hackklotz, den ich vor kurzem von einem 72-jährigen Brooklyner Metzger erstanden hatte, als er an dem Tag, da der Preis für gutes Porterhousesteak erstmals auf 4,25 $ pro Pfund stieg, zum Teufel mit allem sagte und sein Geschäft aufgab. Ich nickte, als Julia Child die zerklopften Hühnerbrüste zuerst in das mit Muskat versetzte Mehl, dann ins leicht geschlagene Eigelb tunkte. »Ich hab’s, Julia«, sagte ich, schaltete das Fernsehgerät aus und ging zur Tür.
Myron Greene stand einen Moment da und musterte mich mit dem leichten Missfallen, mit dem er vermutlich alle ausgewachsenen Männer musterte, die um vier Uhr nachmittags nur mit einem Bademantel und einer Küchenschürze bekleidet an die Tür gehen.
»Lieber Himmel«, sagte er.
»Danke, gut; und selbst?«
Er kam herein und sah sich wie immer so um, als rechnete er damit, einen arg unaufgeräumten Harem vorzufinden. Während er sich umschaute, nutzte ich die Gelegenheit, um festzustellen, was ein prominenter New Yorker Anwalt, der mit achtunddreißig soeben Millionär geworden war, an einem schönen warmen Maitag anhatte.
Anderthalb Jahrhunderte früher auf die Welt gekommen, wäre Myron Greene wahrscheinlich ein Anhänger von Beau Brummell gewesen, vielleicht ein etwas pummeliger, aber dennoch ergebener Jünger. So aber begnügte er sich damit, etwa sechs Monate hinter dem letzten Schrei zurückzubleiben; an diesem Mainachmittag lief das auf eine halbherzige Wiederbelebung der zoot suits aus den Vierzigern hinaus.
Myron Greene trug eine modifizierte Version in Taubenblau, mit einem Jackett, das ihm fast bis auf die Knie hing. Die hochtaillierte Hose reichte bis zum halben Brustkorb, wo sie von fünf Zentimeter breiten nachtblauen Hosenträgern festgehalten wurde. Sein braunes graumeliertes Haar, immer noch modisch lang, glänzte von vermutlich einem Pfund Vaseline.
»Ei, wie hübsch«, sagte ich.
»Gefällt’s Ihnen?«, sagte er in einem halb ernsten, halb hoffnungsvollen Ton.
»Was ist mit der Uhrkette passiert?«, sagte ich. »Sie wissen schon, diese meterlangen Dinger, die man damals getragen hat.«
Myron Greene blickte an sich hinab. »Ich dachte, das wäre ein bisschen übertrieben.«
»Vielleicht«, sagte ich. »Na, jedenfalls Glückwünsche.«
»Wozu?«
»Zur Centennial Group. Ich hab gehört, gestern um zwei ist der Kurs auf eins einundzwanzig gestiegen, und das macht Sie zum Millionär, wenn Sie Ihre Optionen gezogen haben, und wie ich Sie kenne, haben Sie das bestimmt gemacht.«
Myron Greene zuckte die Achseln bei meinen Nachrichten über die Aktien des Konglomerats, das er vor ungefähr sechs Monaten mit zusammengebastelt hatte. »Ist alles nur auf Papier«, sagte er.
»Tja, macht aber doch bestimmt Spaß, die Zahlen zu addieren.«
Er hob erneut die Schultern; seine Blicke wanderten immer noch durch das Apartment. »Das ist neu.« Er zeigte auf den Hackklotz, der vor der Pullman-Küche stand.
»In Wirklichkeit ist das Ding einhundertneunzehn Jahre alt.«
»Wo haben Sie’s her?«
»Aus Brooklyn.«
»Wie viel?«
»Fünfzig – und nochmal fünfzig fürs Hochschleppen hierhin.«
»Trotzdem, gute Investition.«
»Jesses, Myron, ich hab’s nicht als Investition gekauft.«
»Hätten Sie vielleicht machen sollen.«
»Lassen Sie uns zuerst was trinken.«
»Zuerst wovor?«
»Vor den schlechten Nachrichten, die Sie an dem Nachmittag, an dem Sie Millionär geworden sind, um vier Uhr aus Ihrem Büro gescheucht haben.«
Myron Greene sah auf seine Uhr. »Ich bin achtunddreißig.«
»Sehen Sie das auf der Uhr?«
Er seufzte und setzte sich in einen der Sessel vor dem sechseckigen Pokertisch. »Wenn es passiert wäre, als ich achtundzwanzig war, hätte es vielleicht etwas bedeutet. Ich weiß aber nicht, was.«
»Hier«, sagte ich und stellte ihm einen Scotch mit Wasser hin. »Da steckt der Sinn des Lebens drin.«
Er trank einen Schluck und schaute sich dann langsam im Zimmer um. »Sie haben wenigstens gelebt«, sagte er.
Das war eigentlich der Grund, aus dem ich Myron Greenes Klient war. Er war überzeugt, dass ich ein pikantes Dasein führte, bevölkert von langbeinigen Blondinen, sympathischen Abenteurern und leidlich ehrbaren Gaunern und Dieben, die alle ein goldenes Herz hatten. In Myrons Augen war ich ein lockerer Vogel mit beneidenswerter Lebensführung, konzipiert ausschließlich für Lust und Tollerei, aber hier und da gewürzt vom gelegentlichen Reiz milder Gefahr.
Dabei wurde ich in Wirklichkeit immer mehr zum Einsiedler und verbrachte zu viel Zeit allein in Museen, Galerien, Kinos und bei jeder Parade, die gerade stattfand. Außerdem trank ich zu viel in Bars in der Gesellschaft von kleinen Dieben, Betrügern, korrupten Polizisten, bankrotten Spielern, Hochstaplern und ähnlichem Gelichter wie arbeitslosen Schauspielern und freien Autoren.
In meiner Freizeit, die praktisch unbegrenzt war, blieb ich zu Hause, starrte die Wände an oder sah zu viel fern und las zu viel Dickens und Camus. An den meisten Samstagen durfte ich meinen achtjährigen Sohn sehen, dessen Mutter einen Mann geheiratet hatte, der im Gegensatz zu Myron Greene seine erste Million schon mit dreiundzwanzig Jahren gemacht hatte. Inzwischen war er fünfunddreißig und näherte sich wohl der ersten Milliarde.
Mein Sohn kam nie richtig dahinter, was ich für meinen Lebensunterhalt tat. »Du meinst, du besorgst Leuten Sachen wieder, Dad?«
»Stimmt.«
»Du meinst, wenn jemand was verloren hat, ’nen Haufen Geld oder so, hilfst du denen, es wiederzufinden?«
»Nein, ich helfe den Leuten, Dinge zurückzubekommen, die man ihnen gestohlen hat. Es geht nie um Geld.«
»Was für Dinge?«
»Na, Schmuck, zum Beispiel. Oder private Papiere. Oder wertvolle Kunst wie Gemälde und Bilder und so was. Manchmal sogar Menschen.«
»Du meinst, Leute werden geklaut?«
»Manchmal.«
»Und dann suchst du sie und verhaftest die Verbrecher?«
»Nein, ich gehe los und kauf die Menschen oder Dinge zurück.«
Darüber musste er einen Moment nachdenken. »Und die Leute, denen was geklaut worden ist, bezahlen dich dafür, dass du alles von den Gaunern zurückkaufst, ja?«
»Manchmal«, sagte ich. »Manchmal bezahlen mich die Gauner.«
»Wie viel?«, sagte er. Ich konnte sehen, dass ihm sein Stiefvater einiges beibrachte.
»Zehn Prozent«, sagte ich. »Nimm mal an, dir würde was gestohlen.«
»Mein Fahrrad.«
»Okay, dein Fahrrad. Und jetzt nimm an, wer auch immer es dir geklaut hat, ist bereit, es dir für zehn Dollar zurückzuverkaufen.«
»Es ist aber mehr wert. Viel mehr.«
»Weiß ich doch. Also, die Gauner würden dir sagen, wenn du mich benutzt, um ihnen das Geld zu bringen, kriegst du das Rad für zehn Dollar wieder.«
Auch darüber musste er nachdenken. »Versteh ich«, sagte er schließlich. »Aber wie weiß ich denn, dass sie nicht einfach die zehn Dollar nehmen und mein Rad behalten?« Er wurde auch zu einem richtigen New Yorker.
»Weil ich das nicht zulassen würde. Kein Rad, kein Geld.«
»Und wie viel würdest du von mir verlangen?«
»Von dir nichts. Aber wenn’s jemand anders wär’, ein Junge, den ich nicht kenne, würde ich von ihm einen Dollar nehmen.«
»Und das müsste er bezahlen?«
»Entweder er oder der Gauner, der das Rad geklaut hat.«
»Mann«, sagte mein Sohn, »das ist aber ein komischer Beruf.«
»Da hast du recht.«
»Und wie heißt das? Ich meine, wie nennst du das, was du tust?«
»Ich bin ein Mittelsmann«, sagte ich und kam mir dabei seltsam vor.
Er schüttelte langsam den Kopf. »Von dem Beruf hab ich noch nie gehört.«
»Von meiner Sorte gibt’s auch nicht viele.«
»Mama sagt immer, du lebst vom Schreiben.«
»Nicht mehr.«
»Sie sagt, du hast bei einer Zeitung gearbeitet.«
»Das ist lange her. Die Zeitung hat Pleite gemacht.«
»Wann denn?«
»Ungefähr zu der Zeit, als du geboren wurdest.«
»Hast du über Football geschrieben?«
»Nein, ich hab eine Kolumne geschrieben.«
»Worüber?«
»Leute.«
»Was für Leute?»
»Alle möglichen. Ich hab viel über Gauner geschrieben.«
»Und wen noch?«
»Ach, komische Leute. Leute, die von komischen Sachen leben.«
»Wie du jetzt?«
»Ja. Wie ich jetzt.«
»Machst du das jeden Tag?«, sagte er. »Ich mein, kaufst du jeden Tag für Leute Sachen zurück, die man ihnen geklaut hat?«
»Nicht jeden Tag.«
»Wann denn?«
»Also, ein- oder zweimal im Jahr. Manchmal dreimal.«
»Verdienst du viel Geld?«
»Nee. Nicht viel.«
»So viel wie Jack?« Jack war sein neuer Vater.
»Niemand verdient so viel wie Jack.«
»Verdienst du denn so viel wie Onkel Myron?«
»Nicht ganz.«
»Ich wette, du verdienst so viel wie Eddie.«
Diesmal musste ich nachdenken. Eddie war der Portier des Adelphi und ein spezieller Kumpel meines Sohns. Eddie war nicht nur Chefportier, sondern besaß auch ein schäbiges Mietshaus, eine Taxiflotte aus zwei Wagen, ein kleines Wettbüro, und wenn es darauf ankam, war er ein verlässlicher Kuppler. »Also, Eddie könnte ein klein bisschen mehr verdienen als ich.«
»Bist du arm, Dad?«
»Danach musst du deinen Onkel Myron fragen«, sagte ich.
»Sie sind pleite, wissen Sie«, sagte Myron Greene nach einem zweiten Schluck von seinem Drink.
»Das überrascht mich nicht«, sagte ich. »Wurde ja auch Zeit.«
»Nun ja, Sie sind nicht völlig pleite. Ein paar Tausend haben Sie noch.«
Wenn Myron nicht gerade Konglomerate bastelte oder einigermaßen legale Möglichkeiten für seine reichen Klienten fand, noch reicher zu werden, kümmerte er sich ein bisschen um meine Angelegenheiten, falls man davon reden kann. Er sorgte dafür, dass meine Rechnungen bezahlt wurden, gab mir Börsentipps, die ich nie befolgte (unweigerlich zu meinem Bedauern), verhandelte für mich mit dem Finanzamt und bestand darauf, dass ich jedes Jahr etwas in einen Rentensparplan steckte für die Zeit meiner goldenen Ruhejahre, die, soweit ich es sagen konnte, schon da waren.
Und zu Myron Greene kamen die Reichen und ihre Versicherungsgesellschaften, wenn sie etwas Gestohlenes zurückkaufen wollten, meistens etwas, an dem ihnen viel lag oder an dessen Nähe sie gewöhnt waren – ein Brillantcollier, einen Klee oder eine neunjährige Tochter …
Zuweilen waren es aber auch die Diebe, die Kontakt mit Myron aufnahmen. Er unterhielt sich gern mit ihnen. Tatsächlich redete er so gern mit ihnen, dass sie ihn am Telefon nicht loswerden konnten und ich ihnen nachher erklären musste, dass Myron unter anderem gern ein glänzender Strafverteidiger geworden wäre, wenn sich damit hätte Geld verdienen lassen.
Myron Greene verschaffte mir also die zwei, manchmal drei Vermittlungsaufträge im Jahr, und für seine Dienste erhielt er zehn Prozent von meinen zehn Prozent sowie das Vergnügen, das er bei den flüchtigen Berührungen mit der Welt der Diebe empfand.
Als er nun an meinem Pokertisch saß und darüber brütete, dass er zehn Jahre zu spät Millionär geworden war, als dass es irgendeine Bedeutung hätte haben können, sagte ich: »Also, es muss doch eine Alternative zur Sozialhilfe geben.«
Myron Greene seufzte. »Sie kommen auch bald in das Alter.«
»Ich bin sechs Monate älter als Sie.«
»Mittelalt«, sagte er.
»Ich fühle mich nicht mittelalt, aber ich kriege ja auch viel Ruhe.«
»Sie haben doch ein echtes Talent«, sagte er. »Haben Sie je daran gedacht, es wieder zu nutzen?«
»Sie meinen einen festen Job?«
Er nickte.
»Vorigen Freitag, glaub ich, hab ich davon geträumt, bin aber wach geworden, ehe es richtig schlimm wurde.«
Myron Greene seufzte erneut. »Also, heute Nachmittag habe ich einen Anruf bekommen. Ferngespräch.«
»Woher?«
»Aus London«, sagte er. »London in England.«
»Ich dachte immer, London läge da.«
»Es geht um eine beachtliche Summe.«
»Wie viel?«
»Hunderttausend.«
»Nicht schlecht.«
»Pfund.«
»Noch besser. Wer hat angerufen?«
»Er sagte, er wäre ein Freund von Ihnen. Oder jedenfalls ein guter Bekannter.«
»Wer?«
»Ein Mr. Apex.«
»English Eddie«, sagte ich.
»Ja«, sagte Myron, »er heißt Edward, hat er gesagt. Und er klang furchtbar britisch.«
»Er ist aber kein Brite.«
»Was denn?«
»Er ist Amerikaner, in Detroit aufgewachsen, und er heißt in Wirklichkeit Eddie Apanasewicz. Und als ich ihm begegnet bin, war er so ziemlich der beste internationale Betrugskünstler.«
4
Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte die verwitwete Mutter von English Eddie Apex etlichen Söhnen und Töchtern des polnischen Adels in Warschau Unterricht in the King’s English erteilt. Es war allerdings eher the Queen’s English, das Englisch der Oberschicht zu Victorias Zeiten mit so gut wie gar keinen Kontraktionen, wunderbar ausgekosteten Vokalen und knappsten Konsonanten, und wenn es etwas gestelzt klang, besaß es dafür doch einen melodiösen Schwung. Es war das Erbe eines wandernden walisischen Sprachgelehrten, der sich nach dem Ersten Weltkrieg in Warschau niedergelassen und von dem Eddies Mutter nicht nur ihr perfektes Englisch, sondern ein ebenso perfektes Französisch und Deutsch gelernt hatte. Wie man mir erzählte, konnten Exilpolen noch nach Jahren heraushören, welcher ihrer Landsleute bei Madame Apanasewicz gewesen war.
Im Spätsommer 1939 nahm sie die Hilfe einiger ihrer ehemaligen Schüler an, um Polen zu verlassen und nach London zu reisen. Sie nahm nur den letzten ihr verbliebenen Schüler mit, ihren neunjährigen Sohn Edward, den sie aus mädchenhafter Schwärmerei heraus nach dem Prince of Wales benannt hatte, später Edward VIII. und noch später Herzog von Windsor.
Sie blieb nur ein, zwei Wochen in England und fuhr dann nach Kanada, wo sie ankam, als eben der Krieg in Europa ausbrach. Mit Hilfe von entfernten Verwandten emigrierten sie und ihr Sohn nach Detroit, und 1945 wurden beide amerikanische Staatsbürger.
Ihr neunjähriger Sohn, der seine alten europäischen Klamotten trug und Englisch sprach wie Freddie Bartholomew, nur besser, hatte die Möglichkeit, in Detroit die Volksschule zu besuchen mit den Söhnen und Töchtern der Arbeiter, die Autos zusammenbauten und dann während des Kriegs Panzer und Flugzeuge.
Wäre Eddie Apex ein zartes Kind gewesen, sähe seine Geschichte wohl anders aus. Aber er war ein grobknochiger Junge, groß für sein Alter, mit riesigen Händen, die er schnell als riesige Fäuste zu benutzen lernte. »Richtigen Ärger hatte ich mit den crackers, den Jungs aus dem Süden«, sagte er später. »Die haben gesagt, ich klänge ›komisch‹. Die ersten sechs Monate hab ich nicht mal verstanden, was sie gesagt haben. Ich wusste nur, ich muss sie zusammenschlagen, ehe sie mich zusammenschlagen.«
Eddie Apex’ Mutter hatte acht Jahre in einem Kaufhaus gearbeitet und starb 1947, im selben Jahr, in dem ihr Sohn seinen High-School-Abschluss schaffte. Mit seinen siebzehneinhalb Jahren wirkte er eher wie einundzwanzig oder zweiundzwanzig. Er war eins fünfundachtzig groß, athletisch gebaut, mit grünen Augen, blondem Haar, breiten Schultern, schmalen Hüften, und er sah wirklich aus wie der wingback einer Collegemannschaft; nur sprach er eher im Tonfall von Mayfair als von Michigan.
Da ihn nichts mehr in Detroit hielt, ging er nach New York, wo sein Akzent plötzlich ein Trumpf statt eines Nachteils war, jedenfalls bei der Clique, der er sich anschloss und die man früher als schlechte Gesellschaft bezeichnet hätte. Sie bestand vorwiegend aus Weltkriegsveteranen, die in Europa und Asien die Vorzüge des Schwarzmarkts entdeckt hatten und nach Unternehmungen suchten, die es ihnen ersparen würden, etwas Abscheuliches wie geregelte Arbeit zu erledigen.
»Wir sind auf die Masche mit dem verlorenen englischen Vetter gekommen«, erzählte Eddie Apex mir Jahre später. »Einer meiner Kumpels hatte ein paar Semester Jura studiert, und seine Freundin hat bei diesem Ahnenforscher gearbeitet, der für Leute, die Wert auf Verwandtschaft mit der britischen Aristokratie legen, gefälschte Stammbäume hergestellt und ganz hübsch damit verdient hat. Also, diese Leute haben wir uns vorgeknöpft. Mein Job war der längst vergessene englische Vetter, der gerade erst per Schiff aus London eingetroffen ist und in den Staaten nach einem Verwandten sucht, der das Familienschloss retten kann. Kurz, wir machen dem Gimpel weis, dass er mir für läppische fünfundzwanzig- oder fünfzigtausend Dollar einen Millionenbesitz abluchsen kann. Die Habgier hat gesiegt. Sie siegt natürlich immer, und am Ende hat der Gimpel eine piekfeine, auf alt gemachte Pergamenturkunde.«