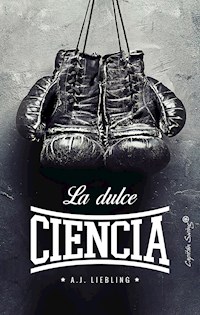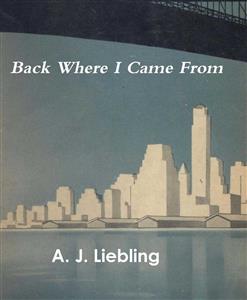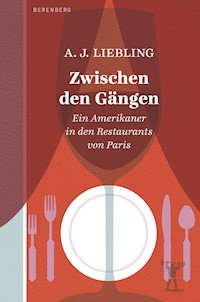
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Über Paris und die französische Küche in ihrer besten Zeit hat niemand so geschrieben wie der wunderbare A. J. Liebling, für den ein Tag ohne opulentes Mittag- und Abendessen nicht der Rede wert war. Zeit seines Lebens ein engagierter politischer Publizist und Gourmand hatte er das Glück, sich von unten nach oben durch die französische Hauptstadt fressen zu müssen: Als junger Mann entdeckte er in den zwanziger Jahren, dass sich teures Essen und guter Geschmack nicht unbedingt vertragen. Später, als Korrespondent des »New Yorker«, erklomm er, ausgerüstet mit ebenso respektgebietendem wie gelassenem Sachverstand, sämtliche Gipfel, die das kulinarische Paris zu bieten hatte. Niemand hat darüber mit solch hinreißender Passion und stoischem Witz geschrieben wie Liebling in seinem letzten Buch. »Eine kurzweilige und garantiert appetitanregende Lektüre.« Johannes Willms, Süddeutsche Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A. J. LIEBLING
Zwischen den Gängen
Ein Amerikaner in den Restaurants von Paris
Aus dem Englischen, mit einem Vorwort und Erläuterungen von Joachim Kalka
INHALT
Vorwort
Ein guter Appetit
Dessen Entsprechung
Mein erstes Paris
Gerade genug Geld
La Nautique
Die bescheidene Schwelle
Das Nachglühen
Passabel
Erläuterungen
Über den Autor
Vorwort
A. J. Liebling (1904–1963) ist einer jener Autoren, bei denen der Journalismus zu einer klassisch eleganten Form gefunden hat; wie sein großer Kollege Joseph Mitchell (McSorley’s Wonderful Saloon) gehörte er der silbernen Epoche des New Yorker an und begann noch unter dem legendären Harold Ross für das Magazin zu arbeiten, diesem so seltsam sprachverliebten Philister (»Is Moby Dick the man or the whale?«). Er stammte aus einer wohlhabenden Familie, Sohn eines Kürschners in Manhattan, und suchte sich früh eine Laufbahn als Zeitungsmann aus (unter anderem dann bei Joseph Pulitzers New York World). Seit 1935 war er fest beim New Yorker angestellt, dessen Korrespondent er 1939–1944 in Frankreich, England und Nordafrika war. Unter den zahlreichen Büchern, die seine Artikel und profiles sammelten, könnte man vielleicht vor allem auf Back Where I Came From (über New York), The Honest Rainmaker (über »Colonel John R. Stingo«, einen Rennplatztrickster) und The Sweet Science (über das Boxen) hinweisen. Seine pressekritische Kolumne »The Wayward Press« liest sich auch heute noch exemplarisch. Er war »ein unintellektueller Intellektueller, ein rasch zu faszinierender Zyniker, ein eigenartig naiver Eingeweihter«, wie Michael Anania geschrieben hat.
Und er gehörte – par excellence – zu den Amerikanern in Paris, zu jenen, die in dieser Stadt etwas fanden, das sie ihr Leben lang entzückte. Lieblings Paris ist das seines Studentenjahres 1926/1927, das der Befreiung 1944 – »Einmal im Leben war ich eine Woche lang in einer Stadt, in der alle glücklich waren« –, aber auch ein Paris, das über verschiedene auratische Bekanntschaften noch bis in die belle époque zurückreicht und dessen Licht seine eigene Kindheit eingefärbt hat. Die Polyphonie der Erinnerung in diesem Buch ist kunstvoll; die kleine Geste der Dreistigkeit, mit der Liebling es eröffnet (wenn Proust nur mehr gegessen hätte …), ist eine kalkulierte Reverenz an den Meister des Gedächtniszaubers.
Liebling behandelte als Journalist eine Fülle von – meist großstädtischen – Gegenständen, mit einem Faible für das Altmodische, Marginale, Ungleichzeitige, Verquere. Er hatte insbesondere drei große, wiederkehrende Themen: die Küche, die Welt des Sports (insbesondere des Boxkampfs) mit ihrem hermetischen Milieu aus Zockern, Schwindlern, Buchmachern, Trainern, Veteranen und Barthekenexperten – und den Zweiten Weltkrieg. Da das Essen in Between Meals zentrale Bedeutung hat, das Boxen in Vergleichen und Anekdoten aufscheint, das dritte Motiv jedoch nur schattenhaft präsent ist, mag hier eine kurze Passage aus »Kanalüberquerung« stehen, einer seiner berühmtesten Reportagen als Kriegsberichterstatter: Liebling machte die Fahrt auf einem der Landungsboote mit, die bei der Invasion in der Normandie die GIs an den unter heftigem Feuer stehenden Strand brachten.
»Ein Matrose ging vorüber und Shorty, einer von den Kanonieren, fragte ihn: ›Wer war das?‹ Der Matrose sagte: ›Rocky und Bill. Die hat’s ganz zerrissen. Eine Granate hat die Winde und die Rampen und alles erwischt.‹ Ich ging nach vorn aufs Tiefdeck, das von einer Mischung aus Blut und Kondensmilch klebte. Soldaten hatten überall auf dem Schiff Proviantrationen liegen lassen, und ein Fragment der Granate, welche die Jungs erwischt hatte, war in einen Karton mit Milchdosen gefahren … Rocky war ohne jeden Zweifel tot, sagte mir jemand, aber der Apothekermaat hatte Bill Blutplasma gegeben und meinte, er könne noch am Leben sein. Ich erinnerte mich an Bill, einen großen, babygesichtigen Jungen aus dem District of Columbia, gebaut wie ein Ringer. Er war etwa zwanzig, und die anderen Jungs zogen ihn oft mit einem Mädchen auf, an das er ständig schrieb. Ein dritter Verwundeter, ein Soldat in Khaki, lag schwer durch den Mund atmend auf einer Bahre an Deck. Sein langes, dreieckiges Gesicht sah aus wie schmutziges Trommelfell; die Haut war weiß und straff über seine hohen Wangenknochen gespannt. Er machte nicht viel Geräusch. Über allem lag ein Schießbudengeruch, und als wir dicht unter der ›Arkansas‹ vorbeifuhren und sie eine Salve abfeuerte, zitterten einige unserer Männer, die ihr den Rücken zukehrten, und mussten erst beruhigt werden …« Seinen Kriegsreportagen wurde bei ihrem Erscheinen gelegentlich ein gewisser Mangel am hohen Ton, am expliziten Verweis auf die große Sache nachgesagt; heute lesen sie sich gerade kraft ihres zurückhaltenden Tonfalls eindrucksvoll. Liebling hätte gerne aus Korea berichtet, aber Ross, der meinte, der Koreakrieg würde nur ganz kurz dauern, zögerte allzu lange mit der Entsendung eines eigenen Korrespondenten.
Zwischen den Gängen ist ein Text, der bei aller radikalen Subjektivität voller allgemeingültiger Einsichten steckt, Einsichten in die Unveränderlichkeiten und Wandelbarkeiten unserer Ess- und Trinkkultur und damit in einem sehr grundsätzlichen Sinne in unsere Gesellschaft. Viele seiner beiläufig vorgetragenen Erkenntnisse haben die Präzision soziologischer Beobachtung (etwa seine winzige, tiefgründige Schilderung des Schicksals der Bahnhofsrestaurants nach der Motorisierung der französischen Handlungsreisenden). Doch die eigentliche Bedeutsamkeit des kleinen Buches liegt vielleicht darin, dass es dem Leser vorführt, wie ein Mensch – ein wenig verlegen, ein wenig im Ton des Triumphs – davon erzählt, auf welche Weise er seinem Leben eine Form gegeben hat. Die intransigente Kennerschaft des Autors hat etwas Werbendes, weil er möchte, dass wir Leser begreifen, was es heißt, als A. J. Liebling zu leben.
Seine Lebenserzählung umkreist eine erstaunliche Unersättlichkeit. Er notiert, dass der Pilaw zu einer Languste à l’américaine sehr viel befriedigender ist als das Brot, das die Franzosen ansonsten zum Auftunken der Soße verwenden, denn das Brot fügt dem Geschmackserlebnis nichts Eigenes hinzu. Und doch sind die Liebling-Anekdoten in den Erinnerungen seiner Freunde und New Yorker-Kollegen voll von Episoden, wo der große Gourmand seinen Teller oder die Platte, auf der das Gericht aufgetragen wurde, mit Brot ausreibt. Liebling ist der Autor, der hinter einem Massiv erlesener Kennerschaft den simplen Horizont der Gier verbirgt. Wer das Gebirge erstiegen hat, nimmt diese majestätisch kompromisslose Perspektive umso besser wahr. Sein Päan auf die Unersättlichkeit hat etwas Entwaffnendes: die Weisheit der selbstbewussten Infantilität. Nicht umsonst erzählt Liebling mit kunstvoller Beiläufigkeit von der Kindheit, in der man wartet und allein ist. Er destilliert Komik aus solchen Situationen, er lobt seine Lebensweise als junger Mann: allein, aber nie einsam – doch die stolzen Schilderungen seiner Vermählung von Sinnlichkeit und Gier evozieren auch ungestillte Sehnsucht. Der irritierende und rührende Schlussabschnitt seiner Geschichte von der Liebe zu Paris erzählt unbeholfen von den Frauen; als Kostbarkeit bewahrt er in der Erinnerung eine Geste der Zuneigung auf: Seine Geliebte sagt zu ihm: »T’es passable.«
Der hier übersetzte Text folgt der zweiten Auflage der Buchausgabe aus dem Jahre 1962, also ein Jahr vor dem Tod des mittlerweile bekannten, ja ein wenig berühmten Autors. Das Buch fasste eine Serie von Artikeln im New Yorker zusammen, erweiterte sie und versah sie mit einigen ergänzenden Fußnoten. Die wenigen Anmerkungen des Übersetzers sollen lediglich einige Details erläutern, die für manche Leser von Interesse sein mögen, und übergehen das in einfachen Lexika oder in Wörterbüchern unmittelbar Zugängliche. Sie beschränken sich auf die Zeit- und Kulturgeschichte – ohne dass das weite Feld der Gastronomie betreten würde. Was dieses angeht, würden wohl die meisten Leser ihre privaten Fußnoten setzen wollen. Die Autorität von Abbott Joseph »Joe« Lieblings gourmandise bliebe durch sie unerschüttert: die Autorität eines Lebensentwurfs, welcher der Kindlichkeit einer Leidenschaft unerwartete Reflexionen entlockt.
Ein guter Appetit
Das Madeleine-Erlebnis Prousts ist heute ein ebenso fester Bestandteil der populären Mythologie wie der Apfel Newtons oder James Watts Teekessel. Der Mann aß ein Stück Teegebäck, der Geschmack weckte Erinnerungen, der Esser schrieb ein Buch. Dies lässt sich mit der Formel G E B ausdrücken – Geschmack Erinnerung Buch. Vor einiger Zeit, als ich ein Buch mit dem Titel Die Küche Frankreichs (von Waverley Root) zu lesen begann, machte ich eine umgekehrt verlaufende Erfahrung: Sie folgte der Formel B E G, also Buch Erinnerung Geschmack. Glücklicherweise waren die Geschmackserlebnisse, welche Die Küche Frankreichs für mich nacherschuf – kleine Vögel, Kaninchenragout, gefüllte Kutteln, Côte Rôtie und Tavel – robusterer Natur als das der Madeleine, welche der Larousse als »ein leichtes Gebäck aus Zucker, Mehl, Zitronensaft, Kognak und Eiern« definiert. (Mit dem Quantum Kognak in einer Madeleine könnte man keine Mücke massieren.) Angesichts dessen, was Proust bereits unter dem Einfluss eines so sanften Reizes schrieb, ist es ein Verlust für die Menschheit, dass er keinen kräftigeren Appetit hatte. Nach einem Dutzend Gardiners-Island-Austern, einem Teller Muschelsuppe, ein paar frisch gefangenen Jakobsmuscheln, drei sautierten weichschaligen Krabben, einigen soeben gepflückten Kolben Mais, einem dünngeschnittenen Schwertfischsteak von generöser Breite, zwei Hummern und einer Long-Island-Ente hätte er möglicherweise ein Meisterwerk verfasst.
Will man gut über die Küche schreiben, ist die Hauptvoraussetzung ein guter Appetit. Ohne einen solchen ist es unmöglich, in dem uns zugemessenen Zeitraum hinreichende Erfahrungen zu sammeln, um irgendetwas Mitteilenswertes zu Papier zu bringen. Jeder Tag bringt nur zwei Gelegenheiten zur Feldforschung, und die darf man nicht verschwenden, indem man die Cholesterinaufnahme zu reduzieren versucht. Diese beiden Mahlzeiten sind so unverzichtbar wie die Laufstunden eines trainierenden Boxers. (Ich habe gelesen, dass der verstorbene Maurice Curnonsky, ein professioneller französischer Gourmand, nur einmal am Tag aß – des Abends. Aber das war im späten Leben, und im Übrigen habe ich seiner Qualifikation auch immer misstraut – es werden ihm so viele mittelmäßige Witzworte zugeschrieben, dass ihm nicht sehr viel Zeit fürs Essen geblieben sein kann.) In einem geräumigen Appetit kann sich der Esser bequem drehen und wenden. So ging beispielsweise vor einigen Jahren ein mir bekannter (nichtprofessioneller) Esser ins Restaurant Pierre, an der Place Gaillon, und dachte an ein vernünftig leichtes Essen: ein Dutzend – oder vielleicht auch achtzehn – Austern sowie ein dickes Steak, mit Rindermark behäuft (von Monsieur Pierre als Délice de la Villette bezeichnet – was man als Entzücken des Schlachthofs übersetzen könnte). Doch wie er eintraf, hörte er Monsieur Pierre zu seinem Oberkellner sagen: »Da kommt Monsieur L. Die beiden Portionen Cassoulet, die noch übrig sind – die stellen Sie für ihn beiseite.« Ein Cassoulet ist ein substanzielles Gericht von einer Komplexität, die nähere Erörterung hier nicht zulässt. (Root widmet der großen Kontroverse, was es denn enthalten sollte, drei Seiten.) Monsieur Pierre ist einer der liebenswürdigsten Restaurateurs und setzt seinen Stolz darein, schon im Voraus zu wissen, was seinen Freunden schmecken wird. Ein Gast mit begrenztem Appetit müsste nun entweder auf sein Steak verzichten oder aber Monsieur Pierres Gefühle verletzen. Monsieur L. jedoch hatte keine Probleme. Er aß die beiden Cassoulets, wie es seiner gewöhnlichen Übung entsprach; hätte er nur eines gegessen, hätte der Wirt befürchtet, das Gericht sei nicht auf dem üblichen Niveau geraten. Dann genoss er sein Steak. Die Austern waren keine Schwierigkeit, da sie kein nennenswertes Volumen besitzen.
In der heroischen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es Männer und Frauen, die neben einem gigantischen Mittagsmahl und einem ruhmreichen Abendessen noch ein umfängliches souper nach dem Theater oder den anderen Vergnügungen des Abends zu sich nahmen. Ich habe einige der Überlebenden dieser Epoche gekannt, Achtzigjährige von makellosem Appetit und nie versagender guter Laune – rüstig, ironisch und frei von den Magengeschwüren, die man sich durch die Sorge um eine ausgewogene Ernährung holt. Aber Nachfolger haben sie in Frankreich keine gefunden, da die Ärzte dort schließlich die Existenz der menschlichen Leber entdeckt haben. Seit diesem Zeitpunkt organisiert sich das französische Leben zunehmend um dieses Organ, und eine kleinliche Vorsicht ist an die Stelle der alten Tollkühnheit getreten. Die Leber war der Sitz der Maginot-Mentalität. Einer der letzten der großen Rund-um-die-Uhr-Tafler Frankreichs war Yves Mirande, ein kleiner, fröhlicher Verfasser von Farcen und Operettenlibretti. 1955 beging Mirande seinen achtzigsten Geburstag mit einer Rede vor dem Vorhang des Théâtre Antoine, dessen Leitung er zusammen mit Madame B. hatte, einer vierzig Jahre jüngeren Protegé. Das Theater war aber nur sein halbes Leben. Er war außerdem der inoffizielle Leiter eines Restaurants in der Rue Saint-Augustin, das er für eine andere Protegé gegründet hatte (ebenfalls vierzig Jahre jünger als er); dies war Madame G., eine Gascognerin und vorzügliche Köchin. Monsieur Mirande setzte seine jüngeren Bekannten, Franzosen und Amerikaner, in Erstaunen, indem er ein Mittagessen einnahm, das aus rohem Bayonne-Schinken und frischen Feigen, einer heißen Wurst im Teigmantel, Röllchen von filettiertem Hecht in einer üppigen rosafarbenen Sauce Nantua, einer mit Sardellen gespickten Lammkeule, Artischocken auf einem Gänselebersockel und vier oder fünf Sorten Käse bestand, mit einer Flasche gutem Bordeaux und einer Flasche Champagner. Anschließend rief er nach dem Armagnac und sagte Madame, sie solle für das Abendessen die versprochenen Lerchen und Fettammern bereithalten, außerdem ein paar Langusten und einen Steinbutt – und natürlich ein schönes civet von dem macassin (dem jungen Wildeber), den der Liebhaber der Hauptdarstellerin seines laufenden Theaterstücks von seinem Gut in der Sologne hatte schicken lassen. »Und wenn ich’s recht bedenke«, hörte ich ihn einmal sagen, »dann haben wir seit Tagen keine Waldschnepfen gehabt, oder Trüffeln in der Asche gebacken, und der Keller ist nachgerade ein Skandal – kein Vierunddreißiger mehr und kaum mehr Siebenunddreißiger. Letzte Woche, da musste ich meinem Verleger eine Flasche vorsetzen, die viel zu gut war für ihn – bloß weil zwischen Beleidigung und Superlativ nichts mehr da war.«
Monsieur Mirande konnte auf hundert aufgeführte Stücke zurückblicken, darunter einige ganz große Pariser Erfolge, aber er hatte soeben sein erstes Buch für den Druck geschrieben, deshalb sprach er die Worte »mein Verleger« mit besonderer ironischer Emphase. »Eine informelle Skizze meiner definitiven Autobiographie«, pflegte er von diesem Buch zu sagen. Diese informelle Skizze, die ich sehr liebe, beginnt mit der wichtigsten Entscheidung seines Lebens. Er war in dem kleinen bretonischen Hafen Lannion fast siebzehn geworden – sein bürgerlicher Name lautete Le Querrec –, als sein Vater, ein pensionierter Offizier der Kriegsmarine, zu ihm sagte: »Es ist jetzt an der Zeit, dass du dir einen Beruf aussuchst. Die Marine oder die Kirche?« Eine andere Wahl war in Lannion nicht vorstellbar. Im Morgengrauen riss Yves aus und fuhr nach Paris.
Dort – so hatte er tausendmal gelesen – saßen all die berühmten Ésprits und Kokotten an den Tischchen vor dem Café Napolitain am Boulevard des Capucines. Er fand sich um neun Uhr am nächsten Morgen vor dem Café ein (spät am Tage für Lannion) und musste feststellen, dass man noch nicht geöffnet hatte. Bald war er Journalist geworden. Es war dies eine Presse-Ära von ebenso zynischer Lebendigkeit wie die der Konkurrenz zwischen den Blättern Bennetts, Pulitzers und Hearsts in New York, und in einer zweiten und dritten Stellung arbeitete er für einen Pressezaren, der so herrisch und geizig war wie die meisten; er bestand darauf, dass seine Reporter stets gut gekleidet waren, aber er zahlte ihnen kein Gehalt, das einem bei Regen erlaubt hätte, ein Taxi zu nehmen. Mirande wohnte beim modischen Montmartre-Friedhof und löste das Problem der Regentagsbügelfalte, indem er sich fallweise einer nach der Bestattung aufbrechenden Trauergesellschaft anschloss und sich in einer ihrer zurückfahrenden Droschken gratis ins Stadtzentrum begab. Er wurde schon früh in seiner Karriere Privatsekretär von Clemenceau und dann von Briand, aber das lustige Theater zog ihn mehr an als die Politik, und er traf die zweite große Entscheidung seines Lebens, nachdem einer seiner politischen Gönner zugesehen hatte, dass er zum Unterpräfekten in einer Provinzstadt ernannt wurde. Ein sous-préfet ist der Verwaltungsbeamte eines jener Distrikte, in die jedes der neunzig Départements Frankreichs zerfällt, und ein junger sous-préfet steht häufig am Beginn einer steilen Karriere, die zu hohen Staatsämtern führen kann. Mirande fuhr in der prächtigen Uniform seines Amtes, die damals de rigueur war, in sein Hauptstädtchen, verbrachte dort eine Nacht und lief wiederum fort nach Paris, um dort bei einer Ein-Akt-Farce Regie zu führen. Trotzdem unterhielt er weiterhin freundliche Beziehungen zur ernsthaften Welt. Im Restaurant in der Rue Saint-Augustin stellte er mir Colette vor, mittlerweile eine berühmte Säule der Nationalliteratur.
Die Kost, die seine Protegé Madame G. zubereitete, hielt ihn en pleine forme. Als ich ihm zuerst in seinem Restaurant begegnete, im Sommer der Befreiung Frankreichs, war er rüstige neunundsechzig. Im Frühling des Jahres 1955, als wir eine Freundschaft erneuerten, die mit der gegenseitigen Bewunderung unseres jeweiligen Appetits begonnen hatte, hielt er sich so gut wie eh und je. Bei Anlass unseres Wiedersehens begannen wir mit Forelle blau – eine lebende Forelle wird in heißem Wasser ums Leben gebracht wie ein römischer Kaiser im Bad. Sie wurde in genug zerlassener Butter serviert, um einem ganzen Regiment Kardiologen eine Thrombose anzuhängen, und dazu gab es wie angemessen einen Elsässer Wein, einen Lacrimae Sanctae Odiliae – eine Lage, die einst ein wenig zu meiner Ausbildung beigetragen hat. Vor langer Zeit, als ich sehr jung war, führte ich in Straßburg eine Frau aus und bestellte, da ich sie mit meiner Kenntnis der lokalen Usancen beeindrucken wollte, eine Flasche Ste. Odile. Ich machte also einen Fehler, als hätte ich in Boston ein Mädchen eingeladen und ihr baked beans bestellt. »Wie nett!«, sagte die Dame in Straßburg. »Das hab ich ja seit Jahren nicht getrunken.« Sie entschuldigte sich, weil sie telefonieren müsse, und kam nie zurück.
Nach der Forelle aßen Mirande und ich zwei Fleischgänge, da wir uns nicht im Voraus entscheiden konnten, was wir vorziehen würden. Wir speisten eine prächtige daube provençale, weil wir treu der cuisine bourgeoise anhingen, und dann Pintadous – junge Perlhühner, einfach und zart gebraten, mit dem ersten Spargel des Jahres, um unsere Treue zur cuisine classique zu beweisen. Zu beiden Gängen tranken wir Roten, einen Pétrus zur daube, einen Cheval Blanc zu den Perlhühnern. Mirande sagte, von Burgundern habe ihm sein Arzt abgeraten. Es war das erste Mal im Lauf unserer Bekanntschaft, dass er eingeräumt hatte, einen Arzt aufzusuchen, aber ich war wieder beruhigt, als er nach dem Essen anderthalb Flaschen Krug trank. Wir tranken zusammen drei – eine auf unsere Liebsten, eine auf unsere Nationen, eine aus Gründen der Symmetrie, und diese letzte ging aufs Haus.
Mirande war ein kleiner alerter Mann mit dem Gesicht eines Scotchterriers – weit vorkragende Augenbrauen und eine hohe Stupsnase. Er sah aus wie eine intelligente Version von Lloyd George. In jenem Sommer wollte er mit Madame B., seiner Theater-Protegé, ein neues Stück von Sartre herausbringen. Mit einem durch Madame B.s Theater jung gehaltenen Verstand, mit einem von Madame G.s Restaurant behüteten Stoffwechsel schien Mirande auf mindestens zwanzig weitere Jahre gegen alle Eventualitäten gefeit. Dann würde er möglicherweise neue Protegés anwerben müssen. Am Sonntag nach unserer Wiederbegegnung traf ich ihn in Longchamp – auf einem Rennplatz, heißt das, wo die Fenster des Restaurants nicht auf die Bahn schauen und die Gäste sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Da saß er, strahlend, umringt von Berühmtheiten und Champagnerkübeln, und entsandte immer wieder Stafetten von Dienstmännern, die auf die Tipps setzten, welche ihm begeisterte Rennstallbesitzer nur zu gerne zwischen den Läufen zuraunten. Er war die Verkörperung eines glücklichen Menschen. (Ich selbst landete einen sehr schönen Coup, 27 zu 1.)
Der erste Umschwung von Mirandes Schicksalen betraf mich selbst so direkt, dass ich nicht sogleich bemerkte, wie ernst der Vorfall in sich war. Sechs Wochen später war ich wieder in Paris. (In diesem Jahr reiste ich häufig zwischen dort und London hin und her.) Am Abend der Rückkehr war ich allein und freute mich auf ein angenehmes Diner bei Madame G., deren Restaurant nur zweihundert Meter von dem Hotel am Square Louvois entfernt war, wo ich immer absteige. Madames Restaurant war weit mehr als ein Ort, wo man aß – obwohl man dies dort wunderbar tun konnte. Zuerst würde ich mich ein wenig mit der Besitzerin unterhalten, dann mit den Kellnerinnen Germaine und Lucienne, die das ursprüngliche Personal des Lokals darstellten. Als das Geschäft zu florieren begann, hatte man zusätzliche Kellner eingestellt, doch diese hatten keine vergleichbar ausgeprägten Persönlichkeiten. Madame war eine hochbusige Dame – beredt, mit dunklem gelblichem Teint, großer Nase und glattem schwarzem Haar; sie ließ mich an eine Sarazenin denken. (Die Sarazenen erreichten die Gascogne im 8. Jahrhundert.) Ihre Konversation war eine Chronik der Literatur und des Theaters – so gut wie ein Abonnement auf den Figaro littéraire, aber anspruchsvoller. Ihre Unterhaltung bewegte sich zwischen der Avantgarde und dem klassischen Geschmack, in Rufweite beider, und war angereichert mit den Namen all der Großen, die kürzlich dagewesen waren – Monsieur Cocteau, Gene Kelly, la Comtesse de Vogüé. Es war immer gut, den Eindruck zu erwecken, man höre dem allem genau zu, sonst könnte sie einem vielleicht eines Tages die letzte Portion Lerchen en brochette nicht mehr aufbewahren und sie stattdessen einem aufmerksameren Gast zuteilen. Mit Germaine und Lucienne – die ich schon gekannt hatte, als wir alle noch jünger waren, im Jahre 1939, zur Zeit des drôle de guerre – flirtete ich nun lediglich pro forma ein wenig, aber die carte du jour war immer noch ein ernstes Thema: Wie hatte beispielsweise der dicke belgische Industrielle aus Tournai auf die caille vendangeuse reagiert – das Wachtel-Confit mit frischen Trauben? »Sie kennen den Herrn«, sagte Germaine, »wenn es nicht ganz vorzüglich ist, nimmt er nur zwei Portionen. Aber wenn er dreimal nimmt, dann kann man sich wahrhaftig sagen …« Sie und Lucienne sahen einander sehr ähnlich – kompakte kleine Frauen mit hohen Stirnen und Wangenknochen und strammen, muskulösen Beinen, die wie chasseurs à pied gingen, hundertdreißig Schritt die Minute. 1939 und wiederum 1944 war Germaine brünett gewesen und Lucienne blond, aber 1955 war auch Germaine zur Blondine geworden, und es fiel mir schwer, die beiden auseinanderzuhalten.
Unter meinen Mitgästen bei Madame G. stieß ich meistens auf irgendeinen Freund, den ich von früher kannte. Es ist riskant, sich für den ganzen Abend mit jemandem zu verabreden, den man jahrelang nicht gesehen hat. Das gilt besonders für das heutige Frankreich. Der fast peinlich amerikabegeisterte Bekannte aus der Zeit der Befreiung mag jetzt ein parteigehorsamer kommunistischer Schreiberling geworden sein, der idealistische junge Résistance-Journalist ein Leitartikler für das reaktionäre Tageblatt eines Textilmagnaten. Der Vichy-Apologet, dem man 1941 in Washington begegnet war, als er de Gaulle einen Verräter und eine Kreatur des britischen Geheimdiensts schimpfte, mag einem jetzt erzählen, dass der General der größte Glücksfall war, der Frankreich je zugestoßen sei – ein anderer, den man in London als Adjutant de Gaulles kannte, vergleicht diesen jetzt vielleicht mit Sulla, dem Zerstörer der Republik. Was die Frauen betrifft – wer will sagen, welche den Jahren widerstanden hat? Aber in einem guten Restaurant, das alle früher aufgesucht haben, kann man auch allen wiederbegegnen, denn so zahlreich sind die guten Restaurants nicht mehr, dass ein Franzose sich auf immer von einem verabschieden würde – falls er nicht pleite ist natürlich, und in diesem Fall würde es einen deprimieren, von seinen Missgeschicken zu erfahren. Trifft man auf alte Freunde, die schon an ihren Tischen Platz genommen haben, hat man Gelegenheit, sie freundlich zu begrüßen und kurz prüfend zu mustern. Wenn sie einem immer noch gefallen, kann man sich weiter verabreden.
An dem fürchterlichen Abend, von dem ich hier spreche – dem eines schönen Junitages –, nahm ich keine Veränderung an Madame G.s äußerlich unauffälligem Restaurant wahr. Der Name – irgendetwas wie Prospéria – war noch derselbe, und da die Fensterscheiben von Leinenbehängen verdeckt waren, konnte man nicht hineinsehen. Auch beim Betreten des Lokals fiel mir zunächst nichts auf. Die Theke, die Tische, die kunstlederbezogenen Sitzbänke, das einfache Dekor mit seinen Spiegeln und rosa Marmorflächen – sie waren wie immer. Das Lokal war einst eine Café-Bar für kleine Angestellte gewesen, ehe Madame G. es von einer langen Reihe namenloser Besitzer übernahm und zu einem illustren Ort machte. Sie hatte das Essen und die Kundschaft ausgewechselt, nicht aber die Räumlichkeiten verändert. Es gibt in Paris Hunderte von identischen Fassaden und Inneneinrichtungen, von irgendeiner Firma Ende der zwanziger Jahre massenhaft hergestellt. Der Umstand, dass der Raum leer war, hätte mir zur Warnung dienen können, aber es war immerhin erst acht und draußen noch hell. Ich war ungewöhnlich früh gekommen, weil ich so hungrig war. Ein Mann, den ich nicht erkannte, trat händereibend auf mich zu und begrüßte mich wie einen alten Bekannten. Ich dachte mir, es könne ein Kellner sein, der mich früher schon bedient hatte. (Die Kellner zählten, wie gesagt, nicht zu den einprägsamen Persönlichkeiten des Etablissements.) Er hatte mich an einen Tisch komplimentiert und ich hatte mich gesetzt, ehe ich die Falle ahnte.
»Madame geht es gut?«, fragte ich höflich.
»Nein, Madame ist ein wenig krank«, sagte er mit – wie mir nun klar ist – schuldbewusster Miene.
Er reichte mir eine carte du jour, die in der vertrauten lila Tinte auf dem vertrauten großen Bogen Papier mit Namen und Telefonnummer der Restaurants geschrieben war. Der Inhalt der Speisekarte jedoch hatte sich italianisiert, die Orthographie verschlechtert und die Preise hatten sich derart verringert, dass es ein Wunder gewesen wäre, wenn das Essen immer noch seinen außergewöhnlichen Charakter bewahrt hätte.
»Madame führt immer noch das Restaurant?«, fragte ich scharf.
Ich sah nun, dass er ein Piemonteser von höchst ausweichendem Gebaren war. Er ging vom Reiben seiner Hände zu verstohlenem Ringen derselben über.
»Nicht ganz«, sagte er, »aber wir machen dieselbe Küche.«
Ich konnte in der verwischten Tintenschrift kaum etwas entziffern außer falsch geschriebenen Nudeln und sogenannten escaloppinis – Italiener, die Französisch nach Gehör schreiben, regredieren zu einer unbekannten Urform beider Sprachen.
»Versuchen Sie es mit uns«, flehte der Mann, und törichterweise tat ich’s. Ich hatte Hunger. Vierzig Minuten später stampfte ich auf die Straße hinaus, dunkelpurpurn wie eine Aubergine vor Wut. Die Minestrone hatte aus Kohlfetzen in fettigem Wasser bestanden. Als ungefährlichstes Gericht in dem subalternen Katalog, in den sich das segensreiche Prospéria-Angebot unversehens verwandelt hatte, hatte ich mir côtes d’agneau ausgesucht. Diese stammten dann von einem ermatteten Bergziegenbock und waren in Maschinenöl abgesengt worden; die haricots verts der Beilage glichen den sich zersetzenden Strähnen eines falschen Bartes.
»Dieselbe Küche?«, donnerte ich, als ich mein Geld auf die getürkte Rechnung schmiss, die zu überprüfen ich zu zornig war. »Sie halten mich wohl für einen Idioten!«
Ich bin mir sicher, dass der Schuft nickte, sobald ich ihm den Rücken gekehrt hatte. Das Restaurant hat seither mindestens noch einmal den Besitzer gewechselt.
Am anderen Morgen rief ich Mirande an. Er bestätigte mir, dass eine Katastrophe eingetreten war: Madame G. war erkrankt und hatte das Restaurant geschlossen. Schlimmer noch: Sie hatte es ganz und gar verkauft und sich für immer zurückgezogen.
»Was ist denn mit ihr?«, fragte ich in dem Tonfall, der einer tödlichen Krankheit angemessen ist.
»Ich glaube, es war der Versuch, Simone de Beauvoir zu lesen«, sagte er. »Das Herz.«
Madame G. lebt immer noch, aber Mirande ist tot. Als ich ihn im November des nächsten Jahres in Paris traf, sah man ihm den Niedergang nicht an. Es war die Jahreszeit für seinen zobelgefütterten Mantel à l’impresario und einen Pelzhut, der seiner Form nach eine Kreuzung aus Kreissäge und Homburg war. Da das Restaurant in der Rue Saint-Augustin nicht mehr existierte, hatte ich ihn in ein winziges Lokal namens Le Gratin Dauphinois eingeladen, in der Rue Chabanais, direkt gegenüber dem Gebäude, das früher das berühmteste öffentliche Haus der Stadt beherbergte. Die Rue Chabanais ist kurz – vielleicht hundert Meter – und führt vom Square Louvois zur Rue des Petits Champs, aber ehe am Ende des Zweiten Weltkriegs eine Stadträtin namens Marthe Richard eine Reformbewegung in Gang setzte, hatte der Name Chabanais ein ganz besonderes Flair. Madame Richard wird als die Carrie Nation des Geschlechtslebens in die Geschichte eingehen. Jetzt ist das Haus geschlossen, und das Gebäude dient irgendeinem niedrigen kommerziellen Zweck. Die Wände des kleinen Gratin Dauphinois sind mit Karikaturen vollgehängt, die nostalgisch auf die vergangenen großen Zeiten der Straße anspielen.
Mirande kam herein und sprühte von Witzen. Er zog mich auf als einen Missetäter, der unbedingt an den Ort seiner Vergehen zurückkehren muss. Die Küche im Gratin ist robust wie die des Dauphiné, aber das schreckte Mirande nicht. Auch die Weinkarte beschränkt sich auf die schweren, groben Weine von Arbois und dergleichen, mit ein paar Burgunderlagen für Gäste, die angeben wollen. Bordeauxweine gibt es keine; der Besitzer hat noch nie von ihnen gehört. Natürlich steht der eine oder andere Champagner für Hochzeitsgesellschaften oder Geburtstagsfeiern auf der Karte, also entschied sich Mirande, dem der Arzt ja vom Burgunder abgeraten hatte, für Champagner während des ganzen Essens. Diese Kombination mit der Gebirgsküche war drôle, aber ich hatte den Bordeaux-Mangel nicht bedacht, als ich ihn einlud.
Wir bestellten zunächst für jeden ein Dutzend escargots en pots de chambre. Das sind Schnecken, die – damit der Gast es leichter hat – einzeln in kleinen Tontöpfchen aus dem Ofen kommen, anstatt dass man sie zurück in ihre Häuser pfercht. Die Schnecke muss natürlich für die Zubereitung aus dem Schneckenhaus genommen werden, und das Haus, in welches man sie zurückzwängt, braucht nicht ihr eigenes zu sein. Insofern gibt es nicht einmal einen sentimentalen Grund für diese erneute Einkerkerung. Die Usance des Servierens der Schnecken en pot trägt nichts zur besseren Zubereitung bei und nimmt ihr auch nichts, aber den Verzehr erleichtert und beschleunigt sie. (Die Vorstellung, das Auftischen der Häuser beweise die Authentizität der Schnecken – wie der Kopf, den man an der Waldschnepfe lässt –, ist nicht stichhaltig, da heutzutage jede Hausfrau in den Vororten weiß, dass man im Supermarkt eine Dose Schneckenhäuser kaufen und sie dann mit einer Mischung aus Nusskäse und gehackten Oliven füllen kann.)
Mirande war mit seinem Dutzend als Erster fertig und wischte die Knoblauchbutter in jedem pot pedantisch mit einem Stück Brot aus, das in den Durchmesser des Töpfchens so präzise hineinpasste wie eine Kugel in den Flintenlauf. Brot so zurechtzubrechen braucht lange Übung. Wir hatten die erste Flasche Champagner geleert, als er mit einer zarten Bewegung die Rechte auf jenen Punkt der Weste legte, der von der Wirbelsäule am weitesten entfernt war.
»Liebling«, sagte er, »mir ist nicht gut.«
Es war wie der Augenblick, da ich Joe Louis zum ersten Mal in den Seilen hängen sah. Ein großes Mitleid erfüllte mein Herz. »Maître«, sagte ich, »ich bringe Sie nach Hause.«
Die betroffen dreinschauende patronne winkte ihrem Mann in der Küche (der sie durch die Durchreiche sehen konnte), dass er die Zubereitung des gendarme de Morteaueinstellen solle – der großen geräucherten Wurst in ihrer harten Haut, die wir auf die Schnecken folgen lassen wollten. (»Sie ist von kurzer und breiter Gestalt und besteht aus reinem Schweinefleisch; meist … reicht man dazu warmen Kartoffelsalat« – Root, S. 217.) Wir hatten entschieden, statt der pommes à l’ huile den gratin dauphinois zu nehmen. (»Dünn geschnittene Kartoffeln werden mit gekochter Milch und geschlagenem Ei durchfeuchtet, mit Salz, Pfeffer und Muskat gewürzt und mit geriebenem Gruyère vermengt. Man tut sie dann in eine irdene Schüssel, die mit Knoblauch ausgerieben und gebuttert wurde, übersät sie mit kleinen Klümpchen Butter und bestreut sie mit weiterem Käse. Dann werden sie langsam im nicht allzu heißen Herd gegart.« – Root, S. 228.) Anschließend wollten wir ein Huhn in Sahne mit morilles, den schwarzen Wildpilzen der Berge, zu uns nehmen. All das brachen wir ab.
Ich führte Mirande auf die Straße hinaus und rief ein Taxi her.
»Mir ist nicht gut, Liebling«, sagte er. »Ich werde alt.«
Er wohnte weit vom Restaurant entfernt, hinter der Place de l’Étoile, im Paris der Erfolgreichen. Von Zeit zu Zeit sagte er während der Fahrt: »Es ist nichts, Sie müssen mich entschuldigen … Mir ist nicht gut.«
Das Mietshaus, in dem er und Madame B. wohnten, glich einem der schicken modernen Museen des Stadtviertels – man betrat es durch ein kleines Labyrinth von überglasten Gartenwegen. Ein Gittertor nach dem anderen schwang auf, als ich den Knopf drückte, auf den mich Mirande jeweils hinwies – in diesen modernen Palästen gibt es keine sichtbaren Lakaien –, und schließlich kamen wir zu einem Aufzug, der uns lautlos hinaufkatapultierte zu seiner Wohnung, die etwas größer war als der Square Louvois. Die Einrichtung mit ihren Basaltsäulen und den Fellen riesenhafter sibirischer Tiger auf dem Boden (wohl eine speziell für Stars des frühen Films hochgezüchtete Rasse) erinnerte mich an das Studiodekor für Belphégor