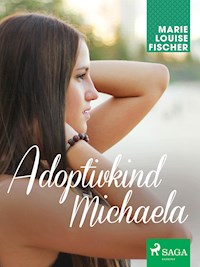
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Michaela
- Sprache: Deutsch
Während die junge Michaela mit ihrem Freund Gregor ein paar schöne Stunde verbringt, sehen sich ihre Eltern zu Hause mit einem Schreiben der Schule konfrontiert, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass Michaelas Versetzung gefährdet ist. Die Diskussion der Eltern wird hitziger und so bekommen sie nicht mit, dass sich Michaela nach Hause schleicht. Zu ihrem grenzenlosen Schrecken bekommt sie durch die Türe mit, was bisher vor ihr verborgen gehalten wurde: Ihre Eltern sind gar nicht ihre leiblichen Eltern, sie haben sie stattdessen adoptiert. Michaela ist fassungslos, sie fühlt sich belogen und ihr reift der Wunsch, alles hinter sich zu lassen. Denn auch ihr Freund scheint sich für ihre Probleme nicht wirklich zu interessieren. So macht sich Michaela auf, ihre richtige Mutter zu suchen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Adoptivkind Michaela
Saga Egmont
Adoptivkind Michaela
Adoptivkind Michaela
Copyright © 2017 by Erbengemeinschaft Fischer-Kernmayr, (www.marielouisefischer.de)
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1967 by F. Schneider, Germany
Copyright © 1962, 2017 Marie Louise Fischer Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711719572
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
I.
Es war schneidend kalt.
Die Straßenlaterne vor der kleinen Villa in München-Bogenhausen brannte schon längst, als Schneiders aus ihrer kobaltblauen Limousine stiegen. Sie hatten bis nach neun Uhr die Frühjahrsmodelle, die am nächsten Montag in die Herstellung gehen sollten, in allen Einzelheiten überprüft. Anschließend hatten sie eine private Verabredung mit einem ihrer wichtigsten Geschäftsfreunde gehabt, die aber im letzten Augenblick abgesagt worden war. So kam es, daß sie an diesem Samstag zwar später, aber immer noch früher als erwartet nach Hause kamen. Erhard Schneider trat als erster in die Diele, ein breiter, untersetzter Mann, dessen spiegelnde Glatze von einem Kranz lockiger grauer Haare umgeben war, die ihm fälschlicherweise das Aussehen eines Künstlers gaben. Tatsächlich war er Kaufmann und nichts als Kaufmann. Er zeichnete verantwortlich für Kalkulation und Vertrieb des Hauses »Schneider & Torsten«, Herstellung von Damenoberbekleidung, während die herbe, kluge Isabella Schneider, geborene Torsten, für die modische Gestaltung und die Herstellung zuständig war.
Ohne besonderes Interesse begann Erhard Schneider den kleinen Stoß Post durchzusehen, der auf dem braungekachelten Dielentisch auf ihn wartete. Es waren fast nur Drucksachen, die geschäftlichen Briefe kamen immer in das Büro der Fabrik, draußen in Giesing. Er wollte die Post schon achtlos in seine Jackentasche schieben, als er plötzlich stutzte.
Isabella trat, ihren Ozelot über dem Arm, näher. »Was ist?« fragte sie. »Etwas Unangenehmes?«
»Keine Ahnung. Ein Brief von Michaelas Schule.«
»Lies doch schon!«
Erhard Schneider riß den Umschlag auf und überflog schnell die wenigen Zeilen. Trotzdem fragte ihn Isabella noch einmal ungeduldig: »Was ist?«
Er ließ den Brief sinken und sah sie an. »Michaelas Versetzung ist gefährdet.«
»Mein Gott!« Isabella nahm ihm den Brief aus der Hand. »Warum hat sie uns davon nichts gesagt?«
»Michaela!« brüllte Erhard Schneider, und als Frau Beermann, die Haushälterin, atemlos die schmal geschwungene Treppe heruntergerannt kam, sagte er, immer noch in beachtlicher Lautstärke: »Wo steckt Michaela?«
»Oh, guten Abend! Ich wußte gar nicht … Sie ist nicht da«, stotterte Frau Beermann.
»Nicht zu Hause?« fragte Isabella erstaunt. »Aber — das verstehe ich nicht ganz!«
»Sie ist fortgegangen, vor etwa einer halben Stunde.«
»Spazieren? Bei der Kälte?« Erhard Schneiders Kopf war rot angelaufen.
»Nein, ich glaube … Sie hat gesagt, sie wolle ins Kino.«
»Da hört sich doch alles auf! Die Schulbehörde schickt uns einen Brief ins Haus — und was tut Michaela? Sie geht ins Kino.«
»Aber, Erhard, sie wußte doch sicher gar nichts von diesem Brief«, versuchte Isabella ihn zu beruhigen.
»Unsinn. Man weiß, ob man versetzt wird oder nicht. Mach mir nichts vor, so etwas weiß man sehr genau.«
Frau Beermann hatte Isabella den Pelzmantel abgenommen.
»Haben die Herrschaften sonst noch Wünsche?« fragte sie.
»Nein, nichts«, sagte Erhard Schneider grob. »Sie hätten besser auf das Kind aufpassen sollen, wozu haben wir Sie denn engagiert?«
»Bitte, Erhard!« Isabella warf Frau Beermann einen entschuldigenden Blick zu. »Es hat wirklich keinen Sinn, alle Welt für diese Sache verantwortlich zu machen.« Sie ging vor Erhard Schneider her in den kostbar und geschmackvoll eingerichteten Wohnraum.
»Du wirst wenigstens zugeben, daß ich dir schon oft gesagt habe …« Erhard Schneider öffnete den kleinen Barschrank, holte eine Flasche französischen Kognak und zwei Gläser heraus.
»Was?« fragte Isabella.
»… daß Michaela faul und oberflächlich ist … Da, lies doch, was der Direktor schreibt!« Er nahm Isabella den Brief wieder aus der Hand. »Da steht es, schwarz auf weiß … Begabt und von schneller Auffassungsgabe, aber völlig desinteressiert und ohne nötigen Ernst. Da hast du es!«
»Sie ist noch jung, Erhard!«
»Sechzehn Jahre. Mit sechzehn Jahren habe ich schon längst als Lehrling gearbeitet, und du —«
»Ach, Erhard, heute ist es doch etwas ganz anderes! Die Zeiten haben sich geändert und …«
Erhard Schneider hatte die beiden Gläser vollgeschenkt und reichte ihr eines. »Ich mache dich ja nicht verantwortlich, Isa«, sagte er in verändertem Ton. »Ich weiß, du hast dich um das Kind gekümmert wie kaum eine andere Mutter. Aber vielleicht ist es das gerade. Wir haben sie zu sehr verwöhnt.«
»Du etwa nicht?«
»Ja, ich auch. Aber ich habe gedacht, daß sie es uns anders danken würde. Was soll nun werden?«
Isabella nahm einen Schluck Kognak. »Nun, das beste wird sein, wir geben ihr jetzt Nachhilfestunden, denke ich … Vielleicht kommt sie doch noch mit. Oder sonst muß sie das Jahr eben wiederholen.«
»Das meine ich nicht.« Erhard Schneider stellte sein Glas hart auf den Tisch. »Glaubst du, daß sie je das Zeug haben wird, die Firma zu übernehmen?«
Ehe Isabella Schneider noch antworten konnte, trat Frau Beermann ein. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie, »draußen steht ein Herr, der Sie sprechen möchte …«
»Wer?« fragte Erhard Schneider böse.
»Er hat mir seinen Namen nicht genannt.«
»Na, erlauben Sie mal! Wie oft sollen wir Ihnen noch sagen, daß Sie niemanden hereinlassen sollen, wenn Sie nicht wissen, wer er ist!«
»Ja, natürlich, Herr Schneider, ich habe das nicht vergessen, nur — er sagte, es sollte eine Überraschung für Sie sein.«
»Eine Überraschung am Samstagabend?«
»Er ist sehr — liebenswürdig.«
Erhard Schneider entging es nicht, daß sie leicht errötete. Eine böse Ahnung stieg in ihm auf. »Na, dann wollen wir mal sehen«, sagte er. »Nein, laß nur, Isa, das werde ich schon allein erledigen.« Er nahm noch einen Schluck aus seinem Glas, dann stellte er es aus der Hand und ging zur Tür.
»Wie sieht er aus, Frau Beermann?« fragte Isabella und runzelte ein wenig die Stirn.
»Gut«, sagte Frau Beermann, »sehr gut, möchte ich sagen. Ein großer, schlanker Herr, schwarzes Haar, ganz glatt, und so hübsche blaue Augen.«
»Ach so.«
Isabella Schneider holte tief Atem, dann öffnete sie ihre Handtasche und zündete sich eine Zigarette an. Mit leichtem Ärger bemerkte sie dabei, daß ihre schlanken, gepflegten Hände zitterten.
»Danke, Frau Beermann«, sagte sie, »ich brauche Sie nicht mehr.«
Sie ließ sich in einen der hochlehnigen Gobelinsessel fallen. Sie fühlte sich müde und zerschlagen. Also war er doch wiedergekommen. Sie hätte es sich ja denken können, einen Menschen wie Till bekam man nie mehr los, wenn man einmal mit ihm in Berührung gekommen war.
Sie spürte zu ihrem eigenen Entsetzen, daß sie ihn haßte. Sie haßte ihren eigenen Bruder, Till Torsten, wie sie nie einen anderen Menschen gehaßt hatte. Sie verabscheute ihn.
Sie konnte sich heute nicht einmal mehr vorstellen, wie es geschehen konnte, daß sie lange Jahre hindurch immer wieder seinem Charme erlegen war. In der Diele standen sich Till Torsten und Erhard Schneider gegenüber. Der schmale, geschmeidige Till wirkte neben seinem schweren, wuchtigen Schwager wie ein Windhund, der um einen Bernhardiner herumschwänzelt.
»Ich verstehe natürlich, daß du überrascht bist, mich zu sehen«, sagte er und zeigte mit einem kleinen Lächeln seine kräftigen weißen Zähne.
»Durchaus nicht.«
»Es ist eben so, Menschen wie ich, die kein Zuhause haben — das soll natürlich kein Vorwurf sein, lieber Erhard, versteh mich bitte nicht falsch — aber man möchte eben doch ein paar —«
»Wieviel brauchst du?« fragte Erhard Schneider scharf.
»Ich verstehe dich nicht.« Till Torsten hob mit gespieltem Erstaunen die Augenbrauen.
»Wieviel?«
»Ja, kannst du dir denn wirklich nicht vorstellen, daß ich einfach aus Sehnsucht nach euch …«
»Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Till. Bitte, hör auf damit. Du solltest schon wissen, daß diese Masche bei mir nicht zieht.«
»Habt ihr euch gar keine Gedanken darüber gemacht, wo ich die letzten Jahre gesteckt habe?«
»Wo denn schon. Wahrscheinlich hinter Gittern.«
»Du bist sehr grausam«, sagte Till Torsten, sein glattes Gesicht verdüsterte sich.
»Was willst du hier?«
»Ich habe dir doch schon gesagt, ich möchte … Ich möchte Isabella Wiedersehen, schließlich ist sie ja meine Schwester. Man hat doch auch so etwas wie Familiensinn, nicht wahr?«
»Du nicht, Till, gib dir keine Mühe, du wirst Isabella nicht sehen.«
»Willst du mir das verbieten?«
»Ja. Wenn du nicht in einer halben Minute aus dem Haus bist, werde ich —«
»Was denn? Was wirst du?«
»Die Polizei verständigen.«
Till Torsten wechselte den Ton. »Natürlich, das kannst du, das steht dir zu. Du bist ja schließlich ein geachteter Staatsbürger, nicht wahr. Aber was versprichst du dir davon? Willst du Isabella von nun an an die Kette legen? Meinst du nicht auch, daß ich vielleicht eine Gelegenheit — nein, es braucht gar nicht hier im Hause zu sein — finden kann, um mich mit ihr in Verbindung zu setzen?«
»Ich habe dich schon einmal gefragt, Till, wieviel brauchst du?«
»Tausend.«
»Du bist verrückt.«
»Bitte, wie du willst!« Till Torsten gab sich den Anschein, als ob er sich zum Gehen wenden wollte. »Grüße meine Schwester von mir — oder auch nicht. Ganz wie du willst, Adieu.«
»Till — wofür brauchst du das Geld?«
Till Torsten sah seinem Schwager mit einem unverschämten Lächeln in die Augen. »Willst du das wirklich wissen?«
»Ja. Du weißt, ich habe schon einmal Schwierigkeiten gehabt, als ich dir damals Geld geliehen habe, mit dem du einen sogenannten großen Coup starten wolltest. Du bist damit reingefallen, und ich habe eine Menge Unannehmlichkeiten deinetwegen gehabt. Erinnerst du dich noch?«
»Na schön. Wenn es dich beruhigt … Ich möchte gern zum Wintersport nach Garmisch fahren. Findest du nicht auch, daß ich ein bißchen blaß und angegriffen aussehe? Na also. Die Gesundheit deines Schwagers sollte dir doch tausend Mark wert sein, oder?«
»Gut. Ich werde dir einen Scheck geben.«
»Scheck kann ich nicht brauchen, Schwager.«
»Na, bitte. Dann bekommst du die tausend Mark bar — aber nur gegen Quittung. Als kurzfristiges Darlehen.«
»Und du glaubst, daß ich so etwas unterschreibe?«
»Ganz bestimmt. Sonst bekommst du das Geld nämlich nicht. Auf keinen Fall.«
»Bildest du dir im Ernst ein, du würdest es von mir zurückkriegen?«
»Nein.«
»Wozu willst du dann die Quittung?«
»Nur so. Also entweder du schreibst mir so einen Wisch aus, oder …«
»Na schön. Wenn es dir Spaß macht. Ich sehe den Sinn zwar nicht ein, aber immerhin …« Till Torsten zog seine Brieftasche aus dem Jackett seines tadellos sitzenden dunkelgrauen Anzugs, fand einen leeren Zettel und kritzelte, über den Dielentisch gebeugt, ein paar Zeilen darauf. »Genügt es so?« fragte er und hielt dem Schwager die Quittung hin.
»Danke.« Erhard Schneider nahm die Quittung entgegen, zählte aus seiner Brieftasche zehn Hundertmarkscheine. »Du hast Glück, daß ich das Geld überhaupt bei mir habe …«
»Ich habe immer Glück, mein Lieber, das solltest du wissen.«
»Um so besser für dich — wenn es dir so vorkommt.«
Till Torsten knöpfte sich seinen dunkelblauen Wintermantel zu. »Also, schönen Dank, Schwager — und von mir aus keinen Gruß an Isabella.«
»Paß auf, Till — ich will kein Versprechen von dir, ich weiß, daß dein Wort nichts gilt, aber ich warne dich. Wenn du noch einmal unser Haus betrittst oder wenn du ein einziges Mal versuchen solltest, dich hinter meinem Rücken mit Isabella in Verbindung zu setzen, dann —«
»Was dann?«
»Dann wirst du von mir nie wieder, unter gar keinen Umständen, auch nur einen einzigen Pfennig herausholen. Hast du mich verstanden?«
»Du hast dich ungewöhnlich deutlich ausgedrückt, Schwager!« Till Torsten drückte sich den weichen Hut auf den Kopf, tippte mit einem spöttischen Lächeln an die Krempe, drehte sich um und ging aufreizend langsam zum Ausgang. Erhard Schneider folgte ihm bis zur Haustür, als die Tür hinter dem unangenehmen Gast ins Schloß gefallen war, drehte er den Schlüssel zweimal um und schob den Riegel vor.
Dann erst wagte er aufzuatmen.
Das »Rock ’n’ Roll« lag im Keller eines alten Schwabinger Hauses und wurde nur von Jugendlichen besucht. Es galt als ausgesprochenes Halbstarkenlokal, obwohl die jungen Leute, die hier verkehrten, sich selbst als Teenager und Twens bezeichneten.
In den Akten der Polizei und in Zeitungsberichten war es schon öfters im Zusammenhang mit Raufereien und Messerstechereien erwähnt worden, aber im allgemeinen spielten sich die Vergnügungen ziemlich friedlich ab.
Der Alkoholverbrauch war sehr gering. Die Mädchen tranken ausschließlich Coca-Cola und Fruchtsäfte, die Jungen Bier und nur wenige einen Schnaps zwischendurch — wenn sie überhaupt tranken, denn die meiste Zeit verbrachten sie auf der Tanzfläche.
Sie waren gekommen, sich auszutoben, und sie tobten sich aus. Die Musikbox, auf größtmögliche Lautstärke eingestellt, war unentwegt in Betrieb. Platten mit Elvis Presley, Peter Kraus, Paul Anka wurden bevorzugt, und den jungen Leuten rann der Schweiß über die Stirn, während sie ihre Glieder wild verrenkten.
Die Einrichtung war mehr als bescheiden. Auf den kleinen Holztischen lagen keine Decken, und die Beine der Stühle zeigten die unangenehme Neigung, Laufmaschen in die Strümpfe der Mädchen zu reißen. Aber sie kannten diese Tücken und nahmen sich in acht.
Die vier Pfeiler, die die Decke stützten, waren mit unzähligen Namenszügen und Zeichnungen bekritzelt, mit Kopierstift aufgemalt oder mit dem Taschenmesser eingeritzt, und dies und die abgeschnittenen Krawatten, die auf Stricken entlang der Decke hingen, waren der einzige Schmuck.
Jeder Junge, der zum erstenmal ins »Rock ’n’ Roll« kam, mußte ein Stück seiner Krawatte opfern. Damit galt er als eingeführt. Aber durchaus nicht jedem wurde diese Ehre zuteil, denn die Stammgäste achteten streng darauf, daß man unter sich blieb.
Michaela Schneider stampfte, die Augen mit den dunklen Wimpern leicht geschlossen, das blütenhafte Gesicht zu Gregor Hellmer erhoben. Sie genoß den betäubenden Rhythmus und die körperliche Nähe des jungen Mannes, die außerordentlich wohltuend und beruhigend auf sie wirkte.
Der Griff seiner warmen, trockenen Hände um ihre Taille war zart und doch fest, sie wußte, wenn sie die Augen aufschlug, würde sie gerade in sein bräunliches, braunäugiges Gesicht mit den lustigen Sommersprossen auf der Nase blicken. Sie sprachen kein Wort miteinander.
Dann war die Platte abgelaufen. »Komm!« sagte Gregor und nahm Michaela bei der Hand, noch bevor die Jungen, die sich sofort auf den Musikautomaten gestürzt hatten, sich über ihre Wahl der neuen Platte einig waren. Er zog Michaela an einen Tisch, der eng an der Rückwand eines Raumes stand, sie setzten sich. Gierig saugte Michaela an ihrem Strohhalm. Gregor zündete sich eine Zigarette an.
»Laß mich mal ziehen!« bat sie ihn.
Er schüttelte den Kopf. »Nichts für kleine Mädchen.«
»Nun sei doch nicht so.«
Er reichte ihr die Zigarette. Sie nahm einen tiefen Zug und verschluckte sich prompt. Sie mußte husten. Er klopfte ihr lachend auf den Rücken und nahm ihr die Zigarette wieder aus der Hand. »Das hätte ich dir gleich sagen können. Rauchen muß gelernt sein.«
»Quatsch. Ich habe schon oft geraucht.«
»Mir bist du jedenfalls lieber, wenn du es nicht tust.«
Sie sah ihn von unten herauf mit schrägen Augen an. »Sag mal, Greg, was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich heute abend nicht gekommen wäre?«
Er grinste. »Wahrscheinlich hätte ich mich in mein Bettchen gelegt und hätte geweint.«
»Nein, ich meine — im Ernst! Mit wem hättest du getanzt?«
»Sieh dich mal um. Es sind massenhaft Mädchen da.«
Sie sagte, ohne den Blick von ihm zu lassen: »Eine gräßliche Fülle von Gesichtern!«
»Was willst du? Samstag abend.«
»Warum —« begann sie, aber dann unterbrach sie sich selbst.
»Ich merke schon, ich falle dir fürchterlich auf die Nerven …«
»Überhaupt nicht. Spuck heraus, was du auf dem Herzen hast!« Sie schlug die Augen nieder und zeichnete mit ihren spitzgefeilten, zartrosa lackierten Fingernägeln Striche und Kreise auf die Tischplatte. »Ich meine nur, du weißt genau, daß ich mich am Samstagabend am schlechtesten frei machen kann … und überhaupt, Samstag ist ein scheußlicher Tag zum Ausgehen. Warum also …«
»Weil ich wochentags arbeiten muß, Micky … Am Sonntagmorgen kann ich mich ausschlafen. Das ist die ganze Erklärung.«
»Du bist ein schrecklicher Spießer, nicht wahr?«
Er zuckte die Achseln. »Kann sein.«
»Wenn dir ein bißchen an mir liegen würde …«
Er legte seine Hand unter ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. In seinen braunen Augen stand freundlicher Spott. »Was erwartest du eigentlich von mir? Daß ich dir einen Heiratsantrag mache, weil ich dich für das bezauberndste Wesen der Welt halte?«
»Warum eigentlich nicht?«
»Weil dir noch die Eierschalen hinter den Ohrwascheln kleben und ich selbst … Also bitte, Micky, mach dich nicht lächerlich. Ich bin jetzt das erste Jahr bei der Dresdner Bank — mein erstes Lehrjahr. In sieben Jahren verdiene ich frühestens genug, um … Du siehst gerade so aus, als wenn du sieben Jahre auf einen Mann warten würdest.«
»Warum nicht? Dann bin ich dreiundzwanzig, das wäre doch noch nicht zu alt.«
Er beugte sich über sie und küßte sie auf die Nasenspitze.
»Wenn du zweiundzwanzig bist, reden wir wieder darüber, ja?«
»Du bist gemein.«
»Klar bin ich das.« Er horchte auf, der Automat hatte eine neue Platte aufgelegt, einen heißen Rock ’n’ Roll. »Komm!« sagte er, reichte ihr die Hand und zog sie hoch.
Sie tanzten wild und ausgelassen, ganz dem Rhythmus hingegeben. Michaela hielt ihren strahlenden Blick auf Gregor geheftet, der sie immer wieder rundum und um sich selbst wirbelte. Ihr blondes, schulterlanges Haar umschwebte ihren kleinen Kopf wie eine seidig schimmernde Wolke, das leuchtend rote Taftkleid mit dem weiten, schwingenden Rock und den vielen Petticoats betonte die Zartheit ihres jungen Körpers.
Michaela und Gregor ließen sich los und klatschten in die Hände. »Hei!« brüllten die Burschen aus vollem Halse — da unterbrach Gregor den Tanz, so plötzlich, daß Michaela, aus dem Rhythmus gerissen, stolperte. Er fing sie in seinen Armen auf. »Schnell!« flüsterte er. »Komm!«
Sie verstand nicht, sträubte sich gegen seinen Griff, wollte ihn zurückreißen. Aber er war stärker als sie und hatte sie schon mitgezerrt, bevor sie wußte, was vor sich ging. »Razzia!« sagte er scharf. Er hatte als erster die drei Herren in Zivil bemerkt, die langsam die Kellertreppe herunterkamen …
Von einer Sekunde auf die andere wechselte ihr Gesichtsausdruck, die ausgelassene Freude machte tiefem Schrecken Platz. »Was nun, Greg? Was sollen wir tun?«
Wortlos riß Gregor sie durch die Hintertür hinaus, sie glaubte ihn verstanden zu haben und wollte in einer der Damentoiletten verschwinden. Aber er zerrte sie am Handgelenk durch einen halbdunklen Gang mit sich fort, stieß eine eiserne Tür auf — sie standen im Heizungskeller.
»Meinst du, hier können wir bleiben?« flüsterte sie atemlos, als er sie losließ.
»Du mußt ’raus!« sagte er und machte sich schon daran, das Kellerfenster aufzustoßen.
»Aber …«
»Tu, was ich dir sage!«
Er faltete seine Hände zu einem Korb, sie trat hinein, er hob sie hoch und half ihr, durch das schmale Fenster hinauszukrabbeln. »Halte dich nach rechts!« rief er ihr zu. »Da ist ein Torweg — immer nach rechts! Und dann in die Garderobe vom >Studio fünfzehn« Warte auf mich!« Ihm fiel ein, daß sie draußen entsetzlich frieren mußte, er riß sich die Jacke herunter und stopfte sie ihr durch das Fenster nach. »So — und nun lauf!«
Das Klappern ihrer halbhohen Absätze war noch auf dem Pflaster zu hören, als die Tür des Heizungskellers aufgestoßen wurde und einer der Herren in Zivil eintrat. Gregor angelte in seiner Hosentasche nach seinem Zigarettenpäckchen, steckte sich eine Zigarette an und gab sich Mühe, so gleichmütig wie nur möglich auszusehen. »Was machen Sie denn hier, junger Mann?« fragte der Kriminalbeamte nicht einmal unfreundlich.
Gregor nahm einen tiefen Zug, bevor er antwortete: »Habe meine Dame nach Hause gebracht.«
Der Kriminalbeamte runzelte die Stirn. »Nach Hause?«
»Na klar. Durchs Fenster.«
Der Kriminalbeamte ging zum Fenster, öffnete die Klappe, ließ sie wieder fallen. »Und wie hieß die Dame?«
»Keine Ahnung. Habe sie erst heute abend aufgerissen.«
»Hm.« Der Kriminalbeamte ging zur Heizung, öffnete die Klappe und warf einen Blick hinein.
»Ich habe sie nicht verbrannt, wenn Sie das glauben!«
»Na, vielleicht nicht die Dame, aber …« Er bückte sich und nahm einen Stummel auf, zerfetzte das Papier und hob es prüfend an die Nase.
»Seit wann sammeln Sie Stummel, Herr Kommissar?«
»Nie was von Marihuana gehört?«
»Gehört schon.«
Der Kriminalbeamte schnupperte dem Rauch von Gregors Zigarette nach, dann sagte er: »Ihren Ausweis, bitte!«
Gregor fuhr sich mit der Hand zur Brust, siedendheiß fiel ihm plötzlich ein, daß sein Ausweis in der Jacke war, die er Michaela mitgegeben hatte. »Verdammtes Pech.«
»Ausweis wohl vergessen, was?«
Gregor hatte sich schon wieder gefaßt. »Nicht doch, Herr Kommissar! Ich habe ihn im Mantel, drinnen!«
»Na schön, dann holen Sie ihn. Sie werden ihn brauchen können.«
Gregor ging zur Tür, sah sich noch einmal um. Der Kriminalbeamte stand versonnen da und stocherte mit der Fußspitze in einem Kohlenhaufen. »Wollen Sie nicht mitkommen, Herr Kommissar?«
Der Kriminalbeamte blickte auf, Spott in den Augen. »Danke. Ich habe was Besseres zu tun.«
Langsam ging Gregor durch den halbdunklen Gang zurück. Er überlegte fieberhaft. Durch die Toiletten konnte er nicht, dort würde bestimmt ein Beamter postiert sein. Es hatte gar keinen Zweck, es zu versuchen. Er mußte sich auf ein paar Stunden auf dem Polizeipräsidium gefaßt machen. Es würde einen furchtbaren Krach zu Hause geben. Aber das war nicht das Schlimmste. Wie sollte Michaela nach Hause kommen? Sie hatte ihre Handtasche auf dem Tisch liegen lassen, und in seiner Jacke war kein Geld. Sie würde sich eine Erkältung, wenn nicht noch Schlimmeres holen, wenn sie in ihrem dünnen Kleid, nur mit seiner Jacke darüber, zu Fuß den weiten Weg von Schwabing nach Bogenhausen machen mußte. Etwas anderes blieb ihr gar nicht übrig. Sie würde auf ihn warten, warten und warten und immer verzweifelter werden.
Nein, das durfte nicht geschehen, irgendwie mußte er hier heraus. Er mußte es mit Frechheit versuchen.
Als er in das Lokal zurückkam, stand einer der Kriminalbeamten noch immer auf der Treppe. Der andere ging von Tisch zu Tisch und prüfte die Ausweise. Die Musikbox spielte nicht mehr, und die Stille hatte etwas Unheimliches an sich. Die jungen Leute saßen und standen in dumpfem Schweigen.
Gregor ging ruhig, nicht zu schnell und nicht zu langsam, zu seinem Tisch zurück, nahm Michaelas Mantel über den Arm, legte seinen Ulster darüber, steckte ihre kleine Handtasche ein und bahnte sich einen Weg zur Treppe. Der Kriminalbeamte, der dort stand, ein älterer Herr mit dem Ansatz eines Bauches, versuchte den ganzen Raum im Auge zu behalten und sah ihn erst, als er vor ihm stand.
»Na?« fragte er.
»Ich möchte nach Hause, Herr Kommissar!«
»Ihren Ausweis, bitte!«
»Den habe ich schon Ihrem Kollegen gezeigt — hinten im Heizungskeller!«
»Na, dann zeigen Sie ihn mir eben noch mal!«
In diesem Augenblick entstand ein Geräusch im Hintergrund des Lokals. Unwillkürlich blickte Gregor sich um. Er sah, daß ein breitschultriger junger Mann mit einem Affengesicht seinen Stuhl zurückgeschoben hatte und blitzschnell, statt seinen Ausweis zu zeigen, dem Beamten, der ihn kontrollieren wollte, die Faust unters Kinn schlug. Der Hieb hatte gesessen, der Kriminalbeamte brach stöhnend zusammen. Wie auf Kommando erhoben mehrere Burschen ihre Stühle und schlugen die Birne an der Decke aus. Der Kriminalbeamte neben Gregor zog seine Trillerpfeife und ließ einen schmerzhaft schrillen Pfiff ertönen. Gregor verlor keine Sekunde. Er raste an dem Beamten vorbei, die Treppe hinauf und ins Freie.
Vor dem Eingang stand ein Funkstreifenwagen, der Fahrer, der den Pfiff gehört hatte, stieg aus und lief zum Eingang.
»Rasch! Beeilen Sie sich!« rief Gregor ihm zu. »Da drinnen ist was fällig!« Dann ging er, nicht zu schnell und nicht zu langsam, die Straße hinunter und sah aufatmend die Neonbeleuchtung über dem »Studio fünfzehn«.
Michaela wartete, wie verabredet, an der Garderobe auf ihn. Sie zitterte am ganzen Körper — nicht vor Kälte, denn hier drinnen war es warm genug, sondern vor Aufregung …
»In deiner Tasche war —«
»Schnauze!« sagte er grob.
Sie verstummte sofort. Er zog seine Jacke an, half ihr in ihren Mantel, gab ihr die Handtasche und schlüpfte selbst in seinen Ulster.
Der Garderobenfrau, einer grauhaarigen, kleinen Person, die laut zu zetern begann, daß ihre Garderobe kein Zufluchtsraum für Verbrecher wäre und daß sie mit der Polizei nichts zu tun haben wollte, schob er besänftigend ein Zweimarkstück hin.
Dann traten sie zusammen ins Freie.
Gregor nahm Michaelas kleine Hand und steckte sie zu sich in die Tasche seines Ulsters. »Tut mir leid, wenn ich grob zu dir war, Micky«, sagte er.
»Versteh’ schon. Ich hätte gar nicht reden sollen. Aber — es war alles aufregend! Toll aufregend, was?«
»Kann man wohl sagen.«
»Wie hast du es bloß fertiggebracht …«
»Dusel«, sagte er kurz. Dann lachte er. »Es hat manchmal doch was für sich, wenn man mit ’nem Spießer ausgeht, was?«
»Greg — das hatte ich doch nicht so gemeint! Ich weiß doch, daß du dufte bist! Wirklich, du bist der tollste Bursche, den ich kenne. Eigentlich …« Sie stockte.
»Na, was?«
»Eigentlich ist es schade, daß du nicht mein Bruder bist!«
Er blieb stehen und sah ihr lächelnd in die Augen. »Na, so schade ist das nun auch wieder nicht.« Er beugte sich zu ihr und küßte sie zärtlich auf den Mund. —
Die Zeit verrann zäh wie Blei.
Isabella und Erhard Schneider saßen in ihrem schweigenden Haus und warteten. Sie lauschten mit angespannter Aufmerksamkeit auf das Läuten der Türklingel — aber die Klingel blieb stumm. Draußen vor den Fenstern stand die Nacht, die kalte Winternacht, wie ein drohender Feind.
Wo war Michaela?
Isabella Schneider saß sehr gerade in einem der hochlehnigen Gobelinsessel, die schönen schlanken Hände um die geschnitzten Knäufe der Lehnen geklammert. Ihr ernstes Gesicht war blaß. Im gehämmerten Messingaschenbecher neben ihr häuften sich Zigarettenstummel.
Erhard Schneider lief, die Hände auf dem Rücken, die Schultern vorgeschoben, im Zimmer auf und ab. Die antike kleine Uhr auf der Barockkommode zeigte mit silberhellen Schlägen die zwölfte Stunde an.
»Zwölf Uhr!« sagte Erhard Schneider. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Zwölf Uhr vorbei … Es ist unglaublich.« Isabella schwieg.
»Ich habe gesagt, daß es zwölf Uhr vorbei ist!« wiederholte er gereizt.
»Meinst du, daß ich es ändern kann?«
»Ich muß etwas tun, sonst werde ich noch wahnsinnig.«
Isabella saß schweigend.
»Nun red doch schon! Sag etwas!« fuhr er sie an.
Sie atmete schwer. »Ruf die Polizei an, Erhard … Das habe ich dir schon vor einer Stunde gesagt.«
»Ausgeschlossen. Ich mache mich doch nicht lächerlich. Die Polizei kann in einem solchen Fall überhaupt nicht helfen.«
»Wir würden eher Bescheid wissen«, sagte Isabella mit tonloser Stimme.
»Was soll das heißen? Du wirst mir doch nicht weismachen wollen, daß sich das Kind etwas angetan hat. Warum auch? Warum?«
»Hast du den Brief vergessen?«
»Sie hat ihn ja gar nicht gesehen!«
»Vielleicht doch.«
»Na, und wenn schon! Sie bleibt sitzen. Was ist weiter dabei? Wegen so was braucht man doch nicht verrückt zu spielen.« Isabella schwieg wieder.
»Warum antwortest du mir nicht, wenn ich mit dir rede?« brüllte er.
»Weil es keinen Sinn hat. Wir haben alles schon wieder und wieder durchgesprochen. Es hat keinen Sinn. Wir müssen warten, das ist alles.«
»Ich glaube niemals, daß sie sich etwas angetan hat. Man zieht doch kein Tanzkleid an, wenn man sich in die Isar stürzt!«
»Bist du so sicher?«
»Ja!« brüllte er. »Ich bin vollkommen sicher, daß du es nur weißt! Sie hat sich nichts angetan, ganz bestimmt nicht. Es ist Wahnsinn, so etwas überhaupt zu denken.«
»Erhard«, sagte Isabella, »glaubst du, daß sie uns lieb hat? Ich meine, wie ein Kind seine Eltern lieben soll?«
»Natürlich … Dumme Frage. Sie hat sich doch immer ganz normal benommen. Nicht ungezogener als andere Kinder. Eher im Gegenteil.«
»Ob das genügt?«
»Was soll das heißen?«
»Ach, bitte, Erhard, sei doch nicht so gereizt … Ich versuche doch nur, mich in Michaelas Situation zu versetzen. Ich möchte einfach wissen, was sie jetzt fühlt und denkt — wenn sie den Brief tatsächlich entdeckt hat.
Ich weiß es nicht. Eigentlich ist sie uns doch sehr fremd, Erhard, nicht wahr?«
»Unsinn. Ich kenne sie ganz genau. Sie ist ein oberflächliches, gutmütiges kleines Ding — nicht gut und nicht schlecht, und überhaupt nicht kompliziert … Sie ist einfach so, wie diese jungen Dinger, na, Teenager, heutzutage sind.«
»Ich weiß nicht. Wir hätten uns mehr um sie kümmern müssen.«
»Noch mehr? Jede freie Minute verbringen wir mit dem Kind. Von früh bis spät denkst du an nichts anderes.«
»Ich habe sie furchtbar lieb, Erhard, und das weißt du. Aber — ob das genügt? Ob wir nicht doch einen Fehler gemacht haben?«
»Meine liebe Isabella, jetzt will ich dir mal was sagen: Du hast Komplexe. Hör auf, dir was einzureden. Oder willst du uns beide verrückt machen?«
»Wenn sie Vertrauen zu uns hätte — wäre sie dann nicht zu Hause geblieben? Und hätte in Ruhe mit uns über alles gesprochen?«
»Wahrscheinlich hat sie keine Ahnung von diesem verdammten Wisch gehabt! Wie oft soll ich dir das noch sagen?!«
»Aber warum ist sie dann fortgelaufen? Warum kommt sie nicht nach Hause?«
»Glaubst du, daß ich ein Hellseher bin?«
»Wenn wir uns genügend um sie gekümmert hätten, würden wir es jetzt wissen.«
»Welcher vernünftige Mensch kann denn wissen, was in einem so unreifen Ding plötzlich vorgeht?« sagte er grob. »Hör auf damit, sage ich dir, mach mich nicht wahnsinnig!«
»Verzeih, Erhard.« Ihre Stimme klang spröde wie gebrochenes Glas. »Verzeih, ich weiß, ich bin schrecklich. Aber ich kann nicht anders. Ich — ich halte es einfach nicht mehr aus!«
»Weil du überarbeitet bist — weil du ins Bett gehörst. Das ist alles. Soll ich dir mal was sagen? Wenn Michaela bis ein Uhr nicht zu Hause ist, gehen wir schlafen. Jawohl, wir gehen schlafen. Morgen früh wird sich dann herausstellen …«
Er unterbrach sich, als er merkte, daß seine Frau lautlos zu weinen begonnen hatte. Sie saß da, hoch aufgerichtet, mit starrem Gesicht, während die Tränen unaufhaltsam ihre Wangen hinunterliefen.
Leise pfeifend stieg Till Torsten die Treppe eines großen, neuen Mietshauses in München-Solln hinauf. Die Wände waren so dünn, daß er im Hinaufsteigen am Familienleben der einzelnen Mietsparteien teilnehmen konnte. Aus einer der Wohnungen klang Gelächter und Gläserklirren, aus einer anderen hörte er Tanzmusik aus dem Radio, dann wieder das harte Aufklopfen von Spielkarten, und dann — nichts. Heidlers, jungverheiratet, schienen in dieser Samstagnacht schon zu schlafen. Till Torsten grinste, als er daran dachte.
Er war bester Laune. Natürlich, der Tausender, den er seinem Schwager entsteißt hat, war nur ein kleiner Fisch, aber immerhin ein Anfang, Betriebskapital sozusagen. Er kannte Erhard Schneider. In solchen Dingen verstand er keinen Spaß. Und auch sonst nicht. Allzuoft konnte er mit dieser Masche nicht reisen.
Jedenfalls, diesmal hatte es wieder geklappt. Jetzt kam es nur darauf an, mit gutem Wind hier loszukommen. Er hatte als Kurt Schreiber, Diplomingenieur, im fünften Stock bei Frau Weber ein möbliertes Zimmer gemietet. Natürlich bildete sie sich ein, daß er sie heiraten würde, obwohl er kein Wort darüber hatte verlauten lassen, nein, so dumm war er bestimmt nicht mehr. Er hatte nicht vor, noch ein einziges Mal wegen Heiratsschwindel zu sitzen.
Immerhin, in Notzeiten war die Fürsorge eines liebenden Weibes recht angenehm, vor allem billig. Nur bekam man bald die Nase voll davon. Außerdem war ein möbliertes Zimmer in München-Solln keine Ausgangsbasis. Jedenfalls nicht für ihn und seine Pläne. Er mußte Schluß machen, es war höchste Zeit. Er hoffte von Herzen, daß Frau Weber schlief, aber als sie, kaum daß er die Wohnungstür aufgeschlossen hatte, aus ihrem Schlafzimmer gestürzt kam, zeigte er sich nicht im geringsten überrascht.
»Guten Abend, Ruthchen!« sagte er fröhlich.
Ruth Weber war, wenn sie gut angezogen und zurechtgemacht das Haus verließ, eine sehr anziehende und hübsche Frau, der man ihre zweiundvierzig Jahre kaum ansehen konnte. Jetzt, mit aufgewickeltem Haar und in einem schäbigen Morgenrock, wirkte sie wie eine alte Vogelscheuche, jedenfalls nach Torstens herzloser Feststellung. Trotzdem küßte er ihr mit lächelnder Zärtlichkeit die Hand.
»Kurt! Wo bist du gewesen?« fragte sie heftig. »Ich habe die ganze Zeit …«
»Es tut mir leid, Ruthchen, daß du auf mich gewartet hast!« Sein Gesicht verlor nichts von seinem lächelnden Gleichmut.
»Du hättest doch wenigstens anrufen können!«
»Es gibt Situationen, Ruthchen … Aber davon versteht ihr Frauen nun einmal nichts. Bitte, sei so lieb und mach mir eine Tasse schönen, starken Kaffee!« Er sah auf seine Armbanduhr. »Um ein Uhr dreiundzwanzig geht mein Zug!«
»Dein — was?«
»Mein Zug, Ruthchen. Es wäre mir lieb, wenn du dich beeilen würdest, damit du mir noch beim Kofferpacken helfen kannst.«
»Du willst — fort?!«
»Ich muß, Ruthchen, ich muß.«
»Aber — du hast mir doch versprochen —«
»Aber, Schäfchen, daran ändert sich doch nichts! Weshalb, glaubst du wohl, fahre ich weg? Um die Dinge zu beschleunigen!«
»Du kommst also wieder?«
Er war an ihr vorbei in sein Zimmer, einem kleinen, mit alten Möbeln vollgestopften Raum, gegangen. Sie folgte ihm auf dem Fuß.
»Natürlich komme ich wieder, Ruthchen«, sagte er gleichgültig. »Was hast du denn von mir gedacht?« Er zog einen großen schweinsledernen Koffer vom Schrank.
»Wann?« fragte sie.
»Komm, Ruthchen, sei lieb, mache mir eine Tasse Kaffee, dann können wir alles in Ruhe besprechen.«
»In Ruhe? Wenn dein Zug in einer knappen Stunde geht?«
»Na eben. Deshalb bleibt keine Zeit mehr, uns zu zanken, obwohl du darin — das muß ich dir gestehen, Ruthchen — eine wahre Meisterin bist.« Durch die Zähne pfeifend, begann er sehr sorgfältig, seinen zweiten Anzug in den Koffer zu legen. Sie wollte ihn zwingen, sie anzusehen, und packte ihn beim Arm.
»Na, na!« sagte er nur und schüttelte sie ab wie ein lästiges Insekt.
»Du glaubst also, du kannst einfach hier verschwinden, was?«
»Einfach habe ich mir das nicht vorgestellt«, erwiderte er ungerührt. »Ich war mir vollkommen klar, daß du dir diese Gelegenheit zu einer Szene nicht entgehen lassen würdest.«
»Wann kommst du wieder?« fragte sie heftig.
»Wenn du es genau wissen willst — am ersten März des nächsten Jahres. Bist du jetzt zufrieden?«
»Nein. Ich will wissen, wohin du gehst!«
»Ich gehe nicht, ich fahre. Mit dem Taxi zum Bahnhof, mit dem Zug nach Hamburg, mit dem Schiff nach Indien. Da staunst du, was? Ich habe einen Jahresvertrag als Ingenieur nach Indien bekommen.
Begreifst du, was das für uns bedeutet? Ich bekomme zweitausend Rupien im Monat. Kaum die Hälfte werde ich dort unten verbrauchen können. Wenn ich zurückkomme, werde ich mir nicht mehr vorwerfen lassen müssen, daß ich von deinem Geld lebe.«
»So hast du dir’s also gedacht«, zischte sie verächtlich. »Aber so einfach mache ich dir die Sache nicht! Du wirst diese Wohnung nicht verlassen, bevor …«
»Bevor was?«
Till Torsten zog die Kommodenschublade heraus und begann, seine Unterwäsche in den Koffer zu legen.
»Bevor du mir nicht auf Heller und Pfennig zurückbezahlt hast, was du mir schuldest.«
Er richtete sich auf und sah sie an. »Wieviel?« fragte er mit hochgezogenen Augenbrauen, faßte in die Jacke und zog ein Bündel Hundertmarkscheine aus der Brieftasche. »Da, komm, bitte, bediene dich!« Ohne sie weiter zu beachten, packte er weiter.
Sie starrte auf das Geld. »Du hast — du willst wirklich?«
»Es tut mir leid, daß es so weit kommen mußte«, sagte er mit tragischem Unterton in der Stimme, »ich habe immer noch gehofft, daß du Vertrauen zu mir haben würdest.«
»Aber ich habe doch Vertrauen zu dir, Kurt. Ich liebe dich! Das mußt du doch wissen.«
»Nein. Du glaubst, daß ich —«
»Kurt! Das ist doch nicht wahr! Ich habe das doch nur gesagt, um … Ich hatte gehofft, du würdest das Geld nicht haben. Du würdest bei mir bleiben!«
»Du hältst mich für einen Lügner.«
»Nein, Kurt, ganz bestimmt nicht. Wie kannst du das von mir nur denken? Mein Gott, daß du mich so wenig kennst!«
»Bitte, nimm das Geld. Es tut mir leid, daß es so weit kommen mußte. Aber es war nicht meine Schuld. Nimm das Geld, und wir trennen uns wie gute Freunde. Für immer.«
»Ich will dein Geld doch gar nicht … Behalte es! Ich will es nicht! Ich brauche es nicht!«
Er sah sie mit einem Blick an, der sie erzittern ließ. »Nimm!« sagte er. »Es ist zu spät.«
»Nein! Nein, Kurt, das darfst du nicht sagen! Bitte, bitte, nicht!«
»Du hast die Probe nicht bestanden, du hast mir nicht geglaubt.«
»Ich — aber, Kurt — verzeih mir! Bitte, bitte, verzeih mir!«
Er seufzte abgrundtief. »Wenn ich dich nur nicht so sehr lieben würde …«
»Kurt! Du liebst mich noch?« Sie warf sich in seine Arme, er zog sie sanft an sich. »Ich kann ohne dich nicht mehr leben«, sagte er. »Jetzt weiß ich es.«
»Dann ist ja alles wieder gut«, sagte sie, tief atmend.
»Ja, Liebes!«
»Und du kommst wieder?«
»Ganz bestimmt.«
»Wirst du mir auch schreiben?«
»Natürlich.«
»Oh, Kurt, ich bin ja so froh … Soll ich dir schnell noch eine Tasse Kaffee machen?«
»Ich fürchte, dazu ist es zu spät. Bitte, sei lieb und bestelle mir ganz rasch ein Taxi, ja?«
Als sie aus dem Zimmer war, strich er mit einem selbstgefälligen Lächeln das Geld wieder ein …
Zwanzig Minuten später betrat er, gefolgt von einem Taxichauffeur, der seinen schweren schweinsledernen Koffer trug, die Hotelpension »Elite« am Maximilianplatz.
Der Ausweis, den er dem Nachtportier zur Eintragung ins Fremdenbuch vorlegte, lautete auf den Namen Joachim Brauner, Beruf: Exportkaufmann, Geburtsort: Augsburg, Alter: vierzig Jahre.
Daß er gefälscht war, wußte nur Till Torsten.
II.
Die Schneidersche Villa war vom Mondlicht fahlweiß, fast taghell beleuchtet, als Michaela und Gregor in die kleine Seitenstraße in Bogenhausen einbogen. Trotzdem sah Michaela sofort, daß im Wohnzimmer noch Licht brannte.
»Verflixt«, murmelte sie und kramte in ihrer Handtasche.
»Was ist? Schlüssel vergessen?« fragte Gregor.
»Ach wo. Aber«, sie machte eine Handbewegung zum Wohnzimmerfenster, »sie sind schon zu Hause.«
»Und nun?«
Sie legte ihm den Finger auf den Mund. »Pst … Ich werde mich ’reinschleichen müssen!«
Wortlos und so leise wie möglich durchschritten sie den Vorgarten und traten unter das Vordach der Haustür. Michaela steckte den Schlüssel ins Schloß, drehte ihn sachte um — die Tür gab nicht nach. »Zugeriegelt«, sagte sie verblüfft.
»Auwei!«
»Komm«, flüsterte sie und zog ihn an der Hand hinter das Haus.
»Was willst du machen?«
»Ich muß da ’rauf«, sagte sie, mit einer Kopfbewegung zum Spalier hin, und bückte sich schon, um ihre schmalen, halbhohen Pumps abzustreifen.
Er schaute unbehaglich die Hauswand hinauf. »Bist du sicher, daß ein Fenster offen ist?«
»Na klar. In meinem Zimmer immer.« Sie rollte sich mit geschickten Händen die Strümpfe herunter, stopfte sie in ihre Handtasche. »Meinst du, daß du mir das hinaufwerfen kannst …«
»Gib her, ich werde es versuchen.«





























