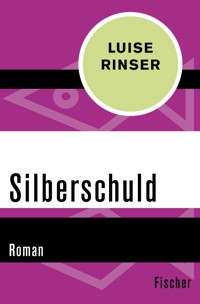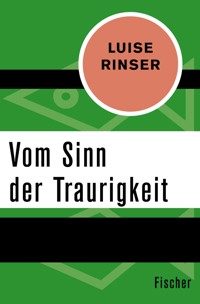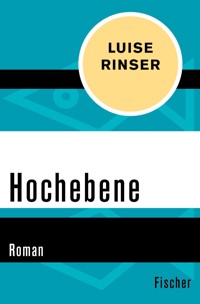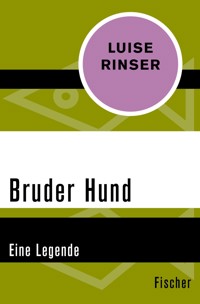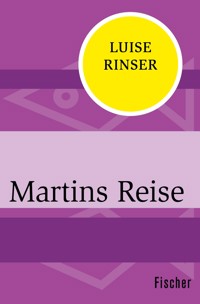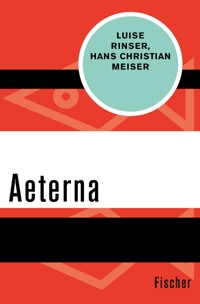
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ganze Menschheitsgeschichte, ein Urmythos, erneuert und erweitert im Spiel der Phantasie – ein spannender Roman. Eine Frau kehrt auf eine Insel zurück, auf der sie vor sehr langer Zeit, vielleicht in einem früheren Leben, gewohnt hat. Dort will sie eine uralte Felsenstadt wieder aufbauen, die nur noch sehr tief in ihrem Gedächtnis existiert. Sie begegnet einem Mann, der wortlos bereit ist, mit ihr zusammen dieses Gebäude aus Erinnerungen neu zu errichten. Auch sein Gedächtnis reicht Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück bis in die Zeit vor dem Ausbruch des Vulkans, der die Stadt verschüttet hat. Gemeinsam entdecken die beiden die Insel, ihre Geschichte, ihre Bewohner, ihre Geheimnisse. Sie versuchen Rätsel zu lösen und Orakel zu entschlüsseln, forschen in Höhlen nach der Vergangenheit und imaginieren eine Zukunft für die neu zu erbauende Stadt und ihre Menschen. Doch sie sind wieder von dem Vulkan bedroht: Die Insel, als ideale Welt erträumt, wird zur Falle. Liegt die Zukunft jenseits des Horizonts, in einem Land, das es noch zu finden gilt? (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Luise Rinser | Hans Christian Meiser
Aeterna
Über dieses Buch
Eine Frau kehrt auf eine Insel zurück, auf der sie vor sehr langer Zeit, vielleicht in einem früheren Leben, gewohnt hat. Dort will sie eine uralte Felsenstadt wieder aufbauen, die nur noch sehr tief in ihrem Gedächtnis existiert. Sie begegnet einem Mann, der wortlos bereit ist, mit ihr zusammen dieses Gebäude aus Erinnerungen neu zu errichten. Auch sein Gedächtnis reicht Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück bis in die Zeit vor dem Ausbruch des Vulkans, der die Stadt verschüttet hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Luise Rinser, 1911 in Pitzling in Oberbayern geboren, war eine der meistgelesenen und bedeutendsten deutschen Autorinnen nicht nur der Nachkriegszeit. Ihr erstes Buch, ›Die gläsernen Ringe‹, erschien 1941 bei S. Fischer. 1946 folgte ›Gefängnistagebuch‹, 1948 die Erzählung ›Jan Lobel aus Warschau‹. Danach die beiden Nina-Romane ›Mitte des Lebens‹ und ›Abenteuer der Tugend‹. Waches und aktives Interesse an menschlichen Schicksalen wie an politischen Ereignissen prägen vor allem ihre Tagebuchaufzeichnungen. 1981 erschien der erste Band der Autobiographie, ›Den Wolf umarmen‹. Spätere Romane: ›Der schwarze Esel‹ (1974), ›Mirjam‹ (1983), ›Silberschuld‹ (1987) und ›Abaelards Liebe‹ (1991). Der zweite Band der Autobiographie, ›Saturn auf der Sonne‹, erschien 1994. Luise Rinser erhielt zahlreiche Preise. Sie ist 2002 in München gestorben.
Hans Christian Meiser ist promovierter Philosoph, Psychologe und Publizist. Als Herausgeber, Übersetzer und Autor veröffentlichte er zahlreiche Werke. Zudem ist er als TV-Moderator und Filmemacher bekannt. Er lebt und arbeitet in München.
Impressum
Dieses E-Book ist der unveränderte digitale Reprint einer älteren Ausgabe.
Erschienen bei FISCHER Digital
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Copyright © by Christoph Rinser
Copyright © by Hans Christian Meiser
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Covergestaltung: buxdesign, München
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-561200-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Die Stadt auf der [...]
1
Als ich meinen kleinen, jetzt nicht mehr seetüchtigen Kahn vertäuen wollte, sah ich, dass der Bootssteg unter Wasser stand und die Ringe, an denen früher Schiffe angebunden waren, nun unter dem Wasserspiegel lagen. Sie waren verrostet, und an manchen hatten sich Krustentiere angesiedelt.
Weit und breit kein Mensch, mir zu helfen. So schürzte ich denn meinen Rock bis über die Hüfte, nahm mein Malgerät und watete durchs Wasser. Es war warm. Schwarzer Sand unter meinen Füßen. Vulkanischer Boden. Ich ließ mein Gepäck am Strand und ging einige Schritte bergauf. Dann rief ich.
Erinnerst du dich meines Rufes? Es war ein namenloser Ruf ins Leere. Keine Antwort. Auch kein Echo. War ich denn gottverlassen allein auf der Insel, dieser kleinen vulkanischen, felsigen Insel? Ich hatte Angst. Wie sollte ich hier in der Einsamkeit leben am Fuß des Vulkans? Ich rief noch einmal. Da kam eine Antwort. Ein lang hingezogener Ruf, der wie ein »Ja« klang. Tatsächlich hattest du, der Namenlose, mir Namenlosen dein Ja zugerufen. Auf welche Frage hattest du geantwortet mit deinem Ja?
Ich sah niemanden. Ich setzte mich auf einen der großen grauen Steinblöcke, die da über ein schräges Feld verstreut lagen, und wartete.
Aus diesen Steinen also wollte ich die kleine Felsenstadt wieder aufbauen, die ich zerstört vor mir sah in tausend großen und kleinen Brocken. Zerstört bis auf die Grundmauern. Zerstört nicht von vulkanischen Beben. Der Vulkan schlief seit langer Zeit. Die Trümmer, die auf dem Steinfeld lagen, waren jünger. Zerstört war das Städtchen durch Vergessen.
Was man vergisst, zerfällt zu Nichts. Dieses Felsennest war nicht völlig zu nichts als Staub geworden. Es lebte in meiner Erinnerung. Darum konnte ich es wieder aufbauen.
Aber ich allein konnte es nicht. Wo blieb der Mensch, der mir sein Ja zugerufen hatte? Wer war er? Ich wartete.
Während ich wartete, sah ich, dass die Insel einen Erosionsriss zeigte. Ich ging näher und stand schließlich am Rand einer Schlucht, die die Insel teilte. Wie tief war die Schlucht? Ich löste einen kleinen Stein und warf ihn in den Felsenriss. Der Stein fiel nicht senkrecht in die Tiefe. Er prallte von der Felswand ab und sprang auf die Gegenwand, und von dort wieder zurück, von Fels zu Fels, immer tiefer ins Dunkel. Und bei jedem Aufprall gab es einen Ton, und so reihte sich Ton an Ton, und der Fall nahm kein Ende, und die Töne fügten sich aneinander und gaben eine seltsam harmonische Reihe, und das Echo pflanzte sich fort, offenbar durch verborgene unterirdische Gänge, und es klang wie Musik.
Da warf noch jemand einen Stein, und die Musik verschlang sich mit der ersten und war schön. Da sah ich dich.
Du standest auf der anderen Seite der Schlucht. Ein Mann. Du machtest mir Zeichen, ich sollte ein wenig weiter bergauf gehen, dann deutetest du auf dich und machtest einige Gesten. Ich übersetzte: Ich gehe jetzt bergauf, da ist eine Stelle, an der die Schlucht so schmal ist, dass man sie überspringen kann. So liefen wir denn beide bergauf, jeder auf seiner Seite der Schlucht, und kamen uns immer näher. Und dann wagtest du den Sprung. Da waren wir also beisammen. Was sagten wir denn? Sprachen wir überhaupt? Musste ich dir nicht erklären, warum ich gerufen hatte?
Ich blieb bei der Zeichensprache. Ich deutete auf die herumliegenden Steine und machte die Gebärde des Bauens. Du sagtest etwas, und es war wieder »Ja«. Da stand es fest: Du wolltest mir helfen, die Felsenstadt wieder aufzubauen.
Wir standen uns gegenüber, und das Rauschen und Gluckern und Tönen in der Tiefe war laut. Dann gingen wir über das Trümmerfeld.
Du hobst etwas auf: ein Stück eines Rundbogens, und sagtest das erste Wort: Rosette. In der Tat: Es war ein Stück einer Stein-Rosette, die vielleicht von einer Kirche stammte. Du begannst sofort weiterzusuchen. Du hobst Stein um Stein. Ich sah, dass deine Hände stark waren wie die eines Baumeisters. Hatte ich mir nicht so einen gewünscht, einen mit solchen Händen?
Es gefiel mir, wie du über das Trümmerfeld gingst und dich da und dort bücktest und einen Stein aufhobst, ihn genau prüfend besahst und dann zur Seite legtest, wortlos, aber immer wieder mir zeigend, was da offenbar zum Bau brauchbar war. So bildete sich ein Mäuerchen auf einer Seite unseres Weges, der kein Weg war, sondern eine Art Ziegenpfad. Wir merkten aber bald, dass da unter dem Schutt eine Treppe lag, eine Treppe aus Sandsteinstufen, und dazwischen und daneben lagen Marmorschwellen, ausgetreten, sehr alt. Sie lagen so, dass man vermuten musste, es waren Schwellen zu Häusern, die nicht mehr standen.
Bisweilen klang es, als gingen wir über Hohlräume, vielleicht über unterirdische Gewölbe. Wir gingen vorsichtig, denn die Stufen lagen locker. Wir stiegen Schritt für Schritt hinunter zum Meer, woher ich gekommen war und wo mein Malgerät lag. Du warst erstaunt: eine Malerin hier allein auf der Insel? Weiter fragtest du nichts. Auch ich fragte nichts. Wir waren da, das genügte.
Wir fanden mein Malgerät unter grauschwarzem Staub, den der Seewind darüber geweht hatte. Du nahmst es auf und trugst es den Berg hinauf, wohin, das wussten wir nicht, aber ich erinnerte mich, eine Ruine gesehen zu haben, die uns vielleicht Unterschlupf gewähren würde. Auf halbem Weg wurde das unterirdische Rauschen lauter, und es schien, als sei dort eine Wasserscheide, ein Strom ging nach Süden, einer nach Osten. Wir hielten inne und horchten, und während wir horchten, wurde das Rauschen leiser und verstummte dann ganz. War das Wasser irgendwo anders hingeströmt? Hatte sich etwas im Berg-Innern verändert? Rührte sich der Vulkan?
Dann aber hobst du den Finger. Ein neuer Laut war zu hören. Kein Rauschen unterirdischen Wassers, sondern ein leises Tropfen wie aus einer Brunnenröhre. Und da war ein Brunnen, ein großer steingemauerter Trog, der einmal der Dorfbrunnen war, an dem man sich traf, Gespräche führte und Neuigkeiten austauschte. Das Wasser aus der Brunnenröhre, die keinen Rost angesetzt hatte, war klar. Wir tranken aus unseren Händen. Das Wasser war wunderbar kühl. Süßwasser. Wo war die Quelle?
Ich erinnerte mich: Hatte es hier nicht einen Baum gegeben, einen Feigenbaum, der sich über den Brunnen neigte und im Spätsommer Früchte gab? Da war der Baum. Die Früchte waren reif und saftig süß, grün und innen rosa. Wir aßen und tranken. Ein köstliches Mahl. Unser erstes gemeinsames. Saft und Wasser rannen über unsere heißen Gesichter. Auf einmal fühlten wir uns beobachtet. Auf dem Steinrand saßen zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, beide alt in alten Gewändern. Erinnerst du dich des seltsamen Gesprächs? Als die Frau fragte, ob wir vom Brunnen getrunken hatten und ob das Wasser salzig oder süß war, und als wir sagten, es sei süß gewesen, lächelten sie zufrieden. Dann arbeiten hier die Richtigen, sagte der Mann. Wer? Wer waren die Richtigen? Aber die Alten gaben keine Auskunft. Die Frau sagte: Ihr könnt hier schlafen. Als ob dies eine Herberge sei, dieser Brunnen. Aber wir waren so müde vom Steigen, dass wir einschliefen. Ich hörte noch, dass die Alten weggingen, aber so leise, dass kaum ein Steinchen rollte.
Als wir aufwachten, sahen wir einige Ziegen, die Wasser tranken, oder vielmehr die zur Tränke gekommen waren und uns beobachteten mit großen runden Augen. Du sagtest: Wo sind die beiden Alten? Ich sagte: Welche Alten? Die hast du geträumt. Du sagtest: Und du träumst wohl jetzt, dass sie zu Ziegen wurden?
Das war unser erster Streit. Bei unseren Streitigkeiten ging es oft um das, was ich Querträume nannte: Einer träumte von etwas, das wirklich war, und der andere behauptete, es sei geträumt.
Waren die Ziegen wirkliche Ziegen oder geträumte?
Sie tranken und gingen davon. Wir hörten das Geklingel der Glöckchen an ihrem Hals. Sie kletterten bergauf. Wo Ziegen waren, musste auch ein Hirte sein. Wir sahen ihn nicht.
2
Stille. Immer nur Stille. Stille seit Tausenden von Jahren. Oder waren es Hunderte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dein Ruf mich aus der Stille erweckte. Hatte ich geschlafen? Hatte ich geträumt? Nein, alles, was ich seit damals erlebt hatte, war Wirklichkeit gewesen, eine Wirklichkeit aber, in der sich nichts ereignete außer der Stille. Bis du mich riefst.
Als der Vulkan zum letzten Mal ausbrach, war ich kaum der Jugend entwachsen. Ich erinnere mich gut: Eines Morgens machte ich mich auf, an den Hängen des Kegels die Weinstöcke zu prüfen. Die Dämmerung hatte die Kälte der Nacht hinweggezogen. Ich spürte die erste Hitze des Tages. Heute aber kam sie mir verändert vor. Es war nicht die gewohnte Hitze der Sonne. Es schien, als würde sie direkt aus der Erde aufsteigen und die Luft in sich schlingen.
Da ahnte ich es: Bald würde der Vulkan Feuer speien. Aufgeregt stieg ich höher. Ich ließ die Reben hinter mir. Gebannt blickte ich zum Kegel empor, sah dort aber keinen Rauch. Offenbar stand ein Ausbruch nicht unmittelbar bevor.
Ich schickte mich an, den Kraterrand zu erreichen, um nachforschen zu können, ob Gefahr im Verzug war. Eigentlich war dies die Aufgabe meines Vaters, des Vulkanwächters, aber seitdem er von einem nächtlichen Fischfang nicht zurückgekehrt war, hatte der Ältestenrat mir diese Aufgabe übertragen, da ich schon als Kind von meinem Vater in die Geheimnisse des Berges eingeweiht worden war.
Ich blickte in den Krater, konnte aber feststellen, dass dort nichts geschah. Alles sah aus wie immer. Nur diese eigenartige Hitze. Ich konnte mir das nicht erklären. Vielleicht wollte der Vulkan an einer anderen Stelle ausbrechen. Vor vielen Jahren hatte er sich durch eine gewaltige Eruption einen zweiten Kegel geschaffen, auf der anderen Seite der Insel.
Ich lief in die Stadt zurück. Am Marktplatz stieß ich auf meine Mutter.
Wenn uns das Gleiche bevorsteht wie damals, sagte sie, dann müssen wir die Götter gnädig stimmen. Ich werde eine Ziege schlachten.
Es geschah nicht selten, dass Bitt- und Dankesopfer dargebracht wurden. Meist ließen die Götter sich besänftigen: Der Vulkan brach zwar aus, sein Blut aber verschonte die Stadt und rann ins Meer. Manche Bauern meinten, ein solches Ereignis bringe guten Boden für die Rebstöcke, andere indes fürchteten um ihr Weideland für die Tiere.
Am Abend, nachdem die Ziege geopfert war, traten die Ältesten zusammen und berieten, was zu unternehmen sei, falls der Berg tatsächlich Asche und Feuer speien würde. Man beschloss, zunächst abzuwarten, aber eine aus vielen Männern bestehende Vulkanwache aufzustellen, die – unter meiner Leitung – dafür zu sorgen hatte, jede Veränderung, die sich im Gestein oder in der Erde zeigen sollte, festzustellen und zu melden. Man musste so handeln, damit möglichst niemand zu Schaden kam. Natürlich hätte man bei einem Ausbruch auch auf das Meer fliehen können, aber was dann? Wohin hätte man segeln sollen?
Deshalb hatte man vorsorglich Fluchtwege rings um die Insel angelegt, sodass man stets zu dem Teil gelangen konnte, den der Berg verschonen würde. Auch waren die größten der vielen Höhlen, die sich am Bergkegel fanden, mit dem Notwendigsten ausgestattet worden. Es fand sich dort Holz zum Feuermachen, Getreide, gedörrtes Obst und getrockneter Fisch. Dazu Matten zum Liegen und gewebte Tücher gegen die Kälte der Nacht. Wasser floss aus unterirdischen Bächen.
Einmal erst hatte man von diesen Verstecken Gebrauch machen müssen, aber der Ältestenrat war stets darauf bedacht, für die Sicherheit der Inselbewohner zu sorgen, sodass es auch zu den Aufgaben meines Vaters – und nun zu den meinen – gehörte, den Zustand der Vorräte zu kontrollieren.
Tagelang geschah nichts. Die Bevölkerung war sich sicher, dass die Götter das Bittopfer angenommen und dem Berg zu schlafen befohlen hatten.
Eines Morgens stieg ich kurz vor Sonnenaufgang wieder zu einer der Höhlen, überprüfte die Vorräte und machte mich dann auf den Weg nach oben. Das Licht war eigenartig. Eher grau als rosa. Die Wolken bildeten einen Kranz um den Kegel, als wollten sie nicht preisgeben, was sich hinter ihnen verbarg.
Und dann geschah es: Ohne die geringste Ankündigung explodierte der Berg. Er spritzte seine Asche in die Luft, die so hoch stieg, als wollte sie den Himmel berühren. Immer mehr Asche trat hervor, begleitet von einem tiefen, schrecklichen Grollen. Es war, als würde sich das Innere der Erde erheben, um alles, was auf ihr lebte, zu verschlingen.
Das Speien nahm kein Ende. Die Welt verfinsterte sich. Die Asche regnete auf die Insel und deckte sie vollständig zu. Das Leben verlosch. Menschen und Tiere starben.
Jetzt warf der Berg riesige Steinbrocken in die Luft, schleuderte sie auf die Stadt, und alles Errichtete zerfiel zu Trümmern. Einige Bauern, die an den Hängen arbeiteten, hatten sich in eine der Höhlen retten können. Sie wussten, nun hatten sie ihre Stadt von neuem zu errichten. Sie taten es, so gut es ging, doch bald wurde auch die neue Stadt zerstört. Mit ihr starben die letzten Bewohner. So blieb niemand, der sich ihrer erinnerte.
All dies ereignete sich, lange bevor du mich riefst. Doch in den Zeiten zuvor war die Insel ein bedeutender Seehafen gewesen. Viele Kulturen hatten sich auf ihr niedergelassen. Es gab einen königlichen Palast, ein Stadion, Türme für die Wächter, Häuser für die Familien, Tempel, Theater und marmorgepflasterte Alleen. Man trieb Handel, baute groß und mächtig, legte Wert auf Erziehung und Kunst. Die Menschen, die hier lebten, waren glücklich. Sie achteten die Götter, gaben ihr Wissen von Generation zu Generation weiter und besangen ihr Dasein in schönen Liedern. Alle aber fürchteten den Vulkan.
Die vielen Völker verschwanden, wie sie gekommen waren. Sie töteten sich entweder gegenseitig oder wurden durch den Vulkan vernichtet. Aber ein jedes Volk trug die Hoffnung des Überlebens in sich. Wann immer die Stadt zerstört war, baute man sie wieder auf. Und ein jedes Volk war der Meinung, auf dem Höhepunkt der Geschichte zu stehen.
Als du mich riefst und deinen Stein in die Schlucht warfst, wusste ich, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, an dem das Vergessen ein Ende haben sollte. Du hast mich befreit aus dem Dunkel des Felsens, und freudig stieg ich empor, um zu sehen, wer da gerufen hatte. Als ich sah, dass du es warst, war ich sicher, dass ich nun bereit zu sein hatte. Ich lief zu dir. Und ich erkannte die Stelle wieder, an der die alte Stadt gestanden hatte.
3
Wir saßen und warteten. Da begann ich zu fragen. Woher warst du gekommen? Was ist auf der anderen Seite der Schlucht? Gibt es auch da Reste einer Stadt?
Du warst beschäftigt mit Sammeln und Sichten der Steine. Ohne dir etwas zu sagen, suchte ich den Übergang über die Schlucht. Zu springen wagte ich nicht. In der Tiefe rauschte und gurgelte das Wasser. Weiter bergauf fand ich eine Stelle, die schmal genug war, dass ich sie mit einem großen Schritt überqueren konnte.
Zuerst schien mir, als sei die andere Seite der Schlucht nicht anders als die, die wir schon kannten. Aber du kannst dir meine Überraschung vorstellen, als ich sah, dass der Berghang terrassiert war, freilich verwildert. Die Mäuerchen halb verfallen, die Pflöcke morsch. Weiter bergauf waren Spuren jüngerer Kulturen. Die Rebenschösslinge waren waagrecht angebunden. Zwischen den Blätterbüscheln hingen schon Trauben, viele Trauben, weiße und rote und dunkelviolette. Die weißen waren wie kleine Glaskugeln, man sah den grünen Kern. Die dunklen waren silbrig beschlagen. Ich pflückte von beiden. Viele von den dunklen waren ein wenig vertrocknet und ungemein süß. Ich aß Beere um Beere, abwechselnd die herberen hellen und die süßen dunklen. Allmählich fühlte ich mich müde, die Beine wurden mir schwer, und ich schlief ein zwischen Eidechsen und kleinen Vögeln.
Da kamst du und wecktest mich. Du packtest mich mit deiner rau gewordenen Hand und warst böse und schaltest mich: Wie konntest du mich allein lassen? Weißt du nicht, dass wir nur zusammen aufbauen können? Und außerdem bist du betrunken. Diese Trauben sind schon am Stock vergoren in dieser starken Wärme. Sie sind wie Wein.
Ich sagte: Versuch doch mal!
Da hast auch du gegessen, und dann schliefen wir beide ein im Rebenschatten. Weißt du noch, was wir träumten oder vielleicht auch nicht träumten?
Du sahst einen Weinbauern, krumm und krüppelig. Er weckte uns und sagte: Es ist gefährlich, hier zu schlafen. Man kann zu lange schlafen. Es gibt Verwandlungen. Der Berg schläft, aber die Wasser wachen. Geht zurück auf eure Seite. Er sagte es so befehlend, dass wir gehorchten. Der Mann war offenbar der Herr dieser Seite. Der Winzer, krumm und knorpelig wie seine alten Weinstöcke. Du sagtest: Das war der Weinbauer. Ich sagte: Ich sah nur einen Rebstock, aber der Rebstock hat gesprochen. Du meintest: Das hast du geträumt. Aber was du geträumt hast, ist wichtig. Wir dürfen hier nicht schlafen. Gehen wir.
Ich war verärgert. Warum sollten wir hier nicht sein dürfen? Der Alte hat doch nicht das Recht, uns fortzuweisen. Gehörte ihm denn der Weinberg, den er hatte verwildern lassen? Wer war er überhaupt? Hatte es ihn denn gegeben? Wir haben beide geträumt. Wo ist der Alte? Einfach verschwunden.
Aber die Terrassen waren noch da und der Geschmack der Trauben in unserem Mund und Flecken vom Rebensaft an unseren Händen.
Gehen wir, sagtest du. Wir haben anderes zu tun, als Trauben zu träumen.
Wir haben doch nicht geträumt.
Doch. Komm jetzt.
Wir übersprangen die Schlucht an der schmalsten Stelle. In der Tiefe rauschte das unsichtbare Wasser.
Auf unserer Seite der Schlucht war es uns weniger unheimlich. Du hattest schon angefangen, etwas zu bauen. Du hattest Steine aneinander gefügt. Es ging dir leicht von der Hand. Du fandest Steine, die schon einmal zu Mauern gefügt waren und ineinander passten. Schon stand eine kleine Mauer. Du sagtest: Das wird vorläufig unser Haus, wir bauen hier die Treppe, wir haben die alten Steinstufen, sie sind schön, und dann bauen wir einen Söller.
Einen Söller? Was für ein altmodisches Wort. Und noch dazu fehlt uns Holz für Dachbalken. Auf der Insel gibt es kein Holz außer Rebholz, und das ist unbrauchbar zum Bauen.
Wir saßen ratlos auf dem Brunnenrand.
Du sagtest: Die alten Häuser müssen Balken gehabt haben. Wo sind sie? Verbrannt? Da sind keine Brandspuren. Unter dem Schutt? Metertief verschüttet, wenn überhaupt noch vorhanden. Aber ohne Holz können wir nicht bauen.
Wer hatte mich auf die verlorene Insel gelockt? Wer mich gerufen hatte, musste wissen, wozu, und wenn er es wusste, musste er uns die Mittel geben, seinen Plan auszuführen. Wenn nicht … Waren wir Betrogene? Von einem leichtfertigen Träumer verführt? Wozu sollten wir eigentlich diese Stadt wieder aufbauen? Und so nah an einem Vulkan? So sinnlos …
Wir hörten leise Schritte, sahen aber noch niemand. Dann sagte eine tiefe Stimme etwas, was wir nicht verstanden. Die Stimme wiederholte die Worte. Jetzt war es vertrautes Latein. Es hieß: Ecce lignum. Die Stimme nahm Gestalt an. Ein Pope, unverkennbar im zerschlissenen entfärbten Gewand. Eine hohe schmale Gestalt. Sie lehnte sich an den Stamm des Feigenbaumes, der gewachsen und stärker geworden war. Der Pope sagte: Warum seid ihr so kleinmütig?
Du gabst Antwort, ich schwieg. Du sagtest aufsässig: Wo ist denn Bauholz? Wie soll ich den Auftrag erfüllen? Wer gab ihn uns überhaupt?
Der Pope schwieg. Ich fragte zögernd: Bist du der Herr der Insel? Er schwieg, aber er blieb. Worauf wartete er? Worauf warteten wir?
Schließlich sagte er: Beginnt zu bauen. Was ihr braucht, werdet ihr finden. Ecce lignum!
Er deutete auf die Schuttberge und Steinfelder. Holz sahen wir nicht. Er wiederholte: Beginnt! Und er verschwand.
Ich sagte: Nun also. Wenn der Pope sagt, hier sei Holz, muss es wohl da sein. Du sagtest: Ja, aber unter einem Berg von Schutt und Felsgestein. Wie sollen wir hier arbeiten? Wir haben nicht einmal Schaufel und Hacke.
Ich sagte: Wir haben Arme und Hände. Du lächeltest und sagtest: Wir haben noch etwas, wir haben Zeit.
Du meinst, wir haben eine Ewigkeit Zeit, um hier Holz auszugraben?
Ich begann zu weinen. Wäre ich doch nie auf diese Insel gekommen.
In diesem Augenblick sahen wir in einem kleinen Felsmassiv einen schmalen Riss, der sich etwas verbreiterte. Er war vorher nicht da gewesen. Wir hörten auch eine Art leisen Donners. Der Berg! Er sprach. Kündigte sich ein Beben an? Wir hatten Angst. Aus dem Spalt aber sahen wir ein Stück Bauwerk ragen. Ich sagte: Du hattest ja gleich nach deiner Ankunft einen Stein gefunden und sprachst dein erstes Wort: Rosette! Es war ein Stück der Einfassung eines runden Fensters, ein Stück einer Rosette aus dem Rückfenster einer Kirche, einer Kapelle. Wir brauchten unsere ganze Kraft und rissen uns die Hände wund. Schließlich ließ sich das Stück herausheben. Wir hatten das fehlende Stück der Rosette. Und wir hatten noch mehr: ein kleines Stück eines Holzbalkens. Eine schöne Beute. Doch was half uns das Stück Holz, nicht länger und nicht dicker als ein Arm. Aber immerhin: Ecce lignum. Plötzlich hatte ich eine Eingebung: Wer dies gesagt hatte, war ein Pope. Wollte er nicht eigentlich sagen: Ecce lignum crucis? Meinte er, wir sollten ihm seine verfallene Kirche wieder aufbauen? Würde er uns dabei helfen auf geheimnisvolle Weise? Ich sagte es dir. Du schautest mich zornig an. Als ob, sagtest du, die Kirche das Wichtigste hier sei! Wir brauchen zuerst Häuser. Wir brauchen eine anständige Herberge, keine Kirche. Ich sagte: Die Kirche ist auch eine Herberge. Für wen?, fragtest du. Vielleicht für Engel oder für den Popen, wir aber sind Menschen und brauchen Menschenhäuser! Nun gut, wenn wir hier wirklich Holz finden, bauen wir eine Kapelle.
Zunächst, sagte ich, brauchen wir doch kein Holz. Wir bauen Mauern aus Stein.
Du warst verärgert. Du sagtest: Du hast keine Ahnung vom Bauen. Das überlasse mir. Ja, sagte ich, nun auch gereizt, und du glaubst, ohne meine Hilfe auszukommen. Baue du nur, ich gehe. Da erschrakst du und batest: Bleib, wir bauen zusammen. Wie aber bauen? Wir legten Stein an Stein, Stein auf Stein. Die Steine fügten sich willig aneinander. Die Mauer wuchs wie Lebendes wächst. Als sie höher war als wir, sagtest du: Aber wir brauchen einen Turm, jede Kirche hat einen Turm. Ich sagte: Nein, das stimmt nicht; es gibt Kirchen ohne Turm und Türme ohne Kirche. Willst du wirklich einen Turm? Natürlich, sagtest du. Ich sagte: Ich will aber keinen Turm; Türme sind gewalttätig und streben von der Erde weg, wir aber gehören zur Erde. Genügt es nicht, dass der Berg hoch und steil ist und drohend? Wir wollen hier wohnen, hier und nicht irgendwo oben. Ich will eine gewölbte Decke, die uns Geborgenheit gibt. Du mochtest keinen Widerspruch. Am liebsten, sagtest du, würdest du ja in einer Höhle wohnen.
Ja, sagte ich, ich möchte in einer Höhle wohnen, wenngleich auch sie keine Geborgenheit gibt. Vergiss nicht: Der Berg lebt und die Höhle ist in ihm und nah am Feuer. Dennoch will ich keinen Turm; er spricht zu laut von unserem Willen, er spricht wie ein Mann, der hoch hinauswill, höher, als gut ist. Keinen Turm also. Was dann, fragtest du unsicher. Ich zeigte dir mit Armen und Händen, was ich wollte: eine sanft gewölbte Decke. Da lachtest du höhnisch: Ja, sanft gewölbt wie der Bauch einer Schwangeren, die nichts weiter will als auf gleicher Ebene gebären; nur nicht höher hinaus, nur nicht den Zorn des Berges riskieren. Höre: das ist mir zu weiblich. Ich sagte: Als ob Gebären kein Risiko wäre! Aber bau du nur deinen Turm, ich gehe und suche mir eine Höhle, ich brauche dich nicht. So geh!, sagtest du, und ich ging bergauf, wo es Höhlen gab. Aber du liefst mir nach. Bleib, bitte, sagtest du; es ist Gesetz, dass wir nur zu zweit bauen können. Ich kam also zurück. Und dann schauten wir uns erstaunt an. Warum wollten wir überhaupt eine Kirche? Ich glaubte an eine kosmische Kraft, in deren Feld ich mich geborgen fühlte, auch wenn sie mir bisweilen Angst einflößte ihrer Unbegreiflichkeit und Unendlichkeit wegen. Also: wozu eine Kirche? Für den Popen? Oder einfach, weil hier einmal eine Kirche gewesen war, und zuvor wohl Älteres, Uraltes, Heiliges? Jedenfalls ein magischer Ort.
Er hielt uns fest. Die magische Stelle. War sie der Punkt, an dem das vulkanische Feuer am nächsten war? Aber dann war diese Stelle die gefährlichste. Oder war sie der Ort des Segens? Hatte hier nicht die alte Kirche gestanden? War da nicht gebetet worden? War da nicht die göttliche Kraft gefunden worden und also Hilfe? Sollten wir nicht diesen Ort wieder beleben und dann rings um ihn die Häuser für Menschen aufbauen?
Wir zögerten lange. Und wieder tauchte die Frage auf: Sollten wir eine Kirche mit einem Turm bauen? Rief der Turm nicht nach Hilfe von oben? Woher? Wo war ein Helfer? Und wozu Hilfe? Waren wir nicht stark genug, wenn wir die Kräfte aus der feurigen Tiefe bekamen?
Wir setzten uns auf den Brunnenrand. Plötzlich plätscherte das Wasser lauter und kam in hellen Stößen, und eine Stimme sagte: Was sorgt und streitet ihr? Baut einen Rundturm mit Zinnen. Baut nicht hoch, baut menschenhoch.
Auf der anderen Seite der Zisterne saß eine Frau, nicht alt, nicht jung. Sie trug einen blauen Mantel. Die einzige Farbe in all dem Grau der Steinwelt. Sie sprach freundlich. Sie wandte sich an mich, sie sagte: Du hast mich gerufen.
Nein, ich habe nicht gerufen.
Doch, und hier bin ich.
Und wer bist du, fragte ich. Sie sagte: Ich bin die alte Lehrerin.
Ich sagte: Erstens bist du nicht alt, und zweitens: Wer sind deine Schüler?
Sie sagte: Ihr beide, und das genügt. Ihr seid dickköpfige Schüler. Ihr streitet, statt zu bauen.
Ich sagte: Er streitet. Ich war eher da, dann kam er und will einen Turm und eine Kirche.
Ihr seid verwirrt. Ihr wollt beide ein Rathaus, ein Haus des guten Rates, wo ihr euch trefft und beratet, ihr und die anderen.
Welche anderen?
Sie werden kommen, und sie werden bauen helfen. Seht, da kommen die Ersten. Es sind nicht die Einzigen. Diese da sind Zimmerleute. Sie schaffen Holz herbei.
Du sagtest: Wir kommen ohne sie aus, und Holz holen wir uns vom alten Weinberg.
Sie sagte: Das ist kein Bauholz. Ihr braucht Balken, und die liegen unterm Schutt, und ihr wisst, dass ihr sie nicht heben könnt. Du lerne die Demut. Lass dir helfen.
Schon kamen die Arbeiter an, kräftige Männer, und sie packten sofort zu. Sie gruben den Schutt auf und legten Holzbalken frei. Sie arbeiteten stumm, und alles ging ihnen leicht von der Hand. Sie zogen die Balken ans Licht.
Du sagtest: Eichenholz. Eingekerbte Zeichen. Zahlen. Wörter. Uralt. In welcher Sprache? Unleserlich. Geheim.
Ich sagte: Botschaften. Man braucht den Schlüssel. Wer kennt ihn?
Niemand.
Geduld. Wir werden ihn finden.
Vielleicht nie. Vielleicht dürfen wir ihn nicht finden, und die Botschaft ist geheim.
Wir finden ihn.
Nie.
Ich sagte zu der Frau im blauen Mantel: Er hat keine Geduld, und er widerspricht mir immer und grundsätzlich.
Die Frau sagte: Und du widersprichst ihm. Wer hat Recht? Hat einer Recht? Hat keiner Recht? Die Frau hat das ältere Wissen, sie kam vom Meer, sie entstieg dem Wasser, sie hat die Worte der Urmutter im Ohr.
Du wurdest zornig. Leicht wurdest du zornig. So, riefst du. Und ich, der Mann, wer bin ich? Ich komme vom Berg. Ich kenne die Botschaft des Steines und des Feuers.
Die blau gekleidete Frau sagte: Du kamst zum Wasser und brachtest deine Botschaft vom Feuer und vom Stein. Und ihr vereint euer Wissen. Ihr beide zusammen habt Recht. Also streitet nicht. Hört ihr, was der Berg sagt?
Wir hörten ein leises Grollen. Was sagt das Feuer? Ich rief: Ich habe Angst. Ein schlafender Vulkan schläft nicht wirklich. Ich fürchte mich vor dem Feuer. Die Frau sagte: Es ist gut, Furcht zu haben. Furcht ist Ehrfurcht. Stein und Feuer sind Verbündete.