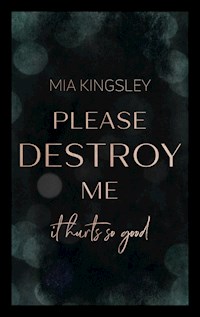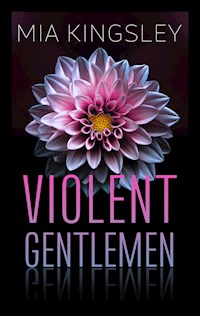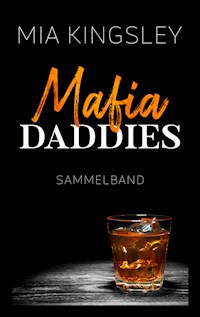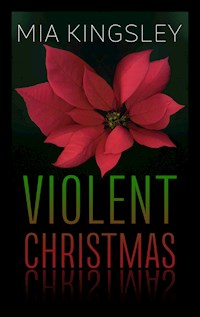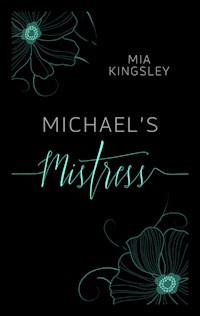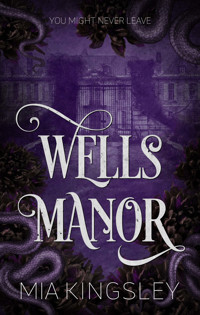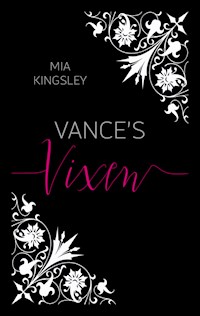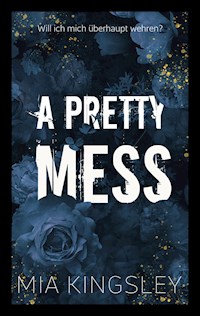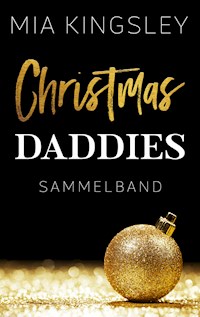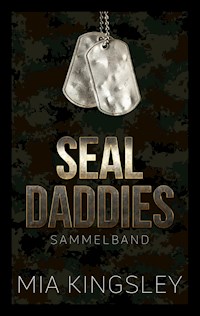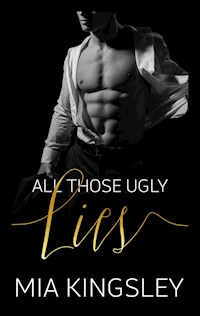
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Brave Mädchen sind bloß böse Mädchen, die noch nicht erwischt wurden. Eigentlich wollte ich mich von meinem Verlobten trennen, stattdessen habe ich ihn mit 37 Messerstichen getötet. Auf den ersten Blick mag die blutige Klinge in meiner Hand ein schlechtes Licht auf mich werfen, aber ich schwöre, dass ich einen wirklich guten Grund hatte – wahrscheinlich sollte ich den Rest der Geschichte erzählen. Doch ich habe ein dringenderes Problem: einen Zeugen. Es ist ausgerechnet der Mann, der dafür bezahlt wurde, meine Leiche verschwinden zu lassen … "All Those Ugly Lies" erschien zuerst Ende 2017 als Blogroman auf Mias Homepage. Für die Buch-Ausgabe wurde die Story um zwei Bonus-Geschichten ergänzt. Insgesamt 360 Taschenbuch-Seiten. Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 4 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sprecher:Kai SchulzEni WinterLaura Sophie HelbigHagen WinterfelsChristopher KussinLiv Johansen
Ähnliche
ALL THOSE UGLY LIES
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
Copyright: Mia Kingsley, 2017, Deutschland.
Coverfoto: © tverdohlib – fotolia.de
Korrektorat: Laura Gosemann
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
I. All Those Ugly Lies
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
II. Tempted – Cosette & Murphy
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
III. Trapped – Lina & Jack
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
ALL THOSE UGLY LIES
KAPITEL1
SADIE
Er hob die Hände, als ich begann, heftiger an den Fesseln zu zerren. »Ich glaube, es reicht jetzt.«
»Schlag mich noch mal!«
»Du blutest schon. Das ist genug. Wirklich.«
Zwischen den Zähnen presste ich hervor: »Noch mal! Verdammt, Palmer, jetzt stell dich nicht so an.«
Er wich vor mir zurück. »Hast du eine Ahnung, wie schwer das für mich ist?«
»Sonst hast du doch auch keine Hemmungen.«
»Sag mal, spinnst du? Dir den Arsch beim Sex zu versohlen ist wohl kaum das Gleiche, wie dir mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.«
»Okay, du hast recht. Sorry. Mach mich los.«
Die Erleichterung zeichnete sich in seiner Miene ab. Er kniete sich vor mich und löste die Knoten in den schwarzen Seilen. »Das sieht übel aus. Bist du sicher, dass du keine Salbe willst?«
Ich rollte mit den Augen. »Mein Entführer würde sich wohl kaum die Zeit nehmen, mich ordentlich zu versorgen, oder?«
Palmer zuckte mit den Achseln, und ich stand auf. Langsam drehte ich den Kopf. Während ich mein Spiegelbild begutachtete, prickelte die Aufregung in meiner Magengegend.
»Es ist nicht überzeugend«, sagte ich und drehte mich um. Mit den Händen umklammerte ich den Rand des Waschbeckens hinter meinem Rücken. »Du musst mich noch einmal schlagen.«
»Du übertreibst.« Palmer verschränkte die Arme, als hätte er Angst, mich unfreiwillig zu attackieren, wenn er seine Fäuste nicht verbarg.
»Bitte«, flehte ich und stieß mich vom Waschtisch ab. Ich streichelte seine Wange, fühlte das Kratzen der dunklen Barthaare in meiner Handfläche. »Bitte. Mein Leben hängt davon ab. Wenn sie es mir nicht abkaufen …«
Palmer wandte sich ab und verließ das Badezimmer. Ich lief ihm hinterher, packte seinen Arm und wollte zu betteln beginnen. Bevor ich es kommen sah, schlug er mir ins Gesicht.
Ich strauchelte und sackte kurz weg. »Autsch.«
Er umfasst meine Schultern und stützte mich. »Ist es sehr schlimm?« Die Qual in seiner Stimme war kaum zu überhören. »Es tut mir so leid.«
»Alles gut. Eine Warnung wäre nur schön gewesen.«
»Ich konnte einfach nicht, während du mich so angestarrt hast. Willst du dich nicht wenigstens revanchieren?«
»Nein. Du brauchst keine Absolution von mir, Palmer. Du hast gemacht, worum ich dich gebeten habe. Keine Sorge.«
Er setzte sich auf das Sofa und stützte den Kopf in beide Hände. »Mir gefällt das nicht.«
Vorsichtig ließ ich mich vor ihm auf die Knie nieder und drückte seinen Oberschenkel. »Ich muss die Wahrheit wissen. Es würde mich sonst auffressen.«
»Und wenn dir was passiert?«
»Mir wird nichts passieren. Ich bin nicht dumm, und in spätestens vier oder fünf Tagen bist du bei mir. Alles wird gut.«
Er strich über mein Haar, beugte sich vor und küsste meinen Scheitel. »Du bist verrückt.«
»Ich weiß.« Mit diesen Worten erhob ich mich wieder und nahm den Stapel Klamotten vom Tisch. Es waren die Sachen, die ich bei meiner Ankunft getragen hatte. Da sie blutig und verdreckt waren, verspürte ich nicht die geringste Lust, sie anzuziehen, doch es musste sein.
Palmer ließ mich nicht aus den Augen, als ich mich auszog und in meine alte Kleidung schlüpfte. Er schüttelte den Kopf. »Du siehst grauenvoll aus.«
»Danke.« Ich versuchte, ihn anzulächeln, aber mein Gesicht schmerzte inzwischen zu sehr. Unsicher sah ich an mir hinunter. »Ist es überzeugend?«
»Ich hasse mich, weil ich dafür verantwortlich bin, obwohl ich die Gründe kenne. Ja, es ist definitiv überzeugend genug.«
»Dann lass uns fahren.«
Mit einem letzten Blick auf mich erhob er sich und nahm die Schlüssel von dem kleinen Brett neben der Eingangstür. »Mir ist nicht wohl dabei.«
»Ich kann auch laufen.«
Er gab ein leises Knurren von sich. »Du weißt genau, dass ich das nicht gemeint habe.«
»Lass es uns einfach hinter uns bringen. Ich lechze schon jetzt nach einer Schmerztablette – oder besser einer ganzen Packung.«
Wir schwiegen, als wir ins Auto stiegen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und Palmer schien zu angespannt zu sein.
»Danke«, sagte ich nach einer Weile.
»Nicht«, bat er. Seine Fingerknöchel traten weiß hervor, weil er das Lenkrad umklammerte. »Das lässt es so endgültig klingen. Bisher habe ich nicht viel für dich getan, und es ist noch nicht vorbei. Bedank dich, wenn du weißt, was du wissen wolltest.«
»Einverstanden.«
Mein Magen krampfte sich zusammen, da das Valley langsam in Sicht kam. »Bieg hier rechts ab. In den kleinen Waldweg.«
»Sicher?«
»Ich kenne das Gebiet besser als das Innere meines Kleiderschranks. Ganz sicher. Wenn ich direkt geradeaus hinunterlaufe, bin ich in weniger als dreißig Sekunden auf dem Grundstück meiner Familie. Irgendjemand wird mich finden.«
»Zum letzten Mal möchte ich meinen Protest ausdrücken, Sadie.« Er wollte nach mir greifen, doch seine Hände verharrten in der Luft. Mein Gesicht war blutig und zugeschwollen, die Kleidung zerrissen und starr vor Schmutz und Blut.
»Und ich nehme ihn zur Kenntnis. Versprich mir, dass du mich rettest.«
»Natürlich. Fünf Tage – genau wie wir es abgesprochen haben.«
»Ich würde dich gern küssen«, sagte ich.
»Aber deine Lippe«, erwiderte er.
»Meinst du, es muss genäht werden?«
»Um Himmels willen. Ich hoffe nicht. Wie soll ich heute Nacht eigentlich schlafen?«
»Mach’s dir selbst und denk an mich.«
Er grinste. »Du bist unmöglich.«
»Ich weiß. Bis später, Palmer.«
»Bis später, Sadie. Du weißt, wo du mich findest, wenn irgendwas ist.«
Ich nickte, kletterte aus dem Wagen und lief in den Wald. Ohne darauf zu achten, wo ich hintrat, rannte ich los. Bewusst sah ich nicht auf den Boden, sodass es nur wenige Augenblicke dauerte, bis ich mit dem Fuß in einer Wurzel oder ähnlichem hängen blieb und der Länge nach auf den Waldboden krachte.
Ich schmeckte Erde im Mund, spürte Dreck unter meinen Fingern und das Brennen auf meiner Stirn, wo ich mir den Kopf angeschlagen hatte.
Perfekt, dachte ich. Jetzt wirkte ich wirklich wie ein Opfer auf der Flucht. Ich rappelte mich hoch und machte keine Anstalten, den Schmutz abzuklopfen. Stattdessen schaute ich in den Himmel, um mich zu orientieren.
Am Stand der Sonne konnte ich ablesen, in welche Richtung ich gehen musste. Das war es, was mich am wütendsten machte. Ich war immer zurechtgekommen und nie schwach oder gutgläubig gewesen. Insgeheim hatte ich mich für stark, klug und selbstbewusst gehalten. Niemals für das Opfer. Deshalb war mir nach wie vor nicht klar, wie ich in diese Situation geraten war. Ich vertraute niemandem leichtfertig und hatte stets alles im Blick – oder zumindest hatte ich es gedacht.
Bald erreichte ich den Rand des Waldstücks, vor mir erstreckte sich das Valley. Sehnsucht durchfuhr mich. Mein Zuhause.
Ein leichtes Lüftchen wehte, und es war nicht zu warm. Durch die diversen Risse in meinem Shirt spürte ich den Wind auf meiner Haut und erschauerte trotz der frühlingshaften Temperaturen.
Mein Herz begann schneller zu klopfen. Jetzt oder nie.
Ein weiteres Mal rannte ich los, das Ziel klar vor Augen. »Hilfe«, brüllte ich. »Hilfe!« Meine Lunge brannte vom Rennen und dem lauten Kreischen.
Aus dem Augenwinkel bemerkte ich eine Bewegung. Haar, so dunkelblond wie meins, darunter befanden sich Augen, grün wie meine.
Meine Mutter ließ fallen, was immer sie in den Händen gehabt hatte, sprintete los und rief den Namen meines Vaters: »Jason!« Ihre Stimme bewegte sich zwischen Panik und Euphorie. »Jason! Sadie ist hier. Sadie ist hier!«
Es krachte laut, als die Tür zum Keller aufflog und mein Vater ins Freie trat. Schwarze Haare, graue Schläfen und ein zynisches Lächeln um die Lippen, so hatte ich ihn in Erinnerung – nur dass er gerade nicht lächelte, sondern vollkommen fassungslos aussah.
Plagte ihn ein schlechtes Gewissen?
Wusste er, wo ich eigentlich hätte sein sollen?
Abrupt blieb ich stehen und hob die Arme. »Nicht anfassen.«
»Liebling«, keuchte meine Mum außer Atem. »Liebling. Geht es dir gut?«
Sie kam auf mich zu, und ich wich zurück. »Nicht anfassen. Wer sind Sie?«
Ihre Miene gefror. »Sadie, Liebling, ich bin deine Mutter.«
»Carol? Carol, was ist?«, wollte Dad wissen. Er war noch ein Stück entfernt.
Ich schüttelte den Kopf und trat zwei weitere Schritte zurück. »Nein. Ich … Ich kenne Sie nicht«, stotterte ich. Egal was es mich kostete, ich musste überzeugend sein.
Mein Dad kam knapp einen Meter vor mir zum Stehen. »Großer Gott! Sadie, du bist zurück.« Er wollte die Hand ausstrecken, doch ich täuschte vor zusammenzuzucken, und er ließ sie sinken. »Was ist passiert?«
Ich riss die Augen auf, bis ich Tränen spürte. »Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.«
Meine Eltern tauschten einen Blick.
»Sadie«, fragte meine Mutter sanft. »An was kannst du dich erinnern?«
Ich reagierte nicht, bis sie meinen Namen erneut sagte. Überrascht hob ich den Blick, als wäre mir nicht klar, wer Sadie war.
»Carol, ich glaube, sie hat ihr Gedächtnis verloren.« Mein Vater berührte meine Mutter am Arm. Sie sahen sich an, und ich hätte zu gern gewusst, was in ihren Köpfen vorging.
»Wo kommst du her?«, wollte Mum wissen.
Ich deutete über meine Schulter in den Wald.
Sie runzelte die Stirn. »Aber da kannst du nicht die ganze Zeit gewesen sein.«
Die erste Träne lief über meine Wange, und ich zuckte mit den Achseln. »Ich weiß es nicht.«
»Carol, ruf einen Krankenwagen. Wir müssen sie ins Haus bringen. Selbst wenn sie sich jetzt nicht erinnert, ist sie wenigstens wieder hier. Alles andere wird sich schon finden.«
Ohne sich um meinen verhaltenen Protest zu kümmern, legte mein Vater einen Arm um mich und führte mich durch die lange Reihe Weinreben. Ich wäre fast geneigt gewesen, ihm den fürsorglichen Dad abzukaufen.
»War ich weg?«, fragte ich.
Meine Mutter schlug die Hand vor den Mund und schluckte ein paar Mal, bevor sie mir antworten konnte. »Oh, Sadie, du bist vor drei Monaten entführt worden.«
»Das kann nicht sein«, gab ich zurück. »Daran könnte ich mich doch erinnern. Oder nicht?« Ich achtete darauf, am Ende des Satzes flehend zu klingen.
Mum presste kurz die Augen zusammen, während Dad seine Schritte beschleunigte. »Kannst du dich an gar nichts erinnern, Sadie?«
»Nein. Ich bin im Wald gestürzt.«
Er musterte mich. »Und was hast du im Wald gemacht?«
Ich sah nach unten auf meine verschmutzten Hände und murmelte: »Das weiß ich nicht.«
»Jetzt verhör sie nicht so, Jason. Siehst du nicht, wie durcheinander sie ist? Wir rufen einen Arzt und den Detective an. Wenn sie sich gesammelt hat, wird sie sich schon erinnern.« Dazu lächelte sie mich aufmunternd an.
Obwohl es mir schwerfiel, hob ich meine Mundwinkel, als würde ich ihr Lächeln erwidern wollen. Ich nahm zur Kenntnis, dass die Reben wunderbar aussahen, äußerte mich aber nicht dazu, um mich nicht zu verraten.
Das Wohnhaus kam in Sicht, und mein Herz schlug unwillkürlich schneller. Etwas mehr als drei Monate war es her, dass ich zum letzten Mal hier gewesen war. Das dunkel gedeckte Dach und die hell gestrichenen Außenwände hatten sich selbstverständlich nicht verändert. Der Rasen war akkurat gemäht worden und die Blumen gegossen. Bisher gab es noch keine Prognosen für eine Dürre in diesem Jahr. Das war ungewöhnlich, allerdings hatte ich im Moment ganz andere Sorgen.
Ich folgte meiner Mum in die Küche, ging allerdings viel langsamer als sie. Immerhin versuchte ich vorzugeben, mich an nichts erinnern zu können. Woher sollte ich also wissen, wo ich hin musste? Meine Eltern sahen sich an, als ich über die kleine Erhebung am Fuß der Treppe stolperte, die nach oben ins Haus führte.
Es roch wie immer. Bevor ich Zeit hatte, die Umgebung auf mich wirken zu lassen, fluchte mein Vater leise. Er schaute zur Wand, und ich folgte seinem Blick.
Ein Schauer lief über meinen Rücken, weil sie eine Art Schrein für mich errichtet hatten. Jeder freie Zentimeter war mit Zeitungsausschnitten bedeckt. Jede Überschrift war reißerischer als die vorherige, und in der Mitte hing mein Foto in Schwarz-Weiß auf einer Vermisstenanzeige. Im Grunde hatte ich einen Heiligenschein aus Schlagzeilen.
Weinberg-Erbin entführt – Verlobter ermordet
Leiche in Hotel gefunden – Verlobte entführt
Keine neue Spur im Fall der Vermissten Sadie Eadric
Polizei tappt im Dunkeln – Sadie Eadric vermisst, Mathis Fournier tot
Örtlicher Weinhändler mit 37 Messerstichen getötet
Mein Vater griff nach meinem Arm, doch ich machte mich los und überflog ein paar der Artikel, bis ich an dem größten Ausschnitt hängen blieb. Der Text umrahmte das Verlobungsbild von Mathis und mir.
»Was für ein ungewöhnlicher Name«, murmelte ich.
Mum strich mir über den Rücken. »Es tut mir so leid.«
»Was?«
»Dass er tot ist, Liebling.«
»Oh«, machte ich. »Ich kann mich nicht an ihn erinnern.«
»Gar nicht?«
Mein Vater gab ein unwilliges Geräusch von sich. »So funktioniert Amnesie nun einmal, Carol. Vielleicht ist es sogar besser, wenn sie sich nicht erinnert.«
Ich konnte den Ton in seiner Stimme nicht genau deuten. War es sein väterlicher Instinkt, der mich vor grauenvollen Gefühlen schützen wollte – oder steckte etwas anderes dahinter? Ich sah ihn nicht an, sondern konzentrierte mich auf die Artikel. Dabei konnte ich förmlich sehen, wie Mum am Küchentisch saß und mit der großen Schere die Zeitung sorgfältig auseinanderschnitt. Dad war eher der Typ, der sich solche Informationen elektronisch in seinem Handy speicherte.
»Ich rufe den Detective an.« Er verließ den Raum.
Wahrscheinlich sollte ich das Gespräch nicht hören, denn er hatte sein Handy eigentlich immer in der Hosentasche, womit er keinen Grund gehabt hätte, woanders hinzugehen.
Ich strich die Ecke eines Zeitungsartikels über Mathis glatt, damit ich ihn lesen konnte.
Mum seufzte. »Mathis war Frankokanadier. Er hat dich sehr geliebt.«
Nein. Hat er nicht.
»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll«, gab ich zurück.
Sie dachte nach. »Ich kann ein Fotoalbum holen. Vielleicht regt es deine Erinnerung an.«
»Kann ich ein Glas Wasser haben? Ich glaube, ich muss mich setzen.«
»Natürlich. Entschuldige.«
Bevor ich an dem schweren Holztisch Platz nahm, von dem meine Oma immer gern erzählt hatte, dass mein Großvater ihn selbst gezimmert hatte, kehrte mein Vater zurück.
»Detective Halverston sagt, dass wir sie direkt ins Krankenhaus bringen sollen. Er wird uns dort treffen. Sie müssen Sadie auf mögliche Spuren untersuchen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
Meine Eltern schauten mich an, als hätte ich verkündet, meine Hausaufgaben nicht machen zu wollen. Mum versuchte, meinen Rücken zu tätscheln. Ich wich ihr aus. »Kein Krankenhaus. Ich mag keine Krankenhäuser.«
»Das stimmt nicht«, widersprach mein Vater. »Du hattest nie Angst vor Krankenhäusern und Ärzten.«
»Ich will nicht.«
»Vielleicht können wir noch einmal mit Detective Halverston sprechen?« Meine Mutter sah meinen Vater an.
Dad schüttelte den Kopf. »Nein. Selbst wenn er nicht darum gebeten hätte, dass wir sie hinbringen, hätte ich darauf bestanden. Ein Arzt muss sie sich ansehen. Was ist, wenn sie eine Gehirnerschütterung hat? Außerdem sieht die Platzwunde übel aus.«
Ehrlich gesagt fühlte sie sich auch grauenvoll an, doch das behielt ich für mich. »Mir geht es gut«, beteuerte ich.
»Liebling, dein Vater hat recht. Wir fahren dich ins Krankenhaus. Es ist nicht weit, und du wirst sicher bevorzugt behandelt.«
Dad legte die Hand auf meinen unteren Rücken und schob mich vorwärts. Mir blieb nichts anderes übrig, als mich zu fügen.
Meine Mutter überließ mir den Beifahrersitz und stieg hinten ein, während mein Vater die Fahrertür öffnete. Wir schwiegen fast die ganze Fahrt, bis ich fragte: »Wo sind wir?«
»Im Napa Valley in Kalifornien.«
»Welcher Tag ist heute?«
»Dienstag«, sagte Mum.
»Und ihr seid wirklich meine Eltern?«
Mein Vater schnaufte. »Warum sollten wir lügen?«
Ich schaute aus dem Fenster. Wir passierten Coben Estate, unseren größten Konkurrenten. Der Besitzer Terry blickte kurz auf, als wir vorbeifuhren, da er mit einem Paketboten vor dem Tor stand. Sein Blick glitt über mich, und ich sah deutlich, wie er die Augen aufriss.
Ja, ich bin zurück.
»Wer ist das?«
»Unser Nachbar.«
»Wie war mein Name noch gleich?«
»Sadie.«
»Sadie«, wiederholte ich. »Wie alt bin ich?«
Dad presste die Lippen aufeinander, und Mum antwortete vom Rücksitz: »Du bist vor zwei Wochen 26 geworden.« Dazu drückte sie meine Schulter. »Vielleicht essen wir nachher ein bisschen Kuchen.«
»Das klingt nett.«
Mein Vater presste die Lippen aufeinander und schnaubte, ehe er fragte: »Nett? Wo zum Teufel warst du, Sadie? Wir haben uns Sorgen gemacht.« Ich hatte darauf gewartet, dass er aufbrauste, denn so war er nun einmal: aufbrausend, laut und herrisch – nicht direkt ein Tyrann, aber viel fehlte dazu nicht.
»Sie kann sich nicht erinnern, Jason«, warf Mum ein. Wie immer, wenn Dad so war, benutzte sie den sanftesten Tonfall, zu dem sie fähig war.
Er atmete durch. »Ich weiß. Es tut mir leid. Ich … Es ist nur so schwer begreiflich. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Schatz.«
Ich schwieg. Interessant, dass er mich in meinem ganzen Leben vorher kein einziges Mal Schatz genannt hatte.
Seit Grandmas Tod vor sieben Jahren war ich nicht mehr im Sheffield Hospital gewesen. Als wir hielten, stieß sich ein Mann von der Wand neben dem Eingang ab und kam auf das Auto zu.
Offensichtlich erkannte er meine Eltern. Ob es Detective Halverston war?
Irgendwie hatte ich mir unter dem Namen einen Mann im mittleren Alter mit zurückgehendem Haaransatz und einem leichten Bierbauch vorgestellt.
Er öffnete die Autotür und wartete, bis ich ausgestiegen war.
Seine dunkle Stimme jagte einen Schauer über meinen Rücken. »Sadie«, sagte er und hielt mir die Hand hin. »Ich bin Detective Jack Halverston. Dein Vater berichtete mir, dass du dein Gedächtnis verloren hast.«
Eher zögerlich nickte ich.
»Du musst dich nicht anstrengen. Wir kennen uns nicht, du kannst dich also nicht an mich erinnern – egal wie sehr du es versuchst.«
Ich war beruhigt, dass er meinen forschenden Blick missinterpretierte. Mir war nicht aufgefallen, wie sehr ich ihn angestarrt hatte. Äußerlich war Jack Halverston bis auf das Alter das genaue Gegenteil von Palmer, was ihn nicht weniger attraktiv machte. Ich schätzte ihn auf Anfang bis maximal Mitte dreißig. Während Palmer mit dunklen Haaren und Bartschatten punktete, war Halverston blond und glatt rasiert, was allerdings seinen kantigen Kiefer betonte.
Palmer reichte ich bis zur Nasenspitze, Halverston überragte mich um mehr als einen Kopf. Nur dass sie beide Jeans und T-Shirt bevorzugten, schienen sie gemeinsam zu haben. Ich sah nach unten. Auch hier unterschieden sie sich. Bisher hatte ich Palmer nur in schweren Boots gesehen, Halverston trug weiße Sneakers. Und soweit ich sehen konnte, war Halverston im Gegensatz zu Palmer nicht tätowiert. Er wirkte wie Mister Saubermann in Person.
»In Ordnung.« Ich sprach ihn nicht direkt an, sondern gab eher meine allgemeine Zustimmung. Obwohl es keine Rolle spielte, wie der Polizist aussah, den ich an der Nase herumführte, irritierte es mich, wie attraktiv ich ihn fand.
Mum lief voraus ins Krankenhaus, und Halverston ging zu meinem Vater. Da es vermutlich nicht schaden konnte, wenn jemand sich meine Wunden ansah und nach Möglichkeit auch desinfizierte, folgte ich ihr.
»Sadie«, rief Halverston hinter mir.
Es war nicht leicht, gegen den Impuls anzukommen, auf ihn zu reagieren. Stattdessen ging ich weiter. Er wiederholte meinen Namen und kam näher. Ich hörte seine Schritte, blieb stehen und schaute über die Schulter. »Entschuldigung …« Meine Stimme verlor sich.
»Kein Problem. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, zu welchem Raum du gehen musst. Meine Kollegin wartet mit einer Ärztin.«
Jack war ein guter Lügner, aber ich durchschaute ihn. Er hatte lediglich testen wollen, ob ich auf den Namen reagierte. Ich betrachtete sein charmantes Lächeln und beschloss, dass Jack Halverston ein Problem werden würde. Ein verdammt großes Problem.
KAPITEL2
PALMER
DREI MONATE VORHER
Ich zog frische Einweghandschuhe über, nachdem ich die blutigen aufgrund der Störung entsorgt hatte. »Das war ein Paket. Entschuldige die Unterbrechung, Nadia.«
Sie schüttelte lediglich den Kopf. Ich hielt inne und betrachtete sie. Wie war das möglich? Eigentlich sollte sie den Kopf nicht bewegen können. Wirklich merkwürdig.
Ich bückte mich und fand den Übeltäter unter dem Tisch. Einer der Lederriemen hatte sich gelöst. Mit festem Griff packte ich Nadias Kopf und fixierte ihn erneut. Sie heulte erbost in ihren Knebel, was mir ein leichtes Lächeln entlockte.
»Was denn? Möchtest du nicht weitermachen? Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du das Kinderheim angezündet hast.«
Es war noch früh am Morgen und wäre die Expresssendung nicht gewesen, hätte ich Nadia längst getötet. Doch nun lag der Tag unberührt vor mir.
Fast wie Nadia. Im hellen Tageslicht, das langsam durch die Fenster drang und den Raum nach und nach in völlig unpassenden Sonnenschein tauchte, glänzte ihr Blut gerade poetisch auf dem Edelstahltisch.
Sie schloss die Augen und begann, eine Melodie zu summen. Durch den Knebel klang es grauenhaft und verzerrt. Ich war versucht, ihr die Zunge herauszuschneiden. Den Leuten, die sie zu mir gebracht hatten, war es ohnehin egal, was mit ihr passierte. Ob ihr die Zunge fehlte oder nicht, spielte nicht die geringste Rolle, solange ich daran dachte, ein paar Zähne zur Identifizierung übrig zu lassen.
Das erinnerte mich daran, dass ich den wichtigsten Teil beinahe vergessen hätte. Ich nahm die Gartenschere vom Tresen und packte Nadias Hand. Sie riss die Augen wieder auf. Das Summen erstarb. Stattdessen versuchte sie, sich gegen die Lederriemen zu stemmen. Aber sie hatte keine Chance.
Die Leute, die bei mir landeten, hatten nie eine Chance. Ihr Schicksal stand in dem Moment fest, in dem sie über meine Schwelle getragen wurden. Die wenigsten kamen freiwillig zu mir. In der Regel hatten sie irgendwen verärgert, der sehr reich und mächtig war. Geld war das einzige Ticket in mein kleines Königreich.
Obwohl ich die Schere schon angesetzt hatte, nahm ich die Fernbedienung für die Surround-Sound-Anlage und machte die Musik lauter. Aus Gewohnheit hatte ich die Fernbedienung in eine Plastiktüte gewickelt, damit ich sie nachher nicht säubern musste. Früher oder später machte ich die Musik nämlich immer lauter. Der Song war gerade vorbei, und der nächste begann genau in diesem Moment. Somebody Stole My Eyes.
Der Titel brachte mich auf eine Idee. Nadia runzelte die Stirn, als ich mich ihr zuwandte und böse lächelte. »Sag mir, Nadia, wie sehr hängst du an deinen Augen?«
Sie riss die besagten Augen auf und bekam vor lauter Panik, die meine Frage ausgelöst hatte, das laute Schnappen der Gartenschere im ersten Moment gar nicht mit. Zufrieden legte ich ihren kleinen Finger auf den Tresen. Ich würde mich später darum kümmern, ihn zu präparieren.
Es folgte Gebrüll. Ich war froh, dass ich von den Ballknebeln zu der guten alten Watte gewechselt war. Sie dämpfte einfach viel mehr.
Ich zuckte bloß mit den Achseln. »Wie schon gesagt: Man muss seine Lebensentscheidungen gut überdenken. Für ein flatterhaftes Regime im Untergang unzählige Leute zu töten und danach in ein anderes Land zu flüchten war keine kluge Wahl, Nadia.«
Sie begann zu zittern. Vermutlich war ihr endgültig klar geworden, dass sie mir nicht entkommen konnte. Hinter dem Knebel wimmerte sie, und Tränen liefen über ihre Wangen. Es war mir egal.
Ich legte die Rosenschere zurück, nachdem ich das Blut von der Klinge gewischt hatte. Dann nahm ich die Tube Sekundenkleber und schmierte das stinkende Zeug großzügig auf die offene Stelle an Nadias Hand, wo sich zuvor ihr kleiner Finger befunden hatte. Ich wollte nicht, dass sie mir zu schnell verblutete.
Mit der Klinge des Skalpells beschrieb ich einige Kreise über ihrem Brustkorb, während ich überlegte, wo ich den nächsten Schnitt ansetzen sollte. Nadia brüllte in den Knebel, als ich einen langen Schnitt hinterließ, aus dem das Blut hervorquoll.
Ohne hinzuschauen, tastete ich nach der Fernbedienung und erhöhte erneut die Lautstärke.
Besser.
Nach einigen Minuten fühlte ich mich ruhiger. Fast schon gelassen.
Es dauerte nicht lang, bis Nadia mit dem Gezappel aufhörte und ihre Augen leer wurden.
Jetzt hatte ich sie ihr gar nicht herausgeschnitten. Verdammt.
Na ja, da konnte man nichts machen. Ich war heute ohnehin irgendwie nicht ganz bei der Sache. Mich beschäftigte der nächste Termin.
Alles daran stank bis zum Himmel.
Ich hasste es, meine Opfer selbst abholen zu müssen. Unter normalen Umständen tat ich es nicht, aber mir war so viel Geld geboten worden, dass ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, darauf zu verzichten.
Wer auch immer am Empire Spa & Resort auf mich warten würde, hatte verdammt viel Geld und dementsprechend auch Macht und die richtigen Verbündeten. Ich hatte vielleicht meine Prinzipien, doch das machte mich noch lange nicht zum Idioten.
Natürlich würde ich pünktlich am Spa sein, allerdings nicht ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen. So viel stand fest.
KAPITEL3
SADIE
Ich fragte mich, ob Mathis bewusst war, dass ich seit exakt elf Minuten kein Wort mehr gesagt hatte. Nicht mehr, seit er angefangen hatte, mit der rothaarigen Kellnerin zu flirten.
Ein Teil von mir war sich der Tatsache, wie egal mir sein Verhalten geworden war, geradezu schmerzhaft bewusst.
Ich hatte mein Handy unter der weinroten Stoffserviette versteckt und schaute verstohlen aufs Display, um nicht unhöflich zu wirken. Dabei hatte mein Verlobter gar keine Aufmerksamkeit für mich übrig.
Es brachte alles nichts, ich musste ihm endlich sagen, was längst überfällig war. Ich faltete meine Hände im Schoß, machte mich innerlich bereit und wartete.
»Das könnte der bisher beste Jahrgang sein«, erklärte Mathis mir, nachdem die Kellnerin endlich verschwunden war. Er nahm die Flasche Petit Duret in die Hand und machte ein riesiges Theater darum, das Etikett zu studieren. Eigentlich fehlte nur noch ein Monokel vor seinem Auge. Dann goss er mir erneut Wein ein.
»Mathis«, begann ich.
Doch genau in diesem Moment legte er seine Hand auf meine und lächelte mich an. Mit Mühe konnte ich mich dazu zwingen, meine Mundwinkel hochzuziehen.
Er streichelte meinen Handrücken mit dem Daumen. »Habe ich dir heute schon gesagt, wie hübsch du aussiehst?«
»Hübscher als die Kellnerin?« Ich hatte mich zurückhalten wollen, trotzdem rutschte mir diese kleine Spitze heraus.
»Selbstverständlich. Baby, ich kann nichts für meinen natürlichen Charme.« Entschuldigend zuckte er mit den Achseln, bevor er sich dem Wein zuwandte.
Sein »natürlicher Charme« schien sogar meinen Vater eingewickelt zu haben. Ich überlegte, wie ich das Thema darauf bringen konnte.
Ehe ich die richtigen Worte gefunden hatte, griff Mathis nach der Weinflasche.
Er legte den Kopf schräg und wirkte damit wie ein neugieriger Vogel. »Die meisten Weinkellereien in der Gegend sind kaum Konkurrenz, aber der hier – darauf müssen wir ein Auge haben.«
»Vermutlich«, erwiderte ich und ließ den Wein in meinem Glas kreisen. Manchmal wünschte ich mir, wenigstens einen Abend hinter mich bringen zu können, ohne über dieses Thema sprechen zu müssen. »Mathis, als du mir gesagt hast, dass ich die Lieferformulare in deiner Ablage finde, habe ich nachgesehen und stattdessen etwas anderes gefunden.«
Mein Verlobter schien seine Aufmerksamkeit nur mit Mühe von dem Wein losreißen zu können. »Was denn, Baby?«
Ich betrachtete sein absolut durchschnittliches Gesicht und fragte mich, was ich überhaupt an ihm fand. Am Anfang unserer Beziehung hatte sich seine Miene aufgehellt, sobald er mich angesehen hatte. Jetzt betrachtete er mich wie eine Weinrebe, die nicht den gewünschten Ertrag brachte.
Bisher hatte ich noch keinen Schluck getrunken und stellte das Glas weg. »Ich hatte gehofft, du könntest mir die Frage beantworten. Für mich wirkte es wie ein Vertrag, in dem mein Vater dir das Weingut überschreibt – für den Fall, dass mir etwas passiert, sobald wir verheiratet sind. Allerdings war nur deine Unterschrift darauf, weshalb ich nicht genau weiß, wessen Idee es war.«
Ich war den ganzen Tag nervös gewesen, weil ich gewusst hatte, dass ich Mathis mit meinem Fund konfrontieren musste. Jetzt war ich allerdings erstaunlich ruhig, was mich selbst irritierte.
Er blinzelte zweimal schnell hintereinander. Ich kannte ihn lang genug, um zu wissen, was in ihm vorging. Mathis neigte dazu, zweimal zu blinzeln, wenn seine Gedanken rasten und er sich selbst Zeit verschaffen wollte, um nachzudenken.
Die Kellnerin kam wieder und brachte den Salat mit Walnüssen und Ziegenkäse, den ich überhaupt nicht essen wollte. Mathis hatte einfach für uns beide bestellt, ohne mich an der Entscheidung teilhaben zu lassen. Dieses Motiv schien sich in letzter Zeit durch mein Leben zu ziehen. Sie wünschte uns guten Appetit und verschwand.
Mathis räusperte sich. »Das hast du missverstanden, Sadie.« Er griff nach dem Weinglas und trank einen beachtlichen Schluck.
»Ich kann lesen.« Mit gerecktem Kinn verschränkte ich die Arme. »Und ich bin mir sicher, dass ich es richtig verstanden habe. Mich interessiert nur, was es damit auf sich hat.«
»Eine reine Sicherheitsmaßnahme, Baby.« Er wollte erneut nach meiner Hand greifen, doch ließ den Arm sinken, da ich keine Anstalten machte, meine abwehrende Haltung zu lösen.
»Habt ihr sonst noch Maßnahmen getroffen, von denen ich wissen sollte?«
»Natürlich nicht.« Er versuchte, empört zu klingen.
Ich glaubte ihm nicht, und diese Erkenntnis sorgte dafür, dass mein Magen sich zu einem harten Ball zusammenzog. Wie lange wollte ich diese Farce noch aufrechterhalten?
Er hob den Blick und schaute mich wie ein Hundewelpe aus seinen braunen Augen an. Doch statt Wärme und einer Entschuldigung sah ich nichts als Härte und Ablehnung. Dann blinzelte er und griff nach meiner Hand. »Entschuldigung, Baby, es war dumm, vorher nicht mit dir darüber zu sprechen. Im Grunde ist es nicht mehr als eine Art Testament.«
Der Moment der Ablehnung war vorbei, und er wirkte wieder wie Mathis. Nur dass ich nicht mehr zu besänftigen war. Der Mathis, den ich kannte, entschuldigte sich nicht und würde niemals zurückrudern. Ihm musste das Thema wichtig sein.
Aber wie konnte ein Testament, das für den absurden Fall, dass mir etwas passierte, Absicherung bieten sollte, ihm dermaßen wichtig sein?
Ein Schauer lief über meinen Rücken. Er baute sich langsam auf meinem Kopf auf, ließ die Härchen in meinem Nacken zu Berge stehen und rieselte wie feiner Sand über meine Rückseite.
Ging Mathis davon aus, dass mir etwas passieren würde?
Draußen war es sommerlich heiß, trotzdem wurde mir plötzlich eiskalt.
Nein, ich steigerte mich in absurde Vorstellungen hinein. Oder?
Sein Handy vibrierte in der Innenseite seines Jacketts, was ich nur wusste, weil er plötzlich die Hand vor die Brust schlug, als wäre er kurz davor, einen Herzanfall zu bekommen. »Entschuldige«, murmelte er und holte das Telefon heraus.
Ich war mir sicher, dass er über die Unterbrechung froh war. Bisher hatte es zwischen uns keine großartigen Auseinandersetzungen gegeben, weshalb ich mir sicher war, dass Mathis nicht wusste, wie er damit umzugehen hatte.
Während er auf seinem Display tippte, betrachtete ich die blutrote Flüssigkeit im Glas vor mir.
Ich ließ meinen Blick durch das Restaurant schweifen. Es war der neueste Hotspot, Warteliste inklusive. An nahezu jedem Tisch schien ein Sommelier zu stehen, und dort, wo sich keiner befand, waren die Gäste damit beschäftigt, Wein in ihren Gläsern kreisen zu lassen.
Früher war es auch mein liebstes Thema gewesen. Ich konnte nicht einmal genau benennen, was sich verändert hatte. Selbst hier in dem Restaurant schien das Essen zweitrangig zu sein. Die Leute waren zu sehr vom Wein fasziniert.
Solange man nicht versuchte, über etwas anderes zu reden, fiel es einem nicht auf. Nur hatte ich keine Lust mehr auf diese Oberflächlichkeit. Morgens, mittags, abends, beim Essen, beim Spazierengehen, vor dem Einschlafen – Wein, Wein, Wein.
Nach ein paar Versuchen, mit meinen Eltern über das Weltgeschehen oder mit Mathis über Politik zu sprechen, hatte ich aufgegeben. Selbst wenn ich ihnen einen Kommentar entlocken konnte, schwang das Gespräch innerhalb von wenigen Minuten zurück zum Wein.
Ihnen reichte dieses eine Thema vollkommen. Es gab ja genug zu besprechen: Die Wetterbedingungen, neue Rebsorten, die benachbarten Weingüter, Marketingmaßnahmen, die nächste Touristenwelle …
Es hörte nicht auf, und ich wusste nicht, wie lange ich es noch aushalten würde. Seit Tagen trug ich mich mit dem Gedanken, dass ich rein gar nichts mit Mathis gemeinsam hatte – abgesehen von der Tatsache, wie sehr er für Wein lebte und dass meiner Familie zufällig das größte Weingut in der Gegend gehörte.
Seit ich die Idee in meinen Kopf bekommen hatte, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Er blühte nur auf, wenn es um sein Lieblingsthema ging. Manchmal hatte ich sogar den Eindruck, dass er nur eine Erektion zustande brachte, solange eine Flasche Wein sich im Raum befand. Sex hatten wir so selten, es war kaum der Rede wert. Meistens vermied Mathis es sogar, mich anzufassen.
Seit ich diesen komischen Vertragsentwurf gefunden hatte, war es mir erst richtig aufgefallen, wie merkwürdig alles war. Vermutlich war ich kurz davor, paranoid zu werden, aber was war, wenn Mathis mich nur ausgewählt hatte, weil ich eines Tages das Weingut meiner Eltern erben würde?
Er hatte mich in einer Bar angesprochen. Damals hatte ich ihn für selbstbewusst und zielstrebig gehalten. Jetzt war ich mir nicht mehr sicher.
Anfangs war ich Feuer und Flamme gewesen. Mathis war groß und attraktiv. Abgesehen davon waren seine Hände riesig. Ich hatte mich unmittelbar in Fantasien ergangen, wie fest er mit besagten Händen wohl zupacken konnte. Mitten in der Bar hatte ich davon geträumt, mit ihm zu vögeln. Zerwühlte Bettlaken und verschwitzte Körper waren vor meinem inneren Auge vorbeigezogen. Zumal Mathis ein Hemd getragen hatte, das wie eine zweite Haut an ihm geklebt hatte. Es war offensichtlich gewesen, wie muskulös er war.
Doch es war nichts passiert. Nicht an diesem Abend und nicht am nächsten.
Bis zum dritten Date hatte ich nicht einmal einen Gutenachtkuss bekommen.
Es war peinlich genug, dass ich es gewesen war, die den Kuss initiiert hatte. Ich hatte gedacht, dass Mathis vielleicht eine Ermunterung oder einen Hinweis brauchte, da er der perfekte Gentleman war, der mir nicht zu nahe treten wollte. Als er mich geküsst hatte, ganz züchtig mit geschlossenen Lippen auf den Mund, hatte ich meine Hand ausgestreckt und flüchtig über seinen Schritt gestrichen. Mir war aufgefallen, dass er an dem Abend immer mal wieder meinen Ausschnitt begutachtet hatte, und hatte auf einen zumindest halb harten Schwanz spekuliert.
Ich hatte keine Erektion ertasten können, und Mathis hatte getan, als wäre nichts passiert.
»Wo waren wir?«, fragte er, nachdem er das Handy in seinem Jackett verstaut hatte.
Mit den Fingern nahm ich einen Crouton aus meinem Salat. »Warum haben wir nie Sex? Warum willst du mich nicht ficken?«
Mathis’ Gesicht wurde feuerrot. »Herrgott, Sadie, wie viel hast du getrunken?«
»Nicht annähernd genug.«
»Ich wünsche nicht, das jetzt zu diskutieren.« Er beugte sich näher zu mir und flüsterte: »Außerdem haben wir Sex.«
»Oh bitte! Das letzte Mal ist Wochen her.«
Seine Nasenlöcher blähten sich auf, als er tief Luft holte.
Ich streckte die Zunge aus, leckte in eindeutiger Weise über den Crouton und schob ihn zwischen meine Lippen.
Mathis wirkte unberührt, während ich über seine Schulter den Mann am Nachbartisch sehen konnte, der verstohlen in meine Richtung grinste. Wenigstens lag es also nicht an mir. Gut zu wissen.
»Was ist in dich gefahren?«, wollte er von mir wissen. Meine kleine Schauspieleinlage schien ihn völlig kalt zu lassen.
»Ich glaube einfach, das hier ist eine dumme Idee.«
»Du meinst das Restaurant? Sollen wir woanders hinfahren?« Er legte schon wieder den Kopf schräg, und ich wollte ihn ohrfeigen.
Ich riss mich zusammen und deutete zwischen uns hin und her. »Nein. Ich meine uns. Wir sind keine gute Idee.« Damit stand ich auf und warf meine Serviette auf den unberührten Salat.
»Sadie, bitte«, sagte Mathis mit leiser Stimme, dabei klang er sehr eindringlich.
»Tu mir einen Gefallen, Mathis.«
»Ja?«
»Nenn mir meinen Lieblingswein.«
»Pinot Noir.«
Ich nickte. »Das stimmt. Und mein Lieblingsbuch?«
Er schwieg.
Mit einem Nicken stemmte ich die Hand in die Hüfte. »Kennst du mein Lieblingsessen? Weißt du, in welcher Stellung ich am liebsten ficke? Was sind meine Lieblingsblumen? Meine Lieblingsfarbe?«
Es war zu sehen, wie er mit den Zähnen knirschte. »Was soll das, Baby? Ist es, weil ich den Valentinstag vergessen habe?«
Ich starrte ihn an. »Valentinstag ist mehr als vier Monate her, und du hast ihn nicht vergessen. Du hast mir sechs Flaschen Wein geschenkt.«
»Wo ist dann das Problem?«
Um nicht das ganze Restaurant an unserem Streit teilhaben zu lassen, beugte ich mich vor und flüsterte: »Sechs Orgasmen wären mir lieber gewesen.«. Im Anschluss daran richtete ich mich auf und verließ das Restaurant, ohne mich noch mal umzusehen.
KAPITEL4
PALMER
Ich nahm den abgetrennten Finger von der Arbeitsplatte und legte ihn in die Schale, die ich immer benutzte, um meine kleinen Trophäen vorzubereiten. Es war nicht mehr als absurde Eitelkeit, das war mir bewusst. Trotzdem machte es mir Spaß.
Der Ofen hatte die nötigen 650 Grad erreicht, und ich konnte Nadias Leiche hineinschieben, bevor ich mich ihrem Finger widmete. Die Zähne lagen bereits in der kleinen, ordentlich beschrifteten Plastiktüte. Ich hatte inzwischen drei davon in der Ablage, da ich Murphy schon länger nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Er war der einzige Kontakt zur Regierung, den ich hatte, und sammelte die Zähne eigentlich regelmäßig ein. Zwar hätte ich ihn anrufen können, doch ich vertraute darauf, dass er sich melden würde, wenn er etwas brauchte. Das hatte er bisher immer getan.
Nachdem ich die Schale mit dem Finger ins Terrarium gestellt hatte, ließ ich die Speckkäfer darauf los. Immerhin war ich nur an den Knochen interessiert. Das Fleisch überließ ich lieber den Käfern. Aufgrund dessen, dass ich mich nicht darum kümmern musste, blieb mir auf diese Weise mehr Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel den Mann im zweiten Raum.
Ich ging hinüber und betrachtete ihn. Er lag auf einer Liege. Die Fixierung an seinem Kopf ließ ihm keine andere Wahl, als aus weit aufgerissenen Augen an die Zimmerdecke zu starren. Vermutlich wunderte er sich, warum er nicht wie versprochen ein neues Gesicht für seine Zeugenaussage bekommen hatte, sondern geknebelt aufgewacht war.
Ich hatte mich gerade für das zweitgrößte Messer entschieden, da gab der Ofen ein lautes Knacken von sich – so laut, dass ich es im Nebenraum hören konnte. Mit einem Seufzen legte ich das Messer zurück. Es gab nichts, was ich so sehr hasste wie Unregelmäßigkeiten in meinem Arbeitsplan.
Seit ein paar Monaten machte der Ofen Probleme, und obwohl ich alles gelesen hatte, was ich zu Krematorien und den Öfen gefunden hatte, wusste ich nicht genau, wie das Ding repariert oder gewartet werden musste.
Mein Job beinhaltete nun einmal eine gewisse Diskretion, weshalb ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, erst einen Handwerker kommen zu lassen, um ihn danach umzubringen, weil er den Ofen gesehen hatte.
Außerdem würde ich in den Betrieb, in dem der Mann arbeitete, einbrechen müssen, um seine Unterlagen zu vernichten. Selbst dann wäre nicht sichergestellt, dass er nicht einem Bekannten, Kollegen oder seiner Frau von dem Auftrag an diesem Tag erzählt hatte, woraufhin sämtliche Spuren nach seinem Verschwinden auf mich deuten würden.
Es ging einfach nicht. Sobald ich eine Zeit lang Leerlauf hatte, würde ich mich selbst auf die Suche nach dem Fehler machen müssen. Zum dritten Mal.
Ich drückte wieder auf den roten Knopf, und der Ofen sprang an, als wäre nichts gewesen.
Das war der Nachteil, wenn man solche Dinge aus zweiter Hand kaufte: Man bekam keine Bedienungsanleitung mitgeliefert.
Wobei es eher ein Zufall gewesen war, dass ich an das Haus geraten war, das direkt ein eingebautes Krematorium besaß. Gekauft hatte ich es vor knapp sieben Jahren von Big Tito, einem zu diesem Zeitpunkt ehemaligen Mafia-Mitglied.
Ich war erstaunt gewesen, als ich ihn getroffen hatte. Bisher war ich davon ausgegangen, dass die Mafia kein Unternehmen war, das man einfach verlassen konnte, wenn einem der Sinn danach stand. Big Tito hatte mich eines Besseren belehrt. Allerdings war er sehr clever gewesen. Er war ausgestiegen und hatte der Mafia gleichzeitig einen perfekten Deal angeboten: Sie ließen ihn gehen, er kümmerte sich dafür um sämtliche anfallenden Leichen. Denn Big Tito hatte schon in diesem Stadtteil gewohnt, als es noch eine üble Ecke gewesen war. Damals hatte er einen Spottpreis für die Villa bezahlt und den Ofen erst danach entdeckt. Inzwischen war es eine hippe Gegend, mit riesigen Anwesen, die genügend Privatsphäre boten.
Ich wartete ab, ob der Ofen erneut den Dienst quittieren würde, bis ich das Zischen der Flammen hörte. Alles klar, dachte ich und ging zurück zu Opfer Nummer 67 für dieses Jahr.
In guten sechs Stunden musste ich am Spa sein – mehr als genug Zeit, um mich mit Nummer 67 zu beschäftigen.
Spontan entschied ich mich gegen das Messer und nahm stattdessen die Spritze. Für das, was ich mit ihm anstellen wollte, musste er stillhalten. Ich hatte aus Erfahrung allerdings gelernt, dass die wenigsten Menschen ruhig blieben, wenn man ein Skalpell an ihrer Stirn ansetzte, die Haut aufschnitt und zurückschlug. Deshalb benutzte ich lieber meinen speziell hergestellten Betäubungsmittelcocktail. Meine Opfer konnten sich nicht bewegen, waren aber bei vollem Bewusstsein und spürten alles. Wo wäre sonst der Spaß geblieben?
In den letzten Tagen hatte ich einige interessante Artikel zum Claustrum gelesen und wollte es mir nun einmal selbst ansehen. Wenn ich ehrlich war, hatte es gedauert, bis ich mich an das Geräusch der Knochensäge gewöhnt hatte, deshalb überraschte es mich nicht, dass mein Pseudopatient entsetzt wirkte. Er hätte wahrscheinlich die Augen aufgerissen, wenn er gekonnt hätte. Nachdem ich die Schädelplatte zur Seite gelegt hatte, betrachtete ich das Gehirn von Nummer 67. Es wirkte reichlich unspektakulär.
Vermutlich ebenso unspektakulär wie das Claustrum selbst. Es war angeblich nicht mehr als ein grauer Lappen, der grob wie die Vereinigten Staaten von Amerika geformt war.
Viel faszinierender fand ich die Tatsache, dass es keine genauen Erkenntnisse darüber gab, was die Funktion des Claustrums war. Einige Forscher waren der Meinung, es würde das Zusammenspiel verschiedener Gehirnregionen steuern, quasi wie ein Dirigent das Orchester. Andere glaubten, dass es die Seele der Menschen beherbergte. Außerdem gab es Studien, bei denen gemessen worden war, wie viel mehr das Claustrum durchblutet wurde, wenn Männer sich Pornos ansahen.
Das zusammengenommen mit der Theorie über den Sitz der Seele sagte viel über unsere Gesellschaft aus.
»Siehst du gern Pornos?«, wollte ich von Nummer 67 wissen.
Seine Lippen formten lautlos das Wort »ja«. Ich nickte. Nicht dass er nach heute eine weitere Gelegenheit bekommen würde, sich einen Porno anzusehen, aber es befriedigte mich immer, wie ehrlich die Leute auf meinem Tisch waren. Entweder sie wurden von der Panik dazu getrieben oder durch die Erkenntnis, dass es keine Rolle mehr spielte, was sie sagten, da das Ende ohnehin gekommen war.
Es machte keinen Sinn, das Ganze weiter hinauszuzögern. Mit dem Skalpell arbeitete ich mich durch den Neocortex. Das Claustrum war nicht schwer zu finden und trotzdem war ich stolz, als ich es hervorholte. Es war kleiner, als ich es mir vorgestellt hatte.
Nummer 67 zuckte ein letztes Mal, bevor seine Augen leer wurden.
Mitleidslos betrachtete ich ihn, dann legte ich das graue Stück Gehirn auf einen Objektträger, um es mir nachher in tausendfacher Vergrößerung anzusehen. Vielleicht würde es mir ja gelingen herauszufinden, ob dort die Seele saß oder nicht.
Wobei ich mir, bei dem, was Nummer 67 in seinem Leben angestellt hatte, nicht vorstellen konnte, dass er überhaupt eine Seele gehabt hatte.
Stone Sour dröhnten noch immer aus dem Sound Dock, und während ich den Objektträger gegen das Licht betrachtete, spürte ich ein Lächeln auf meinen Lippen. Vielleicht würde der Tag doch nicht so schlimm werden, wie ich ursprünglich gedacht hatte.
Jetzt musste ich mich um den Knochen für meine Trophäe kümmern.
KAPITEL5
SADIE
Hätte ich nicht bereits die halbe Flasche Absolut Vodka Peppar geleert, wäre ich garantiert nicht ans Handy gegangen. Der Pfeffergeschmack erfüllte meinen Mund, als ich nach dem Telefon tastete und die Augen zusammenkniff, um den Namen lesen zu können.
Mathis.
Keine große Überraschung, da er an diesem Tag allein gefühlt zwanzig Nachrichten hinterlassen hatte.
In meiner Familie waren wir nicht unbedingt gut darin, über Gefühle zu reden, weshalb ich ihnen noch nichts von meinem Streit mit dem perfekten Frankokanadier erzählt hatte. Manchmal war ich mir sicher, dass meine Eltern Mathis heiraten würden, wenn sie nur könnten. Deswegen zog ich es vor, in meinem Bungalow zu sitzen, traurige Musik zu hören und den einzigen Wodka zu konsumieren, den ich auf die Schnelle hatte auftreiben können. Der Laden hatte gefühlte 28.000 Sorten Wein gehabt, aber nur drei Flaschen Schnaps. Absolut Vodka Peppar – wenn man wusste, dass man kaum tiefer sinken konnte.
»Hallo?« Obwohl ich betrunken war, konnte ich selbst hören, wie voll ich war. Normalerweise bildete man sich ja eher ein, vollkommen normal zu klingen. Nicht in diesem Fall. Ich war voll bis unter die Dachrinne.
»Sadie. Gott sei Dank. Ich habe mir Sorgen gemacht.«
Ich streckte mich auf dem Boden aus, während ich mit einer Haarsträhne spielte. »Hm.« Zu eine eloquenteren Aussage war ich nicht fähig.
»Hör zu: Es tut mir leid, wie ich mich verhalten habe. Du hast vollkommen recht. Immer nur Wein, Wein, Wein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal über etwas anderes gesprochen habe. Bitte lass es mich wieder gutmachen.«
Ich dachte nach. Dabei schwieg ich eine lange Zeit, weil mein Gehirn im betrunkenen Status wesentlich langsamer war. Nach einer Weile wurde mir klar, dass ich etwas sagen musste. »Sprich weiter.«
»Was hältst du davon, wenn wir zusammen wegfahren? Irgendwohin, wo Wein keine Rolle spielt. Nur wir beide. Immerhin habe ich es doch richtig verstanden, dass ich dir sechs Orgasmen schulde, oder?« Er senkte die Stimme, bis ich tatsächlich so etwas wie einen verführerischen Tonfall wahrnahm.
»Ich bin betrunken«, verkündete ich vollkommen zusammenhanglos.
»Das weiß ich, Baby. Es tut mir leid, dass ich dich so weit gebracht habe. Wie stehst du zu meinem Vorschlag? Wir machen einen netten Shoppingbummel, besuchen ein Spa und gönnen uns zwei Nächte in einem schicken Hotel. Das bin ich dir schuldig.« Ich ließ es mir durch den Kopf gehen, bis er fragte: »Sadie? Bist du noch da?«
»Ja«, antwortete ich. »Klingt gut.«
Mathis atmete tief durch. »Du glaubst nicht, wie sehr es mich freut, das zu hören. Du hast mich gestern wirklich wachgerüttelt. Hier ist mein Vorschlag: Du schläfst deinen Rausch aus, packst eine Tasche und ich hole dich morgen Vormittag ab. Wir gehen frühstücken – ach, was sage ich da! Wir machen alles, wie du es möchtest, und ich verspreche, dass ich nicht an Wein denken werde.«
»Okay.«
»Wunderbar. Schlaf gut, Baby, ich liebe dich.«
Das Handy glitt aus meinen Fingern, und während ich zusah, wie es zu Boden fiel, fragte ich mich, warum ich ihm nicht mehr glaubte. Nicht einmal dann, wenn mein Urteilsvermögen durch viel zu viel Alkohol beeinträchtigt war.
* * *
Ich brauchte zwei Kopfschmerztabletten, vier Tassen Kaffee und eine ausgiebige heiße Dusche, bis ich wieder wusste, wie Menschen in der Regel funktionieren.
Zum Glück hatte ich in meinem Bungalow, der exakt so eingerichtet war wie die Ferienhäuser für die Touristen, eine voll ausgestattete Küche und konnte mich selbst mit Kaffee versorgen, ohne meiner Mutter unter die Augen zu treten.
Ich zwang mich sogar dazu, ein Glas Orangensaft zu trinken, obwohl mein Magen sich bereits beim Anblick der sonnengelben Flüssigkeit verkrampfte. Aber ich versuchte, mich selbst mit den darin enthaltenen Vitaminen zu überzeugen. Die Säure brannte in meiner Speiseröhre, und ich war froh, als das Glas leer war.
Mitten in der Nacht hatte Mathis mir eine Nachricht geschrieben, in der er sich für 10.30 Uhr ankündigte. Es war jetzt kurz vor zehn. Ich musste noch packen und meine Haare föhnen.