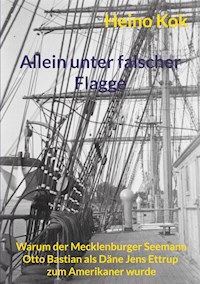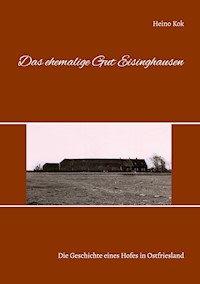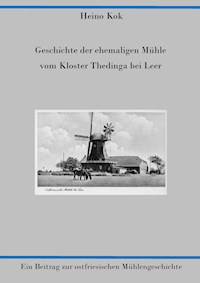Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dies ist die historische Lebensgeschichte meines Großonkels Otto Cornelius Swalve. Er wurde 1876 in Jemgumgeise (Kreis Leer) geboren und führte ein ungewöhnliches Leben für einen Ostfriesen. Geprägt durch die Erziehung in der Kaiserzeit und durch die kaiserliche Marine verließ er Ostfriesland und war anschließend in vielen Positionen tätig u. a. in Deutsch-Südwest (Namibia), Berlin, Bückeburg und Hannover als Redakteur, in Danzig (Gdansk) als Syndikus bei einer Bank und in Schneidemühl (Pila). Seine letzte Arbeitsstelle war von 1934-1946 das Deutsche Theater in Berlin als Hauptkassierer. Er hatte 1905 in Berlin eine adelige Frau aus der Familie Prüschenk von Lindenhofen geheiratet, die bereits 1938 verstarb. Nach Ende des Krieges kehrte er als armer Rentner nach Ostfriesland zurück und wohnte bei seiner Schwester (meiner Oma) auf dem Bauernhof meiner Eltern in Eisinghausen (jetzt Stadt Leer). So wurde er zu meinem gütigen Ersatzopa bis zu seinem schrecklichen Unfalltod am 1. Dezember 1959. Sein einziger Sohn Heinrich Swalve (1906-1988) kam in der Nachkriegszeit ab und an mit seiner Frau Bella zu Besuch aus Moers, später mit seiner Freundin. Otto stellte sich für alle, die sich an ihn erinnern, als besonderer Mensch dar, der ungewöhnliche Dinge tat auch aufgrund seiner herausragenden Intelligenz und seines großen Erfahrungsschatzes. Er hatte sich allein auf den Weg gemacht, die Welt für sich zu entdecken und kam am Ende des Weges doch zurück in seine Heimat Ostfriesland, an der er immer noch hing. Nach über 60 Jahren ist er in den Familien Swalve und Gruis als "Onkel Otto" noch immer präsent, wenn man ihn erwähnt. In dieser Neuauflage sind einige fehlende Informationen und Zusammenhänge ergänzt worden, sowie einige kleine Fehler korrigiert worden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu dieser zweiten, ergänzten und verbesserten Auflage kam es, weil mich kurz nach der ersten Auflage einige Informationen und Zusammenhänge erreichten, die im Buch fehlten. So erhielt ich von Imke Waller, einer Enkelin von Heinrich und Ilse Niehuus, eine Mail. Sie informierte mich über Personen und Zusammenhänge der Familien Niehuus, Prüschenk von Lindenhofen und Pontow sowie über die Adoption von Heinrich Swalve durch Else Swalves jüngste Schwester Hilde Prüschenk von Lindenhofen. Anke Swalve und Eta Grundmann schickten mir die Kopie eines Briefes von Otto Swalve aus dem Jahr 1946 an seinen kranken Bruder Ibeling in Ostfriesland, den ich unbedingt im Buch zitieren möchte.
Heino Kok
Mai 2021
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Familie Swalve aus Jemgumgeise bei Holtgaste
Ottos Kindheit in der Geise
Ottos Schul- und Ausbildungszeit
Otto bei der Kaiserlichen Marine als Zahlmeisteraspirant
Mit der SMS Wolf an der Küste Westafrikas
Otto in Deutsch-Südwestafrika
Südwestafrika im Jahr 1902
Die Ansiedlungspolitik
Beginn des Herero Aufstandes
Otto in Berlin Steglitz, Groß-Lichterfelde
Heirat in Berlin mit Else Marie Ida Prüschenk von Lindenhofen
Wolff’s Telegraphisches Bureau (WTB)
Otto und Else Swalve in Bückeburg
Das Fürstentum Schaumburg-Lippe
Redakteur bei der Schaumburg-Lippischen Landeszeitung
Der Beginn des Ersten Weltkrieges
Otto und Else in Hannover
Die Stadt Hannover nach dem Ersten Weltkrieg
Der Landbund Hannover
Otto und Else in Danzig
Der Freistaat Danzig
Dr. Niehuus und die Lebensversicherungsanstalt Westpreußen in Danzig
Die Unterstützung der deutschen Minderheiten in den Ostprovinzen
Otto und Else in Schneidemühl in Posen-Westpreußen
Die Osthilfe
Die Machtübernahme 1933 in Berlin
Veränderungen in Posen-Westpreußen nach der Machtübernahme
Ottos Sohn Heinrich Swalve als Redakteur bei der Zeitung „Der Deutsche“
Die deutsche Arbeitsfront und ihre Verlagsgeschäfte
Otto und Else in Berlin
Deutsches Theater von 1934-1938
Heinrich schreibt für den Propaganda-Ausschuss der Olympischen Spiele 1936
Heinrich beim Bilderdienst der Associated Press of Amerika
Heinrich als Schriftleiter bei der I. G. Farbenindustrie
Heinrich als Geschäftsführer bei der MITROPA
Deutsches Theater von 1939-1943
Heinrich bei der Wehrmacht in Strausberg, Grafenwöhr und Plauen
Deutsches Theater von 1944-1946
Bei Schwester Aaltje in Eisinghausen bei Leer
Wenn Heinrich Swalve kam
Nachwort
Danksagung
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Index
Quellenverzeichnis
Archive, auch online
Literatur
Internetdokument
Vorwort
Was hat Onkel Otto eigentlich alles erlebt, bevor er zu uns kam? Diese Frage habe ich versucht zu beantworten, da er mir als Ersatzopa bis zu meinem achten Lebensjahr positiv in Erinnerung ist. Als er überraschend durch seinen Unfalltod nur wenige hundert Meter von unserem Zuhause entfernt starb, entstand daraus ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich.
Ich sehe noch genau, wie ich als kleiner Junge bei ihm im Wohnzimmer meiner Tante Anna saß, sie lebte ebenfalls auf dem großen Bauernhof und versorgte sich, meine Oma Aaltje und Onkel Otto. Tante Anna war die ältere Schwester meiner Mutter Alma Daniele Kok, geb. Gruis. Da ich keinen meiner Großväter kennengelernt hatte, sie waren beide vor dem
Abbildung 1 Onkel Otto 1959 an der Kreuzung in Eisinghausen (Sammlung Heino Kok)
Krieg verstorben, stellte Onkel Otto eine Art Ersatz dar. In Wirklichkeit war er mein Großonkel und der Bruder meiner Großmutter Aaltje Gruis, geb. Swalve. Oma starb bereits am 18. Januar 1957, ganz kurz darauf auch noch Onkel Jakobus, ihr ältester Sohn, am 11. Februar des Jahres 1957.
Onkel Otto war nett und hatte fast immer Zeit für mich. Er begab sich oft in die nahe gelegene Stadt Leer, teils zu Fuß oder mit dem Bus und trug seine Aktentasche bei sich. Was sich darin befand, blieb meist ein Rätsel. Er wirkte intelligent und sehr belesen, er wurde bewundernd von meinen älteren Cousinen auch „Professor“ genannt als jemand, der ungewöhnliche Dinge tat für seine ländliche Umgebung. Er legte Wert auf Gesundheit und bürstete allmorgendlich seinen Körper in Richtung des Herzens. Regelmäßig betrieb er Leibesübungen im Freien, um sich ein wenig zu ertüchtigen, ging „spazieren“ und in die erste 1948 in Leer eröffnete Sauna, als das Saunen auf dem Land noch nicht so üblich war, erzählten meine Geschwister. Otto wurde zunächst von seiner Schwester Aaltje und später von seiner Nichte Anna versorgt und aß oft für sich alleine in seinem Zimmer. Zum Frühstück und zum Abendessen wurde ihm eine Scheibe Schwarzbrot mit Leberwurst und eine mit Quark serviert. Dafür schnitt er sich sorgfältig Schnittlauch und verteilte ihn auf dem Quark. Zu Mittag saß er normal mit am Tisch meiner Tante. Otto, so wusste meine Schwester zu berichten, galt als wehleidig, konnte Schmerzen kaum aushalten und war, wie sie es ausdrückte, „nah am Wasser gebaut“.
Onkel Otto wirkte für mich wie ein ruhender Pol, der als mein Ansprechpartner geduldig und mit viel Wissen meine Fragen beantworten konnte. Sonst hatten alle wenig Zeit, da stets etwas auf dem Hof oder im Haushalt erledigt oder getan werden musste. So saß ich oft mit ihm am Wohnzimmertisch in Tante Annas guter Stube. Ihm verdanke ich es unter anderem, dass ich in der Schule und im Beruf vieles geschafft habe. Er förderte mein Talent für das Malen und Zeichnen und hatte wunderbare Buntstifte, die ich benutzen durfte. Das genaue Zeichnen mit dem Lineal habe ich wohl durch ihn gelernt. Von meinen beiden 11 und 13 Jahre älteren Geschwistern Hans und Anna hörte ich später, dass er schon genauso für sie da gewesen war, ihnen bei den Schularbeiten half und als Ersatzopa zur Verfügung stand. Auch mein Cousin Daniel besuchte uns häufig und verbrachte Zeit mit ihm. In den großen Ferien kamen meine beiden Cousinen Hella und Margot aus Bremen und teilten die Gesellschaft mit Onkel Otto. Besonders gut habe ich in Erinnerung, wenn damals mittwochs die Programm-Zeitschrift „Hörzu“1 mit der Post kam. Die Bildergeschichte mit „Mecki“2, dem Igel, wurde mir von Onkel Otto vorgelesen. Dann haben wir zusammen das Bildersuchrätsel „Original und Fälschung“ gelöst. Es galt, zehn Fehler in der Fälschung zu identifizieren und zu markieren. Eigentlich handelte es sich um zwei Kopien eines Gemäldes, nur dass in der einen Kopie die Fehler eingebaut waren, die nur durch genaues Vergleichen mit der korrekten Kopie auffielen. Die Hörzu bot auch noch viele andere Informationen, die mich damals interessierten. Eine weitere Geschichte, die mein Großonkel mir vorlas, war die von „Petzi und seinen Freunden“3, ein Comic, der fortlaufend in der Ostfriesenzeitung abgedruckt wurde.
Otto hatte ein eigenes kleines Dachzimmer oben im Bauernhof unter der Dachschräge. Dort hatte er sein ganzes verbliebenes Hab und Gut untergebracht. Das war neben der Kleidung ein Sekretär und ein Schrank voller Bücher, Bücher zu allen möglichen Themen. Neben uralten Bibeln und Gesangbüchern z. T. in holländischer Sprache gab es eine Auswahl klassischer Literatur nebst einigen philosopischen Werken u. A. von Nietzsche und Dramen von Henrik Ibsen, mit denen ich damals noch nichts anfangen konnte. Dort standen außerdem etliche Bände aus der Reihe „Wissen und Bildung“ des Verlags Wissen ist Macht, Konstanz. Es handelt sich dabei um „Allgemeinverständliche
Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens zur Weiterbildung für jedermann“4. Diese und etliche weitere Bücher mit dem handschriftlichen Vermerk „Swalve“ befinden sich noch in meinen Bücherregalen. In meinem Arbeitszimmer steht Onkel Ottos alter Sekretär, den ich wieder aufgearbeitet habe. Aber was mich damals besonders interessierte, waren die Ausgaben von „Das Beste aus Reader´s Digest“5 mit vielen kurzen oder längeren Geschichten aus aller Welt. Hier fand ich viele Anregungen, die mich zum Lesen geführt haben. Onkel Otto war ein Intellektueller, der sehr viel las und erzählen konnte, das passte nur bedingt in das bäuerliche Umfeld meiner Familie. Regelmäßig versorgte er sich mit Literatur aus der Stadtbibliothek in Leer. Manchmal schrieb er, so wurde mir berichtet, auch noch den einen oder anderen Artikel für eine überregionale Zeitung, um etwas Einkommen zu haben. Meine Oma Aaltje soll manchmal zu ihm gesagt haben: „Du hest nu so vööl Böcker lesen, nu ward dat tied, dat du sülvst mal een schrifst“ (Du hast nun so viele Bücher gelesen, nun wird es Zeit, dass du selbst mal eins schreibst). Dazu kam es aber nicht, auch ein Grund vielleicht, warum ich dieses Buch nun schreibe, das er mir hätte erzählen können.
Abbildung 2 Titelbild vom Juni 1959, Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH.
Ganz genau weiß ich noch, dass Onkel Otto im Herbst 1959 „Urlaub“ auf der ostfriesischen Insel Norderney machte. Dazu fuhr er mit dem Bus zum Bahnhof nach Leer und anschließend in einem Zug sitzend am Bahnübergang vorbei, der sich in einer Entfernung von 200 Metern hinter unserem Hof an der Bahnstrecke Leer-Norddeich befindet. Ich begab mich also rechtzeitig zu den Bahnschranken und wartete auf den Zug. In dem Moment, als der vorbeifuhr, lehnte Onkel Otto sich aus dem Abteilfenster und warf eine Tafel Schokolade für mich aus dem vorbeibrausenden Zug. Schnell fand ich die Schokolade im Bereich des Bahnübergangs am Bahndamm. Er schickte mir kurz darauf eine Ansichtskarte von Norddeich und teilte den Termin der Rückfahrt gleich mit, so dass ich auch diesen Zug wieder abpassen konnte.
Abbildung 3 Onkel Ottos Ansichtskarte von Norddeich,1959 (Sammlung Heino Kok)
Ganz schlimm für uns alle und für mich besonders kam sein plötzlicher Unfalltod. Otto ging, wie so oft, in die nah gelegene Stadt Leer und kehrte mit seiner Aktentasche, seinem Gehstock und der obligatorischen Schiebermütze zu Fuß zurück, entlang der B70. An der großen Kreuzung mit der Eisinghausener Straße angekommen, wollte er die Bundesstraße überqueren, übersah aber ein sich schnell näherndes Lieferfahrzeug, wurde davon erfasst und starb noch am Unfallort im Alter von 83 Jahren. Meine Schwester befand sich sogar in der Nähe der Kreuzung und wurde Augenzeugin des Unfalls. Das muss für sie sehr schrecklich gewesen sein. Auch für mich im Alter von acht Jahren stellte es ein einschneidendes, schockartiges Erlebnis dar. War doch ein von mir geliebter Mensch völlig unverhofft gewaltsam zu Tode gekommen. Das musste ich erst einmal verarbeiten.
Ein kleiner Trost für mich entstand dann später, als ich die Armbanduhr von Onkel Otto bekam, von der er gesagt hatte, dass ich sie erben würde, wenn er nicht mehr da wäre. Es war meine erste Uhr.
Onkel Otto blieb mir in guter Erinnerung, weil er sich um mich kümmerte und mir imponiert hatte mit seiner Klugheit, Gelassenheit und Güte. So blieb der Eindruck, den er als alter Mann bei mir hinterlassen hat.
Eine weitere Geschichte und ein besonderes Ereignis entstand stets dann, wenn Heinrich (Onkel Heini), Ottos Sohn, zu Besuch kam. Als Adresse hatte Heinrich für uns nur ein Postfach in Moers angegeben, wusste mein Cousin Daniel zu berichten. Heinrich nannte sich nach seiner adeligen Mutter Else, „Heinrich Curt Otto Prüschenk von Lindenhofen“, obwohl er selbst nicht von Adel war. Es waberte ein Geheimnis um seine wirtschaftliche Existenz und seine Lebensgeschichte. „Mehr Schein als Sein“ wurde gesagt.
Abbildung 4 Unfallbericht aus der Rheiderland Zeitung vom 3. Dez 1959 (Archiv Rheiderland Zeitung)
Erst viele Jahrzehnte später, nachdem ich schon jahrelang nach Vorfahren meiner Familie suchte und in der Historie meiner Heimat geforscht hatte, zwei Bücher dazu geschrieben hatte und nach einem Thema für ein weiteres Buch suchte, fand ich in meiner Sammlung den Nachruf anlässlich des Todes von Otto Cornelius Swalve in der Rheiderlandzeitung aus dem Jahr 1959 wieder (Siehe Anhang), den meine Schwester Anna aufbewahrt und mir irgendwann gegeben hatte. So begegnete mir Onkel Otto zum zweiten Mal in meinem Leben, und regte mich an, über seine Vita zu recherchieren und zu schreiben mit nicht nur positiven Überraschungen, soviel vorweg. Der Nachruf der Rheiderlandzeitung6 enthält einen kurzen Lebenslauf von Otto Cornelius Swalve und berichtet über die bekannten Stationen im Leben des Großonkels. Mir war eigentlich nur der letzte Teil seines Lebens, als kluger, gütiger Rentner, der seinen Lebensabend relativ bescheiden auf dem Hof der Familie seiner Schwester in Eisinghausen verbrachte, bekannt. Was sich davor ereignete, hatte ich bruchstückhaft schon mal gehört, aber was er tatsächlich alles gemacht oder welche Ziele er verfolgt hat, blieb mir unklar. Er hat es mir nicht mehr berichten können. Auch die Frage, was sein Sohn Heinrich eigentlich vor seiner Zeit in Moers gemacht hat, war völlig offen und erfüllte mich mit Neugier.
Dank Internet und etlicher mittlerweile zugänglicher Archive, Bibliotheken und Datenbanken kann heute vieles erforscht werden, von fast jedem Ort der Welt aus und so machte ich mich an die Arbeit, das Leben meines Großonkels zu hinterfragen und zu dokumentieren. Erst als ich anfing, an den einzelnen Stationen genauer zu recherchieren, wurde mir deutlich, dass das ein Leben mit Brüchen, Rissen, Hochs und Tiefs gewesen sein muss. Er hätte sehr viel erzählen können, aber nun wurde es zu meiner Aufgabe, seine Lebensgeschichte zu Papier zu bringen.
Kaum eine Generation hat so enorme historische Umwälzungen bewusst erlebt mit zwei Weltkriegen, vom kolonialen Kaiserreich über die zerrissene Weimarer Republik, den Hitlerfaschismus bis in die Nachkriegszeit der jungen Bundesrepublik. Aufgewachsen in der tiefsten ostfriesischen Provinz in der wilhelminischen Kaiserzeit ging Otto als junger Mann mit Abitur zur kaiserlichen Marine, ließ sich zum Zahlmeisteraspiranten ausbilden, arbeitete anschließend in „Deutsch-Südwestafrika“7, überlebte beide Weltkriege als Zivilist und kehrte nach vielen weiteren Stationen als Redakteur, Schriftleiter, Syndikus, Kassierer und Hauptkassierer 1946 als Witwer am Ende seines abwechslungsreichen Lebens allein und mittellos in seine Heimat Ostfriesland zurück.
Es zeigt sich ein Leben voller Brüche mit Schnittstellen in die deutsche Geschichte, über Kolonialismus und Großmachtstreben, die wachsende Bedeutung der Presse in Berlin nach der Jahrhundertwende bis zum Ende und Zerfall des Kaiserreichs in der bis dahin ihm durchaus wohlgesonnenen Provinz Schaumburg-Lippe. Man erfährt von der Pressearbeit bei der Landbundbewegung in Hannover bis hin zur Arbeit als Syndikus bei der finanziellen Unterstützung der Großgrundbesitzer und „Junker“8 mit der „Deutschtumspolitik9“ im 1920 abgetrennten „polnischen Korridor“ und danach bei der „Osthilfe“10 in Schneidemühl11. Den letzten beruflichen Abschnitt in der Nazizeit konnte er noch in Berlin als Kassierer, später Hauptkassierer beim Deutschen Theater bestreiten. Seine Frau verstarb leider schon im Alter von 55 Jahren am 16. Januar 1938 in Berlin.
Von der Haltung seines Vaters, der im Krieg gegen Frankreich 1870/71 mit einem Eisernen Kreuz dekoriert zurückkam und ihn im Sinne kaiserlicher Treue sehr konservativ und streng erzogen hatte, wurde er geprägt. Durch die preußisch harte schulische Erziehung im Kaiserreich zuletzt in Emden auf der Kaiser-Friedrich-Schule setzte sich das fort. Seine militärische Ausbildung erfuhr er bei der Marine in Wilhelmshaven und in Kiel. Dort schaffte er es bis zum Zahlmeisteraspiranten auf der SMS Wolf und lernte rechtliche, verwaltungstechnische, kaufmännische und wirtschaftliche Grundlagen, die er anschließend für eine kurze Zeit in der Kolonie in Deutsch-Südwestafrika und im weiteren Berufsleben anwenden konnte. Dabei geriet er zeitlich in den Aufstand der Herero gegen die deutschen Kolonialherren. Er gehörte aber wohl nicht der Kolonialtruppe an. Was er erlebt hat, läßt sich nur erahnen. Wenn man die zahlreichen Berichte über die als Verstärkung ins Land geholten deutschen Kolonialtruppen aus der Zeit liest, ging es dort
sehr hart zu. Unter der Befehlsgewalt von Generalleutnant Lothar von Trotha12 wurde von 1904 an der Aufstand der Herero brutal und vernichtend niedergeworfen.
Ein großer Teil der Herero floh in die fast wasserlose Omaheke-Wüste, in der Zigtausende von ihnen mitsamt ihren Familien und Rinderherden verdursteten.
Heute wird darüber noch gestritten, ob dieser Vorgang als Völkermord bezeichnet werden muss, aber die Historiker sind sich mehrheitlich darüber einig, dass es einer war. Man kann nicht sagen, wie Otto damals gedacht hat, wobei er wohl, wie viele andere auch, grundsätzlich die Politik des Kaiserreiches mit der Aneignung der Kolonien in Afrika und anderswo als notwendig und richtig angesehen hat.
Jedenfalls kehrte er Ende des Jahres 1904 ins Deutsche Reich zurück und zog sogleich nach Berlin. Ob er dort erst noch Jura studiert hat, konnte bisher nicht ermittelt werden. Für seine spätere Tätigkeit als Syndikus in Danzig wäre das eigentlich eine Voraussetzung gewesen. In Berlin hatte er bald eine Stelle als Redakteur bei der ersten deutschen Presseagentur Wolff’s Telegraphisches Bureau (WTB)13 inne. Im Berliner Vorort Steglitz wohnend, geriet er in die großbürgerlichen und adligen Kreise von Groß-Lichterfelde, damals noch eine selbstständige Gemeinde südwestlich von Berlin, zum preußischen Regierungsbezirk Potsdam, Landkreis Teltow, gehörig. Neureiches Bürgertum und alter Adel hatte sich dort vermehrt angesiedelt. In diesem Umfeld lernte Otto seine Frau Else Marie Ida Prüschenk von Lindenhofen kennen. Er heiratete sie noch Ende 1905 und geriet so weiter in den Kreis der konservativen, adligen Gesellschaft Berlins, die zum Teil aus dem Osten des Reiches dorthin gezogen war. Sein Hang zum Adel scheint hier seine Begründung zu finden. Die Familie Prüschenk von Lindenhofen hatte Besitz in den Ostprovinzen. Somit sah Otto wohl einen Grund, sich für den Adel im Osten zu engagieren.
Die weitere Prägung durch adelige Beziehungen bestimmte auch Ottos beruflichen Werdegang. Er blieb lange kaisertreu, hatte eine deutschnational-konservative Einstellung und vertrat öffentlich die Interessen des großbäuerlichen Adels aus dem Osten. Er fühlte sich durch die Vermählung mit einer adeligen Frau dem höheren Stand verpflichtet.
In Bückeburg arbeitete er als konservativer Schriftleiter für das Fürstenhaus Schaumburg-Lippe. Auch dort fand er die Nähe zum Adel, zum Hofstaat und fühlte sich anerkannt. Sein geschäftstüchtiger Schwager Heinrich Niehuus, der sich in Danzig angesiedelt hatte, war stramm konservativ. Er vertrat öffentlich die Interessen von Großbauern und östlichem Adel. Er gehörte zu den Unterzeichnern des Gründungsaufrufs der erzkonservativen, rechtsradikalen Deutschen Vaterlands Partei (DVLP)14 des Alfred von Tirpitz und des
Wolfgang Kapp15 im Jahr 1917. Otto Swalve profitierte von den Beziehungen dieses Mannes, als er 1922 eine neue Anstellung brauchte.
Als im Frühjahr 1933 die Nazis an die Macht gelangten, wurde auch Otto Swalve von der braunen Bewegung erfasst und gehörte zu den mehr als 1,7 Millionen Opportunisten, die dann schnell noch bis zum 1. Mai 1933 in die NSDAP16 eintraten, bevor der Aufnahmestop kam. Wir können heute schlecht beurteilen, ob es seiner politischen Richtung und Überzeugung voll entsprach, aber er erhoffte sich als Mitglied wohl berufliche Vorteile und glaubte möglicherweise, seine Interessen und die der adeligen Familie seiner Frau würden durch die NSDAP vertreten.
Von seiner Mitgliedschaft habe ich erst durch die Ergebnisse meiner Anfrage im Bundesarchiv Berlin erfahren. Davon hatte er nie geredet und ich hatte nur gehofft, dass es nicht so sein würde, geahnt hatte ich es schon, da er den Posten als Hauptkassierer im Deutschen Theater 1934 sonst eher nicht bekommen hätte, wie ein mir bekannter Historiker versichert hatte.
Es passt auch zu der politischen Entwicklung, die mein Großonkel über die Jahrzehnte gemacht hat. Es war insofern eine Entscheidung, die er gewollt vertrat. Seine konservativkaisertreue Haltung war damals wahrscheinlich aufgrund seiner kolonialen Erfahrungen in Afrika schon früh durchdrungen von den abwegigen Lehren des Sozialdarwinismus17, vom Recht des Stärkeren und der Überzeugung, das schnell wachsende deutsche Volk brauche mehr Lebensraum, um zu überleben, entweder in den Kolonien oder im Osten Europas. Diese ideologische Ausrichtung wurde auch von großen Teilen der konservativen Parteien aufgegriffen und von den Nazis am heftigsten vertreten. So gelangte Otto wohl auch auf diesem Weg im Mai 1933 in die NSDAP.
Sein einziger Sohn Heinrich Swalve ist nachweislich im Mai 1933 in die NSDAP eingetreten und erhoffte sich berufliche Vorteile. Aus NS-Perspektive wurden solche Mitglieder, die nach März 1933 massenhaft eintraten, damals als „Märzgefallene“18 verspottet, in Anlehnung an die Toten der gescheiterten Revolution auf dem Alexanderplatz am 18. März 1848.
Das reale Leben meines Großonkels verlief also anders, als ich es mir vorgestellt und gewünscht hatte. Wie es tatsächlich verlief und was er wirklich wollte, kann hier zwar nur lückenhaft dargestellt und vermutet werden, aber mit teils unerwarteten neuen Fakten versehen werden. Der „hochbegabte“ Onkel Otto erschien mir zu Lebzeiten nett und hilfsbereit, aber er verbarg so die andere Seite seines Seins dahinter, wie etliche andere, die in der Zeit gelebt hatten und darüber später häufig den Mantel des Schweigens deckten. Sein Sohn Heinrich scheint noch weit mehr verstrickt in den braunen Sumpf gewesen zu sein und es gelang ihm nicht ganz, alles zu verbergen, während er stärker als sein Vater den Hang zum „Höheren“, also zum Adel hatte, weshalb er sich auch mit dem Namen seiner adeligen Mutter schmückte.
Angefangen hat die Geschichte in Ostfriesland, genauer im Rheiderland, einer flachen Flussmarsch zwischen der Ems, dem Dollart und der niederländischen Grenze. Der Marschboden im Rheiderland wurde seit jeher als sehr fruchtbar beschrieben, aber aufgrund seiner Entstehung etwas höher gelegen und somit auch als ackerfähig zu bezeichnen. Die Bauern dort, im Volksmund „Polderfürsten“ genannt, galten als wohlhabend und bewirtschafteten teils prächtige Gulfhöfe.
Hier bestand seit langer Zeit eine enge, kulturelle und sprachliche Verbindung zum Nachbarland. So ist bis heute der überwiegende Teil (ca. 70%) der Bevölkerung evangelisch reformiert und bis 1850 wurde in den Kirchen noch auf holländisch gepredigt19. Ottos Eltern waren keine Polderfürsten, aber wohlhabende Bauern und überzeugte reformierte Protestanten. Zu den calvinistischen Tugenden dieser Religionsrichtung zählt man eigentlich Fleiß, Bescheidenheit und Disziplin. Otto Swalve wurden durchaus Fleiß und Disziplin nachgesagt, wie wir später noch erfahren werden. Den Erzählungen ist zu entnehmen, dass er doch eher zurückhaltend und verschlossen wirkte und man kann sich aber auch vorstellen, dass er die Annehmlichkeiten des Adels nicht verabscheut hat.
Abbildung 5 Otto Swalve mit Bruder Hermann Swalve und Schwester Aaltje Gruis, geb. Swalve in Neuwesteel 1956 (Sammlung Heino Kok)
1 Die Programmzeitschrift Hörzu war am 11. Dezember 1946 mit einer Startauflage von 250.000 Exemplaren auf den Markt gekommen.
2 Seinen ersten Auftritt hatte Mecki auf der Titelseite der Hörzu 43/1949. Zusammen mit seiner Frau Micki, Charly Pinguin, dem verschlafenen Schrat, Chily, dem Goldhamster, Dora, der Krähe, dem Raben Poppo und vielen weiteren Figuren löst Mecki so manches knifflige Rätsel.
3 Die Comic-Reihe Petzi wurde 1951 von Carla und Vilhelm Hansen erfunden und trägt den dänischen Originaltitel Rasmus Klump. Die Reihe erschien zunächst weltweit in vielen Tageszeitungen, wurde ab 1953 in Deutschland auch in Form von farbigen Bilderbüchern durch den für die Veröffentlichung dieser Reihe gegründeten Carlsen Verlag vertrieben, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Petzi&oldid=184015898,zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
4 Der Ausspruch „Wissen ist Macht“ ist im Deutschen ein geflügeltes Wort, das auf den englischen Philosophen Francis Bacon (1561–1626) zurückgeht. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wis-sen_ist_Macht&oldid=190768141, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
5 Reader’s Digest ist eine Zeitschrift mit internationaler Verbreitung, die ursprünglich dadurch bekannt wurde, dass sie Artikel anderer Zeitschriften sowie Buchauszüge und Bücher in mehreren Sprachen, teilweise in gekürzter Form, veröffentlichte. Die deutsche und die schweizerische Ausgabe erschienen erstmals unter dem Titel „Das Beste aus Reader’s Digest“ im September 1948. Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH.
6 Siehe Anhang.
7 Das heutige Namibia.
9 Siehe dazu Norbert Friedrich Krekeler, Zur Deutschtumspolitik des Auswärtigen Amtes in den durch den Versailler Vertrag abgetretenen Gebieten, 1918-1933: der Revisionsanspruch und die finanzielle Unterstützung deutscher Volksgruppen in Polen, 1972.
10 Die Osthilfe war von 1926 bis 1937 ein agrarpolitisches Unterstützungsprogramm der Reichsregierung und der Preußischen Staatsregierung für die östlichen preußischen Provinzen. https://de.wikipedia.org/w/in-dex.php?title=Osthilfe_(Deutsches_Reich)&oldid=185443886, zuletzt eingesehen am 01.04.2019.
11 heute: Piła in Polen.
12 Adrian Dietrich Lothar von Trotha (* 3. Juli 1848 in Magdeburg; † 31. März 1920 in Bonn) war ein preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie. Sein „Vernichtungsbefehl“ gilt als Grundlage des Völkermordes an den Herero und Nama. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lothar_von_Trotha&ol-did=186605899, zuletzt eingesehen am 06.05.2019.
13 Vgl. Dieter Basse, Wolff's Telegraphisches Bureau 1849 bis 1933, Agenturpublizistik zwischen Politik und Wirtschaft, München, 1991.
14 Die Deutsche Vaterlandspartei (DVLP) war eine rechtsradikale deutsche Partei, die in der Schlussphase des Ersten Weltkrieges aktiv war. Die Partei griff Elemente konservativer, nationalistischer, antisemitischer und völkischer Ideologien auf; sie gilt organisationsgeschichtlich als präfaschistisches Scharnier zwischen der wilhelminischen Rechten und dem neuen Rechtsradikalismus der Nachkriegszeit https://de.wikipedia.org/w/in-dex.php?title=Deutsche_Vaterlandspartei&oldid=181112301, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
15 Wolfgang Kapp (* 24. Juli 1858 in New York, USA; † 12. Juni 1922 in Leipzig) war ein deutscher Verwaltungsbeamter, zuletzt Generallandschaftsdirektor in Königsberg https://de.wikipedia.org/w/in-dex.php?title=Wolfgang_Kapp&oldid=186539503, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
16 Vgl. Eckhard Jesse, Tom Mannewitz (Hg.), Extremismusforschung, Baden-Baden, 2018, S. 558.
17 Sozialdarwinismus ist eine sozialwissenschaftliche Theorierichtung, die einen biologistischen Determinismus als Weltbild vertritt. Sie war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Ersten Weltkrieg sehr populär, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sozialdarwinismus&oldid=187705939, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
18 Falter, Jürgen W. Die "Märzgefallenen" von 1933: neue Forschungsergebnisse zum sozialen Wandel innerhalb der NSDAP-Mitgliedschaft während der Machtergreifungsphase (1998).
19 Im Nachlass meiner Tante Anna befand sich eine holländische Bibel der Familie Swalve, die ich aufbewahrt habe.
Die Familie Swalve aus Jemgumgeise bei Holtgaste
Abbildung 6 Mutter Anna Harms Swalve, geb. Duhm (Sammlung Heino Kok)
Abbildung 7 Vater Heinrich Jans Swalve (Sammlung Heino Kok)
Die Familie Swalve im Rheiderland stammt wahrscheinlich von der Familie Swalve in Emden ab, die aus Rheine kam. Der Stammvater der Familie Swalve in Emden war Franz I. Swalve (1545-1603). Im Jahr 1591 wurde er dort als Bürger registriert.20 Der älteste bekannte Swalve im Rheiderland ist Hindrich (Hindrik) Swalve (vor 1660-19.9.1731), gestorben in Bunde21. Der Name seiner Frau ist unbekannt. Er wurde als Vogt in der Bunder Vogtei im Amt Leerort bezeichnet. Ottos Familie stammt in direkter Linie von diesem Hindrich Swalve aus Bunde ab.
Heinrich Jans Swalve war der Sohn von Jan Gerds Viennen Swalve (1813-1860) und Okkea Jürina Deters Gruis (1814-1877), geboren am 2. Mai 1844 in Bunderhee. Er verstarb am 23. April 1917 in Böhmerwold und trug das Eiserne Kreuz von 1870/7122. Wahrscheinlich hat er während des Deutsch-Französischen Krieges als Soldat beim Ostfriesischen Infanterie Regiment Nr. 78 aus Emden gedient23. Als der Krieg im Sommer 1870 begann, war Heinrich Jans Swalve 26 Jahre alt. Drei Jahre danach hat er geheiratet.
Anna Harms Duhm24 war die Tochter von Harm Duhm (1817-1864) und Aaltje van Lessen (1822-1864), geboren am 27. März 1854 in Jemgumgeise. Sie verstarb am 31. Dezember 1935 bei ihrer Tochter in Eisinghausen bei Leer. Anna zählte noch keine 10 Jahre, als die Eltern am 8. Januar 1864 zusammen mit der Zwillingsschwester der Mutter, Frauke25, beim Schlittschuhlaufen im Groß-Soltborger Sieltief (Dreistrom) ertranken. Nur der Ehemann der Schwester, Cornelius Tjaben van Lessen26, überlebte. Dieses traurige Ereignis wurde in der Familie stets weitererzählt und dokumentiert sich auch im Kirchenbuch (Siehe Anhang). Auf dem Grabstein ihres Vaters steht: „Ist mit seiner Frau u. deren Zwillingsschwester auf der Rückkehr von Weener in der Höhe von Holtgaste durchs Eis gebrochen.“27 Anna Harms Duhm wuchs dann als Waisenkind zusammen mit ihren Geschwistern Friedrich Bernhard, Aleide Hermanne und Elise Margarethe vermutlich bei der Familie ihrer Tante Etha van Lessen, geb. Duhm auf.
Abbildung 8 Geschwister Duhm, v. l. Anna, Friedrich, Aleide und Elise, vor Dez. 1935 (Sammlung Heino Kok)
Heinrich Jans Swalve und Anna Harms Duhm haben am 7. April 1874 in Bunde geheiratet. Sie hatten fünf Kinder:
Otto Cornelius Swalve
, geboren am 5. September 1876 in Jemgumgeise. Er hat
Else Marie Ida Prüschenk von Lindenhofen
am 23. Dezember 1905 in Berlin geheiratet, arbeitete u. a. als Zahlmeisteraspirant, Redakteur und Syndikus
28
bei der Marine, bei Zeitungen, einer Bank in Danzig und als Hauptkassierer beim „Deutschen Theater“ in Berlin. Er verstarb am 1. Dezember 1959 in Eisinghausen.
Hermann Ahlrich Swalve
, geboren am 21. April 1878 in Jemgumgeise.
29
Er hat
Helene (Eta) Mansholt Blickslager
30
am 25. April 1907 in Böhmerwold geheiratet, war Landwirt und bewirtschaftete in Jemgumgeise die Hofstelle Nr. 15 mit 38,6 ha Land
31
. Später zog die Familie nach dem 1934 gegründeten Neuwesteel
32
im Leybuchtpolder bei Norden. Er verstarb am 30. Oktober 1956 in Neuwesteel.
Johann Gerhard Viennen Swalve
, geboren am 11. April 1879
33
in Jemgumgeise. Er hat 1904
Hermine Feekeline Goeman
34
geheiratet und war Landwirt in Marienchor. Er verstarb am 20. August 1953 in Marienchor.
Aaltje Margarethe Swalve
, geboren am 31. Juli 1880 in Jemgumgeise
35
. Sie hat den Landwirt
Daniel Jakobus Gruis
36
am 24. April 1901 in Holtgaste geheiratet. Kurz danach kauften und bewirtschafteten sie das „Gut Eisinghausen“, mit 161 ha Land
37
. Sie verstarb am 18. Januar 1957 in Eisinghausen.
Ibeling Upkes Swalve
, geboren am 29. Juni 1885 in Jemgumgeise
38
. Er hat 1914 in Landschaftspolder
Eta de Muink Hopkes
39
geheiratet, war Landwirt und bewirtschaftete in Jemgumgeise die Hofstelle Nr. 13 mit 36,7 ha Land
40
. Er verstarb am 9. April 1946 in Holtgaste.
Der Vater Heinrich Jans bewirtschaftete nach der Hochzeit den Pachthof der Familie Duhm in Jemgumgeise. Der Hof gehörte der in Ostfriesland sehr bekannten und wohlhabenden Familie Conring41. Heinrich wurde bei der Trauung noch als Müller zu Bunde bezeichnet. Es ist unklar, ob und wann er Teilhaber oder Pächter dieser Mühle gewesen ist42.
Otto blieb der Einzige unter den fünf Geschwistern, der den Aufbruch aus seiner ostfriesischen Heimat in die Ferne wagte, der sich sicher nicht immer einfach für ihn darstellte. Er wurde nicht Landwirt wie seine Brüder, sondern wählte einen Weg, der über die Militärzeit bei der Marine in eine ferne Kolonie und danach viele Stationen außerhalb Ostfrieslands durchlief, um am Ende des zweiten Weltkrieges wieder in der Heimat bei seiner Schwester auf einem Bauernhof anzukommen.
20 Hermann Fischer: Franz Swalve 1590-1604 in Emden, Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familienund Wappenkunde, Heft 2, 2003, S. 34.
21 Dietrich Hensmann, Die Familie Swalve im Rheiderland, Der Deichwart, Nr. 15, Weener, 15.04.1967 22 Im Krieg 1870/71 wurden an rund 3,2 % der deutschen Feldzugsteilnehmer insgesamt 48.574 Eiserne Kreuze verliehen, davon nur 1.295-mal die 1. Klasse. Sämtliche Patente und Besitzzeugnisse für die Auszeichnungen wurden unter dem Datum des 19. Januar 1873 ausgefertigt, auch bei den vorgekommenen posthumen Verleihungen. Institut Deutsche Adelsforschung, http://home.foni.net/~adelsforschung1/eh-ren00.htm, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
23 Das Regiment IR 78 „Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig“ nahm 1870/71 am Deutsch-Französischen Krieg teil. Ein Denkmal dokumentiert die Beteiligung an der Schlacht bei Vionville am 16. August 1870. Schlachten: 1870/71 gegen Frankreich: 6.8. Vionville-Mars la Tour; 18.8. Gravelotte-St. Privat; 19.8.-27.10. Einschl. Metz; 24.11. Ladon, 28.11. Beaune la Rolande, 10.12. Beaugeny-Cravant; 15.12. Vedôme, 20.12 Monnaie, 6.1. Montoire, 9.1. Chazaigne u. l'Homme, 11. nur (F.) u. 12.1. Le Mans, 14.1. Chassille (F.), 15.1. St. Jean s. Erve (F.), 15.1. Sillé le Guillaume (I. u. 6. Kp.). https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Infante-rieRegi_ment_%E2%80%9EHerzog_Friedrich_Wilhelm_von_Braunschweig%E2%80%9C_(Ostfriesi-sches)_Nr._78&oldid=186287820, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
24 Von meiner Uroma Anna Duhm (Ticktack-Oma) habe ich bis heute noch wunderschöne Frühstücksteller mit ihren Initialen, die ich in Erinnerung an ihr schweres Schicksal hütete.
25 Frauke van Lessen (* 3.November 1822 in Holtgaste, † 8. Januar 1864 in Holtgaste).
26 Cornelius Tjaben van Lessen (* 14. April 1821 in Böhmerwold, † 1.Mai 1901 in Böhmerwold).
27 Wilhelm Lange, Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695–1900), Aurich, 2001, Nr. 407, S. 80.
28 Syndikus: Jurist, der als Rechtsanwalt zugelassen ist, aber überwiegend oder nur für ein Unternehmen, eine Bank, einen Verband oder Ähnliches im Rahmen eines Dienstvertrages tätig wird.
29 Helmut Anneessen, Die Familien der Kirchengemeinde Böhmerwold (1695 - 1910), Aurich, 2004, Nr. 994, 995.
30 Helmut Anneessen, Die Familien der Kirchengemeinde Böhmerwold (1695 - 1910), Aurich, 2004, Nr. 995, Klaas-Dieter Voß, Die Familien der Kirchengemeinde Oldendorp (1712 - 1911), Nr. 98, Haustochter zu Böhmerwold.
31 Adolf Freiherr Maltzan (Hg.), Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Band Hannover, Berlin, 1929.
32 Neuwesteel ist ein in den Jahren 1928 bis 1929 eingedeichter Polder, dessen Name auf das alte, in den Sturmfluten von 1373 und 1387 untergegangene Dorf Westeel zurückgeht. HOO Neuwesteel, https://www.ostfriesischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/BIBLIOTHEK/HOO/HOO_Neuwesteel.pdf,zuletzt eingesehen am 01.04.2019.
33 Wilhelm Lange, Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695–1900), Aurich, 2001, Nr. 1570, Helmut Anneessen, Die Familien der Kirchengemeinde Böhmerwold (1695 - 1910), Aurich, 2004, Nr. 994.
34 Ebd. Nr. 1570, Enno Janssen, Erhard Schulte, Die Familien der Kirchengemeinden Grotegaste (1725-1900) und Mitling-Mark (1637-1900), Aurich, 1995, Nr. 285.
35 Wilhelm Lange, Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695–1900), Aurich, 2001, Nr. 1570, Helmut Anneessen, Die Familien der Kirchengemeinde Böhmerwold (1695 - 1910), Aurich, 2004, Nr. 994.
36 R und C. Koens, Die Familien der Kirchengemeinde Wymeer (1713 - 1900), Westerstede, 2004, Nr. 1100.
37 Adolf Freiherr Maltzan (Hg.), Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Band Hannover, Berlin, 1929.
38 Wilhelm Lange, Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695–1900), Aurich, 2001, Nr. 1570, Helmut Anneessen, Die Familien der Ev.-ref. Kirchengemeinde Marienchor, Nr. 837.
39 Wilhelm Lange, Die Familien der Kirchengemeinde Holtgaste (1695–1900), Aurich, 2001, OFB Holtgaste Nr. 1570.
40 Adolf Freiherr Maltzan (Hg.), Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Band Hannover, Berlin, 1929.
41 Der Hof wurde nach dem Krieg neu aufgebaut und befindet sich bis heute im Besitz dieser Familie Conring aus Weener (Pächter ist Johann Willms).
42 Leider gibt es über die Mühle in Bunde wenig überlieferte Akten im Archiv in Aurich.
Ottos Kindheit in der Geise
Der Wohnplatz Geise wird heute als Jemgumgeise bezeichnet und gehört wie die kleineren Dörfer und Gehöfte Soltborg, Ukeborg, Deddeborg, Bentumersiel und Jemgumkloster zur Ortschaft Holtgaste.43
Die Geise bestand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus vier Höfen mit 31 bzw. 36 Einwohnern. Im Statistischen Handbuch des Königreichs Hannover von 1824 wird die Geise mit vier Herdstellen angegeben und zur Untervogtei Bingum gehörig geführt. In einer Beschreibung über die Geise heißt es: „1494 wurde dieser Ortsteil mit dem Namen „Gese“ mit einem Deich umgeben. „Gese“ bedeutet so viel wie „Seeland“. Die Geise war ein Nebenarm der Ems.“44
Arends beschrieb diese Landschaft1818 folgendermaßen: „Nordseits Holtgaste wird der Boden etwas höher bis zum Muhsdyk (Mausedeich) und noch etwas weiter. Diese Gegend wird die Geise genannt; die umliegenden Dörfer haben Antheil daran, auch stehen mehrere einzelne Plätze daselbst, welche Erbpacht an die Krone bezahlen. Hier ist der Boden vorzüglich schön, eine höchst fruchtbare gartenähnliche Erde, so sehr tief geht. Westseits der Geise zieht sich dann der Boden bis zum alten Deich hin; Bömerwold südseits, Mariencoor nordseits liegen darauf, sie haben nicht so guten Boden, wie die Geise, auch ist die Erde etwas sandig, und an manchen
Abbildung 9 Jemgum(er)geise hatte damals vier Hofstellen, wie auch heute noch (Ausschnitt aus Preuß. Landesaufnahme 1897-1912, Blatt 2710 Leer)
Abbildung 10 Otto Cornelius Swalve in Jemgumgeise als Kleinkind (Sammlung Heino Kok)
Abbildung 11 Hof Swalve auf der Geise 1920-1930er Jahre (Sammlung Heino Kok)
Stellen nur einige Zoll hoch, mit Darg darunter. Ganz am alten Deich liegt Bunderhammrich, dessen Boden dem der Geise wieder mehr gleichkommt.“45
In der Landwirtschaftlichen Statistik von 1841 wird folgendes über die Geise berichtet:
„Eine ausgezeichnete fette, reiche Grasgegend befindet sich, unter dem Namen der Geise im letzteren Amte. Selbst auf den schwersten Fettweiden ist man nicht dafür, sehr schweres Vieh zu weiden, und man bleibt am liebsten bei 1000 Pfd. stehen.“46
Hier auf dem Gulfhof seiner Eltern erblickte Otto am 5. September 1876 das Licht der Welt und verbrachte seine ersten Jahre. So begegnete ihm schon früh diese besondere Landschaft mit einer unendlichen Weite rund um die vier weitab gelegenen Hofstellen, je auf einer flachen Warft, und die dort betriebene Viehwirtschaft. Die Weite und der Eindruck von Unendlichkeit müssen ihn geprägt haben. Sie wirkten bestimmt auch belastend in den regnerischen Jahreszeiten. Im Winter waren die Wasserläufe oft gefroren.
Selbst heute erscheint die Geise mir bei einer Ortsbesichtigung noch genauso, wie sie damals wohl wirkte, bis zur nächsten Ortschaft nur kilometerweite Weiden und Felder, von Wasserläufen zur Entwässerung durchtrennt. Der ungebrochene Blick zum entfernten Horizont hatte auch eine gewisse Einsamkeit zur Folge, aber Otto bekam schnell weitere Geschwister. Zudem wohnten noch einige Mägde und Knechte auf dem Hof, so dass es niemals langweilig gewesen sein wird. Mit zwei Jahren bekam Otto den Bruder Hermann, dann mit drei den Bruder Johann. Seine Schwester Aaltje wurde geboren, als Otto vier wurde. Mit neun Jahren bekam Otto dann noch den Nachzügler Ibeling als Bruder. Da ging Otto bereits in die Schule.
Abbildung 12 Heutige Besiedlung der vier Hofplätze in Jemgumgeise Der Hof Swalve war der zweite Hof von links, Google-Maps, https://www.google.com/maps/@53.2287809,7.3557699,1870a,35y,38.98t/data=!3m1!1e3
Es zeigte sich bald, dass Otto andere Interessen hatte, als den Hof der Eltern zu übernehmen. Sein Ziel war es, seinen eigenen Weg aus dieser Einsamkeit in die große weite Welt zu finden. Es gab ja noch drei Brüder, von denen einer den Hof übernehmen konnte. Ibeling Upkes, der Jüngste, übernahm ihn dann später.
43 Vgl. Heimat- Adressbuch Landkreis Leer 1968/69, S. 22.
44 Freerk van Lessen, HOO Holtgaste, Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft, https://www.ostfriesi-schelandschaft.de/fileadmin/user_upload/.../HOO_Holtgaste.pdf, zuletzt eingesehen am 30.04.2019.
45 Fridrich Arends, Ostfriesland und Jever: in geographischer, statistischer und besonders landwirtschaftlicher Hinsicht, Hannover, 1822, S. 179.
46 Landwirtschaftliche Statistik der deutschen Bundesstaaten: Band 2, Teil 2, Braunschweig, 1841, S. 281.
Ottos Schul- und Ausbildungszeit
Abbildung 13 Abbildung 20 Kopie aus dem Statistischen Handbuch für das Königreich Hannover47
Abbildung 14 Auszug aus dem Lesebuch von Gabriel/Supprian, S. 402-403
Die zuständige Grundschule, von April 1883 bis April 1888, die Otto besuchte, befand sich in Holtgaste. In der „Parochie“47 Holtgaste gab es für die Kinder der Geise, aber auch möglicherweise in Soltborg, wenn es dort genügend Kinder gab, eine Schule bis zur fünften Klasse. Sie unterstanden dem Landesherrn. Im Jahr 1869 war das Gebäude der alten Schule in Holtgaste abgerissen worden und es wurde im gleichen Jahr eine neue einklassige Schule gebaut. Die durchschnittliche Schülerzahl lag bei 30.48
Das Rheiderland hatte damals neben den öffentlichen Schulen eine verhältnismäßig hohe Zahl an Privatschulen, die vor allem auf den einzelnen Höfen und kleinen Siedlungen anzufinden waren. Wegen der ungünstigen Verkehrsverhältnisse erwiesen sich die Schulwege viel beschwerlicher als heute. Es gab erst seit 1864 eine gepflasterte Straße entlang des Deiches von Bingum bis Jemgum, 1873 baute man die Straße bis Ditzum weiter, da man sie zur Deichsicherheit benötigte. Die meisten Schulen liefen einklassig und es musste Schulgeld bezahlt werden. In der Schule herrschte ein kasernenhofähnlicher Ton und so sah auch die Erziehung aus. Die Lehrpersonen, oft ohne pädagogische Ausbildung, sprachen die Schüler in Befehlsform an. Die Kinder hatten höflich und respektvoll zu sein, sonst drohten Schläge mit dem Rohrstock. Allerdings durfte das Maß der Züchtigung niemals bis zu Misshandlungen ausgedehnt werden, wobei die Bestrafung der Kinder aus unterschiedlichen Familien meist sehr differenziert erfolgte.49 Da das Militär im Kaiserreich eine wichtige Rolle spielte, begegneten die Kinder diesem Leben sehr früh. Schon in den Kinderliedern ging es meist militärisch zu. Gelesen wurde in der Regel aus der Bibel, dem Katechismus und dem Gesangbuch bis ab Mitte des 19ten Jahrhunderts durch die Benutzung von Lesebüchern als Hilfsmittel für den Unterricht eine Neuerung eingeführt wurde50. Seit 1872 hatte Preußen einen Fächerkanon für Volksschulen festgelegt, dazu gehörten in der Unterstufe vier Stunden Religion, 11 Stunden Deutsch, vier Stunden Rechnen und eine Stunde Singen. In der Mittelstufe kamen die Fächer Zeichnen, Realien und Turnen/Handarbeit dazu. Unter Realien verstand man „nützliche Wissenschaften“ wie z. B. Geschichte, Erdkunde und Naturkunde.51 Damit erhielt der Unterricht in den Realien erstmals zu Ungunsten des Religionsunterrichts Einzug in die preußischen Volksschulen. Die Unterstufe dauerte zwei Jahre und die Mittelstufe drei.
Von Ottos Schwester Aaltje befindet sich ein Lesebuch aus der damaligen Zeit noch in meiner Sammlung. Es handelt sich dabei um ein Buch für die Mittel- und Oberstufe, geschrieben von den Schulräten Gabriel und Supprian, mit folgendem Titel „Deutsches Lesebuch mit Bildern für Volksschulen. Ausgabe A. in einem Bande“, erschienen 1888 im Verlag Velhagen & Klasing52. Das Buch stellt eine Mischung aus Sagen, Bibelgeschichten, Berichten über Tiere, fremde Länder und technische Errungenschaften dar. Die deutsche Geschichte bis zum damaligen Kaiser Wilhelm I. spielt eine wichtige Rolle.
Abbildung 15 Ehemaliges Gebäude des Gymnasiums in der Königstraße in Leer (Foto Heino Kok 10/2019)
Die Autoren setzen deutlich auf deutsch-nationale Bildung und Erziehung. In Rückgriffen auf das Mittelalter wird mit moralisierenden Beispielen die treue Haltung zu Kirche, Kaiser und Familie hochgehalten. Arbeit und Gehorsam werden zu deutschen Tugenden erklärt.
Das Volksschulwesen hatte im 19. Jahrhundert den Auftrag gehorsame und gottesfürchtige Untertanen hervorzubringen.53 „Damit sollten die von den Rekrutierungsstellen des Militärs beklagten Gesundheitsmängel als Folge der Kinderarbeit beseitigt sowie die allgemeine Schulpflicht, die Alphabetisierung der Bevölkerung und die Nationalerziehung (Volksschulen als Teil der Nation) durchgesetzt werden.“54
Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sahen sich die meisten Städte in Preußen gezwungen, ihr Schulangebot stärker an den neuen Qualifikationsanforderungen von Technik, Handel, Wirtschaft, Militär und einer expandierenden Verwaltung auszurichten. Der Reformdruck, der vom Bevölkerungswachstum, der Zuwanderung und der Industrialisierung ausging, nahm zu und das neuhumanistische Gymnasium mit seiner Geringschätzung der Naturwissenschaften und neuen Sprachen war nicht in der Lage, diese Ansprüche zu erfüllen. So kam es nach 1872 u. a. verstärkt zur Gründung von „Realanstalten“ mit naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Fächern. Es entstanden „Realgymnasien“ und „Oberrealschulen“ als Einrichtungen für höhere Bildung, die meist einem moderneren Curriculum mit Englisch und Französisch folgten.
Im April 1888 hatte Otto die Mittelstufe der Volksschule beendet. Von da an bis April 1896 besuchte Otto das Gymnasium, wohl zuerst in Leer, dann in Emden. Das Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer, 1584 als Lateinschule gegründet, erlaubte als Gymnasium nur Jungen den Zugang. Daraus entwickelte sich damals eine „Königliche Doppelanstalt“, eine Kombination aus einem humanistischen Gymnasium mit einem Realgymnasium in der Königstraße in Leer.
Der Weg nach Leer führte von der Geise über Soltborg am Deich entlang über Bingum bis zur Emsfähre, die in Leerort ankam, dann über Groninger- und Neue Str. bis zur Königsstraße. Ein langer Weg, aber machbar. Warum Otto später nach Emden wechselte, wissen wir nicht.
Als einziges Gymnasium bestand in Emden damals das „Königliche Wil-helms-Gymna-sium“. Seit 1874 war das Gymnasium zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. unter diesem Namen eingetragen. Am 9.
Abbildung 16 Die „Kaiser Friedrich-Schule“ in der Bollwerk-Straße 25/26 als Entwurf, Friedrich Schreck (Hg.), Deutsche Bauzeitung, Berlin, 16.11.1889, Nr. 92, S. 555
April 1877 zog die Schule in ein neues Gebäude um in den Bereich etwa an der Ecke Neutorstraße-Bentinksweg. 1886 wurde die höhere Bürgerschule vom Gymnasium abgezweigt und erhielt 1888 nach Kaiser Friedrich III. den Namen „Kaiser-Friedrich-Schule“.
Es scheint so zu sein, dass Otto Swalve hier in der Bollwerk-Straße 25/26 seine letzten Schuljahre bis zum Abschluss verbrachte. Der Weg dorthin war ungleich weiter, entweder bis Ditzum an der Ems entlang, mit der Fähre hinüber und auf der anderen Emsseite weiter, oder schon eher etwa bei der Jemgumer Fähre auf die andere Seite. Insgesamt ein Weg von ca. 25 km. Er wird also wohl eher in Emden bei einer Gastfamilie gewohnt haben. Wenn Otto Ostern 1887 mit 11 Jahren zum Gymnasium in Leer wechselte, wird er spätestens 1896 den Abschluss des Realgymnasiums gemacht haben.
Sowohl im Elternhaus als auch in der Schule galt damals eine strenge Disziplin mit strikter Unterordnungspflicht unter Eltern und Lehrer. Das angebotene Wissen wurde gepaukt, Fragen zu stellen und zu diskutieren war unüblich. Besonders der Vater, aber auch alle Lehrer und Pastoren mussten von den Kindern mit größtem Respekt behandelt werden. Der Einsatz der Prügelstrafe war üblich. Auf militärische Zucht und Ordnung wurde seit Kindesalter geachtet.
Auf ein Leben auf einem Bauernhof zielte Ottos Streben damals sicher nicht. Dass der Vater ihn zur Marine schickte und für seine Ausbildung bezahlte, ergab sich als neue Möglichkeit, die sich damals nicht nur in Ostfriesland für gut situierte Familien auftat.
„Mit der Reichsgründung am 18. Januar 1871 durch die Proklamation Wilhelms I. zum Deutschen Kaiser wurde Ostfriesland in den konstitutionell-monarchistischen Bund aus 22 Einzelstaaten und drei freien Städten eingebunden, stand aber dennoch weiterhin unter preußischem Einfluss. […] Wirtschaftlich blieben Ackerbau und Viehzucht, insbesondere die Rinderzucht dominierend, wie schon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts. Aurich und Leer waren zu dieser Zeit bedeutende Viehhandelsplätze. Die Industrialisierung fand hingegen nur sehr zögerlich statt. Bedeutung erlangten die Werften in Leer und Emden. Hier lagen auch die Handelszentren des Regierungsbezirks.“55
Das Deutsche Reich wandelte sich von einer grundsätzlich landwirtschaftlichen Nation in eine industrielle. Viele ehemalige Bedienstete aus der Landwirtschaft, Handwerker und Kleinbauern hatten keine andere Wahl als auszuwandern. Armut und Mangel an gutem Ackerland lieferten die häufigsten Gründe dafür. Landarbeiter, aber auch kleine Handwerker stellten das Hauptkontingent der Übersiedler. Nach 1880 kam es noch einmal zu einer Auswanderungswelle in die Vereinigten Staaten, die jedoch nicht mehr die Stärke der vorherigen Auswanderungsbewegungen erreichte.
Für die gut situierten Bauernsöhne im Rheiderland blieb der Weg ins Studium oder zum Militär, sofern sie keinen Hof erbten oder in eine benachbarte Bauernfamilie einheiraten konnten. Otto hätte als ältester Sohn den Hof übernehmen können, aber er scheint andere Absichten gehabt zu haben.
47 Eine Parochie ist der Amtsbezirk eines Pfarrers, das heißt ein Pfarrbezirk oder Pfarrei. Sie ist der unterste, kirchliche Verwaltungs- und Seelsorgebezirk mit einem eigenen Pfarrer einer Kirche, die nach dem Parochialprinzip organisiert ist.
48 Vgl. Freerk van Lessen, HOO Holtgaste, Ortsdatenbank der Ostfriesischen Landschaft https://www.ostfrie-sischelandschaft.de/fileadmin/user_upload/.../HOO_Holtgaste.pdf, zuletzt eingesehen am 30.04.2019.
49 Vgl. Wimod Reuer, Schulzucht in: Wimod Reuer, Zeitlich Zwang, Arbeit und Lehr bringt die Kinder zu grosser Ehr, Beiträge zur Geschichte der ostfriesischen Volksschule zwischen der Reichsgründung 1871 und dem 1. Weltkrieg, Folmhusen, 2018, S. 263.
50 Vgl. B. E. Siebs: Das Rheiderland, Beiträge zur Heimatkunde des Altkreises Weener, Kiel, 1930.
51 Vgl. Wimod Reuer, Die Lehrgegenstände der Volksschule und der Stundenplan der Schule zu Nordgeorgsfehn in: Wimod Reuer, Zeitlich Zwang, Arbeit und Lehr bringt die Kinder zu grosser Ehr, Beiträge zur Geschichte der ostfriesischen Volksschule zwischen der Reichsgründung 1871 und dem 1. Weltkrieg, Folmhusen, 2018, S. 141
52 Gabriel/Supprian, Deutsches Lesebuch mit Bildern für Volksschulen. Ausgabe A. in einem Bande, Leipzig, 1888, S. 402, f.
53 Vgl. Eico Jürgens, Jutta Standop, (Hg.), Taschenbuch Grundschule: Grundschule als Institution, Hohengehren, 2012.
54https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksschule&oldid=186248972, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
55https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Geschichte_Ostfrieslands&oldid=187533449, zuletzt eingesehen am 08.05.2019.
Otto bei der Kaiserlichen Marine als Zahlmeisteraspirant
Laut des Verzeichnisses von Militär- und Marineoffizieren von 1600-1918 trat Otto Swalve am 1. April 1896 seinen Dienst bei der II. Werftdivision (II. W. D.) der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven an. Am 14. April 1900 wurde er zum Zahlmeisteraspiranten ernannt56.