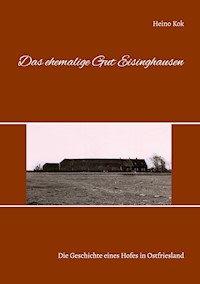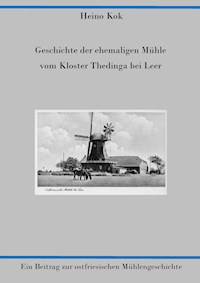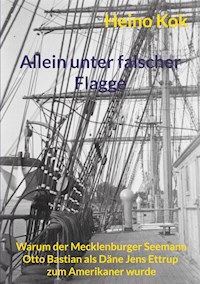
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Buch dokumentiert das ungewöhnliche Leben eines Mecklenburgers, das durch die Wirren des Ersten Weltkrieges nicht wie geplant verlief. Er wurde notgedrungen zum Amerikaner und kam erst 1959 in seine Heimat zurück als Besucher. Die Lebensgeschichte des Seemannes Otto Bastian verlief durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges anders als er und seine Familie es sich gewünscht hatten. Fern der Heimat in Chile hielt er es nicht mehr aus auf seinem internierten Segelschiff, der "Viermastbark Lisbeth" auf der Reede des trostlosen Iquique. Er verließ das Schiff heimlich und suchte einen Weg nach Hause, nach Wismar in Mecklenburg. Das gelang ihm nicht, aber er schaffte es, auf einem amerikanischen Schiff unter falscher Identität, "falscher Flagge", wie er es selbst ausdrückte, nach Honolulu zu kommen. Dort beantragte er unter seinem erfundenen dänischen Namen die amerikanische Staatbürgerschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Klaus und Irmgard Lehmbecker Danke für die Aufgabe, dieses Buch schreiben zu dürfen!
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Klaus Lehmbecker
Einige Gedanken zum Leben der Seemänner vorweg
Vorwort
Schul- und Ausbildungszeit
Die lange Reise nach Amerika und der Krieg
Der Matrose verlässt sein Schiff
Der Seemann heiratet und wird Amerikaner
Der Seemann wird sesshaft
Wieder Krieg
Ein aktiver Rentner sucht seine Wurzeln
Nachwort
Anhang
Die Oldenburger Marine
Die Aufnahmebedingungen des Deutschen Segelschiff-Vereins
Die Großherzogin Elisabeth
Die Bark Hermes strandete bei Marstal
Der russische Dampfeisbrecher Jermak
Reeder August Cords
Reeder Hans Hinrich Schmidt
Karten von Südamerika
Karte vom Puget Sound
Karte von Alaska
Berichte über den Untergang der George W. Loomis
Die Otsego ex Prinz Eitel Friedrich
Fischkonservenfabriken und ihre Fischfallen in Alaska
Die Wapama im San Francisco Maritime National Historical Park
Volkszählungslisten Mecklenburg-Schwerin
Passagierliste
Die Einbürgerungspapiere von Jens Ettrup
Das Lied „De Eekboom“ von Fritz Reuter
Zeitungsartikel zum 50ten Hochzeitstag der Ettrups
Zeitungsartikel über Jens Ettrup mit seinen Erinnerungen
Die Vier Freiheiten
Sterbebenachrichtigung von Jens Ettrup / Otto Bastian
Heinrich von Kralik
James Rolph
Die Standard Oil Company of California (SoCal) ist heute Chevron
Kapitän Richard Dressler
Kapitän Heinz Burmester
Kapitän Ralph E. Peasley
Kapitän Harold D. Huycke Jr.
Andrew Furuseth
Karl Kortum
Quellen und Literaturverzeichnis
Geleitwort von Klaus Lehmbecker
Die Lebensgeschichte eines Seemanns ist nicht üblich in solcher Form, wie sie mein Schwager nach zwei anderen Buchwerken aus der Vorgeschichte der Kolonisierung des Weiten Westens der USA und von friesischen Landleuten seit einigen Jahren auch mit einem großen Anteil aus Liebe zur Sache und zur großen Familie in fast unglaublicher Energie vorgenommen hat. Dabei blieb gewiss kein Name und Ereignis „unentdeckt“ und die Vorgeschichte des vergangenen Jahrhunderts etwas genauer und breiter erhalten.
Seeleute waren einige Jahrhunderte lang zunächst Rudersklaven, dann vielfach Piraten und Goldsucher und wurden in unseren Tagen unmittelbar in der Begegnung mit Corona im Ganzen zu Opfern eines Verbrechens an der Menschlichkeit.
Eine Zeitlang gilt das auch für die Periode des Ersten Weltkriegs und nicht nur für die 2 Jahre des Otto Bastian, sondern auch für die anderen deutschen Segler an der chilenischen Küste über fast ein Jahrzehnt im offenen Gefängnis bis zur Heimreise. Es bleibt ohne Beschreibung, welche Verhältnisse heutzutage noch herrschen im Vergleich zu den fast märchenhaften Glücksfällen, die sich Otto Bastian, der sich Jens Ettrup nannte, im Unterbewusstsein ebenso wie an unbelasteter, nicht berechenbarer und unbedingter beruflicher Findigkeit geleistet hat. Nicht zu übersehen die tödliche Gefahr des Typhus, wie auch die mögliche Entdeckung einer Fälschung bei der Reise in eine Umgebung mit geringerer Legalität für größere Freiheiten. Dass letzten Endes auch eine Gewerkschaft der Seeleute Schutz und Überleben sichern kann und die Vier Freiheiten mehr Bedeutung und Wirkungen im Beruf hatten, ist für unsere Tage die Bestätigung eines Armutszeugnisses. Die Glocke am Ruder klingt nicht mehr 8 Glasen, sondern für des Kapitals fette Beute. Und dagegen hält Otto Bastian die 4 Freiheiten, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit der Religionsausübung, die Freiheit von Not und die Freiheit von Furcht für unverzichtbar.
Abbildung 1 Klaus Lehmbecker 2016 (Sammlung Lehmbecker)
Diese Zeilen begleiten heute unser schon lange nicht mehr ehrliches Verhältnis zur Weltschifffahrt, die Otto Bastian alias Jens Ettrup um die halbe Welt reisen ließ, um Kap Horn ebenso wie nach Alaska neben Archangelsk im Norden des Großen Wassers im Süden die Falkland Inseln, erwähnt wegen der Kohle, die aus Chile dorthin gebunkert werden musste. Da ich als Bewahrer der Gespräche, Besuche und Schriften (bis zu 42 Seiten), in einem großen Karton eine unwahrscheinlich große Menge an gründlichen, weitläufigen und ständig spannenden Daten und Ereignissen bis in meine hohen Achtziger nichts anfertigen konnte, was immer wieder in die Augen fiel - danke ich meinem Schwager für sein Engagement zum sehr hohen Geburtstag. Das Werk wird nicht nur für einen kleinen Kreis und sich selbst, sondern für die Welt der Schifffahrt als geschriebenes Denkmal bestehen bleiben. Zwar sind die heutigen Maßstäbe völlig verändert und verhindern unser Menschenbild. Aber es bleibt zu hoffen, dass die von unserer Natur auf See und an Land erlebten und gelebten Zeiten auch nachsehen können, welche fast paradiesisch zu nennenden Erlebnisse und Erfahrungen im Leben gesammelt und auch erlitten werden.
Ruhm und Dank meiner Frau für die Anregung, den Karton mit Briefen abzugeben, meinem Schwager als Autor und meiner Schwester als Lektorin für dieses Geburtstagsgeschenk.
Klaus Lehmbecker im Mai 2021
Einige Gedanken zum Leben der Seemänner vorweg
Die Bedeutung der Seefahrt wird von der ICS1 folgendermaßen beschrieben: „Der Welthandel auf dem Seeweg hat immense Bedeutung am globalen Güterverkehr: 90% des Welthandels werden über den Schiffverkehr abgewickelt. Es sind über 50.000 Handelsschiffe unterwegs, auf denen mehr als eine Million Matrosen aus Ländern aller Welt arbeiten.“2 Das Leben eines Seemannes war und ist weder romantisch noch angenehm, weder früher noch heutzutage. Natürlich gibt es zwischen den Arbeitsbedingungen der heutigen Seeschifffahrt und denen zu Otto Bastians Zeiten erhebliche Unterschiede, aber in den wenigsten Fällen haben diese auch echte Arbeitserleichterungen gebracht. Seeleute sind heutzutage laut einer Studie3 in der Regel jeden Tag auf ihrem Schiff im Einsatz, durchschnittlich fast 70 Stunden pro Woche. Job und Freizeit können an Bord kaum voneinander getrennt werden. Natürlich belastet sie die Abwesenheit von zu Hause. Manche Crews arbeiten mehr als acht Monate am Stück, bevor sie zurück in ihre Heimat reisen – bis zur nächsten großen Fahrt. Am meisten wird beklagt, dass die Liegezeit im Hafen sich besonders bei kleineren Feederschiffen in den letzten drei Jahrzehnten von zwei bis drei Tagen auf maximal einen Tag verkürzt hat.4 Aus juristischer Sicht ist die Situation für Seeleute kompliziert: Es sind eben nicht nur Deutsche, die auf deutschen Schiffen arbeiten, unterwegs. Neben den Besatzungsmitgliedern mit deutschem Pass gibt es Kollegen aus vielen Ländern. Dazu fahren deutsche Schiffe nicht selten unter anderer Flagge - solchen aus EU-Staaten und sehr oft aus anderen, sogenannten Flaggenstaaten aus Afrika oder der Karibik, in denen der Schiffsbetrieb weniger streng geregelt und sehr viel billiger ist. Mittlerweile stammen die meisten Seeleute aus Niedriglohnländern wie China, Indien, den Philippinen oder anderen asiatischen Ländern. Sie fahren z.B. auf Schiffen, die unter der Flagge Liberias fahren, einem japanischen Reeder gehören, aber von einer deutschen Firma gemanagt werden. Das macht die Besatzungsmitglieder quasi staatenlos. Heutzutage werden die meisten Seeleute aus ihrer fernen Heimat zum Schiff in irgendeinem Hafen der Welt eingeflogen und auch zurückgeflogen.
Dass Seeleute, ähnlich wie Otto Bastian, irgendwo unfreiwillig festlagen, wiederholte sich leider öfter. Da gibt es auch die Geschichte des Hamburger Kapitäns Wolfgang Scharrnbeck, der nach Ausbruch des „Sechstagekrieges“ zwischen Ägypten und Israel 1967 als Kapitän auf dem HAPAG-Frachter „Münsterland“ eingesetzt wurde, der auf dem Großen Bittersee festlag. Mit einem Veranstaltungsprogramm mit Turnieren vertrieben sich die Schiffsbesatzungen aus 13 Ländern das Warten im Suez-Kanal. Erst nach acht Jahren, drei Monaten und fünf Tagen lief die „Münsterland“ wieder in Hamburg ein5. Kapitän Scharrnbeck wurde im Mai 1968 abgelöst und lernte Otto Bastian sogar später noch kennen.
Otto Bastians Schicksal findet ebenso seine Parallelen in der heutigen Zeit durch den weltweiten Lockdown infolge der Corona Pandemie. Die Tagesschau berichtete im Oktober 2020, dass rund 400.000 Seeleute wegen Corona-Reiserestriktionen trotz ausgelaufener Verträge nicht an Land kommen konnten, obwohl sie seit 17 oder mehr Monaten auf See waren.
Die Vereinten Nationen appellierten allgemein an die Regierungen, für Erleichterungen zu sorgen. Die Situation der Seeleute an Bord der Schiffe sei unmenschlich, sagte das UN-Büro für Menschenrechte in Genf. Internationale Arbeitsstandards würden einen ununterbrochenen Aufenthalt an Bord von höchstens elf Monaten erlauben. Das Büro appellierte an alle Regierungen, Lösungen zu finden. Es rief die Unternehmen weltweit, die mit der Schiffsfracht Geschäfte machen, auf, Druck zu machen. Betroffen seien Seeleute auf Container- und anderen Frachtschiffen, aber auch auf Fischkuttern sowie Öl- und Gasplattformen. Die seelische Gesundheit der Menschen würde beeinträchtigt, ebenso wie die Menschenrechte auf Bewegungsfreiheit und das Recht auf ein Familienleben. Abgesehen von den festsitzenden Seeleuten dürften mangels Crew-Rotation auch an Land rund 400.000 Seeleute gewesen sein, die nicht zu ihren Arbeitsplätzen kommen und folglich kein Geld verdienen konnten.6
Eine Gruppe von etwa 170 Seemännern aus dem pazifischen Inselstaat Kiribati saß Weihnachten 2020 in Hamburg fest, die zum Teil zwei Jahre nicht zu Hause gewesen waren, da die eigene Regierung keine Einreiseerlaubnis gab. Erst im Februar 2021 konnten die ersten auf komplizierten Wegen die Heimreise antreten7. Der Rest dieser Gruppe konnte dann im April 2021 auch zurück. Nach mehrwöchiger Rückreise über Katar und Australien, zweiwöchiger Quarantäne in Fidschi und erneuter 16-tägiger Quarantäne in ihrem Heimatstaat Kiribati hatte ihre Regierung endlich grünes Licht gegeben.
Obwohl bereits im Dezember 2020 eine Resolution der Vereinten Nationen die Seeleute als „systemrelevant“ anerkannte begann deren Impfung erst ein halbes Jahr später. Als Signal für andere Häfen hat Hamburg Ende Juni 2021 mit der Impfung von Seeleuten gegen das Coronavirus begonnen. „40 Seeleute aus Indien wurden am Freitag im Seemannsclub Duckdalben geimpft - unmittelbar nach dem Ertönen zahlreicher Schiffshörner im Hafen aus Anlass des Tags der Seefahrer.“8 berichtete der NDR am 25. Juni 2021. Neben den Transportarbeiter-Gewerkschaften setzen sich die Seemannsmissionen weltweit durch Bordbesuche, Gespräche, Unterbringung und Fürsorge in Klubs und Seemannsheimen für die Würde der Besatzungen ein, ihnen gilt mein Dank genauso wie allen Seeleuten weltweit, die unsere Versorgung mit allem, was nötig ist, sicherstellen und dafür immer noch allzu oft ihre Gesundheit oder ihr Leben opfern müssen.
Heino Kok im Juli 2021
1 Die International Chamber of Shipping (ICS) oder Internationale Schifffahrts-Kammer ist eine weltweit aktive Handelsschifffahrtorganisation.
2https://www.ics-shipping.org/explaining/shipping-facts/
3 Oldenburg, Marcus; Jensen, Hans-Joachim, Maritime welfare facilities - utilization and relevance for the compensation of shipboard stress, 2020
4 Vgl. Nele Langosch, Schifffahrtspsychologie: Not an Bord, 12.06.2020, https://www.spektrum.de/news/seefahrt-belastet-die-psyche/1743106, zuletzt geprüft am 10.07.2021
5 Vgl. Stefan Krücken, Orkanfahrt, 25 Kapitäne erzählen ihre besten Geschichten, Ankerherz Verlag, 2006, S. 132, ff.
6 Vgl. https://www.tagesschau.de/ausland/seeleute-corona-101.html, zuletzt geprüft am 17.07.2021.
7 Vgl. https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/seeleute-corona-103.html, zuletzt geprüft am 17.07.2021.
8https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Impfkampagne-fuer-Seeleute-in-Hamburg-gestartet,seeleute176.html, zuletzt geprüft am 17.07.2021.
Vorwort
Diese Geschichte begann damit, dass mein Schwager Klaus Lehmbecker im Herbst 2019 mit einem dicken Karton voller Briefe, Postkarten, Fotos und Prospekte bei uns vorbeikam und meinte, ob ich damit nicht etwas machen wollte, weil er dazu aufgrund vieler anderer Aufgaben nicht in der Lage sei. Bei näherem betrachtet entpuppte sich das Ganze als der gesammelte Briefverkehr mit einem gebürtigen Mecklenburger, namens Otto Bastian, der sich den dänischen Namen Jens Ettrup, als er auf einem amerikanischen Schiff anheuern wollte, zugelegt hatte. Ende der 1970er Jahre hatte er sich per Post bei meinem Schwiegervater Dr. Walter Lehmbecker, dem Vater von Klaus, gemeldet, der als geborener Mecklenburger in Kiel lebte und bei der Landsmannschaft Mecklenburg bekannt war als Schriftleiter und als Fritz Reuter Experte. Den Hinweis auf Dr. Walter Lehmbecker bekam Otto Bastian von seinem jüngsten Bruder Wilhelm Bastian, der 1920 Kommilitone von Lehmbecker in Rostock war. Er war damals auch Mitglied der Mecklenburgischen Landsmannschaft geworden, da er sehr an seiner Heimat hing. Der Kontakt ging dann mit Dr. Lehmbeckers Frau Elisabeth weiter, da Dr. Walter Lehmbecker bereits Anfang 1980 gestorben war. Anfang der 1980er Jahre besuchte Otto alias Jens sie auch in Kiel. Klaus übernahm den Kontakt und schrieb sich mit Otto Bastian. Er war ebenfalls in Mecklenburg geboren, lebte aber zu der Zeit als Schiffsmakler in Barcelona. In den teils sehr langen Briefen aus Seattle, dem Wohnort Bastians, schildert er immer wieder seine Geschichte als deutscher Seemann, der durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges versuchte, auf eigene Faust in die Heimat zurückzukommen, dabei in den USA gelandet war, dort zum amerikanischen Staatsbürger mit dänischer Herkunft wurde, Jennie Rockness, eine geborene Norwegerin, heiratete und erst danach wieder Kontakt zu seiner Familie per Brief fand. Dann war es schon zu spät für eine Rückkehr nach Deutschland. Er blieb in Amerika und wurde Vater von zwei Töchtern, hatte Enkelkinder und Urenkel. Erst 1959, im Rentenalter, kam er das erste Mal per Flieger zurück in die Heimat und besuchte seine noch lebenden Geschwister in Ost- und Westdeutschland, die Eltern waren bereits verstorben. Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war er mehrmals in Europa zu Besuch, meist zusammen mit seinem alten Seemannskameraden von 1909-1910, Walter Strauss, der aus der Nähe von Breslau in Schlesien (heute Polen) stammte und ebenfalls in den USA geblieben war. Sie besuchten teils getrennt ihre Verwandten und zusammen Klaus Lehmbecker in Barcelona. Bastian war alleine 1976 nach Hamburg gekommen und hatte mit dem Ex-Kapitän und Autor Heinz Burmester Kontakt aufgenommen, von dem er in den USA gehört hatte. Er besuchte ihn in Wedel und schilderte ihm sein Leben. Ein Teil dieser Geschichte floss deshalb in das Buch von Burmester „Die Viermastbark Elisabeth ex Pendragon Castle“9, das einen Teil des Schicksals von Bastian darstellt. Eine weitergehende Beschreibung seiner Odyssee veröffentlichte Heinz Burmester in zwei Teilen in der Zeitschrift „Albatros“10, dem Mitteilungsblatt der Deutschen Kap Horniers.
Auch Klaus Lehmbecker hatte immer vor, die ganze Geschichte von Otto Bastian zu Papier zu bringen. Das hat er mir nun auferlegt. Was mich natürlich beglückt hat, da ich gerne solche Lebensgeschichten erforsche und aufschreibe. In den Unterlagen befinden sich teilweise bis zu 42 Seiten lange, handgeschriebene Briefe, in denen Otto alias Jens sein Los detailliert schildert. Die Briefe sind zum Teil bereits von Klaus abgetippt und so leichter zu lesen. Den großen Rest an Briefen und Postkarten habe ich Seite für Seite in eine lesbare Datei gebracht. Dabei fällt auf, wie stark ihm die ungewollte Abwesenheit von seiner Heimat Mecklenburg zu schaffen gemacht hat. Es fällt auch seine besondere Art sich auszudrücken auf. Sein Deutsch ist wohl auf dem Stand von 1914 stehengeblieben und es mischt sich mit seiner englischen Ausdrucksweise und Satzstellung. Aber auch nach über 70 Jahren Abwesenheit konnte er sich in Plattdeutsch äußern, wenn er von Klaus dazu angeregt wurde. Er konnte auswendig mehrere Strophen des Heimatliedes „De Eeckboom“ von Fritz Reuter singen. Er war sein ganzes Arbeitsleben als Seemann auf Schiffen oder als Angestellter in Häfen an der Westküste Amerikas beschäftigt. Ohne ein gewisses Verständnis von Seefahrt im Allgemeinen und von Segelschiffen im Besonderen lassen sich bestimmte Formulierungen in seinen Briefen nicht richtig interpretieren. So kam mir meine Dienstzeit bei der Marine und meine Erfahrung durch etliche Segeltörns zugute. Detailliert beschreibt er auch wiederholt die Jahre seiner Kindheit in Warin, Wismar und Stavenhagen, erinnert sich an Orte, Personen und Begebenheiten, beschreibt alle seine Reisen auf Segelschiffen und Dampfschiffen in der Ost- und Nordsee, im Atlantik und später im Pazifik an der Westküste der USA bis nach Alaska. Stets begründet er seine Verwandlung von Otto Bastian aus Wismar in Jens Ettrup aus Bornholm, die sein eigener Vater ihm nie verziehen hat, nur seine Mutter hielt den Kontakt. Seine wahre Identität hat er in den Staaten zunächst nur seiner Frau, aber erst nach der Hochzeit 1920 gestanden. Ein aus Südjütland stammender, amerikanischer Kapitän hat es zwar bemerkt, dass er kein Däne war, behielt es aber für sich, da er sich gut mit Otto Bastian als Jens Ettrup verstand. Am 1. Juli 1986 verstarb Otto Bastian als Jens Ettrup in der Everet Clinic in Stanwood, WA, USA. Er überlebte seine Frau Jennie und eine der beiden Töchter. Er hinterließ zu seiner Lebenszeit eine Tochter, vier Enkelkinder und fünf Urenkel.
Bei meinen ersten Recherchen in den US-Datenbanken bei Ancestry fiel mir auf, dass es außer dem von mir gesuchten Jens Ettrup aus Seattle noch eine weitere Person als Einwanderer in den Staaten gab, der Jens Sigvard Ettrup (1890-1961) hieß, ein Jahr älter war, 1911 über New York eingewandert war und ebenfalls mit einer Jennie verheiratet war. Er stammte tatsächlich aus Jütland in Dänemark und fuhr während des Zweiten Weltkrieges ebenfalls auf Schiffen, allerdings eher an der Ostküste. Auch er hat dabei einiges erlebt, von dem er hätte erzählen können. Zunächst war ich verwirrt, da einige Mitglieder bei Ancestry in ihren veröffentlichten Familienstammbäumen beide Personen zu einer vermischt hatten und so kam es zu einem dritten Kind, das mein Protagonist haben sollte, das aber das Kind des anderen Ettrup war. Auch habe ich mich gefragt: Könnte unser Jens den Dänen Jens Sigvard auf seinen Fahrten vor 1914 in der Ostsee kennen gelernt haben und sich seine Identität „geborgt“ haben? Möglich schon, aber das klingt mir nicht wahrscheinlich genug. Ich gehe also bis auf weiteres davon aus, dass die beiden sich wohl nicht gekannt haben.
Nun also folgt die ausführliche Geschichte von Otto Bastian als Deutscher Seemann, der in seinem Leben „unter falscher Flagge segelte“, wie er selbst es einmal ausdrückte. Auf der Grundlage der Veröffentlichungen von Heinz Burmester entwickelte sich dieses Buch, aber erweitert durch die vielen, vielen Schilderungen aller Begebenheiten in den ca. 100 Briefen und Postkarten, die Otto Bastian als Jens Ettrup zunächst meinem Schwiegervater, aber hauptsächlich meinem Schwager Klaus geschrieben hat. Das Besondere an dem, was Otto Bastian erzählt, ist die Sichtweise. Er schreibt aus der Sicht eines einfachen Seemannes und nicht wie bei den allermeisten Geschichten über die Seefahrt aus der Sicht eines Kapitäns. Ich habe versucht, alle Angaben durch Belege, Veröffentlichungen und Fotos von Orten, Schiffen und Personen zu ergänzen. Vielfach war es auch nötig, Orte, Hintergründe und historische Entwicklungen zu beleuchten, die Otto Bastian ein Leben „unter falscher Flagge“ aufdrückten.
9 Heinz Burmester, Die Viermastbark Elisabeth ex Pendragon Castle - Kauffahrtei unter Segel bis ins 20. Jahrhundert, Schriften des Deutschen Schifffahrtsmuseums 15, Stalling Verlag GmbH, Oldenburg, Hamburg, München, 1982, im Folgenden zitiert als: Heinz Burmester, Die Viermastbark Lisbeth.
10 Heinz Burmester, Ein deutsches Seemannsschicksal. In: Der Albatros 1978, 23, Heft 1, S. 10-15 und Heft 2/3, S. 146–151.
Schul- und Ausbildungszeit
Abbildung 2 Postkarte Warin, Blick vom See auf den Ort, Boot (Sammlung Heino Kok)
Otto Johannes Carl Bastian wurde am 11. Okt. 1894 als Sohn des Johannes Wilhelm Ludwig Heinrich Bastian (1859-1928) und seiner Frau Caroline Wilhelmine Auguste Maria Jesse (1864-1935) in Warin, Mecklenburg11 geboren und am 4. Nov. 1894 getauft.
Abbildung 3 Mecklenburg, Deutschland, Kirchenbuchduplikate, 1740-1918, Ancestry.com, Record for Otto Johannes Carl Bastian. http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1627&h=1916831&indiv=try, zuletzt überprüft am 21.3.2021.
Abbildung 4 Otto Bastian mit seinen Geschwistern. V. L.: Werner, Margaretha, Otto, Hans, davor Wilhelm, Fritz und Ludwig ca. 1900-1901 (Sammlung Dorothea Heiland).
Otto war eines von 7 Kindern in der Familie. Seine Schwester Margarete war die älteste. Von den 6 Brüdern war Otto der Drittälteste. Otto Bastian schreibt 1985: „6 Kinder sind in Warin geboren. Margarethe12 am 24. Aug. 1886, Hans13 am 4. Feb. 1888, Werner14 am 12. April 1891, Otto, (das bin ich) am 11. Okt 1894, Fritz15 am 21. April 1897 und Ludwig16 am 4. Aug. 1898.“ Der jüngste Bruder Wilhelm17 wurde am 4. Jan. 1900 in Wismar geboren. Der Vater war großherzoglicher Amtsbeamter und wurde 1899 nach Wismar versetzt, wo er im Fürstenhof18 als „Amtsprotokollist“19 arbeitete und die Familie brauchte dringend eine Wohnung. In Warin hatte der Vater seit 1886 als Amtsdiätar gearbeitet, in Warin war er 1894 zum Amtsprotokollisten befördert worden.
Über den Umzug nach Wismar berichtet Otto Bastian: „Und Mutter war auch wieder schwanger. Sie fanden eine Wohnung an der Bademutterstraße bei dem Bierverlag Brehmer. Dies Haus war gegenüber von einem Speicher und hier wurde am 4. Januar 1900 unser jüngster Bruder geboren und ich erinnere mich des Tages heute noch, da ich noch nicht zur Schule ging und ich musste meine 2 jüngeren Brüder Ludwig und Fritz für einen Spaziergang mitnehmen, sobald unser Doktor und die Hebamme kamen. Im Frühling 1900 fand Vater eine Wohnung in der Oberetage eines neugebauten Ziegelhauses an der Lübschen Straße gegenüber des schwedischen Consulats. Der Consul war Herr Eberhardt und er hatte eine Holzhandlung und wurde immer in einer Droschke gefahren. Diese Droschke wurde von rassigen Ponys, die schwarz waren, gezogen und hatten lange Schwänze. Seine Droschke wurde immer begleitet von 4 Terrier Hunden. Es war wirklich eine Sehenswürdigkeit und es ist möglich sich selbst zu erinnern?! Als wir hier wohnten, wurde Mutting krank und eines Tages hörte ich, wie unser Arzt zu Vating sagte: „Herr Bastian, Sie müssen eine andere Wohnung finden. Ihre augenblickliche Wohnung ist zu feucht, und ihre Frau kann das nicht vertragen. Und bald darauf zogen wir in eine Wohnung in der Mitte der Stadt! Sie war über einer Kneipe „Zum Hirsch“ und war „Hinter dem Rathaus“! So war der Name der Straße und ich denke, es war die schönste Wohnung in Wismar mit einer herrlichen Aussicht über den Markt.“
Nachdem die Eltern im Frühling 1900 diese neue Wohnung in einem neugebauten Ziegelhaus gefunden hatten, begannen seine Schuljahre in Wismar. Otto Bastian erinnert sich: „Ja, wir konnten die Wasserkunst, das Hotel „Hamburger Hof“ und den „Alten Schweden“ und auch alle Paraden auf dem Markt von dieser Wohnung aus sehen! Und ich selbst musste immer diese Plätze passieren auf meinem Weg zur Bürgerschule und zurück! In einem anderen Brief schreibt er: „Das großherzogliche Amt war auf dem Fürstenhof. Mein erster Lehrer war Herr Harnack. Hinter dem Rathaus war auch das Hotel zur Sonne20 und dessen Besitzer hieß Ahnfeldt. Die Hauptwache der 90ger21 war an der Ecke des Markts. Wir Jungs, alt und jung, spielten immer auf der Balustrade des Rathauses und auch auf dem Markt, als auf demselben die Bauern ihr nicht gebrauchtes Gemüse etc. verkauften.
Da waren auch ein alter Hafen und ein neuer moderner Hafen.“ Bastian erinnert sich noch an zwei kleine Passagierdampfer „Paul“ und „Poel". Beide wurden auch als Schlepper gebraucht, um z. B. Segelschiffe in den Hafen oder Richtung Ostsee zu schleppen.
Der Dampfer Paul fuhr immer nach Wendorf22 und der Dampfer Poel fuhr nach Kirchdorf auf der Insel Poel. Ihr Abfahrtsplatz war zwischen dem Wasserturm und dem Zollamt. Mit den Eltern machte Otto Ausflüge mit diesen Dampfern. Weiterhin erinnert er sich an ein Baumhaus , das in früheren Jahren als eine Schranke für den alten Hafen gebraucht wurde, um diesen mit Baumstämmen abzusperren.
Abbildung 5 Markt mit alter Wasserkunst in Wismar um 1900-1910 (Sammlung Heino Kok)
Abbildung 6 Wismar Hafen um 1900 (Sammlung Heino Kok)
Für Otto waren das „herrliche Zeiten, die wir in Wismar erlebten“. Ich glaube, dass es auch prägende Zeiten waren, da er dort zum ersten Mal mit der Seefahrt in Berührung kam. Der Wismarer Hafen mit seinen Schiffen hatte es ihm angetan. Im Herbst 1904 wurde der Vater wieder versetzt, diesmal nach Stavenhagen, einer Stadt „weit weg von der Küste“, wie Otto fand. Er ging vorher in Wismar zum Gymnasium und war in der Sexta. Stavenhagen hatte nur eine Privatschule, in der Schüler für das Gymnasium in Malchin vorbereitet wurden bis zur Untertertia.
Er schreibt über die Zeit in Stavenhagen: „Trotzdem wir weit weg von der Ostsee waren, haben wir uns alle sehr wohlgefühlt in der Fritz-Reuter Stadt Stavenhagen.“ An anderer Stelle berichtet er: „Unsere drei ältesten Geschwister Margareta, Hans und Werner hatten ihren Schuldienst beendigt und arbeiteten in der Zeit. Hans und Werner arbeiteten bei der Firma Siemerling23 in Neubrandenburg, doch wo Grete damals arbeitete, erinnere ich mich nicht mehr. In Stavenhagen wohnten wir erst an der Ivenacker Straße bei einer Familie Köpcke. Herr Köpcke hatte mehrere Pferde, mit welchen er immer für andere Leute arbeitete. Stavenhagen hatte ja keine Realschule, nur eine Privatschule, in welche Schüler für das Gymnasium in Malchin vorbereitet wurden bis zur Untertertia. Die Namen unserer Lehrer waren Pagler von Ludwigslust, Hartmann von Trier und Gregersen von Eckernförde. Herr Brüning war der Schuldirektor, doch die Lehrer von der Volksschule lehrten uns auch. Ich ging gleich in die Quinta.“
Dort in Stavenhagen hat er viele herrliche Tage erlebt, wie er meint. Jeden Schultag musste er am Rathaus vorbeigehen auf seinem Weg zur Schule. Er erinnert sich: „An der Malchinerstraße hatte […] Herr Rödiger seine Klempnerei, und mit seiner Tochter bin ich zur Tanzschule im Hotel „Zum Großherzog“ gegangen. […] Besitzer [war] Heinrich Kutzbach24. Ja Herr und Frau Zipse kamen jedes zweite Jahr nach Stavenhagen von Schwerin, wo beide Lehrer am Hofballett waren, um uns Jungs und Mädels Betragen und Sitten zu lehren!“ Auch das Tanzen scheint er gut gelernt zu haben, wie wir später noch erfahren werden.
„Und wenn ich dann zurückdenke die herrlichen Ausflüge, die wir in die Umgegend gemacht haben. Der herrliche lvenacker Tiergarten25, der dem Graf Plessen gehörte, mit all den Damhirschen, will ich doch nie vergessen.“ Weiter erinnert er sich: „Das großherzogliche Amt war im Schloss Stavenhagen und der Amtshauptmann hieß von Aberkrohn. Herr Wunderlich war unser Bürgermeister.“ Seine Ferien verbrachte er immer rund um Rostock und Doberan. Er erinnert sich auch nach 70 Jahren noch an viele Orte wie Sievershagen, Lambrechtshagen, Brodhagen, Nienhagen und Mönchhagen. Seine Großeltern wohnten in Doberan, wo sein Großvater Johann Jesse, auch Wilhelm genannt, Badeaufseher des Stahlbades26 war, als seine Eltern 1886 heirateten. Auch Heiligendamm, Brunshaupten27 und Warnemünde waren ihm alle sehr gut in Erinnerung geblieben.
Schon früh entstand der Wunsch in Otto, Seemann zu werden: „Tante Sophie Hallier in Mönchhagen wollte mir nie glauben, wenn ich sagte, ich wollte ein Seemann werden. Sie sagte dann: „Nein, Du liebst alle Tiere so gut und herzlich und weißt auch mit der Landwirtschaft so gut Bescheid. Du wirst Heimweh kriegen, solltest Du zur See gehen“.“
Der Vater war zunächst auch dagegen, doch Weihnachten 1908 hatte er ihm versprochen, zur See fahren zu dürfen, wenn er die ärztliche Befähigung dazu vom Arzt attestiert bekäme: „Dir wird erlaubt zur See zu gehen, wenn der Dr. sagt, Du bist gesundheitlich fähig“. Im Januar 1909 ist Ottos Vater mit ihm nach Malchin gefahren für eine Untersuchung, die er mit „fliegenden Fahnen“ bestand, erzählt Otto Bastian. Er wurde am 11. April 190928 in Stavenhagen von Pastor Wedemeyer29 konfirmiert, der nur zwei Häuser entfernt von der Familie Bastian in der Ivenacker Straße wohnte.
Abbildung 7 Konfirmation 1909, Auszug aus dem Kirchenbuch Ancestry-Kirchenbuchabschriften, 1580–1945. Digital images. Archiv der Hansestadt Rostock, Rostock, Deutschland.
Gleich nach der Konfirmation in der lutherischen Kirche St. Nicolai nahm Otto Abschied von seiner Familie und reiste mit dem Zug über Hamburg und Bremen nach Elsfleth in Oldenburg, er musste mehrmals umsteigen. Dort meldete er sich beim Deutschen Schulschiff-Verein (D.S.V.)30 an und wurde Schiffsjunge der ersten Division des Segelschulschiffes Großherzogin Elisabeth31. Alle erforderlichen Nachweise und Papiere waren vorhanden. Sein Vater hatte vorher 130 Mark „Kleidergeld“ an den D.S.V. in Oldenburg überwiesen. Das nötige Taschengeld für sich selber musste er beim Zahlmeister des Seglers einzahlen.
Der Deutsche Schulschiff-Verein Oldenburg hatte im Juli 1900 bei der Tecklenborg-Werft32 ein Vollschiff mit drei Masten als erstes Segelschulschiff des Vereins in Auftrag gegeben. Am 7. Januar 1901 war das Schiff unter der Baunummer 176 bei der Tecklenborg-Werft vom Stapel gelaufen.
Abbildung 8 Die Großherzogin Elisabeth als Luftaufnahme 1933, Bild Nr. 254 der Deutschland Fahrt der Zeppelin-Weltfahrten (Sammlung Heino Kok)
Das Schiff war als reines Schulschiff konzipiert und bestach mit einer ungewöhnlich schlanken und eleganten Linienführung. Bei der Abmessung der Takelage wurde Rücksicht auf die Bedienung durch die Jungen genommen und alles in denkbar praktischer Weise ausgeführt. Ein Jahr später startete die Großherzogin Elisabeth mit 150 Schülern zu ihrer ersten Ausbildungsfahrt.
„Als Heimathafen wurde Oldenburg bestimmt, wie auch der D.S.V. alle späteren Schulschiffe ins Oldenburger Schifffahrtsregister eintragen ließ. Als Liegehafen war Elsfleth an der Weser vorgesehen, das in der oldenburger Schifffahrtsgeschichte eine alte Tradition besaß und wo sich eine Navigationsschule befand.“33 Kommerzielle Fracht-Segelschiffe wurden schon damals immer weniger benötigt, deshalb sollten die jungen Seeleute die als notwendig angesehenen Erfahrungen auf reinen Segel-Schulschiffen sammeln.
„Um die Jahrhundertwende eilte das Zeitalter der großen Segelschiffe unweigerlich seinem Ende entgegen. Damit verschwanden die Segelschiffe als bisherige Ausbildungsstätten für den jungen Seemann und späteren Kapitän von der Bildfläche. […] Die deutsche Handelsflotte benötigte aber einen jährlichen Nachwuchs von ca. 2000 Jungen.“34
Sie sollten gut ausgebildet werden an Bord eines großen Segelschiffes in praktischer Seemannschaft. Der marinebegeisterte Erbgroßherzog Friedrich August von Oldenburg übernahm die Initiative. Am 12. Januar 1900 kam es unter seinem Vorsitz und im Beisein des Kaisers in Berlin zur Gründung des D.S.V. Das lange negativ geprägte Image des Seemannsberufes sollte aufpoliert werden, das war auch in der Passagierschifffahrt nötig. Während der Matrosennachwuchs bis dahin oft von der Wasserkante stammte, kamen gegen Ende des 19ten Jahrhunderts immer mehr junge Männer aus küstenfernen Regionen zur Seefahrt. Auf den größeren Passagierschiffen entstanden neue Laufbahnen, ähnlich hierarchisch wie bei der Marine. Somit eröffneten sich auch neue Möglichkeiten für Männer aus einfacheren Verhältnissen. Die Ausbildung der Matrosen wurde zu einer neuen Aufgabe für die zivile Schifffahrt.
Die erforderlichen nautischen Kenntnisse und Fertigkeiten konnten auf Seefahrtsschulen unterrichtet werden, aber die Grundkenntnisse sollten vorher durch eine mehrjährige Fahrenszeit auf Segelschiffen erworben sein. Auch der Norddeutsche Lloyd stellte als erste deutsche Reederei eigene Segel-Schulschiffe in Dienst, obwohl er auch Gründungsmitglied des Deutschen Schulschiff Vereins war, der in erster Linie das Deckspersonal ausbildete. Auf den Schulschiffen des NDL wurden Kadetten als künftige Steuerleute und Kapitäne ausgebildet. Dort drängten auch junge Männer aus gutbürgerlichen Verhältnissen mit höherer Schulbildung an Bord. Dafür waren seit 1900 die Viermastbark Herzogin Sophie Charlotte35 und seit 1902 die Herzogin Cecilie36 in Fahrt.
Die Ausbildungsbewerber des D.S.V., „Zöglinge“ genannt, mussten fit sein, gute Augen haben und schwindelfrei sein, denn sie sollten die Masten hochklettern können. Hatten sie diese Prüfung erfolgreich bestanden, wurden sie als „Schiffsjunge“37 angemustert. Dies wurde in einem persönlichen Seefahrtsbuch vermerkt. Von nun an mussten sich die Zöglinge an die Seemannsordnung halten. Das Ausbildungskonzept sah praktische Seemannschaft an Deck, in der Takelage sowie unter Deck vor. Zusätzlich fand jeweils eine Stunde wöchentlich Unterricht in den Fächern Deutsch, Rechnen, Englisch, Geografie und Geschichte statt. Die Atmosphäre war der Zeit entsprechend: Die Zöglinge „schulden allen mit der Ausbildung und Erziehung beauftragten Personen Gehorsam und Ehrerbietung. Auch den Matrosen gegenüber haben sie sich bescheiden zu benehmen.“38 Als Ziel verfolgte man das Zusammenwirken in der Gemeinschaft durch gegenseitiges Vertrauen in der Zuverlässigkeit. So sollte mit den Schulschiffen diese Persönlichkeitsprägung erreicht werden. Otto Bastian wurde am 12. April 1909 Schiffsjunge der ersten Division auf dem Schulschiff. Es gab vier Divisionen mit Schiffsjungen und eine Division mit Kadetten. Ottos Divisionsoffizier war Herr Bergmann und der Kapitän hieß Richard Dressler39. Dieser hatte einen roten Vollbart und wurde heimlich als Barbarossa tituliert. Der erste Offizier war Emil Frantz von der Heide, dann folgten die vier Divisionsoffiziere und ein Ausbildungsoffizier für die Kadetten. Die Besatzung des Schulschiffes bestand aus dem Kapitän, 6 Offizieren, einem Arzt, dem Zahlmeister und 15 Mann als Stammmannschaft. An all diese Namen und Fakten erinnerte sich Otto Bastian noch.
Abbildung 9 Ansichtskarte von Elsfleth mit dem Schulschiff ca. 1920-1930 (Sammlung Heino Kok)