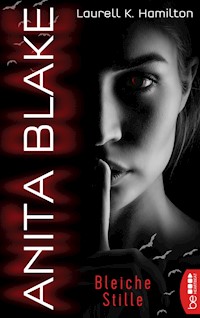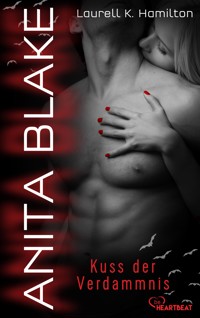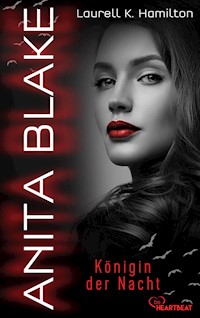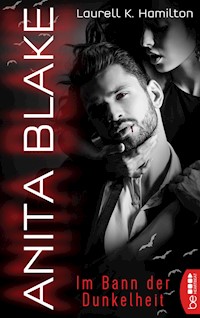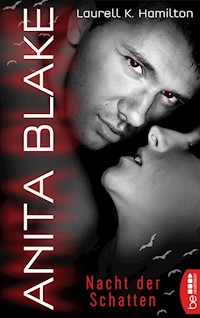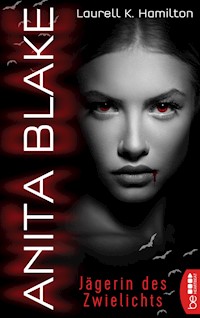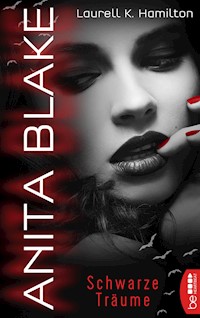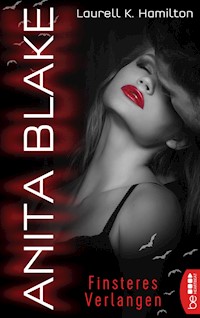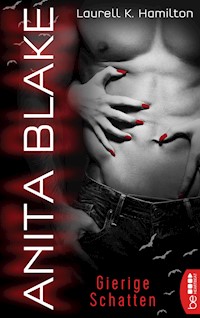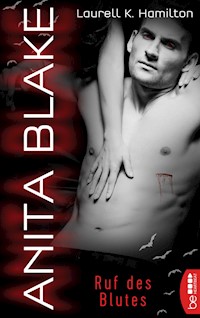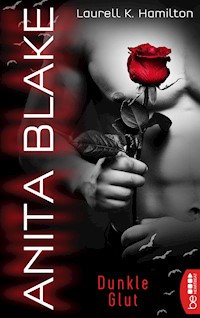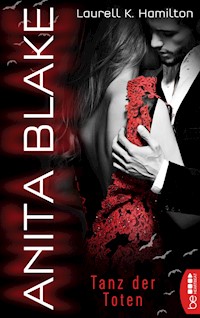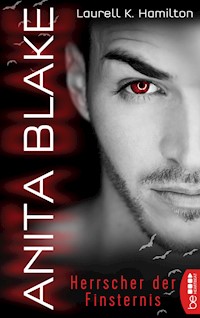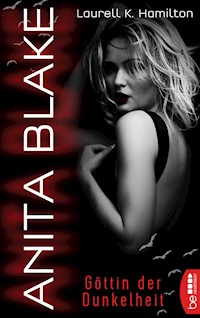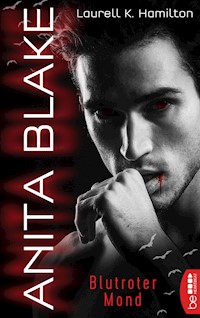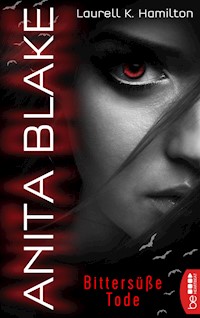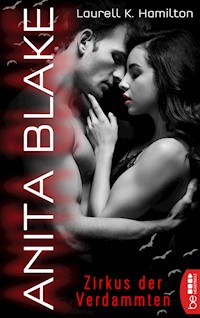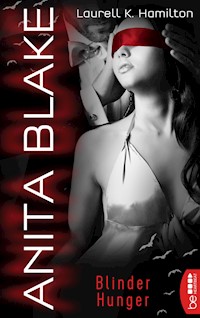
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Keine andere Serie verbindet so geschickt Horror, Mystery und prickelnde Leidenschaft miteinander ...
Seit die Vampirjägerin Anita Blake mit der Ardeur, einem unstillbaren Verlangen, infiziert wurde, kämpft sie mit sich selbst und ihrem übernatürlichen Hunger. Ihr Leben mit wechselnden Männern entspricht nicht im Geringsten den romantischen Vorstellungen, die sie früher hatte. Und im Augenblick kann sie eigentlich keinerlei Ablenkung durch ihr Privatleben gebrauchen, denn sie befindet sich mitten in der gefährlichen Suche nach einem Serienkiller ...
"Wie immer ist Hamilton eine hypnotisierende Erzählerin." Romantic Times
Dieses E-Book ist Band 2 einer zweiteiligen Geschichte. Es wird empfohlen, zunächst den ersten Teil zu lesen: Anita Blake - Schwarze Träume.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Über diesen Band
Über die Autorin
Triggerwarnung
Titel
Impressum
Was bisher geschah …
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Danksagungen
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Keine andere Serie verbindet so geschickt Horror, Mystery und prickelnde Leidenschaft miteinander …
Seit die Vampirjägerin Anita Blake mit der Ardeur, einem unstillbaren Verlangen, infiziert wurde, kämpft sie mit sich selbst und ihrem übernatürlichen Hunger. Ihr Leben mit wechselnden Männern entspricht nicht im Geringsten den romantischen Vorstellungen, die sie früher hatte. Und im Augenblick kann sie eigentlich keinerlei Ablenkung durch ihr Privatleben gebrauchen, denn sie befindet sich mitten in der gefährlichen Suche nach einem Serienkiller …
Dieses eBook ist Band 2 einer zweiteiligen Geschichte. Es wird empfohlen, zunächst den ersten Teil zu lesen: Anita Blake – Schwarze Träume.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Blinder Hunger
Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2004 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Incubus Dreams«
»Incubus Dreams« ist im Deutschen in zwei Teilen erschienen:
Band 1: Schwarze Träume
Band 2: Blinder Hunger
Originalverlag: The Berkley Publishing Group, a division of Penguin Group (USA) Inc., New York
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Blinder Hunger«
Textredaktion: Mona Gabriel
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG unter Verwendung von Motiven von © iStock/ BojanMirkovic; iStock/inarik
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0251-5
be-ebooks.de
lesejury.de
Was bisher geschah …
Anita Blake, Vampirhenker der Stadt St. Louis, verlässt überstürzt die Hochzeit ihres Freundes Larry Kirkland: Das Regional Preternatural Investigation Team braucht ihre Hilfe bei der Aufklärung des neuesten Mordfalles. Die Leiche einer Stripperin wurde im schmutzigen Hinterhof eines Clubs gefunden, übersät mit Vampirbissen. Eine ganze Gruppe Vampire, mindestens einer davon ein alter Meistervampir, muss hier am Werk gewesen sein. Doch wie konnte ein so mächtiger Vampir unbemerkt von Jean-Claude, dem Meister von St. Louis, die Stadt betreten?
Während die Ermittlungen beginnen, führt die Ardeur Anita in neue Abgründe. Die übernatürliche Lust, die sie nicht immer kontrollieren kann, zwingt sie, ihre Beziehung zu ihrem Pomme de Sang Nathaniel zu überdenken, und treibt sie in ein neues Triumvirat mit ihm und ihrem Diener Damian. Das Triumvirat bringt allen Beteiligten neue Fähigkeiten und Eigenschaften, doch Anita kann die Auswirkungen dieser neuen Verbindung noch nicht verstehen. Und so führt ihre neu erlangte Macht dazu, dass sie beinahe versehentlich sämtliche Leichen eines ganzen Friedhofs in Zombies verwandelt.
Nach einer Nacht voller kräftezehrender Rituale und geschwächt vom Kampf gegen die Ardeur bringen Requiem und Graham, zwei Untergebene von Jean-Claude, Anita ins Guilty Pleasures. Noch auf dem Weg dorthin spürt sie, dass ihr Diener Damian im Sterben liegt. Es gelingt ihr, Damian mit Hilfe der Ardeur zu retten. Doch die Aufregung des Abends ist noch nicht vorbei: Kurz darauf landet sie an Nathaniels Seite auf der Bühne des Stripclubs. Nach der Show ziehen sich Anita und Jean-Claude in sein Büro im Guilty Pleasures zurück, um sich ganz ihren angestauten Gefühlen zu überlassen …
45
Jean-Claude und ich wussten genau, was wir mit dem Rest der Nacht vorhatten. Wenn unsere Beine uns endlich wieder tragen konnten, wollten wir uns anziehen, Nathaniel einsammeln und zum Zirkus fahren. Nathaniel würden wir irgendwo ins Bett packen und dann würden wir ein schönes, heißes Bad nehmen. Wir hatten noch nicht mal den Teil mit dem Anziehen erreicht, als mein Handy klingelte.
Fast wäre ich nicht rangegangen, weil morgens um drei keiner mit guten Nachrichten anruft. Die Nummer auf dem Display gehörte Detective Sergeant Zerbrowski. »Scheiße.«
»Was ist los, ma petite?«
»Polizei.« Ich klappte das Gerät auf und sagte: »Morgen, Zerbrowski, was gibt’s denn?«
»Morgen. Ich bin drüben in Illinois, und raten Sie mal, was ich vor mir habe?«
»Noch eine tote Stripperin.«
»Wie haben Sie das erraten?«
»Ich kann hellsehen. Und jetzt wollen Sie vermutlich von mir, dass ich hinkomme und mir die Tote ansehe.«
»Vermuten Sie nicht zu viel, aber in diesem Fall haben Sie recht.«
Ich schaute auf meine blutige Brust und die Wunde, aus der es noch ein bisschen tropfte. »Ich komme, sowie ich mich gesäubert habe.«
»Hühnerblut?«
»Etwas in der Art.«
»Tja, die Leiche läuft uns nicht weg, aber die Zeugen werden unruhig.«
»Zeugen«, sagte ich. »Wir haben Zeugen?«
»Zeugen oder Verdächtige.«
»Was heißt das?«
»Kommen Sie zum Sapphire Club und finden Sie es heraus.«
»Ist das nicht der teure Schuppen, der sich als Gentlemen’s Club bezeichnet?«
»Anita, ich bin schockiert. Wusste gar nicht, dass Sie in Tittenbars verkehren.«
»Die wollten Vampirstripper haben, und ich wurde hingeschickt, um das zu besprechen.«
»Ich wusste nicht, dass das auch zu Ihren offiziellen Aufgaben gehört«, sagte er.
Bei Dolph hätte ich das unkommentiert gelassen, aber es war Zerbrowski, und Zerbrowski war in Ordnung. »Die Kirche des Ewigen Lebens erlaubt ihren Mitgliedern nicht, zu strippen oder anderes zu tun, was sie für unmoralisch hält. Deshalb brauchte der Club Jean-Claudes Erlaubnis, um fremde Vampire vom Nachbarterritorium herzuholen.«
»Hat er sie erteilt?«
»Nein.«
»Und Sie waren dabei, um bei der Entscheidung zu helfen?«
»Nein.«
»Sie sind allein hingegangen?«
»Nein.«
Er seufzte. »Oh Mann, kommen Sie einfach her. Wenn Sie sagen wollen, dass sich Vampire von dem Club fernhalten sollten, wird Ihr Freund nicht erfreut sein.«
»Die sollten nur nicht auf die Bühne. Alles andere ging uns nichts an.«
»Auf der Bühne waren sie nicht, zumindest nicht gegen Bezahlung«, sagte Zerbrowski.
»Eben waren es noch Zeugen oder Verdächtige und jetzt sagen Sie, keine Vampire, die gegen Bezahlung auftraten. Scheiße, haben Sie da welche, die im Publikum waren?«
»Kommen Sie her, dann sehen Sie selbst. Aber ich würde mich beeilen, es dämmert bald.« Er legte auf.
Ich fluchte leise.
»Das hört sich an, als gäbe es heute Nacht kein ausgedehntes Bad«, sagte Jean-Claude.
»Ja, leider.«
»Wenn schon kein Bad, dann vielleicht eine schnelle Dusche?«
Ich seufzte. »Ja, so kann ich mich bei der Polizei nicht blicken lassen.«
Lächelnd schaute er an seinem blutbespritzten Körper hinunter. »Das gilt für mich wohl auch.«
»Wir könnten Wasser sparen und zusammen duschen.«
Er zog eine Braue hoch und lächelte mich an. Das Lächeln sprach Bände.
»Schon gut. Das würde uns wahrscheinlich ablenken.«
»Ich weiß nicht, ob ich schon für diese Art Ablenkung sorgen kann.«
»Entschuldige, ich vergesse immer wieder, dass sich Jungs nicht so schnell erholen wie Mädchen.«
»Ich bin kein Mensch, ma petite, nach einer weiteren Blutspende wäre ich wieder bereit.«
»Wirklich?« Mein Puls beschleunigte sich. Mist, ich war zu müde und zu wund, um auch nur daran zu denken.
»Ja.«
»Ich denke, es wäre schlecht, wenn ich heute Nacht noch mehr Blut verliere.«
»Es muss nicht deins sein«, sagte er.
Ich starrte ihn an, und er starrte mich an. Ich sagte, was ich dachte, was ich mir schon fast abgewöhnt hatte. »Was stellst du dir vor? Du hast einen Blutspender dabeistehen, während wir vögeln? Wir könnten die Blutspender Schlange stehen lassen und es treiben bis zum Umfallen.« Ich meinte das witzig. Er sah das offenbar anders. Als ich seinen Gesichtsausdruck sah, wurde ich rot.
Plötzlich kam mir ein Bild in den Kopf, das so plastisch war, dass es mich umgeworfen hätte, hätte ich nicht schon am Boden gelegen. Ich sah Belle Morte ausgestreckt auf einem großen Bett liegen, umgeben von brennenden Kerzen. Asher und Jean-Claude waren auch auf dem Bett. An die dicken Bettpfosten waren Männer gefesselt. Nackt und bleich waren sie. Blut glänzte in feinen Tropfspuren an Hals und Brust und an den Innenseiten ihrer Arme und Beine. Sie waren nicht ein- oder zweimal gebissen worden, sondern unzählige Male. Einem war der Kopf auf die Brust gesunken, und er hing schlaff in den Fesseln. Falls er atmete, war es zumindest nicht zu erkennen.
Jean-Claude schloss mich mit einem Stoß aus seiner Erinnerung aus, den ich körperlich spürte. Ich kam zu mir am Boden seines Büros, blutbesudelt, das Telefon in der Hand.
»Ich wollte nicht, dass du das siehst.«
»Das möchte ich wetten.«
Kopfschüttelnd schloss er die Augen. »Wir waren jung und noch dumm. Belle Morte war unsere Göttin.«
»Ihr habt sie ausgesaugt für euren Sexmarathon«, sagte ich. Es klang nicht entsetzt, sondern leer. Denn ich sah das Bild noch immer vor mir, wenn auch nicht in allen bleichen Einzelheiten. Einmal gesehen hatte ich es im Kopf. Mann, ich brauchte nicht auch noch die Albträume von anderen.
»Ich habe vieles getan, ma petite, von dem ich nicht möchte, dass du es erfährst. Dinge, für die ich mich schäme. Die in mir brennen wie Galle.«
»Ich habe gespürt, was du damals gefühlt hast. Bedauern war nicht dabei.«
»Dann habe ich dich zu früh hinausgestoßen.« Er zog mich nicht hinein, sondern hörte nur auf, mich hinauszudrücken, und sofort befand ich mich wieder in Belle Mortes Bett. Ich war in Jean-Claudes Kopf, als er bemerkte, dass der Mann sich nicht mehr rührte. Er kroch hinüber und berührte die erkaltende Haut. Ich fühlte seine Reue, seine Scham, wusste, dass die Männer uns vertraut hatten. Wir hatten versprochen, sie zu schützen. Gebt uns euer Blut und euren Körper, und euch wird nichts geschehen. Ich blickte zu Belle Morte, die in ihrer nackten Üppigkeit unter Asher lag. Asher, der der Kirche noch nicht in die Hände gefallen war. Er hob den Kopf, fing unseren Blick auf, und in der sinnlichsten aller Nächte – so sah Belle Morte es – keimte der erste Gedanke an Flucht. Schälte sich die Ansicht heraus, dass es Dinge gab, die man nicht tat, Grenzen, die man nicht überschritt, und dass sie keine Göttin war.
Und erneut fand ich mich am Boden seines Büros wieder. Das Blut an mir trocknete und meine Brust begann zu schmerzen. Ich weinte.
Er starrte mich trocknen Auges an und erwartete, dass ich das Weite suchen, mich rumdrehen und abhauen würde, wie schon so oft. Nichts war mir schön genug, nett genug, sauber genug. Ich wollte in meinem Leben keine Leute mit schmutzigen Händen. So war das gewesen, bis ich eines Tages aufwachte und feststellte, dass ich selbst zu den Leuten mit den schmutzigen Händen gehörte.
Meine Stimme klang fest. Man hörte mir nicht an, dass ich Tränen im Gesicht hatte. »Früher dachte ich immer, ich wüsste, was richtig und was falsch ist und wer die Guten und wer die Bösen sind. Dann wurde die Welt sehr grau, und ich wusste lange Zeit gar nichts mehr.«
Er sah mich nur an. Sein Gesicht wurde ausdruckslos. Er verbarg, was in ihm vorging, weil er zu wissen glaubte, worauf ich hinauswollte, was ich sagen würde.
»Es gibt Tage, manchmal Wochen, wo mir das wieder genauso geht. Ich bin so weit von dem entfernt, was ich mal für richtig und falsch gehalten habe, dass ich mitunter nicht mehr dahin zurückfinde. Im Namen der Gerechtigkeit, im Namen meiner Auffassung von Gerechtigkeit, habe ich Dinge getan, die niemand erfahren soll. Ich kann einem Menschen in die Augen blicken und ihn töten, ohne etwas zu empfinden. Ich empfinde dabei nichts, Jean-Claude, nichts. Du hattest nicht die Absicht zu töten und hast dich schlecht gefühlt.«
»Du tötest, um zu schützen, ma petite. Ich habe getötet, um der Lust willen, für das Vergnügen jener, der ich gedient habe.« Er schüttelte den Kopf. Langsam zog er die Knie an die Brust und schlang die Arme darum. »Hast du dich je gefragt, wieso ich die Vampire nicht ersetzt habe, die du damals im Kampf gegen Nikolaos mit Edward zusammen und später sogar mit mir zusammen getötet hast?«
»Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich weiß, wir hatten plötzlich sehr viele, während wir vorher eher knapp waren.«
»Ich rief Vampire heim, die ich vor langer Zeit gemacht hatte. Aber ich habe keine neuen mehr gemacht, seit ich Meister von St. Louis bin. Wir waren gefährlich wenige. Wenn uns der Meister eines anderen Territoriums den Krieg erklärt hätte, wären wir besiegt worden. Wir sind schlicht zu wenige.«
»Warum machst du dann keine neuen?«, fragte ich, weil er darauf zu warten schien.
Er sah mich an, und sein Gesichtsausdruck erinnerte mich an jemand anderen. In seinem Blick stand Schmerz und Verwirrung und jahrhundertelange Qual. Ich hatte ihn noch nie so offen, so menschlich gesehen. »Um jemanden zum Vampir zu machen, muss ich ihm seine Sterblichkeit, seine Menschlichkeit nehmen. Wer bin ich, dass ich das dürfte, ma petite? Wer bin ich, dass ich entscheiden dürfte, wer weiterleben und wer sterben soll?«
»Du meinst, du willst nicht Gott spielen?«
»Ja. Und wie kann ich wissen, was sich dadurch ändern würde? Belle pflegte unsere Macht einzusetzen, um Länder zu verändern, Kriege zu entscheiden, Herrscher auf den Thron zu bringen oder meucheln zu lassen. Es gab eine Zeit, wo sie mehr Macht über Europa hatte, als selbst der Rat wusste. Sie tötete Millionen in Kriegen und Hungersnöten. Nicht mit eigener Hand, nur durch ihre Entscheidungen.«
»Was hat sie schließlich gestoppt?«
»Die Französische Revolution und zwei Weltkriege. Selbst der Tod muss sich vor solch schamloser Vernichtung beugen. Jetzt hält der Rat bei seinen Mitgliedern die Zügel straffer. Die Zeiten, wo man in Europa solche geheimen Machtstrukturen aufbauen konnte, sind vorbei.«
»Freut mich zu hören.«
»Stell dir vor, ich mache jemanden zu unseresgleichen, der andernfalls vielleicht das Mittel gegen Krebs entdeckt oder eine bedeutende Erfindung hervorgebracht hätte. Vampire erfinden nichts, ma petite, wir verbringen all unsere Zeit mit Tod und Vergnügen und sinnlosen Machtkämpfen. Wir streben nach Geld, Komfort, Sicherheit.«
»Wie die meisten Leute.«
Er schüttelte den Kopf. »Aber nicht alle, und meinesgleichen wird angezogen von Menschen, die Macht oder Reichtum besitzen oder auf andere Weise auffallen. Durch eine schöne Stimme, eine künstlerische oder geistige Begabung oder Charme. Wir nehmen nicht die Schwachen wie es Raubtiere tun, sondern die Besten. Die Klügsten, die Schönsten, die Stärksten. Wie viele Leben haben wir im Lauf der Jahrhunderte vernichtet, die für die Menschheit, für die Welt eine wunderbare oder auch schreckliche Veränderung hätten herbeiführen können?«
Ich sah ihn an, und vor nicht allzu langer Zeit hätte ich dieser Freimütigkeit noch misstraut. Doch ich konnte ihn in meinem Kopf spüren. Ich machte mir Sorgen, ob ich ein Monster war. Jean-Claude dagegen wusste es sicher. Er lehnte sich deshalb nicht ab, denn er konnte sich ein anderes Dasein nicht vorstellen, aber er machte sich Gedanken um andere. Es beschäftigte ihn, dass er über andere entscheiden, die Rolle eines finsteren Gottes spielen konnte. Dass er eines Tages werden könnte, wovor er geflohen war. Eine Abart von Belle Morte.
Was tut man, wenn einem plötzlich jemand Einblick in seine dunkelsten Ängste gewährt? Was sagt man, wenn man so viel Wahrheit über jemanden sieht? Ich sagte das Einzige, was mir einfiel, das Einzige, was ein bisschen Trost bedeutete. »Du bist nicht wie Belle Morte. Du wirst nie so böse sein.«
»Wie kannst du dir so sicher sein?«
»Weil ich dich eher töte, als es so weit kommen zu lassen.« Ich sagte es leise, denn es war nicht gelogen.
»Du würdest mich töten, um mich vor mir selbst zu schützen.« Er versuchte, einen leichten Ton anzuschlagen, und versagte dabei kläglich.
»Nein, um die zu schützen, die du sonst vernichten würdest.« Das sagte ich nicht mehr leise.
»Obwohl du dich selbst dabei vernichten würdest?«
»Ja.«
»Obwohl du unseren gequälten Richard mit in den Tod reißen würdest?«
»Ja.«
»Und Damian auch?«
»Ja.«
»Sogar Nathaniel?«
Mir stockte der Atem, und die Zeit vollzog eine dieser Dehnungen, wo aus einer Sekunde Minuten werden. Bebend atmete ich aus und musste mir über die Lippen lecken, ehe ich antwortete. »Ja, unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?«
»Dass ich garantiert auch nicht überlebe.«
Er sah mich an und es wurde ein langer, langer Blick. Ein Blick, der mich bis in meine Seele hinein abschätzte, und ich erkannte, dass er genau das vor Jahren schon einmal getan hatte.
»Du hast mir mal gesagt, dass ich dein Gewissen bin. Aber das ist nicht alles, was ich bin, stimmt’s?«
»Wie meinst du das, ma petite?«
»Ich bin dein Notfallplan. Ich bin dein Richter, deine Geschworenen und dein Henker, sollten die Dinge irgendwann aus dem Ruder laufen.«
»Nicht die Dinge, ma petite, ich. Sollte ich aus dem Ruder laufen.« In seinen Augen lag ein Friede, als wäre ihm eine große Last von den Schultern genommen. Ich wusste genau, wer diese Last jetzt trug.
»Du Mistkerl. Früher hätte ich dich mit Freuden umgebracht, aber heute nicht mehr. Überhaupt nicht mehr.«
»Wenn es zu viel verlangt ist, dann tu so, als hätten wir nie darüber gesprochen.«
»Nein, du Mistkerl, verstehst du denn nicht? Wenn du wirklich durchdrehst und anfängst, unschuldige Leute abzuschlachten, werde ich diejenige sein, die gerufen wird. Ich bin der Scharfrichter.« Ich starrte ihn an.
»Aber, ma petite, das warst du immer.«
Ich stand auf. Meine Knie waren nicht mehr wacklig. »Aber ich habe noch nie jemanden geliebt, den ich umbringen musste.«
»Aber du hast mir immer gesagt, dass deine Liebe dich nicht abhalten würde, deine Pflicht zu tun.«
Mir brannten die Augen. »Wird sie auch nicht. Wenn du durchdrehst, werde ich meine Pflicht tun.« Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Du verfluchter Machiavelli, ich hätte dich damals töten können, ohne in dich verliebt zu sein.«
»Ich wollte, dass du mich liebst, aber nicht um einen Notfallplan zu haben, wie du es ausdrückst. Ich wollte, dass du mich liebst, weil ich dich liebte.« Seine Stimme war nah, und als ich die Augen aufmachte, stand er vor mir. »In letzter Zeit hat mich die Sorge umgetrieben, du könntest so sehr in mich vernarrt sein, dass du mir Verbrechen nachsiehst.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, niemals.«
»Das wollte ich wissen, ma petite.«
»Nenn mich nicht so, nicht jetzt.«
Er atmete tief durch. »Anita, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht quälen, nicht mit Absicht.«
»Hätte dieses Gespräch nicht warten können, bis das Nachglühen vorbeigewesen wäre?«
»Nein. Ich wollte wissen, ob du mich mehr liebst als deinen Sinn für Gerechtigkeit.«
Ich schluckte mühsam. Ich würde nicht weinen, nein. Ich würde verflucht noch mal nicht weinen. »Was brächt mein Lieben dir Gewinn, liebt ich nicht Ehre mehr!«
Er nahm meine Hände, und fast hätte ich sie weggerissen, aber ich zwang mich stillzuhalten. Ich war so wütend, so sauer, so …
»Mein Herz, o schilt mich lieblos nicht«, sagte er, »dass ich von deiner treuen Brust fortstürmend folge meiner Pflicht.«
Ich sah ihn an und zitierte die nächste Zeile: »Zu Krieg und Waffenlust.«
»Traun! Neuer Minne jag ich nach«, sagte er.
»Dem ersten Feind im Schlachtgefild«, sagte ich und ließ mich von ihm näher heranziehen.
»Und treu umfang ich jeden Tag«, sagte er.
»Das Schwert, das Ross, den Schild.« Und das letzte Wort flüsterte ich an seine Wange, während ich forschend in sein Gesicht sah.
»Und doch, mein unbeständiger Sinn gibt dir die sicherste Gewähr«, flüsterte er in meine Haare.
Ich schloss das Gedicht mit der Wange an seiner Brust, das Ohr an seinem Herzen, das wahrhaftig durch mein Blut schlug. »Was brächt mein Lieben dir Gewinn, liebt ich nicht Ehre mehr!«
»An Lucasta, als er in den Krieg zog«, sagte Jean-Claude. Er hielt mich in den Armen.
Zögernd legte auch ich die Arme um ihn. »Richard Lovelace«, sagte ich. »Dieses Zeug hat mir schon im College gefallen.« Ich schloss die Arme um seine Taille, und so standen wir da. »Ich glaube, ohne deine Hilfe hätte ich nicht mehr das ganze Gedicht aufsagen können.«
»Zusammen sind wir mehr als allein, Anita, und das ist Liebe.«
Ich drückte ihn, und die Tränen begannen zu laufen, heiß und heftig und erstickend. »Nicht, Anita.«
Ich brauchte sein Gesicht nicht zu sehen, um zu wissen, dass er lächelte. Ich konnte es an seinem Ton hören. »Ma petite, ma petite, ma petite.«
Es kommt ein Punkt, wo man einfach nur liebt. Nicht weil derjenige gut oder schlecht oder sonst was ist. Man liebt ihn ohne Wenn und Aber. Das heißt nicht, dass man für immer zusammenbleibt. Es heißt nicht, dass man ihm nicht mehr wehtut. Es heißt nur, dass man ihn liebt. Manchmal trotz dessen, was er ist, und manchmal weil er ist, wie er ist. Und man weiß, dass man ebenfalls geliebt wird, manchmal, weil man so ist, und manchmal, obwohl man so ist.
46
Der Sapphire Club befindet sich in einem flachen weitläufigen Gebäude, das von außen nicht schön aussieht. Er wirkt kaum anders, als die meisten Bars und Clubs dieser Gegend. Was macht ihn dann zum Gentlemen’s Club unter den Tittenbars? Zum Beispiel die Sicherheitsleute, die Einrichtung und der Dresscode für die Tänzerinnen. Heute Nacht war der VIP-Parkplatz voller Polizeifahrzeuge, durch die blinkenden Lichter und wimmelnden Leute konnte man kaum die Fassade des Clubs erkennen. Es waren sogar ein großer Feuerwehrwagen und ein Rettungswagen außer dem üblichen Krankenwagen dort. Ich wusste nicht, wozu der Rettungswagen gebraucht wurde, aber am Tatort waren immer mehr Leute, als man wirklich brauchte, mehr Polizisten, mehr Zivilisten, mehr sonst was.
Eine Menge Menschen drängten sich an der Absperrung, darunter einige Frauen, die für diese kalte Oktobernacht kaum passend gekleidet waren. Vermutlich stammten sie aus den umliegenden Clubs. Die meisten Tänzerinnen kamen in Straßenkleidung zur Arbeit und zogen sich dort um. Von den Frauen, die da in der Kälte zitterten, waren zumindest einige von ihrer Arbeit abgehauen, um sich unter die Gaffer zu mischen.
Ich musste auf dem Gelände des Nachbarclubs parken, dem Jazz Baby, der Live-Musik und Live-Unterhaltung bot. Was sollte man sich mehr wünschen? Schlaf vielleicht. Es war fast vier Uhr. Ich hatte in Rekordgeschwindigkeit geduscht, aber es war eine ziemlich weite Fahrt gewesen. Da mein eigenes T-Shirt blutverschmiert war, trug ich ein T-Shirt, das Jean-Claude mir irgendwoher besorgt hatte. Es war weiß, sodass der schwarze BH durchschimmerte. Das war nicht zu sehen, weil ich wieder Byrons Lederjacke darüber trug. Vielleicht würde ich sie anlassen können. Nein, drinnen würde es warm sein. Tja. Wenn heute Nacht nichts Schlimmeres passierte, als dass jemandem auffiel, dass ich einen schwarzen BH unter einem weißen Hemd trug, konnten wir uns glücklich schätzen.
Jean-Claude hatte auch Unterwäsche für mich gefunden. Und wieder war es ein String, aber diesmal ein bequemer, denn er bestand aus weichem Baumwolltrikot, sogar der Riemen zwischen den Backen. Die meisten Damenstrings hatten ein Elastikband oder Spitze, und das stellte ich mir nicht angenehm vor.
Ich musste meinen Dienstausweis zücken, um durch die Menschenmenge zu kommen. Als ich bis zur Absperrung vorgedrungen war, nahm der Polizist kaum von mir Notiz. Er sah eine Frau in Stiefeln, Minirock und Lederjacke und sagte: »Der Club ist geschlossen. Sie brauchen nicht zu arbeiten.«
Ich hielt ihm meinen Ausweis direkt vor die Nase, sodass er zurückweichen musste, um etwas lesen zu können. »Ich glaube sogar sehr wohl, Officer«, ich las es von seinem Schild ab, »Douglas, dass ich heute Nacht arbeiten werde.«
Er sah auf mich runter, weil er größer war als ich. Ich konnte sehen, wie er versuchte, meinen Aufzug und den Dienstausweis unter einen Hut zu bringen. Er war nicht der erste Polizist, dem das schwerfiel, und würde auch nicht der letzte sein. Ich dachte vielleicht wie ein Cop, sah aber bestimmt nicht wie einer aus. Schon gar nicht heute Nacht.
»Ich bin Marshal Anita Blake. Sergeant Zerbrowski erwartet mich.« Es war immer besser, den Leuten klarzumachen, dass ich mich nicht selbst zur Party eingeladen hatte. Ich war zwar dazu befugt, versuchte aber, möglichst selten ungebeten reinzuplatzen. Kein Polizist, egal welcher Ausprägung, kann es leiden, wenn sich jemand in seinen Fall reindrängt. Schon gar nicht einen großen.
Officer Douglas starrte auf meinen Ausweis, als glaubte er nicht, dass der echt war. »Davon hat mir keiner was gesagt.«
»Es ist vier Uhr früh, und ich habe nur aus Höflichkeit um Ihre Erlaubnis gebeten, die Absperrung zu durchqueren. Denn dieser Ausweis gibt mir das Recht, einen Tatort zu betreten und meine Arbeit zu tun. Wenn Sie mich aufhalten, Officer Douglas, werde ich Sie anzeigen wegen Behinderung eines U. S. Marshals bei der Ausübung seiner Pflicht.«
Er sah aus, als schluckte er etwas Saures, winkte aber einen Kollegen heran, ließ ihn seinen Platz einnehmen und hielt das Band für mich hoch. »Ich werde Sie hinbringen, Ma’am.«
Daraus konnte ich ihm keinen Vorwurf machen. Schließlich hätte der Ausweis gefälscht oder gestohlen sein können. Andererseits, wäre ich ein großer, strammer Kerl gewesen, hätte Douglas ihn nicht angezweifelt. Das war der Unterschied zwischen Neulingen und Veteranen: Die Neulinge urteilten noch sehr nach dem Äußeren. Hatten sie erst ein paar Dienstjahre hinter sich, ließen sie das bleiben. Dann hatten sie die Erfahrung gemacht, dass eine süße alte Dame genauso abdrücken kann wie ein großer Furcht erregender Kerl.
Officer Douglas machte meinetwegen keine kleineren Schritte, und das brauchte er auch nicht. Ich war es gewohnt, neben Dolph herzulaufen, und gegen den war Douglas zierlich. Selbst in meinen hochhackigen Stiefeln konnte ich mithalten. Er sah aus, als wollte er etwas sagen, schwieg aber. War vielleicht auch besser so.
Auf dieser Seite des Flusses kannten mich einige Polizisten nicht. Sie dachten das Gleiche wie Douglas, nämlich dass ich in dem Club arbeitete, und riefen uns Anzüglichkeiten zu. »Hey, Dougie, willste eine aufreißen? Keinen Lapdance im Dienst, Douglas.« Und Schlimmeres. Ich ignorierte die Sprüche. Es war vier Uhr früh und ich war noch nicht im Bett gewesen, da war mir so was egal. Und je mehr man auf diesen Mist eingeht, desto mehr kriegt man ab, das wusste ich aus Erfahrung. Ignoriere es, dann hört es auf. Denn wenn sie keine Reaktion bekommen, macht es ihnen keinen Spaß. Außerdem zielten sie mehr auf Douglas als auf mich. Ich war nur irgendeine Namenlose, die ihnen die Munition lieferte.
Douglas ignorierte es ebenfalls, aber bis wir zum Haupteingang gelangten, war er feuerrot im Gesicht. Er hielt mir die Tür auf und ich ließ ihn. Es hatte mal eine Zeit gegeben, wo ich mir das nicht gefallen ließ. Aber da er vor Verlegenheit schon brannte, wollte ich ihn wegen der Tür nicht anpampen. Und vielleicht würde ich mit ihm zusammenarbeiten müssen, also scheiß drauf. Sollte er mir die Tür aufhalten. Außerdem hätte er dann von seinen Kollegen noch mehr einzustecken gehabt, und das wollte ich nicht.
Wir gingen durch die Glastüren in einen kleinen Eingangsbereich, der wie in netten Restaurants gestaltet war, mit kleinem Empfangspult und einem Maˆıtre d’. Was wahrscheinlich aber nicht der offizielle Titel des großen Typen war, der dahinterstand. Aber immerhin trug er ein Dinnerjacket mit Fliege. Bei unserer letzten Begegnung hatte er sich meinen und Ashers Namen nennen lassen und per Telefon eine Platzanweiserin bestellt, die uns hineinbegleitete. Jetzt stützte er den Kopf in die Hände und sah krank aus.
Linker Hand waren die Toiletten, und ein kurzer Flur führte in den Club. Von der Tür aus konnte man nicht in den Saal blicken. Das gab den Türstehern eine letzte Chance, Unerwünschte und Jugendliche rauszuschmeißen, ehe sie Brüste zu sehen bekamen. Die Räume waren in gedämpften Blau-und Violetttönen gehalten, und wären an den Wänden nicht die Silhouetten nackter Frauen gewesen, oh, und das Poster, das für die Mittwoch-Amateurnacht warb, hätte es nach Restaurant ausgesehen.
An den Namen des großen Typen konnte ich mich nicht erinnern. Aber das war egal, denn Douglas führte mich wortlos an ihm vorbei. Es ging eine kleine Rampe hinauf, dann lag der Club vor uns. Links befand sich ein schöner, gediegener Barbereich, auf den jeder Club stolz gewesen wäre, aber der übrige Saal war auf Striptease zugeschnitten. Oder wozu sollten die kleinen runden Bühnen sonst gedacht sein? Auch dort war alles in Blau- und Violett gestaltet. Vielleicht gab es noch ein paar andere Farben, aber das ließ sich nicht sicher sagen, denn der Stripbereich war in Schwarzlicht getaucht. Er war also beleuchtet und trotzdem schrecklich dunkel. Bei meinem ersten Besuch fand ich das verblüffend. Es war, als könnte Licht dunkel sein; der Raum war gleichmäßig ausgeleuchtet und sah doch aus, als läge er in tiefem Schatten.
Es war Wochenende und gerammelt voll. Trotzdem war es still im Club. Die DJs hatten die Musik abstellen müssen, sodass man von ihrem endlosen Geplapper verschont blieb. Trotzdem fehlte einem was, so als gehörte die Lärmkulisse zum Dekor. Die männlichen und weiblichen Gäste, es waren mehr Frauen da, als man meinen würde, saßen dicht beieinander wie Trauernde bei einer unerwarteten Beerdigung. Die Tänzerinnen hockten zusammen in einer Ecke. Bei ihnen war ein Ermittler in Zivil, den ich nicht kannte. Ein großer Polizist in der gleichen Uniform wie Douglas kam uns mit Notizblock und Stift in der Hand entgegen. Er hatte seinen Hut aufbehalten, als ob sein rundes Gesicht sonst nicht vollständig wäre.
»Douglas, wieso bringen Sie mir noch eine Stripperin an? Wir haben alle Mädchen von heute Nacht hier.« Er deutete mit dem Daumen über die Schulter. Er hatte kleine Knopfaugen, oder vielleicht war ich es auch nur leid, als Stripperin bezeichnet und übergangen zu werden, bloß weil ich eine Frau war und keine Uniform anhatte. »Es sei denn, du hast draußen was gesehen, Mädchen. Hast du?«
Ich hielt meinen Dienstausweis hoch, damit er ihn sah, und trat um Douglas herum, sodass ich vor dem Mann stand, der augenscheinlich sein Vorgesetzter war. »Federal Marshal Anita Blake. Und Sie sind?«
Sogar im Schwarzlicht war zu sehen, wie er rot wurde. »Sheriff Christopher, Melvin Christopher.« Er musterte mich von oben bis unten, aber nicht wie ein Mann, der eine Frau hübsch findet, sondern so, als hielte er nicht viel von mir. »Wissen Sie, wenn Sie nicht wollen, dass man Sie für eine Stripperin hält, sollten Sie sich besser kleiden, Miss.«
»Für Sie Marshal Blake, Sheriff, und in der Großstadt nennt man das Ausgehkleidung. Knielange Röcke sind seit einigen Jahrzehnten aus der Mode.«
Seine Gesichtsfarbe wurde ein bisschen dunkler, die Augen steigerten sich von unfreundlich zu feindselig. »Finden Sie das komisch?«
»Nein.« Ich atmete einmal tief durch. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Sie hören auf, mich als Stripperin zu bezeichnen, und ich höre auf, vorwitzige Bemerkungen zu machen. Tun wir beide so, als wären wir hier, um einen Mord aufzuklären, und machen wir unsere Arbeit.«
»Wir brauchen Ihre Hilfe nicht.«
Ich seufzte. Ich schaute mich um, sah aber kein bekanntes Gesicht. »Na schön, wenn Sie es nicht anders wollen, kann ich auch anders. Wenn ich Ihretwegen nicht alle Vampire bis Anbruch der Dämmerung befragen kann, zeige ich Sie wegen Behinderung eines Ermittlungsbeamten bei der Ausübung seiner Pflicht an.«
»Sind Freunde von Ihnen dabei? Hab gehört, dass Sie so ein Sargluder sind.«
Ich schüttelte den Kopf und ging in weitem Bogen um Douglas herum, sodass ich für ihn außer Reichweite war.
»Wo wollen Sie denn hin?«
»Ich gehe die Zeugen befragen«, antwortete ich und behielt unauffällig den Sheriff im Auge, denn ich war mir nicht sicher, was er tun würde.
»Woher wissen Sie, wo die sind?«
»Sie sind weder draußen auf dem Parkplatz noch hier im Saal. Folglich müssen sie im Saphirsalon sein.« Ich war beinahe an dem kleinen Podest vor der schönen Holzflügeltür angekommen. Davor stand ein weiterer Kollege in Uniform. Von meinem vorigen Besuch wusste ich, dass man hinter dieser Tür aus dem Saal kaum etwas hörte. Darum hatte ich noch nicht nach Zerbrowski geschrien.
Während ich die Stufen hinaufging, zog ich den Reißverschluss der Lederjacke auf. Ich hielt den Dienstausweis in der linken Hand und streckte ihn dem Polizisten entgegen. Ich wusste noch nicht, was ich tun würde, falls der Sheriff ihm befahl, mich nicht durchzulassen. Dass ich das Recht hatte, hineinzugehen, machte die Polizei noch nicht kooperativ. Sie würden nicht handgreiflich werden oder mich rauswerfen, aber wenn sie es mir schwer machen wollten, konnten sie das tun.
»Gehen sie bitte zur Seite, Officer.«
Er machte tatsächlich Anstalten dazu, doch der Sheriff pfiff ihn zurück. »Sie arbeiten nicht für sie. Sie gehen zur Seite, wenn ich es Ihnen sage.«
Na großartig, dachte ich seufzend. Dann kam mir eine Idee. Ich griff in die Innentasche der Lederjacke.
»Überlegen Sie sich gut, wonach Sie greifen«, sagte der Sheriff plötzlich dicht hinter mir.
Ich drehte mich so, dass ich sowohl ihn als auch den Officer sehen konnte, und hielt mein Handy hoch. »Kein Grund, sich aufzuregen, Sheriff. Ich will nur telefonieren.«
Er stützte die Hände oberhalb seines Sam-Brown-Gürtels in die Seiten. Er hatte die Schlaufe am Holster noch nicht gelöst, meinte es also noch nicht ernst. Er wollte nur sehen, ob er mir mit solchem Mist Angst machen konnte. Wenn er das glaubte, hatte er wirklich zu lange im Seichten geplanscht.
Ich drückte die Tasten und behielt dabei den Saal im Auge. Viele Polizisten hatten unterbrochen, was sie gerade taten, und sahen sich unsere kleine Vorstellung an. Zerbrowski nahm beim zweiten Klingeln ab. »Ich bin im Club, direkt vor der Tür.«
»Und warum nicht hinter der Tür?«, fragte er verwirrt.
»Der Sheriff hat seinem Mann befohlen, nicht zur Seite zu treten.«
»Das ist nicht wahr«, brüllte Christopher, »aber Sie können meinen Mann nicht herumkommandieren.«
Ich seufzte ins Telefon. »Wenn Sie hier mal kurz helfen könnten.«
Mit dem Telefon in der Hand öffnete Zerbrowski die Tür. »Danke, Sheriff Christopher, ich denke, Marshal Blake und ich können jetzt übernehmen.« Er legte auf, lächelte in die Runde und machte gerade so viel Platz, dass ich an ihm vorbei durch die Tür passte. Der Sheriff stand am Fuß des Podestes und blickte ihn drohend an. Mir wurde klar, dass der Egohickhack schon im Gange gewesen war, bevor ich kam. Ich war nur mitten reingeraten.
Zerbrowski machte hinter uns die Tür zu und lehnte sich kopfschüttelnd dagegen. Er ist einsfünfundsiebzig groß und hat kurze schwarze Haare, die jedes Jahr grauer werden. Wenn seine Frau ihn zum Friseur zwingt, sind sie kurz und ordentlich. Wenn er es vergisst oder sie zu beschäftigt ist, sind sie lockig und wellig und so unordentlich wie alles an ihm. Sein Anzug war braun, sein Schlips hellgelb wie sein Hemd. Ich glaube, in all den Jahren, seit ich ihn kannte, war es das erste Mal, dass alles zusammenpasste. Okay, zusammenpasste und keine Essensflecken hatte.
Sein silbernes Brillengestell kaschierte die Müdigkeit seiner Augen, aber nicht dass er sauer war. Er ging mit mir zu dem Zimmerbrunnen, neben dem ein ausgestopfter Löwe kauerte. Der Saphirsalon ist eine Kreuzung aus Jagdhütte, Safarizelt und anderem, was die Leute für maskulin halten. Der Teppichboden hat ein Leopardenmuster, sodass ich jedes Mal als Erstes denke: Oh nein, ein Leopard hat sich aufgebläht und auf allem breitgemacht, aber hey, Animalprints sind dieses Jahr absolut in. Den Kunden gefällt es offenbar, denn sie zahlen hunderte Dollar pro Abend, um sich darin aufzuhalten.
Zerbrowski kehrte dem Raum den Rücken zu und bedeutete mir, mich genau vor ihn zu stellen, damit uns niemand reden sehen konnte. »Willkommen auf der Party.«
»Warum schließen Sie die Leute des Sheriffs aus?«
»Als wir hier angekommen sind, hatten sie die Vampire hier drinnen und richteten Kreuze auf sie, die glühten wie verrückt. Sie haben die Zeugen zwar nicht grob angefasst, aber praktisch hieß das, entweder ihr redet oder die Kreuze bleiben, wo sie sind.«
»Mist. Ist der Einsatz von heiligen Gegenständen bei der Befragung von Vampiren nicht erst vor drei Monaten von einem Bundesgericht als tätlicher Übergriff verurteilt worden?«
»Ja.« Er hob seine Brille an und rieb sich die Augen mit Daumen und Zeigefinger.
»Dann könnten sie alle Anzeige erstatten«, flüsterte ich.
Er nickte und rückte seine Brille zurecht. »Wie gesagt, willkommen auf der Party.«
Bis zu diesem Urteil hatten viele Polizeireviere Kreuzzeichen als Teil der Uniform geführt, zum Beispiel als Reversknopf oder Krawattennadel. Jetzt wurde es wieder verdeckt am Körper getragen. Heilige Gegenstände wurden jetzt im Zusammenhang mit Vampiren als Waffe betrachtet. Was der Sheriff getan hatte, entsprach dem Straftatbestand des Angriffs mit einer gefährlichen Waffe.
»Hat nur er das getan oder auch seine Männer?«
»Einige seiner Männer. Sie trugen kreuzförmige Reversnadeln. Ich konnte sie dazu bringen, die wegzustecken, aber erst nachdem ich gedroht hatte, die nächste FBI-Außenstelle anzurufen.«
Ich sah ihn erstaunt an, denn kein Polizist ruft die gern.
»Lieber lasse ich mir den Fall wegnehmen, als solchen Mist durchgehen zu lassen. Jetzt haben die Vampire eine Scheißangst. Wenn jemand Schuldiges darunter ist, kann ich ihnen das nicht mehr anmerken, weil sie entweder stocksauer oder eingeschüchtert sind. Die meisten wollen nicht mal mehr mit uns reden, und von Gesetz wegen müssen sie das auch nicht.« Es war ihm nicht anzuhören, aber so wütend hatte ich ihn noch nie erlebt. Ich merkte es an der Verspannung rings um seine Augen und an der Art, wie sich seine Hände verkrampften. Zerbrowski war ein sehr entspannter Typ, aber jeder hat seine Grenzen. »Wir haben sehr ähnliche Verbrechen in New Orleans und Pittsburgh, das heißt, zwei in Pittsburgh, fünf in New Orleans, dann sind sie hierhergezogen.«
»Da haben wir ja Glück gehabt«, sagte ich.
»Ja, aber das heißt, wir können uns auf mindestens drei weitere Leichen freuen. Ich muss mit diesen netten Vampirmitbürgern reden.«
»Ich werde sehen, was ich tun kann. Soll ich mit einem bestimmten anfangen? Es ist immerhin schon halb fünf, höchstens noch drei Stunden, bis es hell wird. Wir müssen sie vorher nach Hause gehen lassen, außer ihr könnt Anklage erheben.«
»Wir haben eine tote Frau mit zahlreichen Vampirbissen neben dem Gebäude liegen und diese Leute sind Vampire. Ich könnte wahrscheinlich einen Richter überzeugen, dass wir sie als wichtige Zeugen dabehalten sollten. Ich kennen einen, der Vampire hasst und mir die Anordnung geben würde.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir wollen die Wogen glätten, nicht alles noch schlimmer machen. Im Augenblick können sie nur die Stadt verklagen. Geben wir ihnen keinen Grund, auch uns anzuzeigen.«
Nickend ging er beiseite und machte eine schwungvolle Handbewegung. »Sie gehören Ihnen. Viel Glück.«
In der Mitte des Salons scharten sich einige Vampire um den großen Kamin. Keiner gehörte zu Jean-Claude. Einige hatten eine Sitzgruppe mit großen thronartigen Lehnstühlen belegt, andere saßen auf Polsterbänken am Feuer. Einer hielt ein Leopardenprintkissen an sich gedrückt und wirkte verstört. Die übrigen fünf hatten Angst und waren wütend, aber sie hielten sich besser als der Kissendrücker.
Ich zeigte meinen Dienstausweis und stellte mich vor. Doch es war nicht der Ausweis, der den Kissendrücker zum Wimmern brachte. »Oh Gott, sie werden uns umbringen.«
»Halt den Mund, Roger«, fuhr ihn ein großer Vampir mit glatten schwarzen Haaren und zornigen hellbraunen Augen an. »Warum sind Sie hier, Ms Blake? Wir werden gegen unseren Willen festgehalten und haben uns nichts zuschulden kommen lassen, außer dass wir Vampire sind.«
»Und Sie sind?«
Er stand auf und strich einen schönen, konservativen Anzug glatt. »Ich bin Charles Moffat.«
»Den Namen kenne ich«, sagte ich.
Einen Moment lang war ihm anzumerken, dass er nervös war, dann versuchte er, es zu überspielen. Er war keine zwanzig Jahre tot, quasi noch ein Baby.
»Sie sind einer von Malcolms Diakonen«, sagte ich.
Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder, straffte die Schultern und sagte: »Ja, das bin ich, und ich schäme mich nicht dafür.«
»Nein, aber Malcolm hat seinen Kirchenmitgliedern verboten, zu schändlichen Zwecken in dieses Viertel zu gehen.«
»Woher wissen Sie denn, was unser Meister vorschreibt?« Er wollte bluffen.
»Weil Malcolm mit dem Meister von St. Louis gesprochen und zu der Zusage bewogen hat, es ihm zu melden, wenn eines seiner Mitglieder seine Clubs besucht. Sie dürfen sich also in diesen unanständigen Lokalen gar nicht aufhalten. Sie müssen, und ich zitiere, vollkommen untadelig sein.«
Ein Vampir mit Halbglatze und Brille begann in seinem Stuhl zu schaukeln. »Ich wusste, wir hätten nicht herkommen sollen. Wenn Malcolm das herausfindet …«
»Sie ist Jean-Claudes Diener. Sie muss es ihm sagen. Und der wird es Malcolm sagen.«
»Eigentlich verlangt die Vereinbarung nur, dass er meldet, wer in unsere Clubs kommt, nicht wer sich auf dieser Seite des Flusses aufhält.«
Der bebrillte Vampir sah mich an, als hätte ich ihm die Erlösung angeboten. »Sie würden es ihm nicht verraten?«
»Wenn Sie alles aussagen, was Sie über den Fall wissen, sehe ich keinen Grund dazu.«
Er fasste Moffat am Arm, der ihn aber wegriss. »Warum sollten wir Ihnen trauen?«
»Hören Sie, nicht ich habe eine Moralklausel mit meinem Meister vereinbart und ich wurde auch nicht in einer Tittenbar erwischt, sondern Sie. Wenn hier also einer das Wort des anderen anzweifeln sollte, dann wohl ich das Ihre. Ein Vampir, der gegen die ausdrückliche Anweisung seines Meisters handelt, wie verlässlich kann der sein? Sie waren gegen Ihren Meister, Ihre Kirche ungehorsam, haben Ihren Bluteid gebrochen, oder verlangt die Kirche keinen mehr?«
»Das ist ein barbarischer Brauch«, sagte Moffat. »Unsere Mitglieder fühlen sich an unsere moralischen Maßstäbe gebunden und werden nicht durch einen magischen Eid verpflichtet.«
Lächelnd deutete ich auf die Umgebung. »Das sind ja schöne Maßstäbe.«
Moffat wurde rot, was für einen Vampir nicht ganz einfach ist, aber das verriet mir, dass er reichlich Blut zu sich genommen hatte. »An wem haben Sie sich heute Nacht gesättigt?«
Er sah mich bloß wütend an. »Also, Leute, es ist halb fünf. In knapp zwei Stunden müssen Sie zu Hause sein. Wir wollen Sie alle vor der Dämmerung hier raushaben, einverstanden?«
Alle nickten. »Dann beantworten Sie mir meine Fragen. Ich kann unterscheiden, wer von Ihnen satt ist und wer nicht. Ich muss wissen, welche Tänzerinnen oder anderen Blutspender sich dafür zur Verfügung gestellt haben. Wenn die sich nebenan befinden, muss ich mit denen sprechen. Wenn nicht, brauche ich wenigstens ihre Namen, damit ich sie heute Nacht noch anrufen oder sprechen kann.«
»Die Beziehung zwischen einem Vampir und seinem Partner ist heilig.«
»Charles, Sie haben genug Blut in sich, um erröten zu können. Möchten Sie, dass ich Mutmaßungen anstelle, woher Sie es haben?«
»Wir wurden bereits bedroht und misshandelt. Das dürfen Sie nicht.«
Ich wandte mich an die Übrigen. »Wer möchte meine Fragen beantworten und dafür das Versprechen bekommen, dass Malcolm nichts erfährt?«
Der mit der Glatze stand auf. Moffat brüllte ihn an. Aber Glatze schüttelte den Kopf. »Nein, du bist nicht mein Meister, Charles. Wir sind in der Kirche freie Bürger, einer der Gründe, weshalb wir eingetreten sind. Ich werde ihre Fragen beantworten, weil ich das Recht dazu habe.«
»Gehen wir in einen anderen Raum«, sagte ich und winkte ihm, mitzukommen. Es gab ein wirklich hübsches Meerwasseraquarium in einem Bereich, der wie ein Rauchersalon aussah. Von dort gingen mehrere kleine Zimmer ab, in die man sich mit einer Tänzerin zurückziehen konnte, um einen privaten Tanz zu bekommen.
Ich nahm das erstbeste. Es war sogar hübsch, überhaupt nicht kitschig, und hatte eine kleine Couch, einen Sessel, einen Couchtisch und individuelle Beleuchtung. Das Männlichkeitsthema wurde hier fortgeführt, aber nicht aufdringlich. »Nehmen sie Platz«, sagte ich.
Er setzte sich und rieb sich nervös über die Knie. Er war ein bisschen untersetzt und weich, sah aus wie ein Buchhalter. Wenn er sich über die Lippen leckte, blitzten seine Reißzähne hervor. Das passierte nur den Neuen. »Wie lange sind Sie schon in der Kirche?«
»Zwei Jahre.« Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte, das wird erotisch, Sie wissen schon, Vampire, die Kleidung, die Romantik.« Er schlug seine pummeligen Hände zusammen. »Aber so ist es überhaupt nicht. Ich bin immer noch Referendar, nur in einer anderen Kanzlei, wo ich nachts arbeiten kann. Ich kann nichts trinken, kein Steak essen und der Tod hat mich nicht attraktiver gemacht.« Er breitete die Hände aus. »Sehen Sie mich an, ich bin nur blasser geworden.«
»Ich dachte, die Kirche verlangt mindestens sechs Monate Beobachtung, ehe man den letzten Schritt gehen darf.«
Er nickte. »So ist es, aber sie lassen dieses ganze Moralzeug so edel erscheinen, wissen Sie. Wir sind ja so viel besser als die anderen Vampire, keine Perversen wie Jean-Claude und sein Gefolge.« Er blickte erschrocken auf. »Es tut mir leid, ich wollte nicht …«
»Ich weiß, was die Kirche über die normale Vampirgesellschaft sagt.«
»Es klang so erhaben.«
»Lassen Sie mich raten: Da war diese Frau, die zufällig Vampir war.«
Verblüfft sah er auf. »Woher wissen Sie das?«
»Gut geraten. Und nachdem Sie den Wechsel hinter sich hatten, was passierte dann?«
»Ein paar Monate lang war sie meine Partnerin, dann hatte sie anderes zu tun.«
Das war interessant, und ich merkte mir das für später. Wenn die Diakone Mitglieder durch Verführung gewannen, könnte man das als ungesetzlich betrachten oder zumindest moralisch fragwürdig. »An wem haben Sie sich heute Nacht gesättigt?«
Die Frage erwischte ihn kalt, und er starrte mich an wie ein Kaninchen im Scheinwerferkegel. »Sasha. Sie hieß Sasha«, sagte er dann.
»Und Sie haben sie hierher mitgebracht?«
Er nickte.
»Sind Sie Clubmitglied?«
Er nickte.
»Charles auch?«
Nicken.
»Die meisten, die drüben am Kamin sitzen?«
Er nickte wieder und sagte dann: »Aber Clarke ist zum ersten Mal hier.«
»Und Clarke ist der mit dem Kissen?«
»Woher wissen Sie das?«
Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Können Sie mir den Namen oder eine Beschreibung von anderen Frauen geben, an denen sich jemand gesättigt hat?« Das konnte er. Am Ende hatte ich vier Namen und zwei Personenbeschreibungen, und nur der arme Clarke hatte sich nicht gesättigt. Das hatte ich selbst schon gesehen, aber es ist immer schön, wenn man in seiner Wahrnehmung bestätigt wird.
Mit Zerbrowski als Beschützer ging ich in den Clubsaal und holte die betreffenden Frauen. Wir konnten jedem Vampir mindestens eine zuordnen. Moffat hatte drei gehabt, und er gab großzügige Trinkgelder. Zwei der Tänzerinnen hatte er regelmäßig. Für einen Diakon ziemlich unartig.
Es dauerte gut zwei Stunden, bis ich heraushatte, wer wann mit wem zusammen gewesen war. Das hieß nicht, dass sich keiner davongestohlen und sich noch woanders gesättigt hatte, aber das machte es weniger wahrscheinlich. Ich schlug vor, die Zahnabstände der Vampire mit den Bissmalen an der Toten später zu vergleichen, falls es nötig würde. Wir kannten ihre Namen und wussten, wo sie zu finden waren.
Die interessanteste Information hatte ich von dem Vampir, mit dem ich zuerst gesprochen hatte, sowie von Clarke, der solche Angst hatte, dass er seine Mutter verraten hätte. Zu Beginn des Abends waren drei weitere Kirchenmitglieder im Club gewesen, und die gehörten zu einer Clique, die häufig in die Stripbars ging. Von denen war jedoch keiner Mitglied des Saphirsalon-VIP-Clubs. Ich hatte ihre Namen und eine Adresse der jüngsten unter den Vampiren. Vielleicht hatten sie etwas mit dem Mord zu tun oder ihnen war einfach langweilig geworden und sie waren früh nach Hause gefahren. Es war kein Verbrechen, ein Lokal zu verlassen.
Zerbrowski hatte tatsächlich Verstärkung angefordert, damit wir die Vampire sicher zu ihren Wagen bringen konnten. Von denen war keiner alt und machtvoll genug, um nach Hause fliegen zu können. Nachdem wir den letzten der Untoten in ihre Minivans und Kleinwagen verfrachtet hatten, nahm Zerbrowski mich auf die Seite und sagte: »Habe ich richtig gehört? Die Vampirkirche lässt ihre Mitglieder eine Moralklausel unterschreiben?«
Ich nickte. »Die anderen Vampire nennen sie die Nachtschichtmormonen.«
Er grinste. »Nachtschichtmormonen, wirklich?«
»Ehrlich.«
»Das ist gut. Das muss ich mir merken.« Er schaute hinter uns zu den wartenden Kranken- und Feuerwehrwagen und dem vielen Personal. »Da die Vampire jetzt gerettet sind, wie wär’s, wenn Sie sich jetzt die Leiche ansehen?«
»Ich dachte schon, Sie fragen nie.«
Er grinste, und es vertrieb ein wenig die Müdigkeit aus seinen Augen. »Ich geh als Erster die Leiter runter.«
»Welche Leiter?«, fragte ich stirnrunzelnd.
»Die Tote liegt in einem Loch, das ein paar übereifrige Straßenarbeiter hinterlassen haben. Nach Aussage des Clubmanagers haben sie die Straße aufgerissen, aber nicht alle Genehmigungen beisammen, sodass es bei dem Loch geblieben ist. Dafür haben wir die Feuerwehr bestellt, damit sie uns die Leiche heraufhieven, wenn Sie fertig sind.«
»Sie werden nicht vor mir runtersteigen, Zerbrowski.«
»Was tragen Sie unter Ihrem Mini?«
»Das geht Sie überhaupt nichts an. Und wenn Sie mich nicht als Erste runtersteigen lassen, sage ich es Ihrer Frau.«
Er lachte, und einige Leute blickten zu uns herüber. Die froren noch mehr als wir und waren genauso müde. Ich glaube nicht, dass die einen Grund zum Lachen sahen. »Katie weiß, dass ich ein Lustmolch bin.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie schlimm ist es da unten?«
»Mal sehen, es hat geregnet, gefroren, getaut und wieder geregnet.«
»Scheiße.«
»Wo ist der Overall, den Sie sonst bei der Tatortbegehung tragen?«
»Es verstößt jetzt gegen die Firmenpolitik, diese Dinger bei Totenerweckungen zu tragen.« Ich erwähnte nicht, dass ich versehentlich einen Overall getragen hatte, an dem noch Blut klebte. Die Frau eines Klienten war ohnmächtig geworden. Konnte ich etwas dafür, dass sie eine schwache Konstitution hatte? Das Verbot war nicht auf Berts Mist gewachsen, sondern per Abstimmung unter den Animatoren entstanden. Darum musste ich mich daran halten. »Ich hatte nicht vorgehabt, heute Nacht in Erdlöcher zu kriechen und mir Leichen anzusehen.«
Das Grinsen verschwand aus seinem Gesicht. »Ich auch nicht. Bringen wir’s hinter uns. Ich will nach Hause und meine Frau und Kinder umarmen, bevor sie zur Schule und zur Arbeit müssen.«
Ich wies ihn nicht darauf hin, dass es halb sieben und seine Chance, es rechtzeitig nach Hause zu schaffen, verschwindend gering war. Jeder braucht ein bisschen Hoffnung. Wer war ich, seine zu zerstören?
47
Die Frau in der Grube war längst jenseits von Hoffnung oder Furcht. Ihr Gesicht wirkte leer, wie bei allen Toten. Gelegentlich sieht mal einer aus, als hätte er Angst, aber das ist Zufall, abhängig davon, wie sich die Gesichtsmuskeln im Augenblick des Todes bewegt haben. Die meisten sehen nur leer aus, als ob ihnen etwas Wesentliches fehlt, nicht nur der Atem oder der Herzschlag. Ich hatte genug Augen leer werden sehen, um sagen zu können, dass mit dem letzten Atem noch etwas anderes ausgehaucht wird. Oder vielleicht war ich nur müde und wollte nicht knöcheltief im Matsch stehen, um auf eine Frau hinunterzublicken, die jünger war als ich und nun nicht mehr älter werden würde. Wenn ich noch nicht im Bett gewesen bin, werde ich umso makabrer, je mehr es auf die Dämmerung zugeht.
Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen dieser und der vorigen Leiche. Sie lag genauso auf dem Rücken, beide waren Stripperinnen gewesen, beide waren vor der Tür des Clubs getötet worden, in dem sie gearbeitet hatten, beide waren blond und weiß. Rechts und links am Hals hatte sie Bissmale, dazu eins in der linken Armbeuge, am rechten Handgelenk und an der Brust. Um zu erkennen, ob sie an den Oberschenkeln gebissen worden war, hätte ich mich in den Matsch knien müssen, und das wollte ich nicht. Ganz einfach. Ich nahm mir fest vor, nie wieder irgendwohin zu fahren, ohne einen Overall und Dreckstiefel mitzunehmen. Ich hatte mir Handschuhe von Zerbrowski leihen müssen. Als ich mit dem Jeep von Hause weggefahren war, hatte ich meine Verabredung im Sinn gehabt, nicht die Arbeit. Wie dumm von mir.
Ich stand auf und überlegte, ob es anginge, dass ich mal nicht im Matsch herumkroch und mir sämtliche Bisse anguckte. »Sie ist fast einen Kopf größer als die andere. Auch blond, aber die Haare sind sehr kurz. Die andere hatte lange Haare. Davon abgesehen ist alles sehr ähnlich.«
»Die Zahnabstände stimmen überein.«
»Wer hat gemessen?«, fragte ich.
Er nannte mir den Namen, aber der sagte mir nichts. Ich war auf der anderen Seite des Flusses, und dort hatte ich selten Mordopfer zu begutachten. Zwar erledigte ich Hinrichtungen für Illinois, war aber selten als Gutachterin tätig. Ich wollte die Feststellung der Details keinem überlassen, den ich nicht kannte. Wenn nur ein Zahnabstand anders war, bedeutete das einen Wechsel in der Tätergruppe. Wir mussten wissen, ob wir nach fünf, sechs oder mehr Tätern suchten.
Seufzend holte ich mein kleines Maßband aus der Jackentasche, das ich mittlerweile bei den Feuchttüchern im Handschuhfach liegen hatte. Ich maß die leicht zugänglichen Bisse zuerst und ließ Zerbrowski die Ergebnisse notieren. Dann stützte ich zwischen den Beinen der Toten behutsam ein Knie auf. Der Morast war kalt. Ich spreizte die Beine der Toten und fand Bisse an der Innenseite der Oberschenkel. Ich maß alle aus, die ich finden konnte. Die Abstände stimmten mit denen an der vorigen Leiche überein. So ungefähr. Ich benutzte diesmal ein anderes Maßband, was ich eigentlich nicht tun durfte. Ich hätte mir nicht das vom Leichenbeschauer borgen sollen. Messinstrumente können voneinander abweichen. Theoretisch nicht, aber praktisch eben doch.
Vorsichtig erhob ich mich aus dem Kniestand. Mir ging es darum, nicht mit dem Hintern im Matsch zu landen. Hochhackige Stiefel waren nicht die beste Voraussetzung dafür. Darum war ich vorsichtig. »Der Club lässt seine Sicherheitsleute auch das Grundstück patrouillieren, mindestens von einem. Es ist Wochenende, da sollten es zwei sein. Haben die etwas gesehen oder gehört?«
»Einer hat die Tänzerin im Mantel herauskommen sehen. Sie hatte Feierabend. Er sah sie zu ihrem Wagen gehen«, er blätterte in seinem Notizbuch zurück, »dann war sie nicht mehr da.«
Ich sah ihn an. »Was haben Sie gesagt?«
»Er sagte, sie ging zu ihrem Wagen, er winkte ihr zu, dann lenkte ihn auf der anderen Seite des Parkplatzes etwas ab. Er blieb vage, worin die Ablenkung bestand, schwört aber, dass er nur kurz weggesehen hat. Als er wieder zu ihrem Wagen schaute, war sie verschwunden.«
»Verschwunden.«
»Ja. Warum machen Sie so ein Gesicht, als ob das was zu bedeuten hätte?«
»Ist er sofort zu ihrem Wagen gegangen?«
Er nickte. »Ja, und als er sie da nicht gefunden hat, ging er hinein, um nachzusehen, ob sie wieder rein ist. Nachdem sie drinnen auch nicht war, hat er einen Kollegen geholt und mit ihm das Gelände abgesucht. Dann haben sie sie gefunden.«
»Was meint er, wie lange er weggesehen hat?«
»Ein paar Sekunden lang.«
»Wurde überprüft, ob jemand gesehen hat, wie sie den Club verlassen hat? Ich würde gern wissen, zu welcher Uhrzeit das war und wie lange der Mann tatsächlich in die andere Richtung geschaut hat.«
»Lassen Sie uns aus diesem Loch steigen. Dann können wir nachfragen, wer sie beim Nachhausegehen gesehen und dabei auf die Uhr geguckt hat.«
Er blätterte in seinem Notizbuch. Die Grube war gut ausgeleuchtet; das Licht war unbarmherzig hell, sodass mir der Gedanke kam, die Tote zuzudecken, um sie nicht länger fremden Blicken auszusetzen. Sentimental, ich wurde eindeutig sentimental.
»Einer Frau unter den Gästen hat die Blonde tatsächlich so gut gefallen, dass sie auf die Uhr gesehen hat, als die den Club verließ.«
»Und wie passt das zur Aussage des Sicherheitsmanns?«
Er verglich die beiden Zeitangaben. »Da ergibt sich ein Zeitraum von zehn Minuten.«
»Das ist reichlich lange, um etwas anzustarren, über das er sich nicht mal so ganz im Klaren ist.«
»Sie glauben, er lügt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, er hat ausgesagt, was er für wahr hält.«
»Verstehe ich nicht. Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte Zerbrowski.
Ich lächelte ihn an, aber nicht heiter. »Einer der Täter muss ein Meistervampir sein, zu dem Schluss waren wir schon gekommen, aber er muss außerdem fähig sein, einem Menschen den Verstand zu vernebeln.«
»Ich dachte, das kann jeder Vampir.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie können einen Menschen mit den Augen in ihren Bann ziehen, und wenn sie zubeißen, sein Gedächtnis auslöschen. Wenn sie sehr mächtig sind, können sie die Erinnerung auch selektiv löschen. Das Opfer erinnert sich dann vage an Blickkontakt oder an die leuchtenden Augen eines Tieres oder an Autoscheinwerfer. Der Verstand versucht dem Geschehen eine alltägliche Bedeutung zu geben.«
»Okay. Einer der Täter hat ihn also mit seinem Blick ausgeschaltet.«
»Nein, Zerbrowski, ich wette, er hat es nicht mit den Augen getan. Ich wette, er hat es von Weitem ohne direkten Blickkontakt bewirkt. Ich werde den Mann fragen, woran er sich erinnert. Wenn er selbst bissfrei ist und keine sonderbare Erinnerung hat, wurde es aus sicherer Entfernung ohne direkten Blickkontakt getan.«
»Und das heißt?« Er klang gereizt und müde.
Darum nahm ich es nicht persönlich. »Das heißt, dass einer der Täter ein alter Vampir ist. Ein alter Meistervampir. Wir sprechen hier von einem großen Talent, das nur sehr wenige haben.«
»Namen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Sprechen wir mit dem Sicherheitsmann und danach soll er sich für uns entblättern.«
Kurz sah er mich über den Brillenrand hinweg an. »Habe ich richtig gehört?«
»Wir müssen ihn auf Vampirbisse untersuchen. Wenn er sauber ist, suchen wir nach einem sehr mächtigen, andernfalls nach einem gewöhnlichen Vampir. Glauben Sie mir, das ist entscheidend dafür, mit wem wir reden müssen.«
»Sind es Leute von Jean-Claude?«, fragte Zerbrowski.
»Nein.«
»Wie können Sie da sicher sein?«
Wie konnte ich da sicher sein? Ich war so müde, dass ich die Frage in Gedanken wiederholte und überlegte, was Jean-Claude wohl antworten würde. Würde er garantieren, dass die Täter nicht zu seinen Leuten gehörten? Der Gedanke genügte; plötzlich war er in meinem Kopf. Mist.
Er sah, was ich sah. Nicht gut bei einer Morduntersuchung, wenn das Opfer von Vampiren getötet worden war. Ich begann, mich abzuschirmen, versuchte, ihn rauszuwerfen, aber plötzlich kannte ich die Antwort auf meine Frage. »Mein Bluteid hält sie von dergleichen ab, denn es verstößt gegen meine ausdrückliche Anordnung, negative Aufmerksamkeit der Polizei auf uns zu ziehen.«
Ich dachte: Liv hat mal den Eid gebrochen, und er hörte mich. »Damals war ich nicht le sourdre de sang. Jetzt wird mein Eid nicht mehr so leicht abgeschüttelt, ma petite.«
Ich war zu lange still geblieben. Zerbrowski fragte: »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
»Habe nur nachgedacht.« Bisher war mir nicht klar gewesen, welche Bedeutung so ein Bluteid tatsächlich hatte. »Weil Jean-Claudes Leute alle den Bluteid geschworen haben. Der bindet sie auf mystische Weise an ihren Meister. Jean-Claude verbietet seinen Vampiren, solche Straftaten zu begehen.«
»Soll das heißen, der Bluteid macht es unmöglich?«
»Nicht unmöglich, aber schwerer. Das hängt davon ab, wie stark der Meister ist, dem sie den Eid schwören.«
»Wie stark ist Jean-Claude?«
Ich überlegte, wie ich das erklären sollte, und beließ es schließlich bei einer Bekräftigung. »So stark, dass ich auf die Unschuld seiner Leute mein Geld wetten würde.«
»Aber garantieren wollen Sie es nicht.«
»Garantien sind was für Haushaltsgeräte, nicht für Mordfälle.«
Er grinste. »Das ist schlau. Werde ich vielleicht auch mal verwenden.«