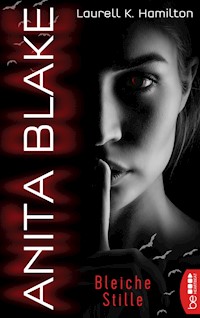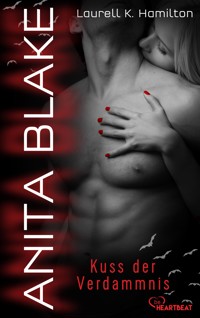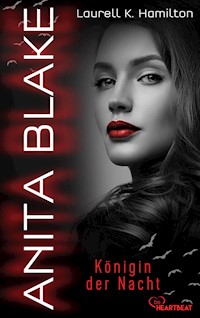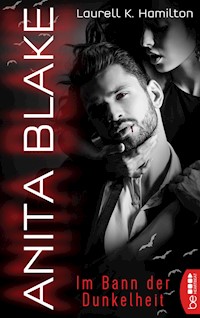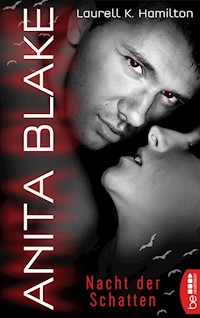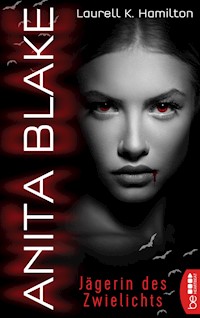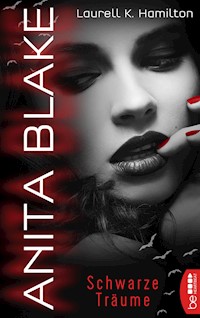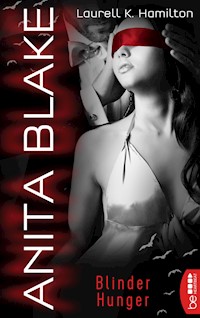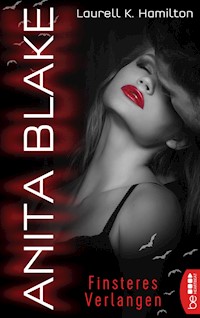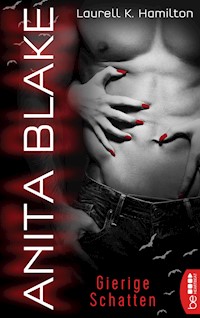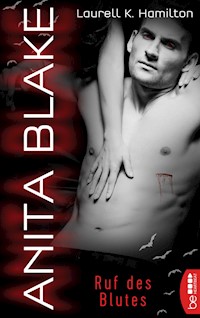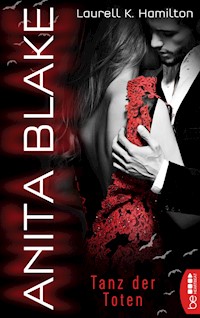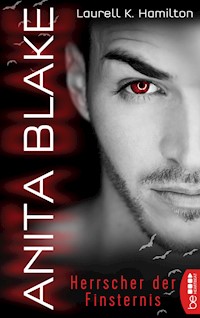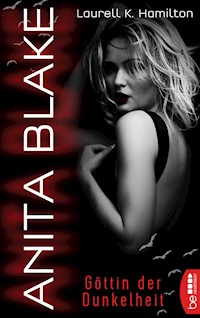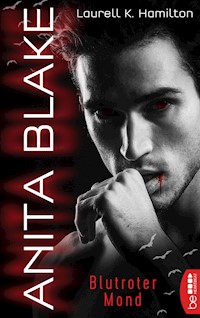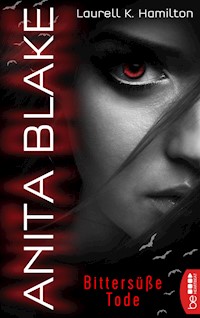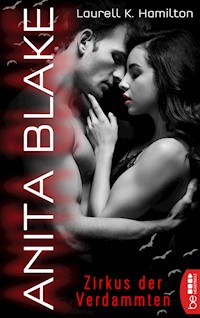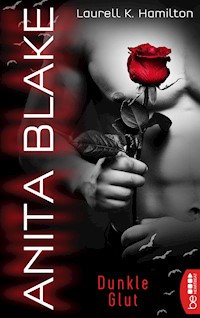
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Alarm in St. Louis: Ein Brandstifter mit unheimlichen Geisteskräften heizt den Untoten der Stadt gehörig ein. Vampirjägerin Anita Blake geht der Sache auf den Grund. Doch ihre gefährliche Liaison mit Jean-Claude, dem Meistervampir der Stadt, macht den Fall mehr als kompliziert - und so findet sie sich plötzlich auf der Seite des vermeintlich Bösen. Die Lage spitzt sich zu, als auch noch der mächtige Rat der Vampire auf den Plan tritt. Jean-Claude soll seinen Platz in den Reihen des Rates einnehmen - eine zweifelhafte Ehre, denn als Jean-Claude ablehnt, beginnt ein tödliches Spiel ...
Nächster Band: Anita Blake - Ruf des Blutes.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die Serie: Anita Blake – Vampire HunterÜber diesen BandÜber die AutorinTriggerwarnungTitelImpressumWidmung1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253DanksagungenIm nächsten BandÜber die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u. a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Alarm in St. Louis: Ein Brandstifter mit unheimlichen Geisteskräften heizt den Untoten der Stadt gehörig ein. Vampirjägerin Anita Blake geht der Sache auf den Grund. Doch ihre gefährliche Liaison mit Jean-Claude, dem Meistervampir der Stadt, macht den Fall mehr als kompliziert – und so findet sie sich plötzlich auf der Seite des vermeintlich Bösen. Die Lage spitzt sich zu, als auch noch der mächtige Rat der Vampire auf den Plan tritt. Jean-Claude soll seinen Platz in den Reihen des Rates einnehmen – eine zweifelhafte Ehre, denn als Jean-Claude ablehnt, beginnt ein tödliches Spiel …
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Dunkle Glut
Aus dem amerikanischen Englisch von Angela Koonen
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Burnt Offerings«
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2007/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Dunkle Glut«
Covergestaltung: Guter Punkt, München
unter Verwendung von Motiven © iStock/BojanMirkovic; iStock/inarik
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0243-0
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meine Großmutter Laura Gentry,die mir bei einsfünfzig Körpergröße gezeigt hat,dass man klein, ein Mädchen und trotzdem stark sein kann.
1
Die meisten Leute starren meine Narben nicht an. Natürlich gucken sie, aber dann sehen sie woandershin. Sie wissen schon: ein kurzer Blick, hastiges Wegsehen, dann ein zweiter Blick. Aber sie machen es schnell. Die Narben sind noch nicht Freak-Show-tauglich, aber durchaus fesselnd. Captain Pete McKinnon, Feuerwehrmann und Brandstiftungsermittler, saß mir gegenüber, die großen Hände um das Glas mit Eistee, das Mary, unsere Sekretärin, ihm gebracht hatte. Er starrte auf meine Arme. Nicht gerade die Stelle, wo die meisten Männer hingucken. Aber es war nicht sexuell gemeint. Er betrachtete meine Narben und schien nicht im Geringsten verlegen zu sein.
Der rechte Arm war mir zweimal mit einem Messer aufgestochen worden. Die eine Narbe war alt und weiß, die andere noch neu und rosa. Der linke Arm sah schlimmer aus. Ein Wulst Narbengewebe am Ellbogen. Ich würde den Rest meines Lebens Gewichte stemmen müssen, damit sich die Narben nicht versteifen und die Beweglichkeit des Arms nicht verloren geht, das meint jedenfalls mein Physiotherapeut. Dann war da noch die kreuzförmige Brandnarbe, die inzwischen ein bisschen krumm geworden war durch die Kratzwunde, die ich mir von einer Hexe eingehandelt hatte. Und es gab noch ein oder zwei weitere Narben, die unter der Bluse verborgen waren, aber der Arm war wirklich am schlimmsten.
Bert, mein Boss, verlangte neuerdings, dass ich im Büro die Kostümjacke oder langärmlige Blusen trug. Er sagte, dass manche Klienten starke Vorbehalte gegen meine, äh …, beruflich erworbenen Verletzungen hätten. Seitdem trug ich keine langärmligen Blusen mehr. Er stellte die Klimaanlage jeden Tag ein bisschen kälter ein. An diesem Tag war es so kühl, dass ich Gänsehaut hatte. Alle anderen kamen im Pullover zur Arbeit. Ich durchstöberte die Geschäfte nach bauchfreien Oberteilen, um demnächst meine Rückennarben zur Geltung zu bringen.
McKinnon war mir von Sergeant Rudolph Storr geschickt worden. Sie hatten auf dem College zusammen Football gespielt und waren seitdem Freunde. Dolph gebrauchte das Wort nicht leichtfertig, darum wusste ich, dass sie einander wirklich nahestanden.
»Was ist mit Ihrem Arm passiert?«, fragte McKinnon schließlich.
»Ich erledige im Auftrag des Staates die Hinrichtung von Vampiren. Die sind manchmal vertrackt.« Ich trank einen Schluck Kaffee.
»Vertrackt«, wiederholte er und lächelte.
Er stellte sein Glas auf den Schreibtisch und zog sich das Jackett aus. Seine Schulterbreite stimmte etwa mit meiner Körpergröße überein. Er war nur knapp von Dolphs zwei Meter vier entfernt, aber wirklich knapp. Er war erst etwas über Vierzig, aber seine Haare waren vollständig grau, an den Schläfen wurden sie schon weiß. Er wirkte deswegen nicht würdevoller, er sah nur müde aus.
Bei den Narben war er mir voraus. An den Armen hatte er Brandnarben von den Händen bis unter die kurzen Ärmel seines weißen Oberhemds. Die Haut war rosa, weiß und braun gesprenkelt wie bei einem Tier, das sich regelmäßig häutet.
»Das muss wehgetan haben«, stellte ich fest.
»Hat es.« Er saß da und begegnete mir mit einem langen festen Blick. »Bei solchen sieht man auch schon mal ein Krankenhaus von innen.«
»Klar.« Ich schob meinen linken Ärmel hoch und entblößte die glänzende Stelle, wo mich eine Kugel gestreift hatte. Seine Augen weiteten sich ein klein wenig. »Nachdem wir uns jetzt gezeigt haben, wie hart wir sind, können wir vielleicht zur Sache kommen. Warum sind Sie hier, Captain McKinnon?«
Er lächelte und hängte sein Jackett über die Stuhllehne. Dann nahm er sein Glas vom Schreibtisch und trank. »Dolph hat gesagt, Sie mögen es nicht, wenn man Sie taxiert.«
»Ich bestehe nicht gerne Prüfungen.«
»Woher wissen Sie, dass Sie bestanden haben?«
Jetzt musste ich lächeln. »Weibliche Intuition. Also, worum geht es?«
»Wissen Sie, was ein Feuerteufel ist?«
»Ein Brandstifter«, antwortete ich.
Er sah mich erwartungsvoll an.
»Ein Pyrokinetiker, der mittels psychischer Kräfte Feuer erzeugen kann.«
Er nickte. »Haben Sie mal einen erlebt?«
»Ich habe Filme von Ophelia Ryan gesehen«, sagte ich.
»Die alten Schwarzweißstreifen?«
»Ja.«
»Sie ist schon tot, wissen Sie.«
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Ist in ihrem Bett verbrannt, Selbstentzündung. Viele Pyrokinetiker enden so. Als ob sie die Kontrolle verlieren, wenn sie alt sind. Sind Sie mal einem persönlich begegnet?«
»Nein.«
»Wo haben Sie die Filme gesehen?«
»Im zweiten Semester Parapsychologie. Da kam ein Medium nach dem anderen in den Kurs, um seine Fähigkeiten zu demonstrieren, aber Pyrokinese ist selten. Der Prof hat wohl keinen auftreiben können.«
Er nickte und leerte sein Glas mit einem langen Schluck. »Ich habe Ophelia Ryan einmal gesehen, bevor sie starb. Nette Dame.« Er fing an, das Glas in den Händen zu drehen. Er starrte es an, während er weiterredete. »Ich hatte auch mal mit einem anderen Feuerleger zu tun. Er war noch jung, in den Zwanzigern. Er fing mit leer stehenden Häusern an, wie viele Pyromanen. Dann steckte er bewohnte Häuser in Brand, aber es kamen immer alle noch rechtzeitig raus. Dann hat er es bei einer Mietskaserne gemacht, war eine richtige Feuerfalle. Er hat sämtliche Ausgänge angezündet. Sind über sechzig Leute umgekommen, hauptsächlich Frauen und Kinder.«
McKinnon sah mich starr an. Sein Blick wirkte gehetzt. »Das ist bisher die größte Opferzahl, die ich bei einem Brand gesehen habe. Er hat es dann bei einem Bürogebäude noch mal versucht, hat aber zwei Ausgänge übersehen. Dreiundzwanzig Tote.«
»Wie haben Sie ihn geschnappt?«
»Er hat angefangen, an die Zeitungen zu schreiben und ans Fernsehen. Er wollte Anerkennung für seine Taten. Er hat noch zwei Polizisten in Brand gesteckt, ehe wir ihn endlich hatten. Wir trugen diese dicken Silberanzüge, die man beim Löschen auf Bohrinseln trägt. Die sollte er nicht entzünden können. Wir haben ihn auf dem Polizeirevier abgeliefert, und das war ein Fehler. Er hat es angezündet.«
»Wo hätten Sie ihn sonst hinbringen können?«, fragte ich.
Er zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, irgendwohin eben. Ich hatte meinen Schutzanzug noch an und hielt ihn fest, drohte, wir würden gemeinsam verbrennen, wenn er nicht aufhörte. Er lachte und hat sich selbst angezündet.« McKinnon stellte sein Glas sehr behutsam an die Schreibtischkante.
»Die Flammen hatten diese blaue Farbe, ähnlich wie bei brennendem Gas, nur heller. Ihm haben sie nicht geschadet, aber mein Anzug fing dann doch an zu brennen. Diese verdammten Dinger halten sechstausend Grad aus, und meiner schmolz einfach. Menschliche Haut brennt bei hundertzwanzig Grad, aber ich bin nicht verbrutzelt, nur der Anzug. Ich musste ihn ausziehen, während der Kerl mich auslachte. Er marschierte zur Tür raus und glaubte, es würde schon niemand so dumm sein und ihn festhalten.«
Ich verkniff mir das Naheliegende und ließ ihn reden.
»Auf dem Gang habe ich ihn angegriffen und ein paar Mal gegen die Wand geknallt. Komisch war, dass meine Haut nicht brannte, wo sie mit ihm in Berührung gekommen war. Das Feuer übersprang die Stellen einfach, darum sind meine Hände heil geblieben.«
Ich nickte. »Es gibt eine Theorie, dass Pyros durch ihre Aura vor dem Feuer geschützt sind. Bei der Berührung haben Sie von seiner Aura profitiert.«
Er starrte mich an. »Vielleicht ist es so gewesen, denn ich habe ihn immer wieder hart gegen die Wand geschleudert. Er hat geschrien: ›Ich werde dich verbrennen, ich werde dich bei lebendigem Leib verbrennen.‹ Dann wurde das Feuer gelb, ganz normal, und er fing selbst zu brennen an. Ich ließ ihn los und rannte zum Feuerlöscher. Wir konnten ihm nicht helfen. Der Schaum löschte an den Wänden und überall, aber nicht bei ihm. Es sah aus, als käme das Feuer von innen durch seine Haut gekrochen. Wir konnten es teilweise eindämmen, aber dann kam immer mehr, bis er in Flammen stand.«
McKinnons Augen waren schreckgeweitet, als sähe er es noch vor sich. »Er ist nicht gestorben, Ms Blake, nicht wie es hätte sein müssen. Er schrie furchtbar lange, und wir konnten nichts für ihn tun, konnten ihm nicht helfen.« Ihm versagte die Stimme. Er saß da und starrte ins Leere.
Ich wartete und schließlich fragte ich freundlich: »Warum sind Sie hier, Captain?«
Er blinzelte und schüttelte sich ein wenig. »Ich fürchte, wir haben wieder einen Pyrokinetiker am Hals, Ms Blake. Dolph meint, wenn uns jemand helfen kann, die Sache zu beenden, dann Sie.«
»Psychokinetische Fähigkeiten sind theoretisch nichts Übernatürliches. Sie sind ein Talent, wie beim Sport starke Bälle werfen können.«
Er schüttelte den Kopf. »Was ich an dem Tag auf dem Flur habe sterben sehen, war kein Mensch. Kann kein Mensch gewesen sein. Dolph sagt, Sie sind der Monsterexperte. Helfen Sie mir, das Monster einzufangen, bevor es anfängt Leute umzubringen.«
»Bisher ist noch niemand ums Leben gekommen? Nur Sachschäden?«, fragte ich.
Er nickte. »Es kann mich meine Stelle kosten, dass ich zu Ihnen gekommen bin. Ich hätte das nach oben weitergeben und auf eine Genehmigung warten müssen, aber wir haben bisher nur ein paar Gebäude verloren, und ich wollte, dass es dabei bleibt.«
Ich seufzte unauffällig. »Ich bin froh, wenn ich Ihnen helfen kann, Captain, aber ich weiß ehrlich nicht, was ich für Sie tun könnte.«
Er brachte einen dicken Schnellhefter zum Vorschein. »Hier ist alles drin, was wir haben. Sehen Sie es durch und rufen Sie mich heute Abend an.«
Ich nahm die Akte und legte sie mitten auf meine Schreibunterlage.
»Meine Nummer steht da drin. Rufen Sie mich an. Vielleicht ist es ja gar kein Pyrokinetiker, sondern etwas anderes. Auf alle Fälle kann er in Feuer baden ohne zu verbrennen. Er kann durch ein Gebäude gehen und Feuer versprühen wie ein Rasensprenger, ohne Brandbeschleuniger, Ms Blake, und trotzdem gehen die Häuser in Flammen auf, als wären sie mit irgendeinem Zeug getränkt. Als wir das Holz im Labor haben untersuchen lassen, war es sauber. Wer immer das ist, er kann mit Feuer Dinge anstellen, die eigentlich nicht möglich sind.«
Er schaute auf die Uhr. »Ich bin spät dran. Ich versuche, Sie offiziell in den Fall reinzubringen, aber ich fürchte, die warten, bis Leute umgekommen sind. Ich will nicht so lange warten.«
»Ich werde Sie heute noch anrufen, aber es könnte spät werden. Wann wäre es Ihnen zu spät für einen Anruf?«
»Nie, Ms Bake, zu keiner Zeit.«
Ich nickte und stand auf, reichte ihm die Hand. Er schüttelte sie. Sein Händedruck war fest, aber nicht unangenehm. Viele männliche Klienten, die mich nach meinen Narben fragen, quetschen mir die Hand, als wollten sie einen Aufschrei provozieren. Aber bei McKinnon war ich sicher. Er hatte selbst Narben.
Kaum hatte ich mich wieder hingesetzt, als das Telefon klingelte. »Was gibt’s, Mary?«
»Ich bin’s«, sagte Larry. »Mary meinte, Sie hätten nichts dagegen, wenn sie mich direkt durchstellt.« Vampirhenkerlehrling Larry Kirkland hätte eigentlich im Leichenschauhaus sein und Vampire pfählen sollen.
»Ja. Was gibt’s?«
»Ich brauche jemanden, der mich nach Hause fährt.« Da war ein ganz leichtes Zögern zu hören gewesen.
»Was ist los?«
Er lachte. »Ich sollte eigentlich wissen, dass ich bei Ihnen nicht zimperlich zu sein brauche. Ich wurde zusammengeflickt. Der Doc sagt, es wird alles wieder gut.«
»Was ist passiert?«, fragte ich.
»Holen Sie mich ab, dann erzähle ich es Ihnen.« Dann hängte der kleine Gauner einfach ein.
Es gab nur einen Grund, warum er es mir nicht sagen wollte. Er hatte eine Dummheit begangen und war deshalb verletzt worden. Zwei Leichen hatte er pfählen sollen. Zwei, die sich frühestens in der nächsten Nacht wieder erhoben hätten. Was konnte schiefgegangen sein? Wie es so schön hieß: Es gab nur eine Methode, das herauszufinden.
Mary sagte meine Termine ab. Ich holte mein Schulterholster mit der Browning Hi-Power aus der Schublade und streifte es über. Die Pistole lag dort, seit ich die Kostümjacke im Büro nicht mehr anbehielt. Außerhalb des Büros ging ich bewaffnet, und bei Dunkelheit sowieso. Die meisten Monster, die mir die Narben beigebracht hatten, waren tot. Die Mehrheit von meiner Hand. Versilberte Kugeln sind eine wunderbare Sache.
2
Larry saß sehr behutsam auf dem Beifahrersitz meines Jeeps. Es ist hart, mit frisch genähtem Rücken in einem Auto zu sitzen. Ich hatte die Wunde gesehen. Sie bestand aus einem sauberen Einstich und einem langen, tiefen Kratzer. Eigentlich also zwei Wunden. Larry hatte noch das blaue T-Shirt an, in dem er hingefahren war, aber hinten war es blutig und zerrissen. Ich war beeindruckt, dass er die Krankenschwestern davon hatte abhalten können, es hinten aufzuschneiden. Sie neigten nämlich dazu, einem sämtliche Kleider zu zerschneiden, die ihnen im Weg waren.
Larry zog an seinem Sicherheitsgurt und versuchte, eine angenehme Haltung zu finden. Seine roten Haare waren frisch geschnitten und so kurz, dass die Locken fast nicht auffielen. Er war einsdreiundsechzig, also unwesentlich größer als ich. Im vergangenen Mai hatte er seinen Abschluss in übernatürlicher Biologie gemacht. Aber mit den Sommersprossen und der kleinen Schmerzensfalte zwischen den klaren blauen Augen sah er eher wie sechzehn als wie einundzwanzig aus.
Ich hatte ihm so fasziniert zugesehen, wie er sich auf seinem Sitz wand, dass ich die Abfahrt zur I-270 verpasste. Wir steckten bis zur Olive auf der Ballas fest. Es war kurz vor dem Mittagessen, und die Olive würde völlig überlaufen sein, weil sich alle Leute irgendwo den Bauch vollstopften, um dann wieder zur Arbeit zu rasen.
»Haben Sie Ihre Schmerztablette genommen?«, fragte ich.
Er versuchte, sehr still zu sitzen. Einen Arm hatte er auf die Sitzkante gelegt. »Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil mich solches Zeug umhaut. Ich will nicht schlafen.«
»Es wäre kein normaler Schlaf«, widersprach ich.
»Richtig, die Träume sind noch schlimmer.«
Da hatte er recht. »Was ist passiert, Larry?«
»Ich staune, dass Sie mit der Frage so lange warten konnten.«
»Ich auch, aber vor den Ärzten wollte ich nicht fragen. Wenn man anfängt, dem Patienten Fragen zu stellen, gehen die Ärzte oft, um den nächsten zu behandeln. Ich wollte aber von dem Arzt wissen, wer Sie genäht hat und wie ernst es ist.«
»Sind nur ein paar Stiche«, sagte er.
»Zwanzig«, erwiderte ich.
»Achtzehn.«
»Ich habe nur aufgerundet.«
»Glauben Sie mir, das ist gar nicht nötig«, meinte er und zog eine Grimasse. »Warum tut das bloß so weh?«, fragte er.
Das war vielleicht eine rhetorische Frage, aber ich gab trotzdem eine Antwort. »Wenn man den Arm oder ein Bein bewegt, gebraucht man die Rückenmuskeln. Man weiß seinen Rücken erst zu schätzen, wenn er mal streikt.«
»Klasse«, sagte er.
»Schluss mit dem Hinhaltemanöver, Larry. Erzählen Sie, was passiert ist.« Vor uns hatten wir eine lange Autoschlange, die bis zur Ampel an der Olive reichte. Wir steckten zwischen zwei kleinen Einkaufzentren fest. Die auf der linken Seite hatte Springbrunnen und einen Tee- und Gewürzladen, wo ich meinen Kaffee kaufte. Rechts gab es einen Plattenladen und ein chinesisches Schnellrestaurant. Wenn man zur Mittagszeit die Ballas herauf fuhr, hatte man immer jede Menge Zeit, sich die Geschäfte von außen anzusehen.
Larry lächelte, dann zog er ein Gesicht. »Ich hatte zwei Leichen zu pfählen. Beides Vampiropfer, die nicht als Vampire wiederauferstehen wollten.«
»Sie hatten ein Testament hinterlassen, ich erinnere mich. In letzter Zeit hatten Sie viele solche Aufträge.«
Er nickte und hielt abrupt inne. »Selbst das Nicken tut weh.«
»Morgen sind die Schmerzen schlimmer.«
»Ach, vielen Dank. Gut, dass Sie mich drauf vorbereiten.«
Ich zuckte die Achseln. »Es bringt auch nichts, Sie anzulügen.«
»Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Ihre Manieren am Krankenbett scheiße sind?«
»Schon viele.«
Er machte ein kleines Glucksgeräusch. »Das glaube ich. Jedenfalls war ich gerade mit den Leichen fertig und wollte zusammenpacken, da rollte eine Frau einen Toten herein. Sagte, es sei ein Vampir ohne gerichtliche Verfügung.«
Ich blickte ihn stirnrunzelnd an. »Sie haben doch keine Leiche ohne Papierkram erledigt oder?«
Er sah genauso stirnrunzelnd zurück. »Natürlich nicht. Ich habe gesagt: kein Gerichtsbeschluss, kein toter Vampir. Eine Pfählung ohne Gerichtsbeschluss sei Mord und ich würde mir keine Anklage einhandeln, nur weil jemand die Papiere verschludert hat. Das habe ich ihnen unmissverständlich klargemacht.«
»Ihnen?«, fragte ich nach. Ich schloss zu dem Wagen vor uns auf und kam der Ampel ein Stückchen näher.
»Der andere Wärter war wieder reingekommen. Sie gingen zusammen weg, um die verlegten Papiere zu suchen. Ich blieb bei dem Vampir. Es war Morgen. Er würde nirgendwo hingehen.« Er wollte den Kopf wegdrehen, um mir nicht in die Augen zu sehen, aber es tat zu weh. Schließlich starrte er mich ärgerlich an.
»Ich bin rausgegangen, um eine zu rauchen.«
Ich blickte ihn an und musste plötzlich auf die Bremse steigen, als der Verkehr wieder stockte. Larry flog in seinen Gurt. Er stöhnte, und als er damit fertig war, sagte er: »Das haben Sie mit Absicht gemacht.«
»Nein, bestimmt nicht, aber vielleicht hätte ich das tun sollen. Sie haben eine Vampirleiche allein gelassen, einen Vampir, der vielleicht genug getan hat, um eine Hinrichtung zu verdienen, allein im Leichenschauhaus.«
»Es war nicht nur wegen der Zigarette, Anita. Die Leiche lag einfach auf der Bahre, war nicht festgeschnallt oder angekettet. Nirgends waren Kreuze. Ich habe schon mehr Hinrichtungen gemacht. Normalerweise sind die Vampire derart mit Silberketten und Kreuzen zugehängt, dass man kaum an das Herz rankommt. Es kam mir komisch vor. Ich wollte mit der Gerichtsmedizinerin sprechen. Sie muss jeden Vampir vor der Hinrichtung abzeichnen. Außerdem raucht sie. Ich dachte, wir könnten in ihrem Büro eine zusammen quarzen.«
»Und?«, fragte ich.
»Sie war nicht da. Ich bin wieder in die Leichenhalle gegangen. Als ich da ankomme, versucht die Wärterin dem Vampir einen Pflock in die Brust zu hämmern.«
Zum Glück standen wir endgültig im Stau. Wäre der Verkehr noch weitergerollt, hätte ich meinen Vordermann gerammt. Ich starrte Larry an. »Sie haben ihre Vampirausrüstung allein unten stehen lassen.«
Er schaffte es, verlegen und wütend zugleich auszusehen. »Meine Ausrüstung enthält keine Schrotflinten wie Ihre, darum dachte ich, die würde keinen interessieren.«
»Viele Leute stehlen nur um des Souvenirs willen, Larry.« Der Verkehr kroch wieder langsam vorwärts, und ich musste auf die Straße sehen.
»Na schön, ich habe etwas falsch gemacht. Ich weiß das. Ich habe sie um die Taille gepackt und weggezogen.« Er senkte den Blick und sah mich nicht an. Jetzt würde kommen, was ihm am meisten zu schaffen machte oder von dem er glaubte, es würde mir am meisten zu schaffen machen. »Ich habe ihr den Rücken zugedreht, um mir den Vampir anzusehen. Um mich zu vergewissern, ob sie ihn nicht verletzt hatte.«
»Sie hat Sie angegriffen«, sagte ich. Wir rollten einen Meter weiter. Jetzt standen wir zwischen einem Dairy Queen und einem Kentucky Fried Chicken auf der einen und einem Autohaus und einer Tankstelle auf der anderen Seite. Die Szenerie hatte sich nicht verbessert.
»Ja, ja. Sie muss gedacht haben, ich wäre k. o. gegangen, denn sie ließ von mir ab und lief wieder zu dem Vampir. Ich habe sie entwaffnet, aber sie versuchte trotzdem noch, an den Vampir ranzukommen, bis der andere Wärter zurückkam. Wir haben sie zu zweit festhalten müssen. Sie war verrückt, wie besessen.«
»Warum haben Sie die Pistole nicht gezogen, Larry?« Jetzt lag sie bei seiner Vampirausrüstung, weil ein Schulterholster und ein genähter Rücken sich nicht vertrugen. Aber er trug inzwischen eine Waffe. Ich hatte ihn zum Schießstand mitgenommen und zu Vampirjagden, bis ich ihm zutraute, sich nicht in den Fuß zu schießen.
»Dann hätte ich vielleicht auf sie schießen müssen.«
»Das ist gewissermaßen der Punkt, Larry.«
»Das ist genau der Punkt«, sagte er. »Ich wollte nicht auf sie schießen.«
»Sie hätte Sie töten können, Larry.«
»Ich weiß.«
Ich schloss die Finger so fest um das Lenkrad, bis sie rosa-weiß gefleckt waren. Ich atmete ganz langsam aus und versuchte, nicht zu schreien. »Sie wissen es offenbar nicht, sonst wären Sie vorsichtiger gewesen.«
»Ich bin am Leben und sie ebenfalls. Der Vampir hatte nicht mal einen Kratzer. Alles ist gutgegangen.«
Ich bog auf die Olive ab und kroch auf die 270 zu. Wir mussten nach Norden in Richtung St. Charles. Larry hatte dort eine Wohnung. Es war eine Fahrt von plus/minus zwanzig Minuten. Von seiner Wohnung blickte man über einen See, wo im Frühling Gänse nisteten und sich im Winter sammelten. Richard Zeeman, Biologielehrer an einer Junior High und Alphawerwolf und damals noch mein Freund, hatte ihm beim Einzug geholfen. Richard war begeistert gewesen, dass direkt unter dem Balkon Gänse nisteten. Und ich auch.
»Larry, Sie müssen diese Zimperlichkeit überwinden oder Sie werden eines Tages umgebracht.«
»Ich werde auch weiterhin tun, was ich für richtig halte, Anita. Daran wird sich nichts ändern, egal was Sie sagen.«
»Verdammt, Larry. Ich will Sie nicht beerdigen müssen.«
»Was hätten Sie denn getan? Sie erschossen?«
»Ich hätte ihr nicht den Rücken zugekehrt, Larry. Ich hätte sie wahrscheinlich entwaffnen oder beschäftigen können, bis der andere Wärter wieder da gewesen wäre. Ich hätte sie nicht erschießen müssen.«
»Mir ist die Situation außer Kontrolle geraten«, sagte er.
»Sie haben falsche Prioritäten gesetzt. Sie hätten als erstes die Bedrohung ausschalten müssen, bevor Sie sich dem Opfer zuwenden. Lebendig konnten Sie dem Vampir helfen, tot nicht.«
»Na, wenigstens habe ich jetzt eine Narbe, die Sie noch nicht haben.«
Ich schüttelte den Kopf. »Um mich darin zu übertreffen müssen Sie sich noch mächtig anstrengen.«
»Sie haben sich von einem Menschen ihren eigenen Pflock in den Rücken jagen lassen?«
»Von zwei Menschen mit mehreren Bissen, die ich früher als menschliche Diener bezeichnet habe, bevor ich wusste, was das wirklich bedeutet. Den einen hatte ich fest im Griff und trieb gerade den Pflock hinein, da kam die Frau von hinten.«
»Also konnten Sie nichts dafür«, sagte er.
Ich zuckte die Achseln. »Ich hätte sie gleich erschießen können, als ich sie sah, aber damals habe ich noch nicht so leicht auf Menschen geschossen. Ich habe meine Lektion gelernt. Dass einer keine Reißzähne hat, heißt noch nicht, dass er einen nicht umbringen kann.«
»Sie waren zimperlich beim Erschießen von menschlichen Dienern?«, fragte Larry.
Ich fuhr auf die 270. »Jeder macht mal Fehler. Warum war die Frau so scharf darauf, den Vampir zu töten?«
Er grinste. »Die Antwort wird Ihnen gefallen. Sie ist Mitglied bei Humans First. Der Vampir war Arzt in einem Krankenhaus. Er hatte sich in einer Wäschekammer eingerichtet. Da schlief er immer, wenn er mal zu lange im Krankenhaus bleiben musste, um es noch nach Hause zu schaffen. Sie hat ihn auf ein Bett gepackt und nach unten in die Leichenhalle gefahren.«
»Ich wundere mich, dass sie ihn nicht einfach nach draußen geschoben hat. Das späte Tageslicht wirkt genauso gut wie die Mittagssonne.«
»Er hatte sich die Wäschekammer im Keller ausgesucht, für den Fall, dass jemand zur falschen Tageszeit die Tür öffnet. Fenster gab es auch nicht. Sie hatte Angst, es würde sie jemand sehen, wenn sie ihn in den Aufzug oder nach draußen rollt.«
»Sie hat wirklich geglaubt, Sie würden ihn einfach so pfählen?«
»Scheint so. Ich weiß es nicht, Anita. Sie war verrückt, wirklich verrückt. Sie hat den Vampir bespuckt und uns auch, meinte, wir sollten alle in der Hölle schmoren und dass wir die Welt von den Monstern zu reinigen hätten, die uns alle versklaven wollten.« Larry schauderte, dann runzelte er die Stirn. »Und ich dachte immer, Humans Against Vampires sei schlimm. Aber diese Splittergruppe ist wirklich beängstigend.«
»HAV versucht, im Rahmen der Gesetze zu handeln«, erklärte ich. »Humans First gibt nicht einmal vor, das zu wollen. Sie behaupten, sie hätten den Vampirbürgermeister in Michigan gepfählt.«
»Behaupten? Glauben Sie das nicht?«
»Ich vermute, dass es jemand aus dem Familienkreis getan hat.«
»Warum?«
»Die Polizei hat mir eine Beschreibung und ein paar Fotos von seinen Sicherheitseinrichtungen geschickt. Humans First ist vielleicht radikal, aber nicht besonders gut organisiert. Man hätte einen Plan und viel Glück haben müssen, um während des Tages zu diesem Vampir vorzudringen. Er war wie die Alten: er nahm seine Sicherheit sehr ernst. Und der Täter ist wahrscheinlich froh, dass die Fanatiker die Tat für sich beanspruchen.«
»Haben Sie der Polizei gesagt, was Sie dazu meinen?«
»Natürlich. Sie haben mich ja danach gefragt.«
»Es wundert mich, dass man Sie nicht an den Tatort bestellt hat.«
Ich zuckte die Achseln. »Ich kann nicht nach jedem übernatürlichen Verbrechen persönlich erscheinen. Außerdem gehöre ich ja nicht zur Polizei. Wenn es ihre Fälle betrifft, sind Polizisten jedem Außenstehenden gegenüber misstrauisch, aber davon einmal abgesehen, wäre das auch für die Presse ein gefundenes Fressen gewesen. ›Der Scharfrichter löst Vampirmord‹.«
Larry grinste. »Für Sie noch eine freundliche Schlagzeile.«
»Leider«, sagte ich. »Ich bin überzeugt, dass der Mörder ein Mensch war, jemand, der ihm nahe stand. Der Fall war wie jeder andere gut geplante Mord, nur mit einem Vampir als Opfer.«
»Nur Sie bringen es fertig, dass sich ein Familienmord wie etwas Alltägliches anhört«, fand Larry.
Ich musste lächeln. »Wahrscheinlich.« Ich zuckte zusammen, mein Piepser meldete sich. Ich zog das verdammte Ding aus der Rocktasche und hielt es so, dass ich die Nummer sehen konnte. Ich zog die Brauen zusammen.
»Was ist los? Die Polizei?«
»Nein. Ich kenne die Nummer nicht.«
»Sie geben Ihre Piepsernummer nicht an Fremde weiter.«
»Das ist mir bewusst.«
»He, nicht grantig werden.«
Ich seufzte. »Entschuldigung.« Larry legte es auf eine langsame Zermürbung meiner Aggressionsbereitschaft an. Er brachte mir durch endlose Wiederholung bei, netter zu sein. Hätte das ein anderer versucht, ich hätte ihm seinen Kopf auf einer Platte serviert. Aber Larry wusste bei mir die richtigen Knöpfe zu betätigen. Er konnte mich belehren, netter zu sein, ohne dass ich ihm ein Ding verpasste. Die Grundlage vieler glücklicher Beziehungen.
Bis zu Larrys Wohnung waren es nur noch ein paar Minuten. Ich würde ihn ins Bett stecken und den Rückruf erledigen. Wenn es weder die Polizei noch ein Zombieauftrag war, würde ich sauer werden. Ich konnte es nicht leiden, wegen Nichtigkeiten angepiepst zu werden. Wofür waren Piepser schließlich da? Wenn es nichts Wichtiges war, würde ich jemandem mächtig in die Speichen treten. Da Larry schlief, durfte ich so gemein sein, wie ich wollte. Ich fühlte mich fast erleichtert.
3
Als Larry mit seiner Demorol im Bett lag und so fest schlief, dass ihn höchstens ein Erdbeben geweckt hätte, erledigte ich meinen Anruf. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wer es war, und das störte mich. Es war nicht nur lästig, es war beunruhigend. Wer gab meine vertraulichen Nummern heraus und warum?
Das Telefon brachte das erste Klingeln nicht zu Ende, da wurde der Hörer abgenommen. Die Stimme war männlich, weich und reichlich panisch. »Hallo, hallo.«
Mein ganzer Ärger wurde sofort von einer ungewissen Angst weggeschwemmt. »Stephen, was ist los?«
Ich hörte ihn schlucken. »Gott sei Dank.«
»Was ist passiert?« Ich strengte mich an, ganz klar und sehr ruhig zu klingen, denn eigentlich wollte ich ihn anschreien, ihn zwingen, mir sofort alles zu sagen.
»Kannst du zum St. Louis University Hospital kommen?«
Ich war alarmiert. »Wie schlimm bist du verletzt?«
»Es geht nicht um mich.«
Das Herz schoss mir in die Kehle hoch und quetschte mir die Stimme ab. »Jean-Claude.« Mir war sofort klar, wie albern das war. Es war gerade Mittag vorbei. Wenn Jean-Claude einen Arzt brauchte, müsste der zu ihm kommen. Vampire fahren nicht am helllichten Tag durch die Gegend. Warum war ich so besorgt um einen Vampir? Zufällig gingen wir miteinander. Meine Familie schaudert, sie sind strenggläubige Katholiken. Da es mir noch immer ein bisschen peinlich ist, fällt es mir schwer, mich zu verteidigen.
»Es ist nicht Jean-Claude. Es ist Nathaniel.«
»Wer?«
Stephen entließ einen geduldigen Seufzer. »Er war einer von Gabriels Leuten.«
Das war die dezente Art zu sagen, dass er ein Werleopard war. Gabriel war ihr Anführer gewesen, ihr Alpha, bis ich ihn getötet hatte. Warum hatte ich das getan? Die meisten Verletzungen, die ich von ihm hatte, waren verheilt. Das war einer von vielen Vorteilen, wenn man die Zeichen eines Vampirs trug. Unten am Rücken und noch ein Stückchen tiefer trug ich einen Wirbel von Narben, schwach ausgeprägt, beinahe zart, aber dennoch eine ständige Erinnerung an Gabriel. Die Erinnerung daran, wie er mich vergewaltigen und seine Phantasie dabei austoben wollte, bis ich lustvoll seinen Namen schreie, bevor er mich umgebracht hätte. Aber wie ich Gabriel kannte, wäre ihm nicht so wichtig gewesen, wann ich sterbe, ob hinterher oder währenddessen – beides hätte ihm Spaß gemacht. Solange ich noch warm gewesen wäre. Die meisten Lykanthropen stehen nicht auf Aas.
Ich tat das in Gedanken so leichthin ab, aber meine Finger tasteten unwillkürlich meinen Rücken entlang, als wären die Narben durch den Blusenstoff zu fühlen. Man musste so damit umgehen. Genau so. Oder man fing an zu schreien und hörte nicht wieder auf.
»Das Krankenhaus weiß nicht, dass Nathaniel ein Gestaltwandler ist, ja?«
Er senkte die Stimme. »Sie wissen es. Er heilt viel zu schnell, als dass sie es nicht begriffen hätten.«
»Warum flüsterst du dann?«
»Weil ich im Wartezimmer am Münztelefon stehe.« Es gab ein Geräusch, als würde er die Sprechmuschel abschirmen. »Ich bin gleich fertig«, hörte ich ihn murmeln, dann war er wieder dran. »Du musst herkommen, Anita.«
»Warum?«
»Bitte.«
»Du bist ein Werwolf, Stephen. Wieso machst du den Babysitter bei einem der Miezekätzchen?«
»Mein Name stand für Notfälle in seiner Brieftasche. Er arbeitet im Guilty Pleasures.«
»Er ist ein Stripper?« Ich fragte, weil er auch ein Kellner hätte sein können, obwohl das nicht wahrscheinlich war. Das Guilty Pleasures gehörte Jean-Claude, und der hätte keinen Gestaltwandler außerhalb der Bühne verschwendet. Sie waren einfach zu exotisch.
»Ja.«
»Ihr wollt also nach Hause gebracht werden?« Ich hatte offenbar Fahrbereitschaft.
»Ja und nein.«
Da schwang etwas mit, das mir nicht gefiel, eine gewisse Unruhe, eine Anspannung. Nicht dass Stephen ein berechnender Typ wäre, er machte einem nichts vor. Er redete bloß. »Wie wurde Nathaniel verletzt?« Vielleicht nützte es, wenn ich bessere Fragen stellte.
»Ein Kunde ist zu grob geworden.«
»Im Club?«
»Nein. Anita, bitte, dafür ist keine Zeit. Komm und sorge dafür, dass er nicht mit Zane nach Hause fährt.«
»Wer zum Teufel ist Zane?«
»Auch einer von Gabriels Leuten. Er ist ihr Zuhälter, seit Gabriel tot ist, aber er beschützt sie nicht, er ist kein Alpha.«
»Zuhälter? Wovon redest du?«
Stephens Stimme wurde höher und viel zu fröhlich. »Hallo, Zane. Warst du schon bei Nathaniel?«
Ich konnte die Antwort nicht verstehen, hörte nur das allgemeine Gerede im Wartezimmer. »Ich glaube nicht, dass sie ihn schon gehen lassen werden. Er ist verletzt«, sagte Stephen.
Zane musste sehr nah ans Telefon getreten sein, denn ein tiefes Knurren kam über den Draht. »Er wird nach Hause gehen, wenn ich sage, er geht nach Hause.«
»Den Ärzten wird das nicht gefallen.« Stephen hörte sich leicht panisch an.
»Das ist mir scheißegal. Mit wem telefonierst du da?«
Da er so klar zu verstehen war, musste er Stephen praktisch auf den Zehen stehen. Er bedrohte ihn, ohne etwas Bestimmtes zu sagen.
Die knurrende Stimme war plötzlich an meinem Ohr. Zane hatte Stephen den Hörer abgenommen. »Wer ist da?«
»Anita Blake, und Sie müssen Zane sein.«
Er lachte, und es klang zu tief, wie nach einer wunden Kehle. »Die menschliche Lupa der Wölfe. Jetzt kriege ich aber Angst.«
Lupa nannten die Werwölfe die Gefährtin ihres Anführers. Ich war der erste Mensch mit dieser Ehre. Dabei war ich mit ihrem Ulfric gar nicht mehr zusammen. Wir hatten miteinander Schluss gemacht, nachdem ich gesehen hatte, wie er jemanden fraß. He, ein paar Grundsätze muss man als Frau schließlich haben.
»Gabriel hatte auch keine Angst vor mir. Sie sehen, wohin ihn das gebracht hat«, erwiderte ich.
Ein paar Herzschläge lang herrschte Schweigen. Zane hechelte durch die Leitung wie ein Hund, aber nicht mit Absicht, sondern eher als könnte er nicht anders. »Nathaniel gehört zu mir. Hände weg von ihm.«
»Stephen gehört nicht zu Ihnen«, sagte ich.
»Zu dir denn?« Ich hörte Kleider rascheln und schloss auf Bewegungen, die mir nicht gefielen. »Er ist ja sooo hübsch. Hast du diese weichen Lippen probiert? Ist dieses lange blonde Haar über dein Kissen gestrichen?«
Ich wusste, dass er Stephen begrapschte, um seine Worte zu unterstreichen. »Fassen Sie ihn nicht an, Zane.«
»Zu spät.«
Ich quetschte den Hörer zwischen den Fingern und zwang mich, ruhig zu sprechen. »Stephen steht unter meinem Schutz, Zane. Haben Sie mich verstanden?«
»Was würdest du denn tun, um deinen Lieblingswolf zu beschützen, Anita?«
»Das wollen Sie gar nicht erst ausprobieren, Zane, ganz sicher nicht.«
Er senkte die Stimme zu einem schmerzhaft klingenden Flüstern. »Würdest du mich töten, damit ihm nichts passiert?«
Gewöhnlich war ich jemandem wenigstens einmal begegnet, ehe ich drohte, ihn umzubringen, aber ich war bereit, eine Ausnahme zu machen. »Ja.«
Er lachte dröhnend und nervös. »Ich begreife, warum du Gabriel gefallen hast, so hart, so selbstsicher, sooo gefährlich.«
»Sie klingen wie eine schlechte Imitation von Gabriel.«
Er fauchte, was sich wie ein »Pah!« anhörte. »Stephen hätte sich nicht einmischen sollen.«
»Nathaniel ist sein Freund.«
»Er braucht keinen anderen Freund als mich.«
»Das glaube ich nicht.«
»Ich nehme Nathaniel jetzt mit, Anita. Wenn Stephen versucht, mich aufzuhalten, wird es ihm leidtun.«
»Wenn Sie ihm etwas tun, haben Sie mich auf dem Hals.«
»Einverstanden.« Er legte auf.
Scheiße. Ich rannte zum Jeep. Das Krankenhaus war eine halbe Stunde entfernt, zwanzig Minuten, wenn ich auf die Tube drückte. Zwanzig Minuten. Stephen war nicht dominant. Er war ein Opfer. Aber er war auch loyal. Wenn er meinte, Nathaniel sollte nicht mit Zane gehen, würde er versuchen, ihn dazubehalten. Er würde sich deswegen nicht prügeln, aber es war ihm zuzutrauen, dass er sich vor den Wagen warf. Ich hatte keine Zweifel, dass Zane ihn überfahren würde. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall würde Zane beide mitnehmen. Wenn Zane Gabriel nicht nur beim Sprechen kopierte, wäre ich lieber das Risiko mit dem Wagen eingegangen.
4
Mein zweiter Notaufnahmeraum innerhalb von zwei Stunden. Das hieß selbst für mich ein rotes Kreuz im Kalender. Die gute Nachricht war, dass keine der Verletzungen meine war. Die schlechte Nachricht war, dass sich das noch ändern konnte. Alpha oder nicht, Zane war ein Gestaltwandler, und die können mittelgroße Elefanten stemmen. Aufs Armdrücken mit ihm würde ich verzichten. Ich würde nicht nur verlieren, er würde mir wahrscheinlich den Arm ausreißen und aufessen. Die meisten Lykanthropen geben sich Mühe, wie Menschen zu erscheinen, aber Zane war bei solchen Kleinigkeiten bestimmt nicht zimperlich.
Allerdings wollte ich lieber vermeiden, Zane zu töten. Nicht aus Barmherzigkeit, sondern aufgrund der Überlegung, dass er mich vielleicht zwingen würde, es in der Öffentlichkeit zu tun, und ich wollte nicht im Gefängnis landen. Dass mir die Strafe mehr Probleme machte als das Verbrechen, sagte einiges über meinen moralischen Zustand aus. An manchen Tagen kam mir der Gedanke, dass ich mich allmählich zum Soziopathen entwickelte. An anderen Tagen fand ich, dass das längst passiert war.
Ich hatte jederzeit versilberte Kugeln in meiner Pistole. Silber wirkte bei Menschen genauso gut wie bei übernatürlichen Wesen. Wozu auf normale Munition wechseln, wenn sie nur Menschen und wenige andere Wesen erledigt? Vor ein paar Monaten allerdings war ich einem Elfen begegnet, der mich beinahe umgebracht hätte. Bei Elfen wirkte Silber nicht, sondern nur normales Blei. Darum war ich dazu übergegangen, ein paar gewöhnliche Patronen im Handschuhfach mitzunehmen. Ich pellte die vorderen zwei Silberpatronen aus dem Ladestreifen und ersetzte sie durch Blei. Dadurch hatte ich zwei Kugeln, um Zane zu entmutigen, ehe es für ihn tödlich werden würde. Aber seien Sie versichert: wenn er mich weiter anging, nachdem ich ihm die zwei Glazer-Kugeln verpasst hatte, was höllisch weh tat, auch wenn die Wunde schnell zuheilte, würde meine erste Silberkugel nicht auf eine Verwundung zielen.
Erst als ich durch die Tür ging, fiel mir ein, dass ich Nathaniels Nachnamen nicht wusste. Stephens Name würde mir nichts nützen. Mist.
Das Wartezimmer war voll, Frauen mit weinenden Säuglingen, Kinder, die zwischen den Stühlen tobten und zu niemandem gehörten, ein Mann mit einem blutigen Fetzen um die Hand, Leute ohne sichtbare Erkrankung, die stumpf in den Raum starrten. Stephen war nirgends zu sehen.
Geschrei, splitterndes Glas, schepperndes Metall. Am Ende des Ganges kam eine Krankenschwester aus einer Tür gerannt. »Rufen Sie die Sicherheitsabteilung, schnell!« Die Schwester hinter der Anmeldung drückte hektisch die Telefonknöpfe.
Nennen Sie es Intuition, ich hatte jedenfalls das starke Gefühl, zu wissen, wo Stephen und Zane sich aufhielten. Ich zückte vor der Schwester meinen Ausweis. »Ich gehöre zum Regional Preternatural Investigation Team. Kann ich helfen?«
Die Schwester packte meinen Arm. »Sie sind Polizistin?«
»Ich gehöre zur Polizei, ja.« Eine irreführende Antwort, wie sie besser nicht sein könnte. Als ziviles Anhängsel eines Polizeidezernats lernte man so etwas.
»Gott sei Dank.« Sie zerrte mich sofort in Richtung Lärm.
Ich befreite meinen Arm und zog die Waffe. Entsichern, den Lauf zur Decke, kampfbereit. Mit normaler Munition hätte ich sie nicht an die Decke gerichtet, nicht in einem Krankenhaus mit lauter Patienten über mir, aber die Glazers heißen nicht umsonst Safety Rounds.
Der hintere Bereich der Notaufnahme war wie in jedem anderen Krankenhaus auch. Überall Metallschienen mit Vorhängen, die man zuziehen konnte, um viele kleine Untersuchungsräume herzustellen. Eine Handvoll Vorhänge waren geschlossen, aber die Patienten richteten sich auf und spähten nach draußen, um nichts zu versäumen. Aber zum Flur hin gab es noch eine Wand, so dass nicht viel zu sehen war. Um diese Wand kam ein Mann im grünen Chirurgenkittel geflogen, knallte an die nächste Wand, rutschte zu Boden und blieb still liegen.
Die Krankenschwester, die bei mir war, rannte zu ihm und ich ließ sie. Wer in dem Untersuchungsraum war und Ärzte wie Bälle durch die Gegend warf, war keine Aufgabe für das Pflegepersonal. Das war meine Aufgabe. Zwei weitere Grüngekleidete lagen auf dem Boden, ein Mann und eine Frau. Die Frau war bei Bewusstsein, ihre Augen waren schreckgeweitet, ihr Handgelenk war in einem 45-Grad-Winkel gebrochen. Sie sah den Ausweis, den ich mir an die Jacke geklemmt hatte. »Er ist ein Gestaltwandler. Seien Sie vorsichtig.«
»Ich weiß Bescheid«, sagte ich. Ich senkte die Waffe nur ein bisschen, da verzog sie das Gesicht, aber nicht vor Schmerzen. »Schießen Sie mir nicht meinen Behandlungsraum zusammen.«
»Ich werde es versuchen«, versicherte ich und schob mich an ihr vorbei.
Zane trat auf den Gang. Ich hatte ihn noch nie gesehen, aber wer hätte es sonst sein können? Er trug jemanden. Zuerst glaubte ich, es sei eine Frau wegen der langen, glänzend braunen Haare, doch der Rücken und die Schultern waren zu muskulös, zu männlich. Das musste Nathaniel sein. Er passte bequem in Zanes Arme.
Zane war gute einsachtzig groß und schlank. Er trug nur eine schwarze Lederweste am blassen Oberkörper. Seine Haare waren weiß wie Baumwolle, an den Seiten kurz geschnitten, auf dem Kopf stachelig zurecht gegelt.
Er riss den Mund auf und fauchte mich an. Er hatte Reißzähne, oben und unten, wie eine Großkatze. Du lieber Himmel.
Ich richtete die Pistole auf ihn und atmete langsam aus, bis ich ganz ruhig war. Ich zielte über den reglosen Nathaniel hinweg auf die Schulter. Auf diese Entfernung würde ich sie treffen.
»Ich werde nur einmal darum bitten, Zane. Legen Sie ihn ab.«
»Er gehört mir! Mir!« Er ging mit großen Schritten den Gang hinunter, und ich schoss.
Die Kugel schleuderte ihn halb herum, dass er taumelnd in die Knie ging. Die getroffene Schulter versagte, und Nathaniel rutschte ihm aus den Armen. Zane klemmte sich den Bewusstlosen wie eine Puppe unter den anderen Arm. Die Schulterwunde schloss sich bereits, es sah aus wie der Schnelldurchlauf einer Filmaufnahme.
Zane hätte seine Schnelligkeit nutzen und an mir vorbeirennen können, aber er tat es nicht. Er kam auf mich zugeschlendert, als glaubte er nicht, dass ich es tun würde. Das war ein Fehler.
Die zweite Bleikugel traf die Brust. Blut spritzte aus der blassen Haut. Er kippte um, bog den Rücken durch und musste um Luft ringen, denn er hatte ein faustgroßes Loch. Ich lief zu ihm, nicht hastig, aber ich beeilte mich.
Ich schlug einen weiten Bogen, um außer Reichweite zu bleiben, und näherte mich von schräg hinten. Seine angeschossene Schulter war noch lahm, sein gesunder Arm unter Nathaniel eingeklemmt. Zane sah mit großen Augen keuchend zu mir auf.
»Silber, Zane, die nächsten Kugeln sind aus Silber. Ich werde sie für einen Kopfschuss verwenden und Ihr bescheuertes Gehirn über den schönen sauberen Fußboden verteilen.«
Endlich brachte er ein Wort heraus: »Nicht.« Sein Mund füllte sich mit Blut, es lief ihm übers Kinn.
Ich richtete die Mündung auf sein Gesicht, etwa in Augenbrauenhöhe. Wenn ich abdrückte, wäre er tot. Ich blickte auf diesen Mann nieder, dem ich noch nie begegnet war. Er sah jung aus, weit unter dreißig. In mir bildete sich eine große Leere, so als wäre um mich nur weißes Rauschen. Ich empfand nichts. Ich wollte ihn nicht töten, aber es würde mir auch nichts ausmachen. Es war mir nicht wichtig. Nur ihm. Ich setzte einen Blick auf, der genau das zum Ausdruck brachte: dass mir das eine wie das andere egal war. Ich tat das, weil er ein Gestaltwandler war und den Blick verstehen würde. Andere Leute würden es nicht verstehen, die meisten jedenfalls.
Ich sagte: »Sie werden Nathaniel in Ruhe lassen. Und wenn die Polizei kommt, werden Sie tun, was sie sagen. Ohne Widerrede, ohne Gegenwehr, sonst erschieße ich Sie. Haben Sie mich verstanden, Zane?«
»Ja«, sagte er, und das Blut floss ihm schwer aus dem Mund. Er fing an zu weinen. Die Tränen vermischten sich mit den Blutspuren.
Tränen? Die Bösen sollten eigentlich keine Tränen haben.
»Ich bin so froh, dass du gekommen bist«, sagte er. »Ich habe versucht, auf sie aufzupassen, aber ich kann es nicht. Ich wollte wie Gabriel sein, aber das geht nicht.« Seine Schulter war soweit verheilt, dass er den Arm heben und die Augen bedecken konnte, damit man ihn nicht weinen sah, doch seine Stimme war ziemlich belegt.
»Ich bin so froh, dass du uns holen kommst, Anita. Ich bin so froh, dass wir jetzt nicht mehr allein sind.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Die Anführerschaft abzulehnen schien mir eine schlechte Idee zu sein, wo überall Bewusstlose verstreut lagen. Er würde vielleicht wieder gefährlich werden, und dann müsste ich ihn töten. Plötzlich merkte ich mit einem inneren Ruck, dass ich das nicht wollte. Lag es an den Tränen? Vielleicht. Aber es gab noch einen anderen Grund. Da war noch die Tatsache, dass ich ihren Alpha, ihren Beschützer getötet hatte und mir nicht ein Mal der Gedanke gekommen war, was ich den Werleoparden damit angetan hatte. Mir war nie in den Sinn gekommen, dass es keinen Stellvertreter gab, keinen, der Gabriels Platz ausfüllen konnte. Ich konnte ganz sicher nicht ihr Alpha sein. Mir wuchs nicht allmonatlich ein Fell. Aber wenn ich schon dabei war, zu verhindern, dass Zane noch ein paar Ärzte in Stücke riss, konnte ich auch gut eine Weile mitspielen.
Bis die Polizei eintraf, war Zane wieder gesund und munter. Er hatte sich um den bewusstlosen Nathaniel gekuschelt, als wäre er ein Plüschbär, und weinte. Er streichelte ihm über die Haare und flüsterte in einem fort: »Sie wird für uns sorgen.«
Mit dem »sie« war ich wohl gemeint. Ich steckte in der Sache drin, ob ich wollte oder nicht.
5
Stephen lag in einem schmalen Krankenhausbett. Seine blonden lockigen Haare, die länger waren als meine, lagen ausgebreitet auf dem weißen Kopfkissen. Er hatte dunkel- und hellrote Schnittwunden kreuz und quer im Gesicht. Er sah aus, als hätte ihn einer durchs Fenster gestoßen, und genau das war passiert. Stephen, der höchstens zwanzig Pfund schwerer war als ich, hatte standgehalten, so lange, bis Zane ihn schließlich in eine mit Draht verstärkte Sicherheitsscheibe gedrückt hatte. Wie ein Ei in einen Eierschneider. Ein Mensch wäre daran gestorben, und sogar Stephen war schlimm verletzt. Aber bei ihm heilte es. Man konnte nicht gerade dabei zusehen, aber in kurzen Abständen sah man die Veränderung, es war wie beim Aufblühen einer Blume. Bei jedem Hinsehen war eine Schnittwunde weniger. Es war ziemlich gruselig.
In dem zweiten Bett lag Nathaniel. Er hatte noch längere Haare als Stephen. Ich wettete auf hüftlang. Schwer zu sagen, denn ich hatte ihn noch nicht stehen sehen. Es war ein sehr dunkles Rotbraun, ein sattes Mahagoni. Die Haare bedeckten das Kopfkissen wie ein dichter, glänzender Pelz.
Er war eher hübsch als gut aussehend und konnte höchstens einsachtundsechzig groß sein. Die Haare ließen ihn weiblich wirken. Doch seine Schultern waren unverhältnismäßig breit, vom Gewichtheben, aber auch Veranlagung. Er hatte prachtvolle Schultern, doch sie schienen zu jemandem zu gehören, der einen halben Kopf größer war. Um im Guilty Pleasures strippen zu dürfen, musste er achtzehn sein. Sein Gesicht war schmal, das Kinn zu glatt. Wenn er achtzehn war, dann noch nicht lange. Vielleicht würde er in seine Schultern eines Tages noch reinwachsen.
Wir waren in einem halbprivaten Zimmer der Isolierstation. Auf dem Flur, der für Lykanthropen, Vampire und andere übernatürliche Bürger reserviert war. Für alles, was als gefährlich eingestuft wurde. Zane wäre gefährlich gewesen, aber die Polizei hatte ihn mitgenommen, zumal seine Wunden fast zugeheilt waren. Sein Fleisch hatte die Kugeln nach außen gedrückt, bis sie zu Boden fielen. Ich glaubte nicht, dass bei Stephen und Nathaniel die Isolierstation nötig war. Bei Nathaniel mochte ich mich täuschen, wahrscheinlich aber nicht. Ich vertraute Stephens Urteil.
Nathaniel war noch nicht zu Bewusstsein gekommen. Ich hatte gefragt, was für Verletzungen er habe, und tatsächlich Auskunft erhalten, weil ich noch immer für eine Polizistin gehalten wurde und weil ich die beiden gerettet hatte. Dankbarkeit ist etwas Wunderbares.
Nathaniel war fast ausgeweidet worden. Ich meine nicht, dass er eine große Schnittwunde in den Bauch bekommen hatte, sondern jemand hatte ihn aufgeschnitten und die Gedärme auf dem Boden verteilt; man hatte Schmutzpartikel im Bauchraum gefunden. Außerdem hatte er Verletzungen an anderen Körperstellen. Er war sexuell missbraucht worden. Ja, auch ein Stricher kann vergewaltigt werden. Dazu braucht es nur ein Nein. Niemand, nicht einmal ein Lykanthrop würde sich ficken lassen, während seine Gedärme auf dem Fußboden lagen. Die Vergewaltigung konnte dem Mordversuch auch vorangegangen sein. Diese Reihenfolge wäre vielleicht einen Tick weniger krank. Aber nur einen Tick.
An Hand- und Fußgelenken hatte er Fesselungsspuren, als hätte er sich an den Fesseln wundgerieben, weil er sich gewehrt hatte, und die heilten nicht. Das hieß, es waren Ketten mit einem hohen Silberanteil verwendet worden, damit es ihm zusätzlich wehtat. Wer immer ihm das angetan hatte, hatte gewusst, dass er einen Lykanthropen vor sich hatte. Er war vorbereitet gewesen. Was einige sehr interessante Fragen aufwarf.
Stephen sagte, Gabriel habe die Werleoparden zum Sex angeboten. Ich verstand, warum Leute die Exotik eines Werleoparden haben wollten. Ich wusste, dass es Sadomasochisten gab. Gestaltwandler können enorme Verletzungen überstehen. Darum war die Kombination sogar einleuchtend. Aber das hier ging über Sexspiele weit hinaus. Ich hatte noch nie von etwas so Brutalem gehört, außer vielleicht bei Taten von Serienmördern.
Ich durfte sie nicht allein, nicht ohne Schutz lassen. Abgesehen von der Bedrohung durch einen Sexualmörder waren da noch die anderen Werleoparden. Zane hatte vielleicht geweint und mir die Füße geküsst, aber es gab noch mehr von ihnen. Wenn sie keine Rudelstrukturen hatten, kein Alphatier, dann gab es niemanden, der ihnen befehlen konnte, Nathaniel in Ruhe zu lassen. Das hieß für mich entweder heraushalten oder jeden einzelnen umbringen. Keine erfreuliche Vorstellung. Echte Leoparden kümmert es nicht viel, wer das Sagen hat. Sie haben keine Rudelstrukturen, aber Gestaltwandler waren keine Tiere, sondern Leute. Das hieß, egal wie einzelgängerisch und unkompliziert das Tier war, die Leute fanden irgendwie einen Weg, um die Dinge schwierig zu machen. Wenn Gabriels Leute handverlesen waren, durfte ich nicht darauf bauen, dass sie Nathaniel in Ruhe lassen würden. Gabriel war ein krankes Kätzchen gewesen, und Zane hatte bei mir auch keinen guten Eindruck hinterlassen. Wen sollte man zur Verstärkung holen? Natürlich das örtliche Werwolfrudel. Stephen gehörte zu ihnen. Sie schuldeten ihm Schutz.
Es klopfte an der Tür. Ich zog die Browning und hielt sie im Schoß unter der Illustrierten, die ich gerade las. Ich hatte ein drei Monate altes Heft der National Wildlife mit einem Artikel über Kodiakbären gefunden.
»Wer ist da?«
»Irving.«
»Kommen Sie rein.« Ich ließ die Pistole, wo sie war, falls sich hinter ihm noch jemand hereindrängeln wollte. Irving Griswold war ein Werwolf und Reporter. Er war ein guter Kerl für einen von der Presse, aber er verhielt sich nicht so vorsichtig wie ich. Erst wenn sich herausstellte, dass er allein war, würde ich die Waffe wegstecken.
Irving drückte lächelnd die Tür auf. Die krausen braunen Haare umgaben seinen Kopf wie ein Heiligenschein, und in der Mitte glänzte eine kahle Stelle. Auf der schmalen Nase saß eine Brille. Er war klein und wirkte rundlich, ohne dick zu sein. Er sah nicht im Geringsten nach einem großen bösen Wolf aus. Man sah ihm nicht mal den Reporter an, was einerseits dazu beitrug, dass er großartige Interviews hervorbrachte, andererseits war er eben nicht der Typ, den man vor die Kamera stellte. Er arbeitete für die St. Louis Post Dispatch und hatte mich schon oft interviewt.
Er schloss die Tür hinter sich.
Ich steckte die Browning weg.
Er riss ein wenig die Augen auf, dann fragte er gedämpft, aber nicht im Flüsterton: »Wie geht es Stephen?«
»Wie sind Sie hier hereingekommen? Es sollte eigentlich ein Polizist vor der Tür stehen.«
»Mann, Blake, ich freue mich, Sie mal wieder zu sehen.«
»Lassen Sie den Quatsch, Irving. Da draußen sollte ein Wachmann stehen.«
»Er unterhält sich mit einer sehr hübschen Schwester am Tresen.«
»Verdammt.« Ich war keiner von ihnen, darum konnte ich nicht herumlaufen und sie anschreien, aber die Versuchung war groß. In Washington wurde ein Gesetz vorbereitet, durch das Vampirjäger bald Dienstmarken erhalten könnten. Was ich eigentlich für eine schlechte Idee hielt. Manchmal aber auch nicht.
»Erzählen Sie schnell, bevor mich einer mit einem Tritt nach draußen befördert. Wie geht es Stephen?«
Ich sagte es ihm. »Nach Nathaniel fragen Sie nicht?«
Er machte ein verlegenes Gesicht. »Sie wissen, dass Sylvie de facto das Rudel führt, solange Richard weg ist, um seinen Master zu machen?«
Ich seufzte. »Nein, das wusste ich nicht.«
»Ich weiß, dass Sie mit Richard nicht mehr reden, seit Sie miteinander Schluss gemacht haben, aber ich dachte, ein anderer hätte es mal erwähnt.«
»Die anderen Wölfe schleichen um mich herum, als sei jemand gestorben. Keiner redet mit mir über Richard, Irving. Ich nehme an, dass er es ihnen verboten hat.«
»Soweit ich weiß, nicht.«
»Ich bin überrascht, dass Sie nicht wegen eines Artikels gekommen sind.«
»Ich kann darüber keinen Artikel schreiben, Anita. Das ist mir zu nah.«
»Weil Sie Stephen kennen?«
»Weil jeder, der damit zu tun hat, ein Gestaltwandler ist, und ich bin bloß ein sanftmütiger Reporter.«
»Sie nehmen wirklich an, dass Sie ihre Stelle verlieren, wenn es herauskommt?«
»Die Stelle, ach was. Aber was soll meine Mutter dazu sagen?«
Ich lächelte. »Also können Sie nicht den Beschützer spielen.«
Er runzelte die Stirn. »Wissen Sie, daran hatte ich nicht gedacht. Wenn einer aus dem Rudel in der Öffentlichkeit verletzt wurde, wo es nicht vertuscht werden konnte, kam immer Raina zur Rettung angesaust. Seit sie tot ist, haben wir keine Alphas mehr, die offen zeigen, was sie sind. Und einen, der Stephen beschützen könnte, sowieso nicht.«
Raina war die alte Lupa des Rudels gewesen, bevor ich die Stelle antrat. Theoretisch braucht sie nicht zu sterben, um abgelöst zu werden, im Gegensatz zum Ulfric, dem Wolfskönig. Doch Raina war Gabriels Gespielin gewesen. Sie hatten gewisse Hobbys gemeinsam gehabt, wie zum Beispiel Snuff-Filme mit Gestaltwandlern und Menschen drehen. Sie war bei der Aufnahme dabei, während Gabriel mich vergewaltigen wollte. Oh ja, es war mir ein Vergnügen gewesen, Raina das Licht auszublasen.
»Jetzt haben Sie Nathaniel schon zum zweiten Mal ignoriert«, sagte ich. »Wie kommt das, Irving?«
»Ich sagte ja, Sylvie hat die Verantwortung, bis Richard wieder da ist.«
»Und?«
»Sie hat uns in jeder Hinsicht verboten, den Werleoparden zu helfen.«
»Warum?«
»Raina hat sie häufig in ihren Pornofilmen benutzt, zusammen mit den Wölfen.«
»Ich habe einen der Filme gesehen. Ich war nicht beeindruckt. Entsetzt, aber nicht beeindruckt.«
Irving sah sehr ernst aus. »Sie hat auch widerspenstige Rudelmitglieder von Gabriel und den Katzen bestrafen lassen.«
»Bestrafen lassen?«
Irving nickte. »Sylvie hat es auch getroffen und mehr als einmal. Sie hasst sie alle, Anita. Wenn Richard es nicht verboten hätte, hätte sie das Rudel genommen und die Leoparden alle zur Strecke gebracht.«
»Ich habe gesehen, was Gabriel und Raina unter Spaß verstanden. Da bin ich ausnahmsweise auf Sylvies Seite.«
»Sie haben bei uns aufgeräumt, Sie und Richard. Richard hat Marcus getötet und ist jetzt Ulfric. Sie haben uns von Raina befreit und sind unsere Lupa.«
»Ich habe sie erschossen, Irving. Nach den Rudelgesetzen, so wurde mir gesagt, wird die Herausforderung unwirksam, wenn man eine Pistole benutzt. Ich habe gemogelt.«
»Sie sind nicht die Lupa, weil Sie Raina getötet haben, sondern weil Richard Sie als seine Gefährtin ausgesucht hat.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wir sind nicht mehr zusammen, Irving.«
»Richard hat sich aber auch keine neue Lupa genommen, Anita. Solange er das nicht tut, haben Sie diesen Platz.«
Richard war groß, dunkelhaarig, gut aussehend, anständig, aufrichtig, tapfer. Er war perfekt, außer dass er ein Werwolf war. Selbst das war verzeihlich, jedenfalls glaubte ich das einmal. Bis ich ihn beim Festschmaus erlebt hatte. Bis ich das ganze beschissene Menü kannte. Das Fleisch war roh gewesen und hatte noch gezappelt, die Sauce war ein bisschen blutig gewesen.
Jetzt ging ich nur noch mit Jean-Claude. Ich war mir nicht sicher, ob es so viel besser war, mit dem Obervampir der Stadt zu gehen statt mit dem Oberwerwolf, aber ich hatte mich so entschieden. Es waren Jean-Claudes ach so blasse Hände, die meinen Körper hielten, seine schwarzen Haare, die sich auf meinem Kopfkissen kräuselten, seine mitternachtsblauen Augen, in die ich blickte, wenn wir miteinander schliefen.
Brave Mädchen haben keinen vorehelichen Sex, erst recht nicht mit den Untoten. Ich glaube nicht, dass brave Mädchen dem Ex-Freund nachtrauern, nachdem sie sich für den neuen Freund entschieden haben. Vielleicht hatte ich mich falsch entschieden. Richard und ich gingen uns so weit wie möglich aus dem Weg. Fast die ganzen vergangenen sechs Wochen. Im Augenblick war er nicht in der Stadt. Das machte es einfacher.
»Ich werde nicht fragen, woran Sie denken«, sagte Irving. »Ich glaube, ich weiß es.«
»Seien Sie bloß nicht so superklug.«
Er breitete entschuldigend die Arme aus. »Berufskrankheit.«
Darüber musste ich lachen. »Sylvie hat also verboten, den Werleoparden zu helfen. Was heißt das für Stephen?«
»Er hat gegen ihren ausdrücklichen Befehl verstoßen, Anita. Für einen, der im Rudel so weit unten steht wie Stephen, ist das sehr mutig. Aber das wird Sylvie nicht beeindrucken. Sie wird ihn zerreißen, und sie wird niemandem erlauben, nachzugeben und sich um die beiden zu kümmern. Ich kenne Sylvie gut genug.«
»Ich kann nicht rund um die Uhr hier sitzen, Irving.«
»In ein, zwei Tagen sind sie wieder auf den Beinen.«
Ich sah ihn ärgerlich an. »Ich kann keine zwei Tage hier sitzen.«
Er wich meinem Blick aus und trat an Stephens Bett. Er sah den Schlafenden an, der mit gefalteten Händen dalag.
Ich ging zu ihm und fasste Irving am Arm. »Was verschweigen Sie mir?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
Ich drehte ihn zu mir herum und zwang ihn, mich anzusehen. »Reden Sie mit mir, Irving.«
»Sie sind kein Gestaltwandler, Anita. Sie sind nicht mehr mit Richard zusammen. Sie müssen unsere Welt verlassen, anstatt noch tiefer einzudringen.«
Er machte ein so ernstes, so düsteres Gesicht, dass mir angst wurde. »Irving, was ist los?«
Er schüttelte nur den Kopf.
Ich nahm ihn bei beiden Armen und konnte mich nur mühsam beherrschen, ihn zu schütteln. »Was verbergen Sie vor mir?«
»Es gibt ein Mittel, wie Sie das Rudel bewegen können, auf Stephen und sogar auf Nathaniel aufzupassen.«
Ich trat einen Schritt zurück. »Ich höre.«
»Sie stehen rangmäßig über Sylvie.«
»Ich bin kein Gestaltwandler, Irving. Ich war die Freundin des Rudelführers. Jetzt bin ich nicht einmal mehr das.«
»Sie sind mehr als das, Anita, und das wissen Sie. Sie haben einige von uns getötet. Sie töten ruhig und ohne Bedauern. Das verschafft Ihnen die Anerkennung des Rudels.«
»Mensch, Irving, was für eine mitreißende Unterstützung.«
»Fühlen Sie sich schlecht, weil Sie Raina getötet haben? Hatten Sie wegen Gabriels Tod schlaflose Nächte?«
»Ich habe Raina getötet, weil sie mich töten wollte. Ich habe Gabriel aus dem gleichen Grund getötet: Selbsterhaltung. Darum hatte ich keine schlaflosen Nächte.«
»Das Rudel respektiert Sie, Anita. Wenn Sie ein paar finden, die sich als Gestaltwandler geoutet haben, und sie überzeugen können, dass man vor Ihnen mehr Angst haben muss als vor Sylvie, dann werden sie die beiden hier bewachen.«