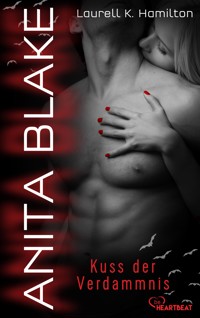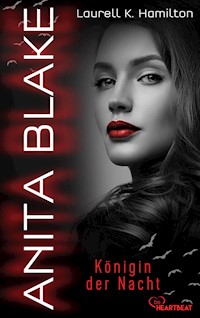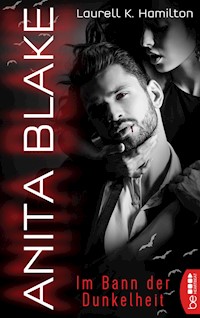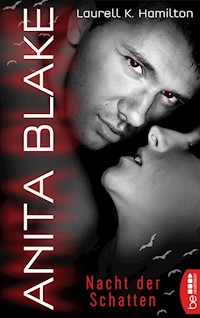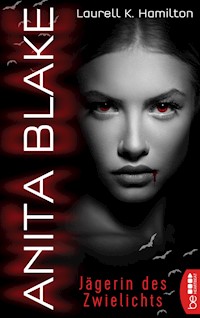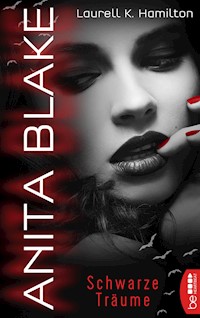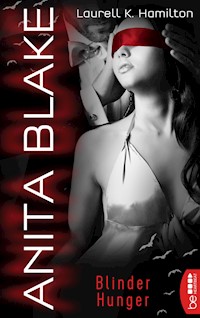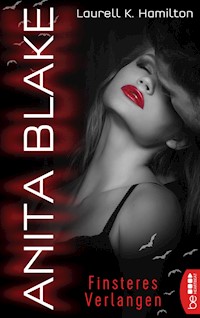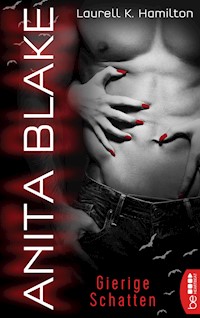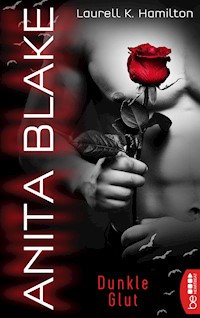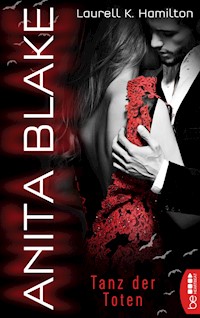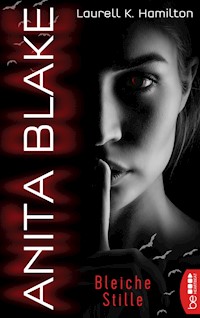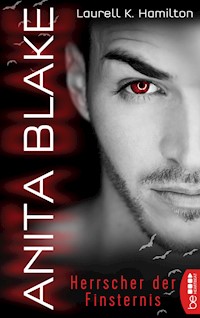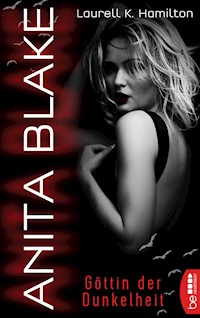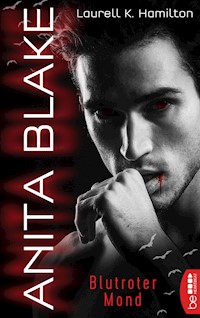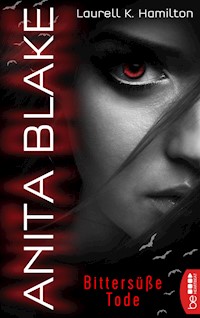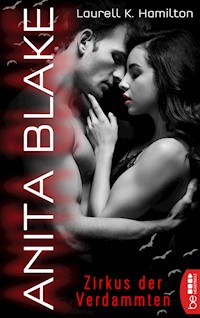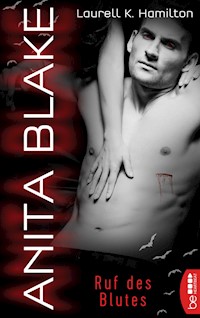
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Anita Blake hatte sich entschieden - gegen ihren Verlobten Richard, Anführer der Werwölfe von St. Louis, und für Jean-Claude, den Meistervampir der Stadt. Doch als Richard wegen eines schrecklichen Verbrechens mitten in der Provinz im Gefängnis landet, eilt Anita ihm sofort zu Hilfe. Die Zeit ist knapp, denn bald wird die Nacht des Blauen Mondes anbrechen, und kein Werwolf kann sich dann der Verwandlung entziehen. Und wenn Richards Geheimnis ans Licht käme, würde er alles verlieren. Doch als Anita in Tennessee ankommt, stellt sie schnell fest, dass sich ihr nicht nur Richter und Anwälte in den Weg stellen ...
Nächster Band: Anita Blake - Göttin der Dunkelheit.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Über diesen Band
Über die Autorin
Triggerwarnung
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Im nächsten Band
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Anita Blake hatte sich entschieden – gegen ihren Verlobten Richard, Anführer der Werwölfe von St. Louis, und für Jean-Claude, den Meistervampir der Stadt. Doch als Richard wegen eines schrecklichen Verbrechens mitten in der Provinz im Gefängnis landet, eilt Anita ihm sofort zu Hilfe. Die Zeit ist knapp, denn bald wird die Nacht des Blauen Mondes anbrechen, und kein Werwolf kann sich dann der Verwandlung entziehen. Und wenn Richards Geheimnis ans Licht käme, würde er alles verlieren. Doch als Anita in Tennessee ankommt, stellt sie schnell fest, dass sich ihr nicht nur Richter und Anwälte in den Weg stellen …
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Ruf des Blutes
Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1998 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Blue Moon«
Originalverlag: Jove Books (Berkley Publishing Group, a division of Penguin Putnam Inc.)
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2009/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Ruf des Blutes«
Textredaktion: Mona Gabriel, Leipzig
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © iStock/ BojanMirkovic; Gettyimages/ LightFieldStudios
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0244-7
be-ebooks.de
lesejury.de
Dieses Buch widme ich Shawn Holsapple,Schwager, Polizeibeamter und
Danksagung
Danken möchte ich meinem Mann Gary, der mich das erste Mal in die Berge von Tennessee brachte, meiner Schreibgruppe, den Alternate Historians: Tom Drennan, N. L. Drew, Deborah Millitello, Rett MacPherson, Marella Sands, Sharon Shinn, Mark Sumner und unserem neuesten Mitglied, W. Agustus Elliot, der ein paar Monate zu spät zu uns kam, um dieses Buch noch kritisieren zu können. Ein Lob an die beste Schreibgruppe, zu der ich je gehört habe!
Wer mich online erreichen möchte, kann dies über folgende E-Mail-Adresse: [email protected].
1
Ich träumte von kühler Haut und blutroten Laken. Das Telefon sprengte den Traum, es blieben nur Splitter: ein Blick mitternachtsblauer Augen, Hände, die sanft an mir hinabglitten, seine Haare, die in einer feinen Duftwolke über mein Gesicht strichen. Ich erwachte in meinem Haus, Meilen von Jean-Claude entfernt, mit dem Gefühl seines Körpers auf meiner Haut. Ich fummelte den Apparat vom Nachttisch und nuschelte: »Hallo.«
»Anita, bist du’s?« Es war Daniel Zeeman, Richards kleiner Bruder. Daniel war vierundzwanzig und süß wie ein Babypopo. »Baby« reichte irgendwie nicht mal. Richard war mein Verlobter gewesen – bis ich bei Jean-Claude schwach geworden bin. Dass ich mit Jean-Claude geschlafen habe, hat unseren Beziehungsplänen einen echten Dämpfer verpasst. Nicht dass ich Richard die Schuld dafür gab. Nein, ich gab mir selbst die Schuld. Das gehört zu den wenigen Dingen, die er und ich immer noch gemeinsam haben.
Ich blinzelte zur Leuchtanzeige meiner Nachttischuhr. Drei Uhr früh. »Daniel, was ist los?« Um die Zeit rief niemand an, der eine gute Nachricht loswerden wollte.
Er holte tief Luft, um sich auf seinen Text vorzubereiten. »Richard ist verhaftet worden.«
Ich setzte mich auf, die Decke rutschte mir in den Schoß. »Was hast du gesagt?« Ich war hellwach, mein Herz wummerte.
»Richard ist verhaftet worden«, sagte er.
Ich ließ es ihn nicht noch einmal wiederholen, obwohl mir die Frage auf der Zunge lag. »Weshalb?«, fragte ich.
»Versuchte Vergewaltigung.«
»Was?«
Daniel wiederholte es. Ich begriff so wenig wie beim ersten Mal. »Richard mit seinem Pfadfinderherzen«, sagte ich. »Einen Mord würde ich ihm vielleicht noch zutrauen, aber doch keine Vergewaltigung.«
»Das soll wahrscheinlich ein Kompliment sein«, antwortete er.
»Du weißt, was ich meine, Daniel. Richard würde so etwas nicht tun.«
»Das stimmt.«
»Ist er in St. Louis?«, fragte ich.
»Nein, er ist noch in Tennessee. Er hat seine Prüfungen zum Masters abgelegt und wurde gestern Abend verhaftet.«
»Erzähl mir, was passiert ist.«
»Ich weiß es nicht genau«, sagte Daniel.
»Was soll das heißen?«
»Sie lassen mich nicht zu ihm«, erklärte er.
»Warum nicht?«
»Mom ist zu ihm rein, aber wir durften nicht alle mit.«
»Hat er einen Anwalt?«, fragte ich.
»Er sagt, er braucht keinen. Er sagt, er hat’s nicht getan.«
»Die Gefängnisse sind voll von Leuten, die es nicht getan haben, Daniel. Er braucht einen Anwalt. Sein Wort steht gegen das der Frau. Wenn sie eine Einheimische ist, steckt er in Schwierigkeiten.«
»So ist es«, sagte Daniel.
»Scheiße.«
»Es gibt noch mehr schlechte Nachrichten.«
Ich warf die Bettdecke zurück, klemmte mir das Telefon ans Ohr und stand auf. »Lass hören.«
»Wir haben bald Vollmond«, sagte er sehr leise. Das hörte sich seltsam an, aber ich verstand ihn trotzdem.
Richard war ein Alphawerwolf. Er war der Anführer des Rudels von St. Louis. Das war sein einziger ernsthafter Fehler. Wir hatten uns getrennt, nachdem ich einmal mitansehen musste, wie er jemanden auffraß. Danach flüchtete ich in Jean-Claudes Arme. Ich war vom Werwolf auf den Vampir gekommen. Jean-Claude war der Meistervampir der Stadt. Er war ganz bestimmt nicht der Menschlichere von den beiden. Ich weiß, der Unterschied zwischen einem Blutsauger und einem Fleischfresser ist verschwindend gering, aber Jean-Claude hatte wenigstens keine Fleischfasern zwischen den Zähnen, wenn er satt war. Für mich reichte das als Kriterium.
Wir hatten August, und der nächste Vollmond war in fünf Tagen. Richards Selbstbeherrschung war hervorragend, aber ich hatte noch von keinem Werwolf gehört, auch von keinem Ulfric, einem Anführer, der seine Verwandlung in einer Vollmondnacht verhindern konnte. Egal, in welches Tier sich ein Lykanthrop verwandelt, dagegen ist er machtlos. Der Mond regiert ihn.
»Wir müssen ihn vorher da rausholen«, sagte Daniel.
»Ja«, stimmte ich ihm zu. Richard hielt sein Lykanthropenleben geheim. Er unterrichtete an der Junior High Biologie. Wenn dort herauskam, dass er ein Werwolf war, dann war er seine Stelle los. Jemanden wegen einer Krankheit zu benachteiligen, verstieß zwar gegen die gesetzlichen Bestimmungen, erst recht, wenn es sich um eine Krankheit handelte, die nicht leicht übertragbar war. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht trotzdem taten. Niemand wollte seine Kinder von einem Monster unterrichten lassen. Außerdem gab es in Richards Familie nur einen, der sein Geheimnis kannte, und das war Daniel. Selbst Mutter und Vater Zeeman wussten von nichts.
»Gib mir eine Nummer, unter der ich dich erreichen kann«, bat ich.
Er gab sie mir. »Dann kommst du also?«
»Natürlich.«
Er seufzte. »Danke. Mom macht einen Riesenaufstand, aber es nützt nichts. Wir brauchen jemanden, der weiß, wie so etwas läuft.«
»Ich werde einer Freundin sagen, dass sie dich anrufen und dir einen guten Anwalt nennen soll. Vielleicht habt ihr ihn schon auf Kaution frei, bis ich da bin.«
»Wenn er den Anwalt zu sich lässt«, sagte Daniel.
»Was will er denn damit erreichen?«
»Er meint, es reicht, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben.«
Das klang genau nach Richard. Es gab doch mehr als einen Grund für unsere Trennung. Er hielt an Idealen fest, die nicht mal funktioniert hatten, als sie in Mode waren. Wahrheit, Gerechtigkeit und die amerikanische Lebensart kamen in diesem Rechtssystem nicht zum Zuge. Geld, Einfluss und Glück, darauf kam es an. Oder jemanden auf seiner Seite zu haben, der Teil des Systems war.
Ich war Vampirhenker. Ich hatte die Lizenz, Vampire zu stellen und zu töten, wenn ein gerichtliches Todesurteil ergangen war. Meine Lizenz galt in drei Bundesstaaten. Tennessee gehörte nicht dazu. Aber Henker wurden von Polizisten gewöhnlich anders behandelt als normale Bürger. Wir riskierten unser Leben und hatten meistens auch mehr Leute getötet als sie. Klar, diese Leute waren nur Vampire gewesen, und für manche zählte das nicht. Für manche zählten nur Menschen.
»Wann kannst du hier sein?«, fragte Daniel.
»Ich muss hier erst ein paar Dinge klären, aber ich werde kurz vor Mittag bei dir sein.«
»Ich hoffe, du kannst Richard zur Vernunft bringen.«
Ich hatte seine Mutter erlebt – mehr als einmal –, darum sagte ich: »Es wundert mich, dass Charlotte ihm keine Vernunft beibringen kann.«
»Was glaubst du, woher er das mit ›ich habe die Wahrheit auf meiner Seite‹ hat?«, erwiderte Daniel.
»Großartig«, sagte ich. »Ich komme, Daniel.«
»Ich muss jetzt Schluss machen.« Er legte plötzlich auf, als hätte er Angst, erwischt zu werden. Wahrscheinlich war seine Mutter hereingekommen. Die Zeemans hatten vier Söhne und eine Tochter. Sie waren alle um die sechs Fuß groß und über einundzwanzig, und alle hatten sie Angst vor ihrer Mutter. Nicht buchstäblich, aber Charlotte Zeeman hatte in dieser Familie die Hosen an. Ein einziger Familienabend dort genügte, und man wusste Bescheid.
Ich legte auf, machte das Licht an und fing an zu packen. Während ich Sachen in den Koffer warf, kam mir die Frage, wieso ich das eigentlich tat. Ich könnte sagen, weil Richard der dritte in unserem Triumvirat war, das Jean-Claude zwischen uns geschmiedet hatte. Ein Meistervampir, ein Wolfskönig und ein Totenbeschwörer. Der Totenbeschwörer war ich. Wir waren so eng miteinander verbunden, dass wir manchmal unabsichtlich in die Träume der anderen gerieten. Manchmal auch nicht so unabsichtlich.
Aber ich galoppierte nicht zu Richards Rettung an, weil er der Dritte im Bund war. Ich liebte ihn noch, das konnte ich immerhin vor mir selbst zugeben, wenn auch vor keinem anderen. Ich liebte ihn nicht auf dieselbe Art wie Jean-Claude, aber genauso sehr. Er war in Schwierigkeiten, und ich würde ihm helfen, so gut ich konnte. Ganz einfach. Scheißkompliziert. Verdammt schmerzhaft.
Ich überlegte, was Jean-Claude dazu sagen würde, dass ich alles stehen und liegen ließ, um Richard zu helfen. Es spielte eigentlich keine Rolle. Ich würde hinfahren und fertig. Aber ich machte mir doch Gedanken, wie sich mein Liebster dabei fühlte. Sein Herz schlug zwar nicht immer, aber es konnte trotzdem brechen.
Liebe ist wirklich zum Abgewöhnen. Manchmal geht’s einem gut dabei. Manchmal ist es nur eine andere Art draufzugehen.
2
Ich erledigte ein paar Anrufe. Meine Freundin Catherine Maison-Gilette war Anwältin. Sie hatte mir schon mehr als einmal geholfen, wenn ich bei der Polizei wegen einer Leiche aussagen musste, die irgendwie mit auf mein Konto ging. Bisher keine Gefängnisstrafe. Mensch, nicht mal ein Prozess. Wie ich das hinkriegte? Lügen, lügen, lügen.
Bob, Catherines Ehemann, ging beim fünften Klingeln ran. Seine Stimme war so schläfrig, dass er kaum zu verstehen war. Nur an dem tiefen Brummen war zu erkennen, wer von beiden am Apparat war. Sie hatten beide Probleme mit dem Wachwerden.
»Bob, hier ist Anita. Ich muss mit Catherine sprechen. Es ist geschäftlich.«
»Bist du auf einer Polizeiwache?«, fragte er. Bob kannte mich.
»Nein, diesmal brauche ich keinen Anwalt für mich selbst.«
Er stellte keine Fragen. Er sagte nur: »Hier ist sie. Wenn du denkst, ich bin nicht neugierig, dann irrst du dich, aber Catherine wird mir nachher alles erzählen.«
»Danke, Bob«, sagte ich.
»Was ist los, Anita?« Catherines Stimme klang normal. Sie war Strafrechtsanwältin mit einer eigenen Kanzlei. Sie wurde oft mitten in der Nacht angerufen. Sie mochte es nicht, konnte das aber gut verbergen.
Ich teilte ihr die schlechte Neuigkeit mit. Sie kannte Richard. Und sie mochte ihn sehr. Sie verstand überhaupt nicht, warum ich ihn für Jean-Claude hatte sausen lassen. Weil ich ihr von Richards Werwolfdasein nichts sagen durfte, war es irgendwie schwer zu erklären. Mann, selbst dann wäre es schwer zu erklären.
»Carl Belisarius«, sagte sie schließlich. »Er ist einer der besten Strafverteidiger dort. Ich kenne ihn persönlich. Bei seinen Klienten ist er nicht so wählerisch wie ich. Er hat einige, die bekannte Kriminelle sind, aber er ist gut.«
»Kann ich ihn anrufen und auf den Fall ansetzen?«, fragte ich.
»Dafür brauchst du Richards Erlaubnis, Anita.«
»Ich kann Richard erst überreden, sich einen neuen Anwalt zu nehmen, wenn ich vor ihm stehe. Zeit ist immer kostbar bei so einem Fall, Catherine. Kann Belisarius wenigstens die Hebel in Bewegung setzen?«
»Weißt du denn, ob er schon einen Anwalt hat?«
»Daniel hat gesagt, dass er sich weigert, mit seinem Anwalt zu sprechen, also nehme ich es an.«
»Gib mir Daniels Nummer, und ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte sie.
»Danke, Catherine, wirklich.«
Sie seufzte. »Ich weiß, dass du das auch für deine Freunde tun würdest. Du bist eben loyal. Aber bist du sicher, dass du nur freundschaftliche Motive hast?«
»Wie meinst du das?«
»Du liebst ihn noch, stimmt’s?«
»Kein Kommentar.«
Catherine lachte leise. »Kein Kommentar. Du stehst hier nicht unter Verdacht.«
»Sagst du.«
»Schön, ich werde tun, was ich kann. Gib mir Bescheid, wenn du dort angekommen bist.«
»Mach ich«, sagte ich und legte auf. Ich rief meinen Arbeitgeber an. Vampire töten war nur eine Nebenbeschäftigung. Ich arbeitete bei Animators Inc., der ersten Firma des Landes, die Tote erweckte. Wir waren auch die profitabelste. Das lag zum Teil an unserem Boss, Bert Vaughn. Er konnte einen Dollar aufstehen und singen lassen. Es gefiel ihm nicht, dass ich der Polizei bei der Aufklärung übernatürlicher Verbrechen half, weil das mehr und mehr Zeit in Anspruch nahm. Es würde ihm auch nicht gefallen, wenn ich wegen einer Privatangelegenheit auf unbestimmte Zeit die Stadt verließ. Ich war froh, dass es mitten in der Nacht war und er nicht im Büro sein würde, um mich persönlich anzuschreien.
Wenn Bert weiter solchen Druck machte, würde ich kündigen müssen, und das wollte ich nicht. Ich musste Tote erwecken. Das war nicht wie bei einem Muskel, der verkümmert, wenn man ihn nicht benutzt. Es war eine angeborene Eigenschaft. Wenn ich sie nicht einsetzte, würde sie ungebeten von allein hervorbrechen. Im College hatte mal ein Professor Selbstmord begangen. Die Leiche war drei Tage lang nicht gefunden worden, das ist der Zeitraum, den die Seele braucht, um fortzugehen. Dann kam der Tote eines Nachts in mein Zimmer geschlurft. Meine Zimmergenossin ließ sich am nächsten Tag ein anderes Bett zuweisen. Sie hatte keinen Sinn für Abenteuer.
Also weckte ich so oder so Tote auf. Ich hatte gar keine Wahl. Aber aufgrund meines Rufs könnte ich auch auf eigene Rechnung arbeiten. Ich bräuchte dann zwar eine Bürohilfe, aber es würde gehen. Das Problem war, dass ich die Firma nicht verlassen wollte. Einige meiner Kollegen gehörten zu meinen besten Freunden. Außerdem hatte ich in diesem Jahr schon genug Veränderungen hinter mir.
Ich, Anita Blake, Geißel der Untoten – die Frau, die von allen Vampirhenkern des Landes die längste Jagdstrecke aufweisen konnte –, war mit einem Vampir liiert. Romanze mit Ironie.
Es schellte an der Tür. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Das Klingeln an sich war ein normales Geräusch, aber nicht nachts um Viertel vor vier. Ich ließ den halb gepackten Koffer auf dem ungemachten Bett stehen und trat ins Wohnzimmer. Meine weißen Möbel standen auf einem leuchtenden Orientteppich. Auf Sofa und Sessel waren lässig Kissen verteilt, die die schönen Farben aufgriffen. Die Möbel gehörten mir, der Teppich und die Kissen waren ein Geschenk von Jean-Claude. Sein Stilempfinden war schon immer besser als meins. Warum also widersprechen?
Es klingelte noch einmal. Ich hatte keinen Grund, zusammenzuzucken, außer dass der Besucher Sturm klingelte und die Uhrzeit ungewöhnlich war und ich schon wegen der Geschichte mit Richard nervös war. Ich ging mit meiner Lieblingspistole zur Tür, meiner 9mm Browning Hi-Power, entsichert und auf den Boden gerichtet. Ich war fast da, als mir auffiel, dass ich nur ein Nachthemd anhatte. Halbnackt, aber bewaffnet. Ich hatte meine Prioritäten.
So stand ich barfuß auf dem eleganten Teppich und überlegte, ob ich mir einen Bademantel oder eine Jeans überziehen sollte. Irgendetwas. Wenn ich wie immer eines meiner übergroßen T-Shirts angehabt hätte, hätte ich geöffnet. Doch ich trug ein schwarzes Seidenhemdchen mit Spaghettiträgern, das bis knapp an die Knie reichte. Keine Einheitsgröße. Es bedeckte alles Wichtige, war aber nicht gerade besuchstauglich. Zum Teufel damit.
»Wer ist da?«, rief ich. Die Bösen drückten eigentlich eher nicht auf die Klingel.
»Jean-Claude, ma petite.«
Mir blieb der Mund offen stehen. Ich hätte nicht überraschter sein können, wäre es einer von den Bösen gewesen. Was machte er hier?
Ich sicherte die Browning und machte ihm auf. Das Seidenhemd hatte ich von ihm bekommen. Er hatte mich schon in weniger gesehen. Bademantel nicht nötig.
Da stand er vor mir. Als wäre ich ein Zauberkünstler und hätte gerade den Vorhang aufgezogen, um meinen schönen Assistenten vorzustellen. Sein Anblick verschlug mir den Atem.
Sein Hemd hatte einen konservativen Schnitt mit gewöhnlichen Manschetten und Kragen. Letztere glänzten in einem kräftigen Hellrot, der übrige Stoff war blutrot und hauchdünn, sodass man die nackte Haut wie durch einen roten Schleier sah. Die schwarzen Locken fielen ihm über die Schultern und sahen auf diesem Hemd noch dichter und dunkler aus, seine dunkelblauen Augen blauer als sonst. Dieses Rot liebte ich an ihm besonders, und das wusste er. Er hatte sich eine rote Kordel durch die Gürtelschlaufen der schwarzen Jeans gezogen. Die Enden fielen mehrfach geknotet an der Hüfte herab. Die schwarzen Stiefel reichten weit die Oberschenkel hinauf und hüllten seine langen, schlanken Beine von den Zehen bis zu den Leisten in Leder.
Wenn ich nicht in seiner Nähe war, ihn nicht sah und hörte, war es mir manchmal peinlich bis zur Gereiztheit, dass er mein Liebhaber war. Dann konnte ich ihn mir fast ausreden – fast. Aber niemals, wenn er bei mir war. Wenn er vor mir stand, wurden meine Knie weich, und ich musste sehr an mich halten, dass ich nicht Dinge sagte wie »hinreißend«.
Stattdessen sagte ich: »Du siehst sensationell aus, wie immer. Was tust du hier in einer Nacht, von der ich dir gesagt habe, du sollst nicht kommen?« Was ich eigentlich tun wollte, war, mich wie einen Mantel über ihn zu werfen und festgeklammert über die Schwelle tragen zu lassen. Aber das würde ich nicht tun. Es wäre doch etwas würdelos. Außerdem erschreckte es mich, wie sehr ich ihn wollte – und wie oft. Er war wie eine neue Droge. Das hatte nichts mit seinen Vampirkräften zu tun. Es lag an der guten, altmodischen Lust. Aber erschreckend war es trotzdem, und darum hatte ich mir ein paar Schranken gesetzt. Regeln aufgestellt. Meistens befolgte er sie.
Er lächelte, und es war das Lächeln, das ich liebte und fürchtete. Es bedeutete, dass er Schlimmes dachte, Dinge, die zwei oder mehr in einem dunklen Zimmer miteinander tun konnten, wo die Laken nach teurem Parfüm rochen, nach Schweiß und anderen Körperflüssigkeiten. Früher hatte er mich damit nie zum Erröten gebracht, das gelang ihm erst, seit wir miteinander ins Bett gingen. Manchmal brauchte er nur zu lächeln, und die Hitze schoss mir durch den Körper, als wäre ich vierzehn und er mein erster Schwarm. Er fand das charmant. Mich machte es verlegen.
»Du Mistkerl«, sagte ich leise.
Sein Lächeln wurde breiter. »Unser Traum ist unterbrochen worden, ma petite.«
»Wusst ich’s doch, dass das kein Zufall war«, antwortete ich. Es klang feindselig, und ich war hocherfreut. Denn der warme Sommerwind blies mir den Duft seines Rasierwassers über die Haut. Exotisch, ein Hauch von Blumen und Gewürzen. Manchmal sträubte ich mich, die Bettwäsche zu wechseln, um auf seinen Geruch nicht verzichten zu müssen.
»Ich hatte dich gebeten, mein Geschenk zu tragen, damit ich von dir träumen kann. Du wusstest, was ich wollte. Wenn du etwas anderes behauptest, lügst du. Darf ich hereinkommen?«
Ich hatte ihn so oft hereingebeten, dass er meine Schwelle auch ohne Erlaubnis überqueren konnte, aber er machte ein Spiel aus dieser Frage. Und gewann jedes Mal das offene Eingeständnis, dass ich ihn wollte. Das ärgerte und freute mich gleichermaßen, wie so vieles an Jean-Claude.
»Wie immer.«
Er ging an mir vorbei. Seine Stiefel waren an der Rückseite vom Absatz bis zum Saum geschnürt. Die schwarze Jeans saß so eng und glatt, dass man nicht zu raten brauchte, ob er etwas darunter trug.
Er trat ins Zimmer und sagte: »Sei nicht so mürrisch, ma petite. Du besitzt durchaus die Fähigkeit, mich aus deinen Träumen auszusperren.« Jetzt erst drehte er sich um, und in seinen Augen funkelte ein dunkles Licht, das nicht von seinen Vampirkräften kam. »Du hast mich mit mehr als offenen Armen willkommen geheißen.«
In weniger als fünf Minuten wurde ich zum zweiten Mal rot. »Richard ist in Tennessee verhaftet worden«, sagte ich.
»Ich weiß«, antwortete er.
»Das weißt du? Woher?«
»Der dortige Meister hat es mir erzählt. Er hatte große Angst, ich könnte denken, dass er etwas damit zu tun hat. Dass er auf die Weise unser Triumvirat zerstören will.«
»Wenn er das wollte, ginge es um Mord, nicht um versuchte Vergewaltigung«, sagte ich.
»Stimmt«, meinte Jean-Claude, dann lachte er. Das Lachen strich mir über die Haut wie ein Lufthauch. »Wer unseren Richard reingelegt hat, kennt ihn nicht besonders gut. Ich würde ihm einen Mord zutrauen, aber keine Vergewaltigung.«
Das war fast dasselbe, was ich gesagt hatte. Wieso war das so zermürbend? »Wirst du nach Tennessee reisen?«
»Colin, der Meister dort, hat mir verboten, sein Territorium zu betreten. Es wäre also ein aggressiver Akt, wenn ich es täte, wenn nicht sogar eine Kriegserklärung.«
»Warum sollte ihn das stören?«, fragte ich.
»Er fürchtet meine Macht, ma petite. Er fürchtet unsere Macht, weshalb er auch dich zur Persona non grata erklärt hat.«
Ich starrte ihn an. »Das ist ein Witz, oder? Er hat uns beiden verboten, Richard zu Hilfe zu kommen?«
Er nickte.
»Und dann sollen wir glauben, dass er nichts damit zu tun hat?«
»Ich glaube ihm, ma petite.«
»Du konntest durch das Telefon spüren, dass er nicht lügt?«, fragte ich.
»Manche Meistervampire können einen anderen belügen, aber ich glaube nicht, dass er so mächtig ist. Das ist jedoch nicht der Grund, warum ich ihm glaube.«
»Warum dann?«
»Beim letzten Mal, als du mit mir in ein fremdes Gebiet gereist bist, haben wir den Meister getötet.«
»Sie hat versucht, uns umzubringen«, verteidigte ich mich.
»Eigentlich«, korrigierte er, »hat sie uns alle gehen lassen außer dir. Dich wollte sie zum Vampir machen.«
»Wie ich sagte, sie wollte mich umbringen.«
Er lächelte. »Oh, ma petite, du kränkst mich.«
»Lass den Quatsch. Dieser Colin kann nicht im Ernst glauben, dass wir Richard einfach in der Zelle verfaulen lassen.«
»Er hat das Recht, uns die Einreise zu verweigern«, sagte Jean-Claude.
»Weil wir woanders einen Meistervampir auf seinem Territorium getötet haben?«
»Er braucht keine Gründe, ma petite. Er braucht nur nein zu sagen.«
»Wie kriegt ihr Vampire eigentlich überhaupt etwas geregelt?«
»Mit sehr viel Geduld«, antwortete Jean-Claude. »Aber bedenke, dass wir die Zeit haben, geduldig zu sein, ma petite.«
»Tja, ich nicht, und Richard auch nicht.«
»Ihr hättet eine Ewigkeit Zeit, wenn ihr beide das vierte Zeichen akzeptieren würdet«, erwiderte er ruhig, ganz sachlich.
Ich schüttelte den Kopf. »Richard und ich hängen an unserem letzten Rest Menschlichkeit. Außerdem, mein Lieber, würde uns das vierte Zeichen nicht unsterblich machen. Es heißt nur, dass wir leben, solange dich keiner umbringt. Du bist zwar nicht so leicht umzubringen wie wir beide, aber so viel schwerer auch nicht.«
Er setzte sich auf die Couch und schlug die Beine unter. Bei so viel Leder am Bein war das keine bequeme Haltung. Vielleicht waren die Stiefel weicher, als sie aussahen. Vielleicht.
Er stützte die Ellbogen auf die Lehne und beugte sich mit dem Oberkörper darüber. Das dünne rote Hemd war bis oben hin zugeknöpft und überließ doch nichts der Fantasie. Seine Brustwarzen drückten sich dagegen. Unter diesem roten Schleier wirkte seine kreuzförmige Narbe, als wäre sie ganz frisch.
Er stützte sich auf eine Hand wie eine Meerjungfrau auf einen Felsen. Ich wartete, was er Neckendes oder Anzügliches sagen würde. Stattdessen sagte er: »Ich bin extra gekommen, um dir persönlich von Richards Verhaftung zu erzählen.« Er beobachtete mein Gesicht sehr genau. »Ich dachte, es könnte dich aufregen.«
»Natürlich regt es mich auf. Dieser Colin ist doch verrückt, wenn er glaubt, er kann uns davon abhalten, Richard zu helfen.«
Jean-Claude lächelte. »Asher verhandelt bereits mit ihm, damit dir erlaubt wird, die Grenze zu überqueren.«
Asher war Jean-Claudes Stellvertreter, seine rechte Hand. Ich runzelte die Stirn. »Warum mir und nicht dir?«
»Weil du in Polizeidingen viel besser bist als ich.« Er warf ein lederverschnürtes Bein über die Couchlehne. Es erinnerte an den Hüftschwung eines Strippers. Soweit ich wusste, hatte Jean-Claude in seinem Club nie gestrippt. Aber er hatte das Talent, die kleinste Bewegung erotisch und ein bisschen unanständig wirken zu lassen. Man hatte ständig den Eindruck, dass er an schlimme Dinge dachte, an Dinge, die man in Gesellschaft nicht erwähnen konnte.
»Warum hast du mich nicht einfach angerufen und mir alles erzählt?«, fragte ich und kannte die Antwort bereits oder jedenfalls teilweise. Er war von meinem Körper so begeistert wie ich von seinem. Guter Sex ist eine zweischneidige Klinge. Der Verführer kann zum Verführten werden, wenn er an das richtige Opfer gelangt.
Er glitt auf mich zu. »Ich dachte, das sei eine Neuigkeit, die man lieber persönlich überbringt.« Er blieb dicht vor mir stehen, so dicht, dass der Saum meines Nachthemds seine Oberschenkel berührte. Er machte eine winzige Bewegung, und der Saum strich um meine nackten Beine. Die meisten Männer hätten die Hände nehmen müssen, um das zu erreichen. Aber natürlich hatte Jean-Claude vierhundert Jahre Zeit gehabt, um seine Techniken zu perfektionieren. Übung macht den Meister.
»Warum?«, fragte ich ein bisschen hauchig.
Seine Lippen kräuselten sich. »Du weißt, warum.«
»Ich will es hören«, sagte ich.
Bevor er antwortete, setzte er eine schöne, glatte Maske auf, nur in seinen Augen sah man das lodernde Feuer. »Ich konnte dich nicht gehen lassen, ohne dich ein letztes Mal zu berühren. Ich will lasterhafte Dinge mit dir tun, bevor du gehst.«
Ich lachte, aber es klang nervös. Mein Mund war plötzlich trocken. Ich hatte Mühe, nicht auf seine Brust zu starren. Lasterhafte Dinge, das sagte er gern, wenn er Sex meinte. Ich wollte ihn streicheln, aber ich war mir nicht sicher, wo das enden würde. Richard war in Schwierigkeiten. Ich hatte ihn einmal mit Jean-Claude betrogen, ich wollte ihn nicht noch einmal im Stich lassen. »Ich muss packen«, sagte ich, drehte mich abrupt um und ging ins Schlafzimmer.
Er folgte mir.
Ich legte die Pistole auf den Nachttisch neben das Telefon, nahm Socken aus der Schublade und warf sie nacheinander in den Koffer, während ich versuchte, Jean-Claude zu ignorieren. Er war nicht leicht zu ignorieren. Er legte sich neben den Koffer aufs Bett, auf einen Ellbogen gestützt, die langen Beine ausgestreckt. Auf meinem weißen Bettzeug wirkte er schrecklich overdressed. Er beobachtete jede meiner Bewegungen nur mit den Augen. Wie eine Katze: wachsam und vollkommen entspannt.
Ich ging nach nebenan ins Bad, um die Toilettenartikel zu holen. Ich hatte ein kleines Männernecessaire, in dem ich den ganzen Kleinkram aufbewahrte. In letzter Zeit reiste ich immer öfter. Da sollte man sein Zeug beisammenhaben.
Jean-Claude lag inzwischen auf dem Rücken, die langen schwarzen Haare wie in meinen dunklen Träumen auf dem weißen Kissen ausgebreitet. Als ich hereinkam, streckte er mit einem leisen Lächeln die Hand nach mir aus. »Komm zu mir, ma petite.«
Ich schüttelte den Kopf. »Wenn ich das tue, werden wir nur abgelenkt. Ich werde zu Ende packen und mich anziehen. Für anderes haben wir keine Zeit.«
Er kroch über das Bett zu mir herüber, mit einer rollenden Gleitbewegung, als hätte er Muskeln, wo andere Leute keine hatten. »Bin ich so wenig verlockend, ma petite? Oder ist deine Sorge um Richard so überwältigend?«
»Du weißt genau, wie verlockend du bist. Und ich mache mir Sorgen um Richard, ja.«
Er schob sich vom Bett herunter und folgte mir auf Schritt und Tritt. Während ich hin und her eilte, glitt er in eleganter Zeitlupe mit, ohne hinter mir zurückzubleiben. Die gemächliche Jagd eines Raubtiers, das alle Zeit der Welt hat, weil es weiß, dass es am Ende seine Beute fängt.
Als ich das zweite Mal fast mit ihm zusammenstieß, sagte ich: »Was hast du für ein Problem? Hör auf, mir nachzulaufen. Du machst mich nervös.« Die Wahrheit war, dass mir die Haut kribbelte, wenn er mir so nahe kam.
Er setzte sich auf die Bettkante und seufzte. »Ich will nicht, dass du gehst.«
Ich blieb wie angewurzelt stehen, drehte mich um und guckte ihn groß an. »Wieso denn nicht, um Himmels willen?«
»Jahrhunderte lang habe ich davon geträumt, so mächtig zu sein, dass mir nichts mehr passieren kann. So mächtig, dass ich mein Territorium halten und endlich, endlich Frieden haben kann. Und jetzt fürchte ich gerade den Mann, der mir zum Ziel verhelfen kann.«
»Was meinst du damit?« Ich ging zu ihm, einen Haufen T-Shirts und Kleiderbügel in den Armen.
»Richard. Ich fürchte Richard.« Da war ein Ausdruck in seinen Augen, den ich selten gesehen hatte. Er war unsicher. Ein normaler, menschlicher Ausdruck. Das passte überhaupt nicht zu dem Mann in dem durchsichtigen Hemd.
»Warum solltest du Richard fürchten?«, fragte ich.
»Wenn du ihn mehr liebst als mich, wirst du mich vielleicht seinetwegen verlassen.«
»Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Richard hasst mich. Er spricht mehr mit dir als mit mir.«
»Er hasst dich nicht, ma petite. Er hasst, dass du mit mir zusammen bist. Das ist ein großer Unterschied.« Er sah ein wenig düster zu mir hoch.
Ich seufzte. »Bist du eifersüchtig auf Richard?«
Er blickte auf die Spitzen seiner teuren Stiefel. »Ich wäre ein Dummkopf, wenn ich’s nicht wäre.«
Ich drückte den einen Arm um mein Kleiderbündel und strich ihm über die Wange, dann hob ich sein Kinn. »Ich schlafe mit dir, nicht mit ihm, weißt du noch?«
»Ja, und hier bin ich, ma petite, nur für dich verführerisch gekleidet, und du gibst mir nicht einmal einen Kuss.«
Das überraschte mich. Und da glaubte ich schon, ihn zu kennen. »Bist du gekränkt, weil ich dir keinen Begrüßungskuss gegeben habe?«
»Vielleicht«, sagte er sehr leise.
Ich schüttelte den Kopf und warf die Kleider Richtung Koffer. Ich stieß mit den Beinen seine Knie an, bis er mich dazwischen ließ. Ich drängte mich an ihn und legte die Hände auf seine Schultern. Der dünne Hemdstoff fühlte sich rauer an, als er aussah. »Wie kann ein so hinreißender Mann so verunsichert sein?«
Er schlang die Arme um meine Taille und schmiegte sich an mich, während er seine Beine gegen meine drückte. Seine Stiefel waren sehr weich und geschmeidig. Ich war quasi gefangen. Aber ich war eine willige Gefangene, darum war es in Ordnung.
»Ich würde jetzt gern auf die Knie gehen und dir über dein schickes Hemd lecken, nur um herauszufinden, wie viel ich von dir dadurch schmecken kann.« Ich sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Er lachte sanft mit tiefer Stimme. Über meinen ganzen Körper zog eine Gänsehaut. Meine Brustwarzen wurden steif, und andere Dinge auch. Sein Lachen war immer wie eine Berührung, eine zudringliche Berührung. Er konnte allein mit seiner Stimme Dinge tun, die die meisten Männer noch nicht einmal mit zwei Händen zustande brachten. Trotzdem hatte er Angst, dass ich ihn wegen Richard verlassen würde.
Er lehnte den Kopf an meine Brust und umfasste meine Brüste. Dann rieb er die Wange daran, dass die Seide über meine Haut glitt, bis mein Atem schneller ging.
Ich seufzte und beugte mich über ihn, um möglichst viel von ihm zu spüren. »Ich habe nicht vor, dich wegen Richard zu verlassen. Aber er ist in Schwierigkeiten, und das ist wichtiger als Sex.«
Jean-Claude drehte sein Gesicht zu mir, wir hatten uns so eng umschlungen, dass er sich kaum rühren konnte. »Küss mich, ma petite, mehr nicht. Nur ein Kuss, der mir sagt, dass du mich liebst.«
Ich drückte die Lippen auf seine Stirn. »Ich habe dich immer für selbstsicher gehalten.«
»Das bin ich«, sagte er, »bei jedem außer dir.«
Ich löste mich so weit, dass ich sein Gesicht mustern konnte. »Die Liebe sollte dich sicherer machen, nicht unsicherer.«
»Ja«, erwiderte er leise, »das sollte sie. Aber du liebst auch ihn. Du versuchst, ihn nicht zu lieben, und er versucht, dich nicht zu lieben. Aber die Liebe lässt sich nicht so leicht vernichten – oder hervorbringen.«
Ich beugte mich über ihn. Der erste Kuss war nur eine streifende Berührung der Haut. Der zweite Kuss geriet fester. Ich biss ihm leicht in die Oberlippe, und er stieß einen kleinen Laut aus. Er küsste mich zurück, nahm meine Wangen zwischen die Hände und küsste mich, als wollte er mich austrinken und noch den letzten Tropfen eines köstlichen Weins auflecken, zärtlich, gierig, hungrig. Ich ließ mich auf ihn sinken, schob die Hände an ihm entlang, als hungerten sie nach dem Gefühl seiner Haut.
Ich spürte seine Reißzähne an Lippen und Zunge, dann einen raschen, scharfen Schmerz und den süßen Kupfergeschmack von Blut. Er stieß einen wohligen Laut aus und rollte mich herum. Plötzlich lag ich auf dem Bett unter ihm. Seine Augen waren leuchtend blau, die Pupillen in der aufwallenden Begierde verschwunden.
Er wollte mir den Kopf auf die Seite drehen und den Mund auf meinen Hals setzen. Ich stemmte mich dagegen. »Kein Blut, Jean-Claude.«
Er sackte auf mir zusammen und vergrub sein Gesicht in den Falten der Bettdecke. »Bitte, ma petite.«
Ich stieß ihn an die Schulter. »Runter von mir.«
Er rollte sich auf den Rücken und starrte an die Decke, vermied es sorgfältig, mich anzusehen. »Du lässt mich in jede Körperöffnung eindringen, aber das letzte bisschen von dir verweigerst du mir.«
Ich stand vorsichtig vom Bett auf, um zu sehen, ob meine Knie es schaffen würden. »Ich bin kein Futter«, stellte ich klar.
»Es ist so viel mehr als Sättigung, ma petite. Wenn du mir nur erlauben würdest, es dir zu zeigen.«
Ich wandte mich dem Haufen Blusen zu, um sie von den Bügeln zu nehmen und zusammenzufalten. »Kein Blut – so ist es abgemacht.«
Er drehte sich auf die Seite. »Ich biete dir alles an, was ich bin, aber du hältst einen Teil von dir zurück. Wie soll ich da nicht auf Richard eifersüchtig sein?«
»Du bekommst Sex, er nicht mal eine Verabredung.«
»Du gehörst mir, aber nicht vollkommen.«
»Ich bin kein Schoßtier, Jean-Claude. Man kann eine andere Person nicht besitzen.«
»Wenn es dir möglich wäre, Richards Tier zu lieben, würdest du nichts vor ihm zurückhalten. Du würdest dich ihm ganz hingeben.«
Ich faltete die letzte Bluse zusammen. »Verdammt, Jean-Claude, das ist doch lächerlich. Ich habe mich für dich entschieden. Klar? Wir sind zusammen. Warum machst du dir solche Gedanken?«
»Weil du in dem Moment, wo er in Schwierigkeiten steckt, alles stehen und liegen lässt und zu ihm rennst.«
»Für dich würde ich dasselbe tun.«
»Stimmt«, sagte er. »Ich bezweifle nicht, dass du mich auf deine Weise liebst, aber ihn liebst du auch.«
Ich zog den Kofferreißverschluss zu. »Wir werden nicht darüber streiten. Ich schlafe mit dir, aber ich lasse dich nicht an mir saugen, nur damit du dich sicherer fühlst.«
Das Telefon klingelte. Ashers kultivierte Stimme, die Jean-Claudes so ähnlich war. »Anita, wie geht es dir in dieser schönen Sommernacht?«
»Gut, Asher. Was gibt’s?«
»Darf ich Jean-Claude sprechen?«
Ich wollte etwas einwenden, doch Jean-Claude streckte schon die Hand aus. Ich gab ihm den Apparat.
Jean-Claude sprach französisch mit Asher, das hatten sie sich so angewöhnt. Ich freute mich, dass er mit jemandem in seiner Muttersprache reden konnte. Mein Französisch war nicht gut genug, und ich konnte ihrer Unterhaltung nicht folgen. Ich vermutete stark, dass sie mich damit manchmal wie ein Kind behandelten, das für die Gespräche der Erwachsenen noch nicht reif genug ist. Das war unverschämt herablassend, aber sie waren jahrhundertealte Vampire, und manchmal konnten sie eben nicht anders.
»Colin gibt dir die Erlaubnis nicht. Keiner meiner Leute darf sein Gebiet betreten.«
»Kann er das tun?«, fragte ich.
Jean-Claude nickte. »Oui.«
»Ich werde nach Tennessee reisen und Richard helfen. Arrangiere das, Jean-Claude, oder ich reise ohne Arrangement.«
»Auch wenn das einen Krieg bedeutet?«, fragte er.
»Verdammt«, sagte ich. »Ruf den kleinen Scheißkerl an und lass mich mit ihm sprechen.«
Jean-Claude zog die Augenbrauen hoch, nickte aber. Er beendete das Gespräch mit Asher und wählte eine Nummer. »Colin, hier ist Jean-Claude«, sagte er. »Ja, Asher hat mir berichtet, was du entschieden hast. Mein menschlicher Diener, Anita Blake, wünscht mit dir zu sprechen.« Er hörte einen Moment lang zu. »Nein, ich weiß nicht, was sie dir sagen möchte.« Er gab mir das Telefon und lehnte sich ans Kopfende des Bettes, wie um einem spannenden Auftritt zuzusehen.
»Hallo? Colin?«
»Am Apparat.« Er sprach mit dem Akzent des Mittleren Westens, klang also nicht so exotisch wie viele andere seiner Art.
»Ich heiße Anita Blake.«
»Ich weiß, wer Sie sind«, sagte er. »Sie sind der Scharfrichter.«
»Ja, aber ich komme nicht wegen einer Hinrichtung nach Tennessee. Mein Freund ist in Schwierigkeiten. Ich möchte ihm bloß heraushelfen.«
»Er ist der dritte Mann des Triumvirats. Wenn Sie mein Territorium betreten, dann habe ich schon zwei davon auf meinem Land. Sie sind zu mächtig, als dass ich das erlauben könnte.«
»Asher sagt, Sie verweigern auch anderen von uns den Zutritt, ist das wahr?«
»Ja.«
»Aber warum denn?«
»Sogar der Rat fürchtet Jean-Claude. Ich will Sie auf meinem Land nicht haben.«
»Colin, hören Sie, ich will Ihnen gar nichts streitig machen. Ich will Ihr Gebiet überhaupt nicht. Ich habe keinerlei Absichten, die Sie betreffen. Sie sind ein Meistervampir. Sie können spüren, dass ich die Wahrheit sage.«
»Sie meinen, was Sie sagen, aber Sie sind der Diener, Jean-Claude ist der Meister.«
»Verstehen Sie mich nicht falsch, Colin, aber warum sollte Jean-Claude es auf Ihr Land abgesehen haben? Zwischen Ihnen und uns liegen noch drei andere Gebiete. Wenn Jean-Claude Eroberungspläne hätte, würde er ein benachbartes Territorium überfallen.«
»Vielleicht gibt es gerade hier etwas, das er haben möchte«, erwiderte Colin, und ich hörte die Angst in seiner Stimme. Bei einem Meistervampir eine Seltenheit. Gewöhnlich können sie ihre Gefühle besser verbergen.
»Colin, ich schwöre jeden Eid, dass wir nichts von Ihnen wollen. Wir müssen nur Richard aus dem Gefängnis holen. In Ordnung?«
»Nein«, sagte er. »Wenn Sie ohne Erlaubnis hierherkommen, gibt es Krieg zwischen uns, und ich werde Sie töten.«
»Hören Sie, Colin, ich weiß, dass Sie Angst haben.« Mir war sofort klar, dass ich das nicht hätte sagen sollen.
»Woher wissen Sie, was ich fühle?« Seine Angst steigerte sich ein bisschen, doch sein Zorn wuchs schneller. »Ein menschlicher Diener, der die Angst eines Meistervampirs spüren kann – und da wundern Sie sich, warum ich Sie nicht auf mein Gebiet lassen will.«
»Ich kann Ihre Angst nicht spüren, Colin. Sie war Ihnen anzuhören.«
»Lügnerin!«
Meine Anspannung wuchs. Es gehört meist nicht viel dazu, mich sauer zu machen, und er näherte sich meiner Schmerzgrenze. »Wie sollen wir Richard helfen, wenn Sie uns nicht erlauben, jemanden hinzuschicken?« Mein Ton war ganz ruhig, aber in meinem Hals saß ein Kloß, und meine Stimme rutschte ein bisschen tiefer, weil ich mich zwang, nicht zu schreien.
»Was mit Ihrem Dritten geschieht, ist nicht mein Problem. Mein Land und meine Leute zu schützen, das ist mein Problem.«
»Wenn Richard wegen dieser Behinderung etwas zustößt, dann mache ich es zu Ihrem Problem«, erwiderte ich noch immer ganz ruhig.
»Sehen Sie, schon beginnen die Drohungen.«
Die Anspannung in meinen Schultern schoss in meinen Hals und brach sich Bahn. »Jetzt passen Sie mal auf, Sie kleiner Scheißer, ich werde kommen. Ich werde nicht zulassen, dass Richard wegen Ihrer Paranoia was passiert.«
»Dann töten wir Sie«, sagte er.
»Kommen Sie mir nicht in die Quere, Colin, dann lasse ich Sie ebenfalls in Ruhe. Wenn Sie sich mit mir anlegen, werde ich Sie vernichten, ist das klar? Krieg gibt es nur, wenn Sie ihn anfangen, aber wenn Sie das tun, werde ich ihn bei Gott zu Ende bringen.«
Jean-Claude verlangte verzweifelt nach dem Apparat. Es gab ein kurzes Gerangel, während ich Colin als antiquierten Intriganten und Schlimmeres bezeichnete.
Jean-Claude sprach seine Entschuldigung in die tote Leitung. Er legte auf und sah mich an. Sein Blick war beredt. »Ich würde sagen, ich bin sprachlos, ma petite, oder dass ich nicht glauben kann, was du soeben getan hast, aber ich glaube es. Die Frage ist: Begreifst du, was du da getan hast?«
»Ich werde Richard rausholen. Ich kann Colin aus dem Weg gehen oder über ihn hinwegsteigen. Es liegt ganz bei ihm.«
Jean-Claude seufzte. »Er hat Recht, wenn er das als Kriegserklärung ansieht. Aber Colin ist sehr vorsichtig. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wartet er ab, ob du mit Feindseligkeiten anfängst, oder er macht den Versuch, dich zu töten, sobald du einen Fuß auf sein Territorium setzt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Was hätte ich denn tun sollen?«
»Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Was geschehen ist, ist geschehen, aber es ändert die Reiseumstände. Du kannst mein Flugzeug nehmen, aber du wirst Begleitung haben.«
»Du kommst mit?«, fragte ich.
»Nein. Dann wäre Colin sicher, dass wir seinetwegen kommen. Nein, ich bleibe hier, aber du reist mit einer Entourage von Leibwächtern.«
»Moment mal«, setzte ich an.
Er hob die Hand. »Nein, ma petite. Du bist sehr grob gewesen. Bedenke, wenn du stirbst, dann vielleicht auch Richard und ich. Unsere Verbindung gibt uns Macht, aber das hat seinen Preis. Du riskierst mehr als nur dein eigenes Leben.«
Das brachte mich ins Stocken. »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte ich.
»Du wirst eine Entourage benötigen, die meinem menschlichen Diener angemessen und die stark genug ist, um sich nötigenfalls gegen Colins Leute zu behaupten.«
»Was hast du vor?«, fragte ich misstrauisch.
»Überlass das mir.«
»Ganz bestimmt nicht«, widersprach ich.
Er stand auf, und sein Zorn fegte durch das Zimmer wie ein sengender Wind. »Du hast dich selbst, mich und Richard in Gefahr gebracht. Alles was wir haben oder für uns erhoffen, hast du mit deiner Wut aufs Spiel gesetzt.«
»Am Ende wäre es doch zu einem Ultimatum gekommen, Jean-Claude. Ich kenne die Vampire. Du hättest argumentiert, um ein, zwei Tage herauszuschlagen, aber am Ende wäre es auf dasselbe hinausgelaufen.«
»Bist du da so sicher?«
»Ja. Ich konnte ihm anhören, wie sehr er dich fürchtet. Er macht sich vor Angst in die Hosen. Er hätte in keinem Fall zugestimmt, dass wir kommen.«
»Er fürchtet nicht nur mich, ma petite. Du bist der Scharfrichter. Den jungen Vampiren droht man, wenn sie Dummheiten machen, dass du kommst und sie in ihrem Sarg erschlägst.«
»Das hast du dir ausgedacht«, sagte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ma petite, du bist bei uns der Buhmann.«
»Wenn ich Colin begegne, werde ich versuchen, ihm nicht noch mehr Angst zu machen.«
»Du wirst ihm begegnen, ma petite, so oder so. Entweder arrangiert er ein Treffen, wenn er sieht, dass du ihm nichts Böses willst, oder er ist dabei, wenn sie dich angreifen.«
»Wir müssen Richard vor der Vollmondnacht freibekommen. Uns bleiben nur fünf Tage. Wir haben nicht die Zeit, um die Sache langsam anzugehen.«
»Wen willst du damit überzeugen, ma petite, mich oder dich?«
Ich hatte die Beherrschung verloren. Das war dumm gewesen. Unentschuldbar. Ich konnte leicht aufbrausen, aber gewöhnlich hatte ich mich besser im Griff. »Es tut mir leid«, murmelte ich zerknirscht.
Jean-Claude schnaubte höchst unelegant. »Jetzt tut es ihr leid.« Er wählte eine Nummer. »Ich sage Asher und den anderen, sie sollen packen.«
»Asher?«, sagte ich. »Den nehme ich nicht mit.«
»Oh doch.«
Ich öffnete den Mund, um zu protestieren. Er zeigte mit einem langen, bleichen Finger auf mich. »Ich kenne Colin und seine Leute. Du brauchst Begleiter, die beeindruckend, aber nicht allzu Furcht erregend und trotzdem imstande sind, dich und sich zu verteidigen. Ich entscheide, wer mitgeht und wer hier bleibt.«
»Das ist unfair.«
»Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Fairness, ma petite. Dein kostbarer Richard sitzt hinter Gittern, und die Vollmondnacht naht.« Er ließ seine Hände in den Schoß fallen. »Wenn du welche von deinen Werleoparden mitnehmen willst, gerne. Asher und Damian müssen unterwegs satt werden können. Sie dürfen auf Colins Territorium nicht jagen. Das wäre ein feindlicher Übergriff.«
»Du willst, dass ich ein paar Werleoparden als wandelnden Proviant mitnehme?«
»Ich werde auch ein paar Werwölfe stellen«, sagte er.
»Dann musst du mir die Verantwortung für sie geben. Ich bin ihre Lupa.« Als ich noch mit Richard ging, machte er mich zur Lupa. Die Lupa des Rudels war oft nicht mehr als die Freundin des Leitwolfs, aber bisher war sie immer ein Werwolf und kein Mensch gewesen. An die Werleoparden war ich durch einen Fehler gekommen. Ich hatte ihren Anführer getötet und stellte dann fest, dass sie ständig irgendwelchen Angriffen ausgesetzt waren. Schwache Gestaltwandler ohne einen Anführer, der sie beschützt, enden als Fressen für andere. Ich war gewissermaßen schuld an ihrer Lage, darum gab ich ihnen Schutz. Da ich kein Werleopard war, konnte ich den Schutz nur mit einer Drohung erreichen, nämlich dass ich jeden töten würde, der ihnen etwas tat. Die übrigen Monster müssen es mir geglaubt haben, denn ab da ließen sie die Werleoparden in Ruhe. Wenn man genug Silbermunition verschossen hat, bekommt man einen gewissen Ruf.
Jean-Claude drückte sich den Apparat ans Ohr. »Langsam kommt es noch so weit, dass keiner in St. Louis irgendein Monster beleidigen kann, ohne dass er es mit dir zu tun bekommt, ma petite.« Man konnte fast meinen, dass er sauer auf mich war.
Ich schätze, diesmal konnte ich ihm keinen Vorwurf machen.
3
Das Privatflugzeug sah aus wie ein längliches weißes Ei mit Flossen. Gut, ein bisschen länger als ein Ei und spitzer an den Enden, aber es sah genauso zerbrechlich aus. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein kleines Flugangstproblem habe? Ich saß kerzengerade in meinem voll drehbaren, voll abwaschbaren Sessel angeschnallt und grub die Fingernägel in die Armlehnenpolster. Ich hatte den Sessel mit Absicht von dem runden Fenster weggedreht, sodass ich nicht neben mir in die Tiefe sehen konnte. Leider war das Flugzeug so schmal, dass ich aus den Augenwinkeln die Wattewolken und den blauen Himmel in der anderen Fensterreihe aufblitzen sah. Da fiel es mir schwer zu vergessen, dass ich etliche Meilen über dem Boden schwebte und mich nur eine dünne Metallplatte vom Eintritt in die Ewigkeit trennte.
Jason ließ sich neben mir in den Sitz fallen, sodass mir ein kleiner Schrei entfuhr. Er lachte. »Ich kann nicht fassen, dass du solche Angst vorm Fliegen hast.« Er stieß sich mit den Füßen ab und drehte sich mit dem Sessel herum wie ein kleiner Junge in Papas Büro. Seine dünnen blonden Haare waren knapp schulterlang, ohne Pony. Seine Augen hatten dasselbe helle Blau, das an uns vorbeiflog. Er war genauso groß wie ich, eins sechzig, also klein für einen Mann. Das schien ihn aber kein bisschen zu stören. Er trug ein weites T-Shirt und völlig ausgeblichene, fast weiße Jeans, dazu Zweihundert-Dollar-Joggingschuhe, obwohl er nie joggte. Das wusste ich genau.
Diesen Sommer war er einundzwanzig geworden. Er hatte mich offiziell informiert, er sei Zwilling und dürfe ab sofort alles. Alles hieß bei Jason eine Menge. Er war ein Werwolf, lebte aber zurzeit bei Jean-Claude und spielte für ihn den morgendlichen Aperitif oder den Abendimbiss. Das Blut von Gestaltwandlern hat mehr Kraft. Man braucht davon weniger als von Menschenblut und fühlt sich hinterher viel besser, jedenfalls habe ich das beobachtet.
Jetzt sprang er aus seinem Sitz und fiel vor mir auf die Knie. »Komm, Anita. Warum sich solche Sorgen machen?«
»Lass mich in Ruhe, Jason. Das ist eine Phobie. Das hat nichts mit Logik zu tun. Du kannst es mir nicht ausreden, also lass mich in Ruhe.«
Er sprang auf, und das so schnell, dass es wie ein Zaubertrick wirkte. »Wir sind vollkommen sicher.« Er begann auf und ab zu hüpfen. »Siehst du, vollkommen sicher.«
»Zane!«, schrie ich.
Zane erschien an meiner Seite. Er war über eins achtzig und so dünn, als hätte er nicht genügend Fleisch auf den Rippen gehabt, als er in die Höhe geschossen war. Seine Haare waren schreiend blond wie Neonbutterblumen, an den Seiten rasiert und auf dem Kopf zu Stacheln gegelt. Er trug schwarze Vinylhosen wie eine glitschige zweite Haut und darunter eine passende Weste ohne Hemd. Glänzende schwarze Stiefel rundeten seinen Aufzug ab.
»Sie haben gerufen?«, fragte er mit schmerzhaft tiefer Stimme. Wenn ein Gestaltwandler zu viel Zeit in seiner Tiergestalt verbringt, bilden sich manche Eigenschaften nicht mehr zurück. Zanes Gerölltimbre und die niedlichen Reißzähne in Unter- und Oberkiefer zeigten an, dass er zu oft zu lange Leopard gewesen war. Seine Stimme hätte noch als menschlich durchgehen können, aber die Zähne – die Zähne verrieten ihn.
»Schaff mir Jason vom Hals, bitte«, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen.
Zane blickte auf den kleineren Werwolf hinab.
Jason wich nicht von der Stelle.
Zane ging die letzten zwei Schritte auf ihn zu. So standen sie da, Brust an Brust, und starrten sich in die Augen. Plötzlich fühlte man diese kribbelnde Energie, bei der man wusste, dass jemand nicht so viel Mensch war, wie er vorgab.
Mist. Ich wollte keinen Streit.
Zane senkte ein wenig den Kopf und ließ ein tiefes Knurren durch die Mundwinkel hören.
»Keine Schlägerei, Jungs«, sagte ich.
Zane drückte Jason einen dicken, nassen Kuss auf den Mund.
Jason machte lachend einen Satz rückwärts. »Du bisexueller Mistkerl.«
»Fass dir an die eigene Nase«, sagte Zane.
Jason grinste bloß und schlenderte davon, obwohl dafür nicht genug Platz war. Ich habe eine leichte Klaustrophobie. Die stammt von einem Tauchunfall, aber wie mir auffällt, ist sie schlimmer geworden, seit ich mal eines Morgens in einem Sarg neben einem Vampir aufgewacht bin, den ich nicht mochte. Ich konnte mich retten, aber seitdem kann ich beengte Räume immer weniger leiden.
Zane glitt in den Sessel neben mir. Die glänzende schwarze Weste klaffte über der mageren, bleichen Brust auf und ermöglichte einen Blick auf seinen silbernen Ring in der Brustwarze. Zane gab mir einen Klaps aufs Knie, und ich ließ ihn. Er fasste die Leute ständig an, das war nicht persönlich gemeint. Viele Gestaltwandler taten das, quasi wie Tiere, die weniger Berührungsängste haben, doch Zane hatte die beiläufige Berührung zu einer Kunstform erhoben. Ich hatte irgendwann begriffen, dass das für ihn ein Ersatz für seine Schmusedecke war. Er versuchte, das dominante Raubtier zu spielen, war aber keins. Hinter dieser Maskerade augenzwinkernden Selbstvertrauens wusste er das. Wenn er mal in Gesellschaft auf sich allein gestellt war, ohne jeden Hautkontakt, war er wirklich angespannt. Darum ließ ich mich von ihm anfassen, wo ich jeden anderen scharf angefahren hätte.
»Wir werden bald landen«, sagte er. Seine Hand verließ mein Knie. Er kannte die Regeln. Er durfte mich anfassen, aber nicht zärtlich werden. Ich war seine Beruhigungspille, nicht seine Freundin.
»Ich weiß«, sagte ich.
Er lächelte. »Aber du glaubst mir nicht.«
»Sagen wir, ich entspanne mich erst, wenn wir wirklich auf dem Boden aufgesetzt haben.«
Cherry kam zu uns. Sie war groß und schlank, hatte glattes, naturblondes Haar, das sehr kurz geschnitten war, und ein kräftiges, dreieckiges Gesicht. Sie trug grauen Lidschatten und schwarzen Lidstrich. Der Lippenstift war ebenfalls schwarz. Das waren nicht die Make-up-Farben, die ich für sie ausgesucht hätte, aber sie passten zu ihrer Kleidung: schwarze Netzstrümpfe, Vinylminirock, schwarze flache Stiefel und ein schwarzer Spitzen-BH unter einem Netzhemd. Den BH trug sie mir zuliebe. Seit sie nicht mehr als Krankenschwester arbeitete, ging sie häufig oben ohne. Sie hatte den Krankenhausjob gehabt, bis man herausfand, dass sie ein Werleopard war. Dann fiel sie einer Haushaltskürzung zum Opfer. Vielleicht war es eine Haushaltskürzung gewesen, vielleicht aber auch nicht. Es war nicht rechtens, jemanden wegen einer Krankheit zu benachteiligen, aber kein Kranker wollte sich von irgendeinem Wertier behandeln lassen. Die Leute schienen zu glauben, dass sich Lykanthropen nicht beherrschen können, wenn sie ringsherum frisches Blut wittern. Ein ganz neuer Gestaltwandler hätte da vielleicht Schwierigkeiten, aber so neu war Cherry nicht. Sie war eine gute Krankenschwester gewesen, und jetzt würde sie nie wieder eine sein. Das hatte sie verbittert und in diese Punkerbraut verwandelt, als wollte sie nun auch in Menschengestalt jedem zeigen, dass sie vollkommen anders war. Leider sah sie wie tausend andere Jugendliche und Mittzwanziger aus, die auch gern anders sein und auffallen wollten.
»Was machen wir, wenn wir gelandet sind?«, fragte Cherry mit ihrer gurrenden Altstimme. Ich hatte immer vermutet, die Stimme sei eine Folge zu langer Pelzzeiten, wie Zanes Zähne, aber nein, Cherry hatte von Natur aus so eine tiefe, erotische Stimme. Für Telefonsex wäre sie genau richtig gewesen. Sie ließ sich im Schneidersitz vor uns auf dem Boden nieder. Dabei schob sich ihr Rock hoch und entblößte den Saum ihrer Strümpfe, ohne noch mehr zu zeigen. Ich hoffte, dass sie einen Slip anhatte. Ich wäre gar nicht imstande, einen so kurzen Rock zu tragen, ohne mich irgendwann ungeschickt zu bücken.
»Ich rufe Richards Bruder an und fahre zum Gefängnis«, sagte ich.
»Und was sollen wir so lange tun?«, fragte Zane.
»Jean-Claude sagt, dass er für Zimmer gesorgt hat, also begebt ihr euch dorthin.«
Sie wechselten einen Blick. Der kam mir seltsam vor.
»Was?«, fragte ich.
»Einer von uns muss mit dir gehen«, antwortete Zane.
»Nein, ich werde da reingehen und meine Henkerlizenz zücken. Allein komme ich besser klar.«
»Und wenn der hiesige Meister seine Leute in die Stadt geschickt hat, damit sie dir auflauern?«, fragte Zane. »Er wird wissen, dass du heute zum Gefängnis gehst.«
Cherry nickte. »Da ist mit einem Hinterhalt zu rechnen.«
Da hatten sie Recht, aber … »Seht mal, das ist nicht persönlich gemeint, Leute, aber ihr seht aus wie die Püppchen auf einer SM-Hochzeitstorte. Die Bullen mögen keine Leute, die aussehen wie …« Ich wusste nicht, wie ich das sagen sollte, ohne beleidigend zu werden. Polizisten waren bodenständige Leute, die hatten es nicht so mit Exotik. Sie hatten schon alles Mögliche erlebt und hinterher den Dreck weggemacht. Wenn sie was Exotisches sahen, dann waren es meist üble Kerle. Nach einer Weile glaubten sie dann, dass jeder mit einem auffälligen Outfit ein Verbrecher war. Nur um Zeit zu sparen.
Wenn ich mit zwei Bilderbuch-Punks auf der Wache aufkreuzte, würden sofort alle Antennen auf Alarm stehen. Sie wüssten sofort, dass ich nicht das war, was ich zu sein behauptete, und das würde die Dinge komplizieren. Wir wollten die Lage möglichst einfach haben, nicht schwierig.
Ich trug meine Henker-Alltagskluft: schwarze, nicht abgenutzte Jeans, rote kurzärmlige Bluse, schwarze Kostümjacke, schwarze Nikes, einen schwarzen Gürtel, in den ich mein Schulterholster einhaken konnte. Die Browning saß unter meinem linken Arm und sorgte für ein vertrautes Gefühl. Außerdem trug ich drei Messer, zwei an den Handgelenken und eins unterhalb des Nackens an der Wirbelsäule. Der Griff ragte so weit heraus, dass meine Haare ihn verdecken mussten. Aber die waren dazu ausreichend dicht und dunkel. Dieses Messer war sehr lang und erst ein Mal benutzt. Ich hatte es einem Werleoparden ins Herz gestoßen, und die Spitze war am Rücken wieder ausgetreten. Für echte Notfälle trug ich ein Silberkreuz unter der Bluse, und ich hatte passende Munition für Werbären und alles Mögliche, zum Beispiel auch ganz normale, falls ich einem wild gewordenen Elfen begegnen sollte. Bei denen nützte Silber nämlich nichts.
»Ich werde mitgehen.« Nathaniel rutschte hinter Cherry und zwängte sich zwischen die Bordwand und meine Beine. Eine breite Schulter lehnte sich recht schwer gegen meine Jeans. Dort konnte er gar nicht sitzen, ohne mit mir auf Tuchfühlung zu gehen. Das versuchte er immer, und er machte es so gut, dass ich oft gar nichts dagegen sagen konnte. Wie jetzt.
»Besser nicht, Nathaniel«, sagte ich.
Er zog seine Knie an die Brust und fragte: »Warum nicht?« Immerhin war er einigermaßen normal gekleidet, in Jeans und T-Shirt, das sogar in der Hose steckte, aber ansonsten … Seine Haare waren rötlich braun, fast wie Mahagoni. Er trug sie als Pferdeschwanz, aber der reichte ihm in seidigen Locken bis an die Knie.
Nathaniel blickte mich mit seinen lila Augen an. Selbst wenn er sich das Haar kurz schneiden lassen würde, die Augen blieben ein Problem. Er war klein für einen Mann und außerdem der jüngste von uns, erst neunzehn. Ich nahm stark an, dass er mitten in einem Wachstumsschub war. Eines Tages würde seine Größe zu den Schultern passen, die sehr breit und sehr maskulin waren. Er war Stripper im Guilty Pleasures, ein Werleopard und früher mal Stricher. Letzterem hatte ich allerdings einen Riegel vorgeschoben. Wenn ich schon Leopardenkönigin sein musste, dann sollte ich auch regieren. Mein erstes Gesetz hatte geheißen, dass sich keiner aus meinem Rudel prostituierte. Gabriel, ihr voriger Alpha, hatte sie auf den Strich geschickt. Gestaltwandler können grobe Verletzungen aushalten und überleben. Gabriel hatte einen Weg gefunden, damit Geld zu verdienen. Er verkaufte seine Kätzchen an sadistische Kunden. Nathaniel hatte ihm viel Geld eingebracht. Als ich ihm zum ersten Mal begegnete, lag er im Krankenhaus, weil ihn ein Kunde übel zugerichtet hatte. Zugegeben, das war, als Gabriel schon nicht mehr lebte. Die Werleoparden versuchten damals, ihren angestammten Kundenkreis aufrechtzuerhalten, aber Zane, der Gabriels Platz als Zuhälter einnahm, war nicht stark genug, um sie zu beschützen, und konnte schließlich nicht verhindern, was Nathaniel passierte.
Nathaniel konnte mit bloßen Händen einen Konzertflügel stemmen, aber dennoch war er das geborene Opfer. Er mochte Schmerzen und wollte sich jemandem unterordnen, brauchte einen Gebieter, und so versuchte er beharrlich, mir diese Aufgabe aufzudrängen. Wir hätten vielleicht eine Regelung finden können, aber für ihn schien auch Sex dazuzugehören, und das kam für mich nicht in Frage.
»Ich werde mitgehen«, sagte Jason. Er setzte sich neben Cherry und legte mit anschmiegsamen Bewegungen den Kopf auf ihre Schulter. Sie rückte von ihm ab und kuschelte sich an Nathaniel. Das war nichts Sexuelles, das war das normale Gruppenverhalten der Wertiere. Dabei wurde es als Fauxpas angesehen, mit einer anderen Tierart zu kuscheln. Aber Jason kümmerte das nicht. Cherry war eine Frau, und er flirtete mit jeder. Nichts Persönliches, reine Gewohnheit.
Jason rutschte auf dem Po hinterher, bis Cherry zwischen ihm und Nathaniel eingeklemmt saß. »Ich habe einen Anzug dabei, einen schönen, normalen blauen Anzug. Ich werde sogar einen Schlips tragen.«