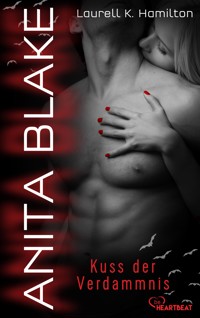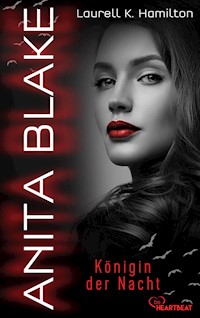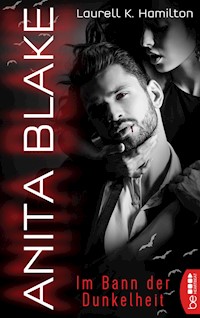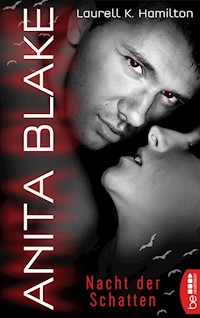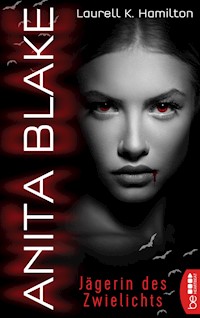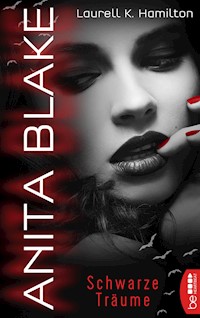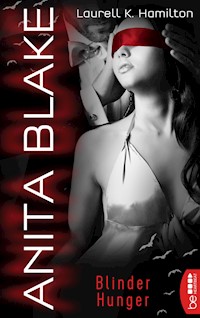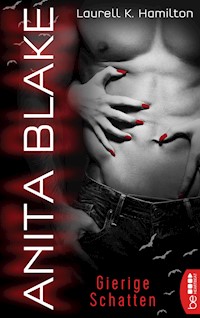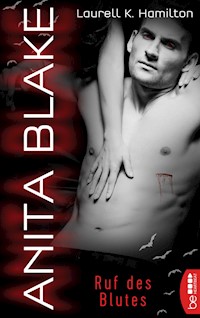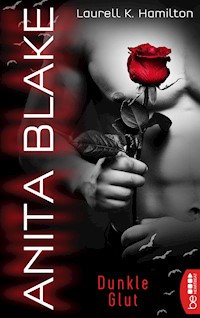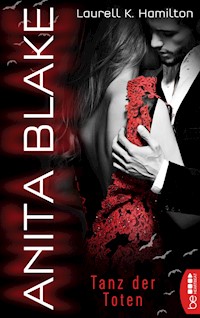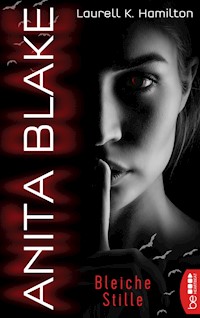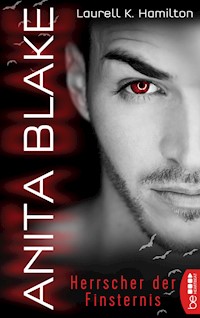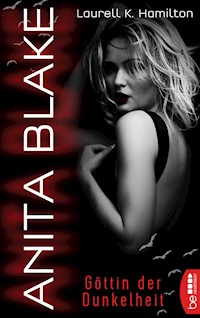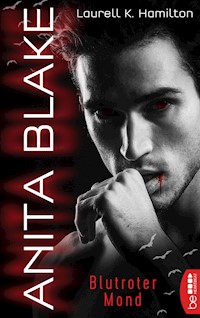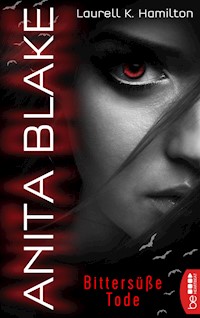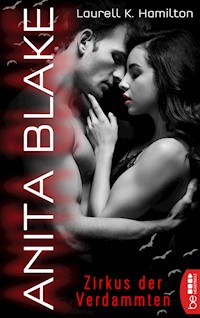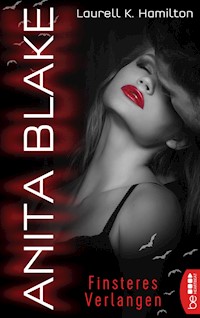
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
"Hamilton ist wieder da, mit der besten Blake seit Langem." Publishers Weekly
Ich brauche Urlaub. Es gibt zu viele Jobs und Männer in meinem Leben. Ich arbeite als Vampirhenkerin, Totenerweckerin und kläre Verbrechen auf. Und ich habe einen Vampir und einen Werleoparden als Liebhaber. Nun taucht auch noch eine hinreißende, unschuldig aussehende Gesandte des Vampirrats auf und stellt unverschämte Forderungen. Am besten hätte ich sie sofort kalt gemacht ...
Eine Gesandte des Europäischen Vampirrats kommt in die Stadt. Sie fordert im Namen der grausamen Meisterin Belle Morte den Vampir Asher ein. Für ihn bedeutet dies Schmerz und Folter - ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ein Fall für Anita Blake, die nichts von blindem Gehorsam hält.
Nächster Band: Anita Blake - Schwarze Träume.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Über diesen Band
Über die Autorin
Triggerwarnung
Titel
Impressum
Vorwort
Widmung
Danksagungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Im nächsten Band
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Ich brauche Urlaub. Es gibt zu viele Jobs und Männer in meinem Leben. Ich arbeite als Vampirhenkerin, Totenerweckerin und kläre Verbrechen auf. Und ich habe einen Vampir und einen Werleoparden als Liebhaber. Nun taucht auch noch eine hinreißende, unschuldig aussehende Gesandte des Vampirrats auf und stellt unverschämte Forderungen. Am besten hätte ich sie sofort kalt gemacht …
Eine Gesandte des Europäischen Vampirrats kommt in die Stadt. Sie fordert im Namen der grausamen Meisterin Belle Morte den Vampir Asher ein. Für ihn bedeutet dies Schmerz und Folter – ein Schicksal schlimmer als der Tod. Ein Fall für Anita Blake, die nichts von blindem Gehorsam hält.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Finsteres Verlangen
Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Cerulean Sins«
Originalverlag: The Berkley Publishing Group, a division of Penguin Putnam Inc., New York
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Finsteres Verlangen«
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG unter Verwendung von Motiven von © iStock/ BojanMirkovic; © Gettyimages/KatarzynaBialasiewicz
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
Die im Text zitierten Passagen sind folgender Ausgabe entnommen:
Christopher Marlowe: »Die tragische Historie vom Doktor Faustus«.
Deutsche Fassung, Nachwort und Anmerkungen von Adolf Seebaß, Reclam Verlag, Stuttgart 2008.
ISBN 978-3-7517-0249-2
be-ebooks.de
lesejury.de
Hallo Leute,
ich bin Anita Blake. Einige von Ihnen kennen mich schon. Wer meine Welt schon mal besucht hat, kann diesen Abschnitt überspringen. Manche sagen, dass ich clever bin. Es gibt Tage, an denen ich dem zustimmen kann. Ab und zu behauptet auch mal jemand, dass ich schön bin. Aber da bin ich anderer Meinung. Hübsch ja, wie das Mädchen von nebenan, sofern es eine Schusswaffe trägt und sich mit Monstern abgibt. Ich helfe nämlich der Polizei und dem FBI bei der Aufklärung übernatürlicher Verbrechen. Außerdem bin ich staatlich bestellter Vampirhenker. Und mein täglicher Job sind Totenerweckungen. Ich habe also ein ganz normales Berufsleben.
Aber jetzt zu dem Teil, der niemanden was angeht außer mir: mein Liebesleben. Im Augenblick bin ich mit Jean-Claude, dem Meistervampir von St. Louis, und mit Micah, dem König des örtlichen Werleopardenrudels zusammen – harmlos ausgedrückt.
Außerdem ist da noch mein Ex-Freund, ein Alphawerwolf namens Richard. Wenn wir uns mal sehen, streiten wir uns meistens. Die Liebe überwindet ja angeblich alles, aber das ist eine Lüge. Klinge ich verbittert? Entschuldigung.
Kürzlich habe ich erfahren, dass ich mehr Kräfte besitze, als man für ein paar simple Totenerweckungen braucht. Wofür die Kräfte gut sind und wie ich sie beherrschen kann, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber sie sind ganz praktisch, wenn ich es mit einem Gegner zu tun habe, bei dem eine Schusswaffe nichts nützt.
Wie zum Beispiel bei der hinreißenden, blonden, unschuldig aussehenden Blutsaugerin, die der Vampirrat nach St. Louis geschickt hat, damit sie Jean-Claude auf den Zahn fühlt. Am besten, ich hätte sie sofort kaltgemacht. Und auch gleich ihre Gebieterin in Europa, die sich immer wieder in meinen Verstand schleicht. Und den Serienkiller, der eine Blutspur durch die ganze Stadt gezogen und überall Leichenteile hinterlassen hat.
Insgesamt ein bisschen viel, selbst für mich.
Aber lehnen Sie sich zurück, schnallen Sie sich an und machen Sie mit mir eine Fahrt in meinem nagelneuen SUV. (Der vorige wurde von Werhyänen aufgefressen. Ja, wirklich.) Lassen Sie Hände, Arme und sonstige Körperteile unbedingt im Wagen. Man weiß nie, wer draußen auf einen Happen unterwegs ist.
Herzlich
Ihre
Anita Blake
Für J., der öfter ja als nein sagt,der mir nie das Gefühl gibt, ein Freak zu sein,
Danksagungen
Dank an Karen und Bear, die neue Plätze ausfindig gemacht haben, wo sich Leichen verstecken lassen; an Joanie und Melissa, die Trinity bespaßt haben, als ihre hart arbeitende Mami zu wenig Zeit hatte; an Trinity, die mir geholfen hat, das Buch fertig zu schreiben, indem sie allein gespielt hat – jedes neue Jahr ist schöner als das vorhergegangene; an Carniffex und Maerda, die mir beim Recherchieren geholfen haben und die ich hier längst hätte erwähnen sollen; an Darla, ohne die so vieles liegen geblieben wäre; an Sergeant Robert Cooney von der St. Louis City Police Mobile Reserve Unit, weil er mir in letzter Minute noch Fragen beantwortet hat – er hatte keine Zeit, das Manuskript zu lesen, sodass die Fehler ganz allein meine sind; und wie immer an meine Schreibgruppe: Tom Drennan, N. L. Drew, Rhett McPhearson, Deborah Millitello, Marella Sands, Sharon Shinn und Mark Sumner.
1
Es war Anfang September, da lief das Geschäft mit Totenerweckungen immer besonders gut. Der Halloween-Betrieb schien jedes Jahr früher anzufangen. Jeder Animator bei Animators Inc. war ausgebucht. Ich war keine Ausnahme. Mir wurden sogar mehr Aufträge angeboten, als ich selbst bei meiner Fähigkeit ohne Schlaf auszukommen verkraften konnte.
Mr Leo Harlan hätte dankbar sein sollen, den Termin bekommen zu haben. Er sah nicht dankbar aus. Eigentlich sah er nach gar nichts aus. Er war extrem durchschnittlich. Körpergröße: durchschnittlich, Haut: weder blass noch gebräunt, Haare: irgendwie dunkel, Augen: allerweltsbraun. Das Bemerkenswerteste an Mr Harlan war, dass er nichts Bemerkenswertes an sich hatte. Sogar sein Anzug war dunkel und konservativ geschnitten, ein Straßenanzug, der seit zwanzig Jahren als guter Stil galt und vermutlich auch in weiteren zwanzig Jahren noch als solcher gelten wird. Sein Hemd war weiß, die Krawatte ordentlich geknotet, seine mittelgroßen Hände gepflegt, aber nicht manikürt.
Seine Erscheinung verriet so wenig, dass das an sich schon interessant und unterschwellig beunruhigend war.
Ich trank einen Schluck Kaffee aus meinem Becher, auf dem stand: »Schieb mir Koffeinfreien unter und du bist tot.« Den hatte ich ins Büro mitgebracht, nachdem Bert, unser Boss, Koffeinfreien in die Kaffeemaschine geschüttet hatte, weil er glaubte, keiner würde es merken. Das halbe Büro dachte eine Woche lang, wir hätten das Pfeiffersche Drüsenfieber, bis wir Berts feigen Anschlag aufdeckten.
Der Kaffee, den unsere Sekretärin Mary für Mr Harlan gebracht hatte, stand am Rand meines Schreibtischs. Es war die Tasse mit unserem Firmenlogo. Nachdem er sie entgegengenommen hatte, hatte er einen winzigen Schluck getrunken. Er hatte ihn schwarz haben wollen, trank aber, als schmeckte der Kaffee nicht oder als wäre ihm egal, wie er schmeckt. Er hatte ihn nur aus Höflichkeit angenommen.
Ich trank meinen Kaffee mit viel Zucker und Sahne, um meinen nächtlichen Arbeitseinsatz zu kompensieren. Koffein und Zucker, die beiden grundlegenden Nahrungsgruppen.
Mr Harlans Stimme war wie er selbst, auffällig unauffällig. Er sprach völlig akzentfrei. »Ich möchte, dass Sie einen meiner Vorfahren erwecken, Ms Blake.«
»So hörte ich.«
»Sie scheinen daran zu zweifeln, Ms Blake.«
»Ich bin von Natur aus skeptisch.«
»Warum sollte ich herkommen und Sie belügen?«
Ich zuckte die Achseln. »Manche Leute tun das.«
»Ich versichere Ihnen, Ms Blake, ich sage die Wahrheit.«
Leider glaubte ich ihm das nicht. Vielleicht war ich paranoid, doch unter meiner adretten dunkelblauen Jacke hatte ich am linken Arm ein Sammelsurium von Narben, von dem kreuzförmigen Brandmal, das mir der Diener eines Vampirs beigebracht hatte, über etliche glatte Messernarben bis zu dem Liniengewirr, das von den Krallen einer Hexe stammte. Am rechten Arm hatte ich bloß eine Messernarbe, vergleichsweise nichts. Und es waren noch mehr unter dem dunkelblauen Rock und dem königsblauen Stricktop versteckt. Seide glitt gut über glatte Haut, störte sich aber auch nicht an rauem Narbengewebe. Das Recht, paranoid zu sein, hatte ich mir jedenfalls verdient.
»Welchen Vorfahren wollen Sie erweckt haben und warum?« Ich lächelte freundlich, aber nicht mit den Augen. Für ein echtes Strahlen musste ich mich neuerdings anstrengen.
Er lächelte ebenfalls, und seine Augen blieben davon so unberührt wie meine. Lächeln, weil man angelächelt wird, nicht weil es etwas bedeutet. Er griff nach seiner Tasse, und diesmal fiel mir in seiner linken Jacketthälfte ein Gewicht auf. Er trug kein Schulterholster – das hätte ich sofort bemerkt –, doch es war etwas Schwereres als eine Brieftasche. Da waren eine Menge Dinge vorstellbar, aber mein erster Gedanke war: Kanone. Ich habe gelernt, meinen ersten Gedanken zu vertrauen. Wenn wirklich Leute hinter einem her sind, ist Vorsicht keine Paranoia.
Meine Waffe steckte im Schulterholster unter meinem linken Arm. Das sorgte zwar für Chancengleichheit, aber ich wollte mein Büro nicht in den O. K. Corral verwandeln. Mr Harlan war bewaffnet. Vielleicht. Wahrscheinlich. Natürlich konnte es auch ein richtig schweres Zigarrenetui sein. Ich hätte allerdings fast alles darauf gewettet, dass es eine Schusswaffe war. Nun konnte ich entweder dasitzen und mir den Verdacht ausreden oder ich konnte mich verhalten, als hätte ich damit recht. Wenn ich mich irrte, könnte ich mich später entschuldigen; wenn ich recht hatte, würde ich am Leben bleiben. Lieber ungehobelt und am Leben, als höflich und tot.
Ich unterbrach den Vortrag über seinen Stammbaum. Ich hatte kaum etwas mitgekriegt. Ich war auf das Gewicht in seiner Innentasche fixiert. Nichts war mir wichtig, bis ich genau wusste, ob’s eine Schusswaffe war oder nicht. Ich setzte ein Lächeln auf und drängte es bis in meine Augen. »Was tun Sie eigentlich beruflich, Mr Harlan?«
Er holte eine Winzigkeit tiefer Luft und richtete sich in seinem Stuhl auf, aber beides war kaum zu bemerken. Es war die unauffälligste Anspannung, die ich je bei einem Mann gesehen hatte. Und seine erste wirklich menschliche Regung. Normalerweise rutschen die Klienten vor mir auf ihrem Stuhl herum. Harlan tat das nicht.
Die Leute haben nicht gern mit jemandem zu tun, der Tote aufweckt. Fragen Sie mich nicht warum, aber sie sind dann nervös. Harlan war nicht nervös, er war überhaupt nichts. Er saß mir bloß gegenüber, mit kalten, nichtssagenden Augen und freundlich leerem Gesichtsausdruck. Ich wäre jede Wette eingegangen, dass er über den Grund seines Kommens log und dass er eine Schusswaffe trug.
Leo Harlan wurde mir immer unsympathischer.
Noch lächelnd stellte ich meine Tasse behutsam auf meine Schreibunterlage. Ich hatte beide Hände frei, Schritt eins. Die Browning ziehen wäre Schritt zwei. Hoffentlich ließ er sich vermeiden.
»Ich möchte, dass Sie einen meiner Vorfahren erwecken, Ms Blake. Ich wüsste nicht, wie meine Arbeit dabei von Bedeutung sein könnte.«
»Tun Sie mir den Gefallen«, sagte ich noch lächelnd, doch es rutschte mir bereits aus den Augen wie schmelzendes Eis.
»Warum sollte ich?«
»Weil ich mich sonst weigere, Ihren Fall anzunehmen.«
»Mr Vaughn hat mein Geld bereits angenommen. In Ihrem Namen.«
Diesmal lächelte ich ehrlich erheitert. »Eigentlich ist Bert nur der Geschäftsführer von Animators Inc. Die meisten von uns sind Teilhaber der Firma, wie in einer Anwaltskanzlei. Bert kümmert sich um den Papierkram, aber er ist nicht mehr mein Boss.«
Harlans Gesicht wurde, sofern das möglich war, noch stiller, noch verschlossener. Es war, als blickte man auf ein schlechtes Gemälde, das handwerklich perfekt ist, aber kein Leben ausstrahlt. Die einzigen Menschen, von denen ich so etwas kannte, waren die gruseligen.
»Von Ihrer Statusänderung habe ich nichts gewusst, Ms Blake.« Seine Stimme klang jetzt einen Ton tiefer, blieb aber leer wie sein Gesicht.
Er ließ bei mir sämtliche Alarmglocken schrillen, und meine Schultern verspannten sich unter dem Drang, als Erste zu ziehen. Automatisch nahm ich die Hände vom Schreibtisch. Erst als er seine aus dem Schoß auf die Armlehnen hob, bemerkte ich, was ich getan hatte. Wir hatten beide die Hand näher an die Waffe gebracht.
Plötzlich hing die Anspannung wie ein nahendes Gewitter in der Luft. Es gab keinen Zweifel mehr. Ich sah in seine leeren Augen und auf das kleine Lächeln. Diesmal war es echt, kein Fake. Wir standen kurz davor, von allem, was ein Mensch dem anderen antun kann, das Unbestreitbarste zu tun. Wir waren bereit, einander zu töten. Ich beobachtete nicht seine Augen, sondern seinen Oberkörper und wartete auf die eine verräterische Bewegung. Und wir wussten es beide.
In diese lastende Spannung fiel seine Stimme wie ein Stein in einen tiefen Brunnen. Allein deswegen wollte ich schon ziehen. »Ich bin Auftragskiller, aber ich bin nicht ihretwegen hier, Anita Blake.«
Ich ließ seinen Oberkörper nicht aus den Augen, die Anspannung ging nicht zurück. »Warum sagen Sie es mir dann?« Meine Stimme war weicher als seine, beinahe sanft.
»Weil ich nicht nach St. Louis gekommen bin, um jemanden zu töten. Ich bin wirklich nur daran interessiert, meinen Vorfahren von den Toten erwecken zu lassen.«
»Warum?«, fragte ich und beobachtete meiner Anspannung gemäß weiter seinen Oberkörper.
»Selbst Berufskiller haben Hobbys, Ms Blake.« Sein Ton war sachlich, aber sein Körper blieb sehr, sehr still. Plötzlich begriff ich, dass er versuchte, mich nicht zu erschrecken.
Kurz sah ich ihm ins Gesicht. Es war nach wie vor nichtssagend, unnatürlich leer, trotzdem war da … eine Spur Belustigung.
»Was ist so komisch?«, fragte ich.
»Ich wusste nicht, dass man mit einem Besuch bei Ihnen das Schicksal herausfordert.«
»Inwiefern?« Ich wollte die Anspannung halten, aber sie entglitt mir. Er klang zu normal, zu spontan ehrlich, als dass ich weiter glauben konnte, er würde gleich die Waffe ziehen und mich erschießen. Es kam mir plötzlich albern vor, und dennoch … ein Blick in seine toten Augen, die doch nicht restlos heiter waren, und es erschien mir gar nicht mehr albern.
»Überall auf der Welt gibt es Leute, die mich liebend gern tot sehen würden, Ms Blake. Und einige haben dafür beträchtliche Summen und Mühen aufgewendet, aber bis heute kann keiner behaupten, dass es ihm auch nur beinahe gelungen wäre.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das war nicht beinahe.«
»Normalerweise würde ich Ihnen zustimmen, aber ich weiß einiges über Ihren Ruf. Darum trage ich meine Waffe nicht wie sonst. Sie haben sie bemerkt, als ich eben nach der Tasse gegriffen habe, stimmt’s?«
Ich nickte.
»Hätten wir ziehen müssen, wäre ihr Holster ein paar Sekunden schneller gewesen als mein Jacketttaschenmist, den ich da trage.«
»Warum tragen Sie ihn dann?«
»Einerseits wollte ich Sie nicht nervös machen, indem ich bewaffnet herkomme, andererseits gehe ich nirgendwohin unbewaffnet. Ich hielt diese Lösung für geschickt und dachte, Sie würden es nicht bemerken.«
»Hätte ich auch beinahe nicht.«
»Danke, aber das wissen wir beide besser.«
Da war ich mir nicht sicher, aber ich ließ das unkommentiert; wozu noch streiten, wenn man gerade gewinnt?
»Was wollen Sie wirklich von mir, Mr Harlan, falls das Ihr richtiger Name ist?«
Darüber schmunzelte er. »Wie gesagt, ich möchte meinen Vorfahren von den Toten erwecken lassen. Das ist nicht gelogen.« Er überlegte einen Moment lang. »Seltsam, ich habe hier noch gar nichts Unwahres gesagt.« Er wirkte erstaunt. »Es ist lange her, dass das mal der Fall war.«
»Mein Beileid«, sagte ich.
Er sah mich stirnrunzelnd an. »Wie bitte?«
»Es muss belastend sein, nie die Wahrheit sagen zu dürfen. Ich jedenfalls fände das ermüdend.«
Er lächelte, und wieder krümmte er nur geringfügig die Lippen. Es schien sein echtes Lächeln zu sein. »Ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht.« Er zuckte die Achseln. »Ich schätze, man gewöhnt sich dran.«
»Möglich. Welchen Vorfahren soll ich erwecken und warum?«
»Warum was?«
»Warum soll ich diesen speziellen Vorfahren erwecken?«
»Ist das wichtig?«, fragte er.
»Ja.«
»Warum?«
»Weil ich finde, dass man die Toten nur aus gutem Grund stören sollte.«
Wieder erschien dieses kleine Lächeln. »In dieser Stadt gibt es Animatoren, die das jede Nacht zu Unterhaltungszwecken machen.«
Ich nickte. »Dann gehen Sie zu einem von denen. Die machen so ziemlich alles, wenn das Honorar stimmt.«
»Können die auch eine Leiche aus dem Grab wecken, die schon zweihundert Jahre dort liegt?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das übersteigt ihr Können.«
»Ich habe gehört, dass ein Animator fast alles erwecken kann, sofern er zu einem Menschenopfer bereit ist.« Sein Ton war ruhig.
Erneut schüttelte ich den Kopf. »Glauben Sie nicht alles, was Sie hören, Mr Harlan. Einige Animatoren mögen das können. Aber natürlich wäre das Mord und darum illegal.«
»Gerüchte behaupten, dass Sie es schon getan haben.«
»Gerüchte können behaupten, was sie wollen, aber ich opfere keine Menschen.«
»Sie können also meinen Vorfahren nicht erwecken«, schloss er glatt.
»Das habe ich nicht gesagt.«
Seine Augen wurden größer. »Sie können ohne Menschenopfer eine zweihundert Jahre alte Leiche erwecken?«
Ich nickte.
»Auch das ist mir zu Ohren gekommen, aber ich habe es nicht geglaubt.«
»Sie glaubten also, dass ich Menschen opfere, aber nicht, dass ich aus eigener Kraft vor zweihundert Jahren verstorbene Leute erwecken kann?«
Er zuckte die Achseln. »Ich bin es gewohnt, andere Leute zu töten, habe aber noch nie gesehen, wie ein Toter erweckt wird.«
»Sie Glücklicher.«
Er lächelte, und das Eis seiner Augen taute ein bisschen an. »Sie werden es also für mich tun?«
»Wenn Sie mir einen guten Grund dafür nennen.«
»Sie lassen sich nicht leicht ablenken, Ms Blake.«
»Ich bin die Hartnäckigkeit in Person«, meinte ich lächelnd. Vielleicht hatte ich zu viel Zeit mit wirklich üblen Leuten verbracht, aber seit ich wusste, dass Leo Harlan nicht da war, um mich oder sonst wen in der Stadt umzubringen, hatte ich kein Problem mehr mit ihm. Wieso glaubte ich ihm? Aus demselben Grund, wie ich ihm vorher nicht geglaubt hatte: aus Instinkt.
»Ich habe die Existenz meiner Familie in diesem Land so weit wie möglich zurückverfolgt, doch besagter Vorfahre ist in keinem Geburtsregister verzeichnet. Ich nehme an, dass er unter falschem Namen gelebt hat. Erst wenn ich seinen wirklichen Namen ermittelt habe, kann ich meine Vorfahren in Europa finden. Und das ist mein dringender Wunsch.«
»Ich soll ihn erwecken, nach seinem wirklichen Namen und dem Einwanderungsgrund fragen und ihn wieder zurückbetten?«
Harlan nickte. »Ganz genau.«
»Das klingt vernünftig.«
»Also werden Sie es tun?«
»Ja, aber es wird nicht billig. Ich bin wahrscheinlich der einzige Animator hier, der solch einen Auftrag ohne Menschenopfer durchführen kann. Angebot und Nachfrage, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Auf meine Weise bin ich genauso Spezialist wie Sie, Ms Blake.« Er versuchte, ein bescheidenes Gesicht zu machen, und versagte. Er wirkte selbstzufrieden, bis hinauf in die sonst so nichtssagenden, beängstigenden Augen. »Ich kann bezahlen, Ms Blake, keine Sorge.«
Ich nannte eine ungeheure Zahl. Er zuckte nicht mit der Wimper. Stattdessen griff er ins Jackett. »Nicht«, sagte ich.
»Nur meine Kreditkarte, Ms Blake.« Er zog die Hand zurück und spreizte die Finger, damit ich sah, dass er nichts dahinter verbarg.
»Sie können den Papierkram und die Bezahlung bei unserer Sekretärin erledigen. Ich muss gleich zu einem Termin.«
Fast lächelte er. »Selbstverständlich.« Er stand auf. Ich stand auf. Keiner von uns streckte die Hand aus. An der Tür zögerte er. Ich blieb ebenfalls stehen, aber ein gutes Stück von ihm entfernt. Man sollte sich immer Raum zum Manövrieren lassen.
»Wann können Sie es machen?«
»Diese Woche bin ich ausgebucht. Vielleicht kann ich Sie nächsten Mittwoch einschieben. Oder nächsten Donnerstag.«
»Was ist Montag und Dienstag?«, fragte er.
Ich zuckte die Achseln. »Schon belegt.«
»Sie sagten wörtlich: ›Diese Woche bin ich ausgebucht.‹ Dann sprachen Sie von nächstem Mittwoch.«
Früher konnte ich schon nicht gut lügen, und auch heute war ich nicht wesentlich besser darin, wenn auch aus anderen Gründen. Ich merkte, wie mein Blick leer wurde. »Ich wollte eigentlich sagen, dass ich in den nächsten beiden Wochen so gut wie ausgebucht bin.«
Er blickte mich so durchdringend an, dass ich am liebsten ausweichen wollte, aber ich hielt stand und bedachte ihn mit einem nichtssagenden, unbestimmt freundlichen Blick.
»Nächsten Dienstag ist Vollmond«, sagte er ruhig.
Ich sah ihn mit großen Augen an und hatte Mühe, meine Überraschung zu verbergen. Mein Gesicht blieb unbewegt, aber meine Körpersprache verriet mich. Die meisten Leute achten lediglich aufs Gesicht; Harlan gehörte zu den Übrigen. Mist.
»Es ist also Vollmond, wie schön. Na und?« Ich klang so nüchtern, wie ich eben konnte.
Er ließ dieses kleine Lächeln sehen. »Bescheidenheit wirkt bei Ihnen unglaubwürdig, Ms Blake.«
»Richtig, und da ich nicht bescheiden bin, ist das kein Problem.«
»Ms Blake, bitte«, erwiderte er schmeichelnd, »beleidigen sie nicht meine Intelligenz.«
Aber es ist so leicht, wollte ich sagen, tat es jedoch nicht. Erstens war das nicht wahr, zweitens machte es mich ein bisschen nervös, welche Richtung das Gespräch nahm. Aber ich hatte nicht vor, freiwillig etwas preiszugeben. Je weniger man sagt, desto mehr ärgert es die Leute.
»Ich habe Ihre Intelligenz nicht beleidigt.«
Sein Stirnrunzeln erschien mir so echt wie das kleine Lächeln. Der wahre Harlan lugte hervor. »Den Gerüchten nach arbeiten Sie seit ein paar Monaten in der Vollmondnacht nicht mehr.« Er wirkte mit einem Mal sehr ernst, nicht auf bedrohliche Weise, sondern als wäre ich unhöflich gewesen oder hätte meine Tischmanieren vergessen und er hätte mich zurechtweisen müssen.
»Vielleicht bin ich eine Wicca. Der Tag des Vollmonds ist für sie heilig, wissen Sie.«
»Sind Sie eine Wicca, Ms Blake?«
Es dauerte nie lange, bis ich solches Drumherumgerede leid wurde. »Nein, Mr Harlan, bin ich nicht.«
»Warum arbeiten Sie dann nicht in der Vollmondnacht?« Er musterte mein Gesicht, forschte darin, als wäre die Antwort überaus wichtig.
Mir war klar, was er von mir hören wollte. Ich sollte zugeben, ein Gestaltwandler zu sein. Leider konnte ich das nicht zugeben, weil ich keiner war. Ich war die erste menschliche Nimir-Ra der Geschichte, die Königin eines Werleopardenrudels. Ich hatte das Rudel geerbt, nachdem ich den vorigen Anführer hatte töten müssen, weil er sonst mich getötet hätte. Außerdem war ich Bölverkr des örtlichen Werwolfrudels. Der Bölverkr war mehr als ein Leibwächter und weniger als ein Henker, im Grunde jemand, der alles tat, was der Ulfric nicht tun durfte oder wollte. Der Ulfric war Richard Zeeman. Ein paar Jahre lang war er abwechselnd mein Liebster und mein Ex gewesen. Im Augenblick war er mein Ex. Mehr denn je. Sein Trennungssatz war gewesen: Ich will keine lieben, die sich bei den Monstern wohler fühlt als ich. Was soll man darauf erwidern? Was könnte man sagen? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Es heißt bekanntlich, die Liebe überwindet alles. Aber das ist gelogen.
Als Nimir-Ra und Bölverkr trug ich große Verantwortung; viele Leute waren von mir abhängig. Darum nahm ich den Vollmondabend frei. Es war wirklich einfach und nichts, das ich mit Leo Harlan besprechen wollte.
»Manchmal nehme ich mir einen freien Tag, Mr Harlan. Wenn meine freien Tage mit dem Vollmond zusammenfallen, so ist das Zufall, das versichere ich Ihnen.«
»Den Gerüchten nach wurden Sie vor einigen Monaten von einem Gestaltwandler verwundet und sind jetzt selbst einer.« Er sagte das nach wie vor gleichmütig, aber ich hatte es erwartet. Mein Gesicht, meine Körpersprache, alles blieb ruhig, weil er im Irrtum war.
»Ich bin kein Gestaltwandler, Mr Harlan.«
Seine Augen wurden schmal. »Ich glaube Ihnen nicht, Ms Blake.«
Ich seufzte. »Das ist mir ziemlich egal, Mr Harlan. Ob ich ein Lykanthrop bin oder nicht, hat für meine beruflichen Fertigkeiten keinerlei Bedeutung.«
»Den Gerüchten nach sind Sie die Beste, doch Sie sagen mir ständig, die Gerüchte seien falsch. Sind Sie wirklich so gut, wie behauptet wird?«
»Besser.«
»Es heißt, Sie hätten schon ganze Friedhöfe erweckt.«
»Ihretwegen werde ich noch eingebildet.«
»Heißt das, es ist wahr?«
»Spielt das wirklich eine Rolle? Ich sage es noch einmal: Ich kann Ihren Vorfahren erwecken, Mr Harlan. Ich bin einer der wenigen, wenn nicht der einzige Animator im Land, der das ohne Menschenopfer tun kann.« Ich schenkte ihm mein professionelles Lächeln, das so strahlend und bedeutungslos ist wie eine Glühbirne. »Wäre Ihnen der nächste Mittwoch oder Donnerstag recht?«
Er nickte. »Ich gebe Ihnen meine Handynummer, damit Sie mich jederzeit erreichen können.«
»Haben Sie es damit eilig?«
»Sagen wir so: Man weiß nie, wann ein Angebot hereinkommt, dem man nicht widerstehen kann.«
»Ihnen geht es nicht nur um Geld«, schloss ich.
Das echte Lächeln kam zum Vorschein. »So ist es, Ms Blake. Ich habe genug Geld, aber eine Aufgabe, die neue Herausforderungen bietet … die suche ich ständig.«
»Überlegen Sie gut, was Sie sich wünschen, Mr Harlan. Es gibt immer jemanden, der größer und gemeiner ist als man selbst.«
»Das habe ich noch nicht festgestellt.«
Ich musste schmunzeln. »Dann sind Sie entweder furchterregender, als Sie scheinen, oder Sie sind noch nicht den richtigen Leuten begegnet.«
Einen Moment lang sah er mich an, bis mir das Lächeln aus den Augen rutschte und ich ihn genauso leer anblickte wie er mich. Zugleich strömte Ruhe in mich. Dieselbe friedvolle Ruhe, mit der ich tötete, ein weißes Rauschen, bei dem nichts wehtat, nichts fühlbar war. Während ich in Harlans leere Augen sah, fragte ich mich, ob auch sein Kopf weiß und leer war und rauschte. Fast hätte ich ihn danach gefragt, aber ich verkniff es mir, weil ich dachte, er habe bei allem gelogen und werde gleich die Waffe ziehen. Das würde erklären, warum er wissen wollte, ob ich ein Lykanthrop war. Ein, zwei Augenblicke lang dachte ich, ich würde ihn töten müssen. Das erschreckte mich nicht und machte mich auch nicht nervös; ich richtete mich lediglich darauf ein. Ob er leben oder sterben würde, war seine Entscheidung. Das war eine dieser langsamen Sekunden, wo Entscheidungen gefällt und Leben beendet werden.
Dann schüttelte er sich, wie ein Vogel sein Gefieder. »Eigentlich hatte ich selbst zu bedenken geben wollen, dass ich in der Tat sehr furchteinflößend bin, aber das schenke ich mir. Es wäre albern, weiter mit Ihnen zu spielen, als würde ich eine Klapperschlange mit dem Stock reizen.«
Ich sah ihn unverwandt und mit derselben tödlichen Ruhe an. Mein Ton war genauso ruhig und bedächtig. »Ich hoffe, Sie haben mich nicht angelogen, Mr Harlan.«
»Das hoffe ich ebenfalls, Ms Blake«, erwiderte er mit beunruhigendem Lächeln. Nach dieser doppeldeutigen Antwort öffnete er behutsam die Tür, ohne den Blick abzuwenden, dann drehte er sich um und ging schnell hinaus. Die Tür schloss sich, und ich stand da mit meinem aufgestauten Adrenalin, das nur ganz langsam abfloss.
Es war nicht Angst, was mich lähmte, sondern das Adrenalin. Ich verdiente mein Geld als Totenerwecker und staatlich bestellter Vampirhenker. War das nicht ungewöhnlich genug? Musste ich auch noch furchterregende Klienten bekommen?
Ich hätte Harlan sagen sollen, dass er Unmögliches verlangte, doch ich hatte ihm die Wahrheit gesagt. Ich konnte tatsächlich so alte Tote wecken, und kein anderer im Land war dazu imstande, jedenfalls nicht ohne Menschenopfer. Aber wenn ich abgelehnt hätte, da war ich mir ziemlich sicher, wäre Harlan zu jemand anderem gegangen. Zu jemandem, der weder meine Fähigkeiten noch meine moralischen Skrupel hatte. Manchmal lässt man sich tatsächlich mit dem Teufel ein; nicht weil man es will, sondern weil es sonst ein anderer tut.
2
Der Lindel-Friedhof war einer dieser modernen, wo die Grabsteine flach liegen und Bepflanzung nicht gestattet ist. Das erleichtert das Rasenmähen, schafft aber auch eine deprimierende Leere. Nichts als flaches Gelände mit Rechtecken in der Dunkelheit, so leer und kalt wie die dunkle Seite des Mondes und genauso fröhlich. Ich mag lieber Friedhöfe mit aufrechten Grabsteinen und Gruften, mit Engeln, die über Kinderbildern weinen, und mit Heiligen Jungfrauen, die die Augen zum Himmel erheben und für uns alle beten. Ein Friedhof sollte den Menschen in Erinnerung rufen, dass es einen Himmel gibt und nicht bloß ein Loch in der Erde mit einem Stein darüber.
Ich war dort, um Gordon Bennington von den Toten zu erwecken, weil die Versicherungsgesellschaft Fidelis hoffte, er sei nicht verunglückt, sondern habe sich umgebracht. Mehrere Millionen Dollar standen auf dem Spiel. Die Polizei hatte den Tod als Unfall deklariert, aber Fidelis gab sich damit nicht zufrieden. Sie zahlten lieber mein beträchtliches Honorar, in der Hoffnung, Millionen zu sparen. Ich war teuer, aber nicht so teuer. Verglichen damit, was sie der Witwe zu zahlen hätten, war ich ein Schnäppchen.
Auf dem Friedhof standen drei Gruppen von Fahrzeugen. Zwei davon mindestens fünfzehn Meter weit auseinander, weil Mrs Bennington und Arthur Conroy, der Chefanwalt von Fidelis, jeweils ein Kontaktverbot erwirkt hatten. Die dritte Gruppe parkte zwischen den beiden: ein Streifenwagen und ein Zivilfahrzeug der Polizei. Fragen Sie mich nicht, wieso ich wusste, dass dieser ungekennzeichnete Wagen der Polizei gehörte. Er sah einfach so aus.
Ich parkte ein wenig abseits von den anderen. Ich fuhr einen nagelneuen Jeep Grand Cherokee, den ich zum Teil mit dem Geld finanziert hatte, das ich für meinen dahingeschiedenen Country Squire bekommen hatte. Die Versicherung hatte nicht zahlen wollen. Sie glaubte nicht, dass der Country Squire von Werhyänen gefressen worden war. Sie schickte ein paar Leute raus, die die Schäden fotografierten und sich die Blutflecken ansahen. Dann zahlten sie doch, kündigten mir aber. Jetzt zahle ich monatlich an eine andere Versicherung, die mir Vollkasko gewährt, sofern es mir gelingt, meinen neuen Wagen ganze zwei Jahre lang heil zu lassen. Die Chancen sind enorm.
Meine Sympathie gehörte der Familie Gordon Benningtons. Klar, es ist schwer, mit einer Versicherungsgesellschaft zu sympathisieren, die sich davor drücken will, eine Witwe mit drei Kindern auszuzahlen.
Die Wagen, die mir am nächsten standen, gehörten den Fidelis-Mitarbeitern, wie sich herausstellte. Arthur Conroy kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Er rangierte am oberen Ende von »klein«, hatte schütteres, blondes Haar, das er über seinen kahlen Fleck kämmte, als ließe der sich dadurch verbergen, und trug eine silberne Brille vor seinen großen grauen Augen. Wären seine Wimpern und Brauen dunkler gewesen, hätte man die Augenpartie als bemerkenswert bezeichnen können. Doch die Augen waren so groß und nackt, dass sie etwas Froschartiges hatten. Aber vielleicht stimmte mich die jüngste Meinungsverschiedenheit mit meiner Versicherung auch ungnädig. Vielleicht.
Conroy kam mit einer Wand aus Bodyguards im Rücken. Ich schüttelte ihm die Hand und spähte an ihm vorbei auf die beiden dunkel gekleideten Zwei-Meter-Kerle.
»Leibwächter?«
Conroy riss die Augen auf. »Woher wissen Sie das?«
»Sie sehen so aus, Mr Conroy.«
Ich gab den zwei anderen Fidelis-Mitarbeitern die Hand, den Leibwächtern nicht. Die schütteln meistens keine Hand, selbst wenn man sie ihnen hinstreckt. Ob sie ihr hartes Image nicht ruinieren oder nur die Waffenhand freihaben wollen, weiß ich nicht. Jedenfalls bot ich keine an und sie ebenfalls nicht.
Der Dunkelhaarige von den beiden, der fast so breit wie hoch war, lächelte mich immerhin an. »Sie sind also Anita Blake.«
»Und Sie sind?«
»Rex, Rex Canducci.«
Ich zog die Brauen hoch. »Heißen Sie wirklich Rex mit Vornamen?«
Er platzte mit diesem überraschten, lauten Lachen heraus, das so männlich war und meistens auf Kosten einer Frau ging. »Nein.«
Ich verzichtete auf die Frage, wie er in Wirklichkeit hieß; vermutlich war es etwas Peinliches wie Florence oder Rosie. Der andere Leibwächter war blond und still. Er beobachtete mich aus kleinen, hellen Augen. Er war mir unsympathisch.
»Und Sie sind?«, fragte ich.
Er sah mich groß an, als überraschte ihn meine Frage. Die meisten Leute ignorieren Leibwächter, die einen aus Angst oder weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, die anderen, weil sie an solche Männer gewöhnt sind und denken, sie seien wie Möbelstücke, die man erst beachtet, wenn man sie braucht.
Er zögerte, dann sagte er: »Balfour.«
Ich wartete eine Sekunde, aber er fügte nichts hinzu. »Nur Balfour, so wie Madonna oder Cher?«, fragte ich möglichst zurückhaltend.
Er kniff die Augen zusammen, seine Schultern spannten sich an. Er war leicht zu erschüttern. Er hatte den einschüchternden Blick und eine bedrohliche Ausstrahlung, war aber nicht mehr als ein Schläger. Er wusste, welche Wirkung er auf Leute hatte, aber viel mehr auch nicht.
Rex schaltete sich ein. »Ich habe Sie mir größer vorgestellt.« Er sagte es lustig mit seiner Erfreut-Sie-zu-sehen-Stimme.
Balfours Schultern entspannten sich wieder. Die beiden arbeiteten nicht zum ersten Mal zusammen; Rex wusste, dass sein Partner nicht der bruchsicherste Keks in der Dose war.
Ich sah ihm in die Augen. Wenn die Lage kompliziert würde, wäre Balfour ein Problem, er würde überreagieren. Rex nicht.
Plötzlich hörten wir laute Stimmen, darunter eine weibliche. Mist. Ich hatte Mrs Benningtons Anwälten gesagt, sie sollten sie zu Hause lassen. Sie hatten entweder meinen Rat in den Wind geschlagen oder ihrem gewinnenden Charme nicht widerstanden.
Der nette Polizist in Zivil redete beruhigend auf sie ein, wenn auch mit einer gewissen Lautstärke, um sie fünfzehn Meter von Conroy entfernt zu halten. Vor einigen Wochen hatte sie den Anwalt geohrfeigt, worauf er ihr mit der flachen Hand auf beide Wangen schlug. Sie reagierte mit einem Kinnhaken, bei dem er auf dem Hintern landete, und schließlich griffen die Gerichtsdiener ein und zogen die beiden auseinander.
Ich war bei den Lustbarkeiten zugegen gewesen, weil ich quasi zur außergerichtlichen Einigung gehörte. Heute Nacht sollte der Fall entschieden werden. Wenn Gordon Bennington aus dem Grab aufstand und aussagte, dass er durch einen Unfall ums Leben gekommen war, würde Fidelis zahlen müssen. Wenn er einen Selbstmord zugab, würde Mrs Bennington leer ausgehen. Ich sprach sie mit Mrs an, weil sie darauf bestand. Bei meinem ersten Ms hätte sie mir fast den Kopf abgerissen. Sie war keine emanzipierte Frau, sondern mochte es, Ehefrau und Mutter zu sein. Das freute mich für sie und gleichzeitig für uns, die wir mehr Freiheit genießen.
Seufzend ging ich den hellen Kiesweg entlang auf die lauter werdenden Stimmen zu. Als ich an dem Streifenpolizisten vorbeikam, nickte ich ihm zu. »Hallo.«
Er nickte zurück, behielt aber die Versicherungsleute im Blick, als hätte er Befehl, sie nicht hinüberlaufen zu lassen. Oder er mochte einfach die körperlichen Ausmaße von Rex und Balfour nicht. Beide waren hundert Pfund schwerer als er. Für einen Polizisten war er schlank und hatte diesen unerfahrenen Gesichtsausdruck, als wäre er noch nicht lange im Dienst und unschlüssig, ob er überhaupt Polizist sein wollte.
Mrs Bennington schrie den netten Zivilpolizisten an, der ihr den Weg verstellte. »Diese Arschlöcher haben sie engagiert, und sie wird tun, was die von ihr verlangen. Sie wird Gordon dazu bringen, dass er lügt, das weiß ich genau!«
Ich seufzte. Ich hatte allen Beteiligten erklärt, dass Tote nicht lügen. Im Grunde glaubten mir nur der Richter und die Polizisten. Fidelis glaubte, mit dem Honorar hätten sie das Ergebnis gekauft, und Mrs Bennington war derselben Meinung.
Schließlich entdeckte sie mich, als sie über die breiten Polizistenschultern hinwegsah. Mit ihren hohen Absätzen war sie größer als er. Er war höchstens eins fünfundsiebzig.
Sie versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen, während sie mich anschrie. Er verstellte er ihr bei jeder Bewegung den Weg, ohne sie anzufassen. Sie prallte gegen seine Schulter und starrte ihn wütend an. Immerhin hörte sie dadurch auf zu brüllen.
»Lassen Sie mich vorbei«, verlangte sie.
»Mrs Bennington«, begann er mit tiefer Stimme, »Ms Blake ist auf Anordnung des Gerichts hier. Sie müssen sie ihre Arbeit tun lassen.« Er hatte kurze graue Haare, die oben auf dem Kopf ein bisschen länger waren. Das war vermutlich kein Modebekenntnis, er hatte es nur länger nicht mehr zum Friseur geschafft.
Mrs Bennington war jedoch entschlossen, mir die Meinung zu sagen, und wollte nun an der anderen Seite an ihm vorbei, und diesmal fasste sie ihn an. Er war nicht groß, aber breit, ein rechteckiges Muskelpaket. Sie merkte ziemlich schnell, dass sie ihn nicht wegschubsen konnte, und versuchte es schließlich mit einem Ausweichschritt.
Er musste sie am Arm festhalten. Als sie daraufhin mit der freien Hand nach ihm ausholte, hörte man seine tiefe Stimme klar durch die stille Oktobernacht: »Wenn Sie mich schlagen, werde ich Ihnen Handschellen anlegen und Sie in den Streifenwagen setzen, bis wir hier fertig sind.«
Sie zögerte mit erhobener Hand, sah ihm aber offenbar an, dass er es ernst meinte.
Eigentlich hätte schon sein Ton genügen müssen.
Schließlich ließ sie den Arm sinken. »Ich lasse Sie suspendieren, wenn Sie mich anfassen.«
»Einen Polizisten zu schlagen wird als Verbrechen geahndet, Mrs Bennington«, erwiderte er.
Im Mondschein sah ich das Erstaunen in ihrem Gesicht; sie schien vorher nicht begriffen zu haben, dass auch für sie Gesetze galten. Das nahm ihr jetzt den Wind aus den Segeln. Sie ging auf Abstand und ließ sich von ihren Anwälten ein Stück wegführen.
Ich war als Einzige nah genug und hörte ihn sagen: »Wenn das meine Frau wäre, hätte ich mich auch erschossen.«
Ich musste unwillkürlich lachen.
Ärgerlich drehte er sich um, doch was er in meinem Gesicht sah, brachte ihn zum Grinsen.
»Dann betrachten Sie sich als Glückspilz«, sagte ich. »Ich hab Mrs Bennington schon ein paar Mal erlebt.« Ich streckte die Hand aus.
Er hatte einen kräftigen, ernst gemeinten Händedruck. »Lieutenant Nicols, und mein Beileid zu der Bekanntschaft mit dieser …« Er stockte.
»Übergeschnappten Zicke. Das ist wohl der Ausdruck, nach dem Sie suchen.«
Er nickte. »Das ist er. Ich habe Verständnis dafür, wenn eine Witwe mit drei Kindern das Geld haben will, das ihr zusteht«, sagte er, »aber sie macht es einem schwer, auf ihrer Seite zu sein.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen.«
Er lachte und holte ein Päckchen Zigaretten aus der Jackentasche. »Was dagegen?«
»Nicht hier draußen. Außerdem haben Sie eine verdient, nachdem sie mit unserer wunderbaren Mrs Bennington fertig geworden sind.«
Er klopfte die Zigarette mit der gekonnten Geste des langjährigen Rauchers aus der Packung. »Wenn Gordon Bennington aussagt, dass er sich umgebracht hat, wird sie ausrasten, Ms Blake. Ich darf sie nicht niederschießen, aber was ich stattdessen tun werde, weiß ich nicht.«
»Vielleicht können ihre Anwälte sie festhalten. Ich denke, dafür reichen sie gerade.«
Er steckte sich die Zigarette beim Reden zwischen die Lippen. »Die waren bisher sch … ziemlich nutzlos. Hatten Schiss, ihr Honorar zu verlieren.«
»Scheiß nutzlos, Lieutenant. Scheiß nutzlos ist der Ausdruck, nach dem Sie suchen.«
Er lachte wieder, sodass er die Zigarette zwischen die Finger nehmen musste. »Scheiß nutzlos, ja, genau.« Die Zigarette wurde erneut zwischen die Lippen geklemmt. Er nahm eines dieser großen Feuerzeuge aus der Hosentasche, die man nicht mehr allzu häufig sieht, und hielt automatisch, obwohl kein Wind wehte, die hohle Hand darum. Die Flamme schoss orangerot heraus. Als das Zigarettenende aufglühte, ließ er den Deckel des Feuerzeugs zuschnappen und steckte es wieder ein, dann nahm er die Zigarette aus dem Mund und blies eine lange Rauchfahne aus.
Unwillkürlich wich ich einen Schritt zur Seite, um ihr zu entgehen, aber wir standen im Freien, und Mrs Bennington konnte einen schon zum Rauchen treiben. Wenn nicht zu Schlimmerem.
»Können Sie Verstärkung anfordern?«
»Die dürften auch nicht auf sie schießen«, sagte Nicols.
Ich schmunzelte. »Nein, aber vielleicht einen Kordon bilden, damit sie niemanden verletzen kann.«
»Wahrscheinlich könnte ich ein oder zwei Kollegen bekommen, aber mehr nicht. Sie hat Verbindungen zu den höchsten Stellen, weil sie Geld hat und am Ende dieses Abends vielleicht noch mehr haben wird. Aber sie war auch scheiß unangenehm.« Das sagte er so genüsslich, wie er an der Zigarette zog. Als wäre es ihm schwergefallen, vor der trauernden Witwe seine Zunge zu hüten.
»Weil ihr gesellschaftlicher Einfluss ein bisschen getrübt wurde?«, fragte ich.
»Die Zeitungen haben es dick und fett auf der Titelseite gebracht, wie sie Conroy umgehauen hat. Die da oben sind in Sorge, dass sich die tragische Angelegenheit in Scheiße verwandelt, und wollen keine Spritzer davon abbekommen.«
»Sie distanzieren sich also für den Fall, dass Mrs Bennington etwas noch Ungeschickteres tut«, folgerte ich.
Er zog ausgiebig an der Zigarette, hielt sie fast wie einen Joint, dann ließ er den Rauch aus Mund und Nase kriechen, während er antwortete. »Distanzieren, so kann man es auch nennen.«
»Sie gehen in Deckung, verlassen das sinkende Schiff …«
Er lachte, und weil er den Rauch noch nicht ganz ausgeblasen hatte, musste er ein bisschen husten, was ihn aber nicht zu stören schien. »Ich weiß nicht, ob Sie wirklich so witzig sind oder ob ich so dringend was zu Lachen brauche.«
»Das ist der Stress«, meinte ich. »Die meisten Leute finden mich überhaupt nicht witzig.«
Er schoss mir einen Seitenblick zu. Er hatte verblüffend helle Augen; ich tippte auf Blau bei Tageslicht. »Hab’s gehört. Angeblich sind Sie eine Nervensäge und gehen vielen Leuten gegen den Strich.«
Ich zuckte die Achseln. »Eine Frau tut was sie kann.«
Er schmunzelte. »Dieselben Leute, die Sie als Nervensäge bezeichnen, haben kein Problem damit, bei einem Fall mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Tatsache ist, Ms Blake«, er warf die Zigarette auf den Boden, »dass die meisten lieber Sie als Verstärkung mitnehmen als manchen Kollegen.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Unter Polizisten gibt es kein dickeres Lob.
»Da werde ich glatt rot, Lieutenant Nicols.« Dabei sah ich ihn nicht an.
Er blickte auf die qualmende Kippe auf dem weißen Kies. »Zerbrowski drüben beim RPIT meint, dass Sie nicht oft rot werden.«
»Zerbrowski ist ein quietschfröhlicher Lustmolch«, sagte ich.
Er lachte brummend und trat die Kippe aus. »Das ist wahr. Haben Sie mal seine Frau kennengelernt?«
»Ich kenne Katie.«
»Und sich gefragt, wie er die ergattern konnte?«
»Jedes Mal, wenn ich sie sehe.«
Er seufzte. »Ich werde einen zweiten Streifenwagen anfordern. Bringen wir die Sache hinter uns, damit wir von diesen Leuten wegkommen.«
»Ja, fangen wir an.«
Er erledigte den Anruf. Ich ging meine Zombie-Weck-Ausrüstung holen. Da mein Hauptwerkzeug eine Machete ist, mit einer Klinge so breit wie mein Arm, hatte ich die Tasche erst mal im Wagen gelassen. Die Leute erschrecken sonst. Ich wollte auf keinen Fall die Leibwächter erschrecken, und auch nicht die netten Polizisten. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass ich nichts tun konnte, um Mrs Bennington zu erschrecken. Und genauso wenig würde ich ihre Meinung über mich ändern können.
3
Meine Zombie-Weck-Ausrüstung steckte in meiner grauen Sporttasche. Manche Animatoren haben ausgeklügelte Transportkästen. Einer hatte sogar mal einen Koffer, der sich in einen Tisch verwandeln ließ, wie ein Bühnenmagier oder Straßenhändler. Ich sorgte lediglich dafür, dass alles gut verpackt war und nichts zerbrach oder zerkratzte; darüber hinaus sah ich keine Notwendigkeit für irgendwelchen Schnickschnack. Wenn die Leute eine Show wollten, sollten sie zum Zirkus der Verdammten gehen. Da konnten sie Zombies aus dem Grab kriechen sehen, und Schauspieler, die Angst und Schrecken mimten. Ich war kein Entertainer, sondern Animator, und was ich tat, war Arbeit, keine Unterhaltung.
Jedes Jahr musste ich Aufträge für Halloween-Partys ablehnen, wo die Gastgeber Schlag zwölf Tote erweckt haben wollten und solchen Unsinn. Je furchterregender mein Ruf wurde, desto mehr Leute wollten von mir erschreckt werden. Ich hatte Bert gesagt, ich könne gern ein paar Partygäste bedrohen und erschießen, das wäre mal etwas Erschreckendes. Er hatte das gar nicht komisch gefunden, verlangte seitdem aber nicht mehr von mir, Partyaufträge anzunehmen.
Früher hatte ich mir immer eine Salbe auf Gesicht, Hände und Herz gestrichen, und ihr Rosmarinduft war für mich sehr nostalgisch, doch ich benutzte sie nicht mehr. In Notfallsituationen hatte ich schon ohne sie Tote aufgeweckt, mehr als einmal sogar, und das hatte mir zu Denken gegeben. Angeblich bewirkte die Salbe, dass die Magie leichter eindringen und durch den Animator den Toten wecken kann. Die meisten Kollegen, zumindest in Amerika, glaubten, der Geruch und der Kontakt der Salbe stärke die übersinnlichen Fähigkeiten oder würde sie überhaupt erst erschließen, damit sie wirken können. Ich hatte jedoch bei Erweckungen nie Schwierigkeiten zu überwinden. Meine übersinnlichen Fähigkeiten waren immer bereit. So nahm ich die Salbe für alle Fälle mit, aber ich benutzte sie kaum noch.
Drei Dinge allerdings brauchte ich nach wie vor: Stahl, frisches Blut und Salz. Das Salz, um den Zombie nachher wieder zur Ruhe zu betten. Ich hatte meine Utensilien auf das Notwendigste reduziert und neulich noch einmal beschnitten.
Apropos beschnitten. Meine linke Hand war voller Pflaster. Ich benutzte die transparenten, damit ich nicht aussah wie die Mumie. Am linken Unterarm hatte ich diverse Pflaster mit Mullkompressen. Alle Wunden hatte ich mir selbst beigebracht, und allmählich war ich das leid.
Ich hatte von Marianne gelernt, meine wachsenden übersinnlichen Kräfte zu beherrschen. Zu Beginn unserer Freundschaft war sie Hellseherin gewesen, inzwischen war sie eine Hexe. Genauer gesagt, eine Wicca. Nicht alle Hexen sind Wicca, und wäre Marianne eine andere Art Hexe, müsste ich mich nicht ständig aufschneiden. Als meine Lehrerin teilte sie meine karmische Schuld, jedenfalls glaubte das ihre Gruppe – ihr Hexenzirkel. Als die hörten, dass ich bei jeder Totenerweckung ein Tier tötete, das heißt, drei-, viermal pro Nacht und das täglich, waren sie förmlich ausgerastet. Blutmagie ist für Wicca schwarze Magie. Ein Leben für magische Zwecke zu nehmen, egal was für eins, selbst das eines Hühnchens, ist schwärzeste Magie.
Wie sich Marianne an jemanden habe binden können, der so böse ist?, wollten sie wissen.
Um Mariannes karmische Bürde zu erleichtern – und damit auch meine, wie der Hexenzirkel versicherte –, erweckte ich die Toten jetzt ohne Tiere zu töten. Das hatte ich in Notsituationen auch schon getan, ich wusste also, dass es möglich war. Aber – welche Überraschung – es ging zwar ohne ein Tier, aber nicht ohne frisches Blut. Was also tun? Der Kompromiss bestand darin, mein eigenes Blut zu nehmen.
Begonnen hatte ich beim linken Unterarm, doch das ging nicht lange gut, da ich es drei-, viermal pro Nacht tun musste. Dann war ich dazu übergegangen, mir in die Fingerspitzen zu stechen. Bei Toten, die kein halbes Jahr im Grab lagen, reichte das aus. Aber dann gingen mir die Finger aus, und am Arm hatte ich schon genug Narben. Außerdem hatte ich festgestellt, dass ich beim Schießen mit links langsamer war, weil die Schnitte verflucht wehtaten. Die rechte Hand wollte ich nicht aufschneiden, denn ich konnte es mir nicht leisten, auch mit rechts langsamer zu werden. Ich hatte mich auf dieses Verfahren eingelassen, weil es mir leid tat, Hühner und Ziegen zu opfern, aber mein eigenes Leben ist mir mehr wert als das der Tiere. So, jetzt ist es heraus, eine total selbstsüchtige Entscheidung.
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die kleinen Schnitte gleich wieder zuheilen. Denn dank meiner Bindung an Jean-Claude, den Meistervampir von St. Louis, verheilt bei mir alles sehr, sehr schnell. In diesem Fall jedoch nicht. Marianne vermutete, dass es an der magischen Klinge lag. Doch ich hing an meiner Machete. Ehrlich gesagt, war ich nicht so ganz sicher, ob ich die Toten mit nur so wenig Blut und ohne magischen Stahl wecken könnte. Das war ein Problem.
Ich würde Marianne anrufen und ihr sagen müssen, dass ich die Wicca-Tugend-Prüfung nicht bestanden hatte. Die Wicca würden mich deshalb sicher ablehnen. Warum sollten die anders reagieren als fundamentalistische Christen?
Ich schaute über die Schulter zu meinem Publikum. Zwei zusätzliche Streifenpolizisten hatten sich zu Lieutenant Nicols und seinem Kollegen gesellt. Die Polizei stand zwischen den beiden anderen Gruppen und hatte ihnen erlaubt, sich dem Grab so weit zu nähern, dass sie verstehen würden, was der Tote sprach. Dadurch waren die fünfzehn Meter Abstand nicht mehr einzuhalten, doch beide Parteien sollten Gordon Benningtons Aussage hören können, so hatte der Richter es verfügt. Der war übrigens ebenfalls anwesend, zusammen mit einer Gerichtsschreiberin und ihrem kleinen Apparat. Außerdem hatte er zwei stämmige Gerichtsdiener mitgebracht. Offenbar war der Richter klüger, als er aussah. Aber mich hatte er schon vorher beeindruckt. Nicht jeder lässt Zombies in den Zeugenstand treten.
Heute Nacht war der Friedhof ein Gerichtssaal. Ich war froh, dass Court TV keinen Wind davon bekommen hatte. Das war genau das gruselige Zeug, das die gerne sendeten. Sie wissen schon – Sorgerechtsstreit unter Transen, Lehrerin vergewaltigt Dreizehnjährigen, Mordprozess gegen Football-Profi. Der O.J. Simpson-Fall hatte beim amerikanischen Fernsehen eine üble Entwicklung in Gang gesetzt.
Mit seiner dröhnenden Prozessstimme, die auf dem leeren Friedhof seltsam hallte, sagte der Richter: »Fangen Sie an, Ms Blake, wir sind vollzählig.«
Normalerweise hätte ich also ein Huhn geköpft und mit dem ausblutenden Rumpf einen Kreis gezogen, einen Machtkreis, der den erweckten Toten am Weglaufen hindert. Der Kreis diente außerdem dazu, die Macht und die Energie zu bündeln. Diesmal hatte ich kein Huhn dabei. Wenn ich mich selbst genügend bluten ließ, um auch nur einen kleinen Machtkreis zu ziehen, war es gut möglich, dass ich für den Rest der Nacht erledigt war, zu benommen und schwindlig, um noch etwas anderes zu tun. Was kann ein moralisch aufrechter Animator in dem Fall tun?
Seufzend zog ich die Machete aus der Scheide und hörte hinter mir erschrockenes Luftholen. Es war eine große Klinge, aber die brauchte man, wenn man ein Huhn einhändig köpfen wollte. Ich musterte meine linke Hand, um eine geeignete pflasterfreie Stelle zu finden, dann setzte ich die Klingenspitze am Mittelfinger an (das Symbolhafte entging mir dabei keineswegs) und stach hinein. Ich hielt die Machete immer gut scharf, damit ich nicht aus Versehen zu tief schnitt. Es würde mich ziemlich nerven, wenn ich genäht werden müsste.
Der Schnitt tat nicht sofort weh, was bedeutete, dass ich doch tiefer reingestochen hatte als beabsichtigt. Ich hob die Hand ins Mondlicht und sah das Blut hervorquellen. Sowie ich es sah, tat es weh. Wieso tut eigentlich alles weh, sobald man Blut fließen sieht?
Die Klingenspitze nach unten haltend, begann ich mit dem blutenden Finger den Kreis zu ziehen. Früher hatte ich nie wirklich gespürt, wie die Machete durch mich den magischen Ring im Boden zog, erst seit ich keine Tiere mehr tötete nahm ich das wahr. Vermutlich war es immer schon so gewesen, als zöge ich ihn mit einem Stahlgriffel, aber durch den Ansturm des Todes war es nicht zu spüren gewesen. Ich spürte jeden fallenden Blutstropfen, fühlte den Durst des Bodens, der ihn aufsaugte wie Wasser nach der Dürre, doch es war nicht die Feuchtigkeit, wonach die Erde dürstete, es war die Macht. Ich wusste genau, wann der Kreis um den Grabstein geschlossen war, denn in dem Moment, wo ich am Ausgangspunkt ankam, befiel mich ein Kribbeln, bei dem sich mir die Haare aufrichteten.
Ich wandte mich dem Grabstein zu, während ich den Machtkreis wie ein unsichtbares Flimmern in der Luft spürte, und trat an das Fußende heran, um den Stein mit der Machete anzuschlagen. »Gordon Bennington, mit Stahl rufe ich dich aus dem Grab.« Ich drückte meine blutige Hand auf den Stein. »Mit Blut rufe ich dich aus dem Grab.« Ich wich zum Rand des Kreises zurück. »Höre mich, Gordon Bennington, höre und gehorche. Mit Stahl, Blut und Macht befehle ich dir, dich aus dem Grab zu erheben. Erhebe dich aus dem Grab und wandle unter uns.«
Der Erdboden wellte sich wie Wasser und schwemmte die Leiche nach oben. In Horrorfilmen kommen die Toten immer aus dem Grab gekrochen, arbeiten sich angestrengt mit den Händen hervor, als wollte der Boden sie nicht loslassen. In Wirklichkeit gibt er sie bereitwillig her, und der Zombie steigt liegend an die Oberfläche. Es gab diesmal keine Pflanzen, die ihm in den Weg gerieten, über die er stolpern konnte. Er setzte sich ungehindert auf und sah sich um.
Eines hatte sich geändert, seit ich keine Tieropfer mehr brachte: Meine Zombies waren nicht mehr so hübsch. Mit einem Huhn hätte ich Gordon Bennington aussehen lassen können wie auf seinen Fotos. Mit meinem Blut sah er nach dem aus, was er war: eine reanimierte Leiche.
Er war nicht furchtbar, ich hatte schon schlimmere gesehen, doch seine Witwe schrie, lang und laut, und dann begann sie zu schluchzen. Ein weiterer Grund, weshalb ich Mrs Bennington nicht hatte dabei haben wollen.
Der schöne blaue Anzug verbarg die Schusswunde in der Brust, an der ihr Mann gestorben war. Trotzdem sah man, dass er tot war. Zum Beispiel an der Hautfarbe. Und daran, wie eingefallen sein Gesicht wirkte, wodurch die Augen zu rund, zu groß erschienen. Sie wirkten geradezu nackt und drehten sich in den Höhlen, als könnte das wächserne Fleisch sie kaum halten. Die blonden Haare waren stumpf und sahen aus, als wären sie nachgewachsen. Doch das war eine Täuschung, die durch die Schrumpfung des Gewebes entstand. Entgegen der verbreiteten Annahme wachsen Haare und Fingernägel nach dem Tod nicht weiter.
Eines war noch erforderlich, um Gordon Bennington sprechen zu lassen: Blut. In der Odyssee wird ein Blutopfer gebracht, damit der Geist eines toten Sehers Odysseus Rat geben kann. Es ist eine sehr alte Binsenweisheit, dass die Toten nach Blut dürsten. Ich ging über den wieder festen Boden zu dem Toten und kniete mich vor sein ratloses, runzeliges Angesicht. Da ich in der einen Hand die Machete hielt und die andere blutig war, konnte ich mir den Rock nicht runterziehen. Dadurch bekamen alle reichlich Oberschenkel zu sehen, aber das war nicht weiter wichtig, denn gleich würde ich tun, was mich am meisten an dem tieropferlosen Verfahren störte.
Ich hielt Gordon Bennington meine blutige Hand an den Mund. »Trink, Gordon, trink von meinem Blut und sprich zu uns.«
Die großen runden Augen starrten mich an, seine eingefallene Nase nahm den Blutgeruch auf. Er griff mit beiden Händen zu und senkte den Mund an die Wunde. Seine Finger fühlten sich an wie kaltes Wachs mit Stöcken drin. Die Lippen waren so gut wie verschwunden, sodass ich die Zähne spürte, als er an meiner Hand saugte. Die Zunge schnellte über die Schnittwunde wie ein eigenständiges Wesen, das in seinem Mund lebte.
Ich atmete tief und gleichmäßig ein und aus. Mir würde nicht schlecht werden. Nein. Ich würde mich nicht vor all diesen Leuten blamieren.
Als ich fand, er habe genug, sprach ich ihn an. »Gordon Bennington.«
Er reagierte nicht, sondern hielt meine Hand weiter an seinen Mund gedrückt.
Ich klopfte ihm sacht mit der Machete auf den Kopf. »Mr Bennington, alle warten auf Ihre Aussage.«
Ich weiß nicht, ob die Machete oder meine Worte wirkten, jedenfalls blickte er auf und ließ langsam meine Hand los. In seinen Augen war jetzt mehr von seiner Persönlichkeit. Das war die Wirkung des Blutes; es ließ das Wesen des Toten in ihn zurückfließen.
»Sind Sie Gordon Bennington?«, fragte ich. Es musste streng nach Vorschrift laufen.
Er schüttelte den Kopf.
Der Richter sagte: »Sie müssen laut antworten, Mr Bennington, fürs Protokoll.«
Der Tote sah mich an. Ich wiederholte die Bitte des Richters, und Bennington sagte: »Ich war Gordon Bennington.«
Wenn ich mein eigenes Blut verwendete, hatte das den Vorteil, dass die Toten immer wussten, dass sie tot waren. Früher hatte ich welche gehabt, die sich darüber nicht im Klaren waren, und jemandem beibringen zu müssen, dass er nicht mehr am Leben war und gleich wieder ins Grab sinken würde, war schon eine ziemliche Gemeinheit. Geradezu albtraumhaft.
»Wie sind Sie gestorben, Mr Bennington?«, fragte ich.
Er seufzte, und ich hörte es pfeifen, weil er ein großes Loch in der Brust hatte. Der Anzug verbarg das, aber ich hatte die Fotos der Spurensicherung gesehen. Außerdem wusste ich, was eine zwölfkalibrige Schrotflinte aus nächster Nähe anrichtet.
»Durch einen Schuss.«
Hinter mir wuchs die Anspannung. Ich spürte es durch das Flimmern des Machtkreises. »Wie wurden Sie erschossen?«, fragte ich ruhig und freundlich.
»Ich habe mich selbst erschossen, als ich die Kellertreppe runterging.«
Von einer Gruppe gab es einen Triumphschrei, von der anderen einen Wutschrei.
»Haben Sie sich mit Absicht erschossen?«, fragte ich.
»Nein, natürlich nicht. Ich bin gestolpert, und das Ding ging los, ganz blöd, wirklich. Saublöd.«
Große Aufregung hinter mir, hauptsächlich hörte ich Mrs Bennington schreien: »Ich hab’s doch gesagt, dieses Miststück …«
Ich drehte mich um und rief: »Richter Fletcher, haben Sie alles gehört?«
»Das meiste«, antwortete er und richtete dann seine donnernde Stimme an die Witwe: »Mrs Bennington, wenn Sie bitte lange genug still sein wollen, um zuzuhören: Ihr Gatte hat soeben ausgesagt, dass er durch ein Missgeschick gestorben ist.«
»Gail?«, fragte der Tote zaghaft. »Gail, bist du da?«
Ich wollte keine tränenreiche Umarmung am Grab. »Sind wir fertig, Richter? Darf ich ihn zurückbetten?«
»Nein.« Das kam von einem der Versicherungsanwälte. Conroy trat näher. »Wir haben auch ein paar Fragen an ihn.«
Sie stellten ihre Fragen. Zuerst musste ich sie wiederholen, damit der Tote antworten konnte, doch nach und nach ging es besser. Physisch sah er nicht besser aus, aber er wurde wacher, nahm seine Umgebung genauer wahr. Er entdeckte seine Frau und sagte: »Gail, es tut mir so leid. Du hattest recht wegen der Waffen. Ich war nicht vorsichtig genug. Es tut mir leid, dass ich dich und die Kinder allein gelassen habe.«
Mrs Bennington kam mit ihren Anwälten im Schlepptau zu uns. Ich machte mich darauf gefasst, sie am Betreten des Machtkreises hindern zu müssen, doch sie blieb von selbst davor stehen, als ob sie ihn spürte. Man ist mitunter überrascht, welche Leute übernatürlich begabt sind. Ich bezweifle, dass sie wusste, warum sie vor dem Kreis Halt machte. Und natürlich behielt sie ihre Hände bei sich. Sie streckte nicht die Arme nach ihrem Gatten aus. Wahrscheinlich wollte sie nicht so genau wissen, wie sich diese wächserne Haut anfühlte. Ich konnte ihr keinen Vorwurf machen.
Conroy und die anderen Anwälte wollten weitere Fragen anbringen, doch der Richter schaltete sich ein. »Er hat Ihnen ausreichend Auskunft gegeben. Es ist Zeit, ihn wieder, äh, ruhen zu lassen.«
Da war ich ganz seiner Meinung. Mrs Bennington war in Tränen aufgelöst, und ihr Mann wäre es auch gewesen, wenn seine Tränenkanäle nicht schon vertrocknet gewesen wären.
Ich verschaffte mir seine Aufmerksamkeit. »Mr Bennington, ich bette Sie nun wieder ins Grab.«
»Wird Gail das Geld von der Versicherung bekommen?«
Ich drehte den Kopf nach dem Richter. Der nickte.
»Ja, Mr Bennington, das wird sie.«
Er lächelte oder versuchte es zumindest. »Danke. Dann bin ich bereit.« Er sah seine Frau an, die auf dem Rasen kniete. »Ich bin froh, dass ich mich verabschieden durfte.«
Sie schüttelte in einem fort den Kopf und sagte mit tränennassem Gesicht: »Ich auch, Gordie, ich auch. Du fehlst mir.«
»Du fehlst mir auch, meine kleine Kratzbürste.«
Sie brach in Schluchzen aus und schlug sich die Hände vors Gesicht. Hätte nicht einer der Anwälte sie festgehalten, wäre sie hingesunken.
»Meine kleine Kratzbürste« klang in meinen Ohren nicht besonders vorteilhaft, aber na ja, es bewies, dass Bennington seine Frau wirklich gekannt hatte. Es zeigte außerdem, dass sie ihn für den Rest ihres Lebens vermissen würde. Angesichts von so viel Schmerz konnte ich ihr einige Wutanfälle verzeihen.