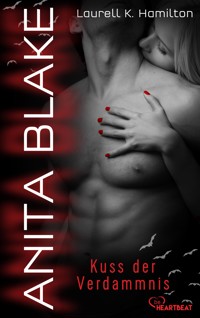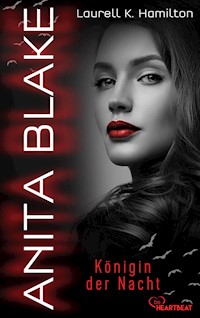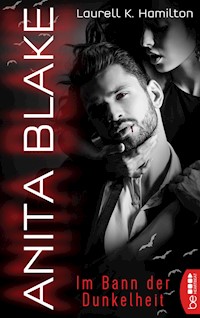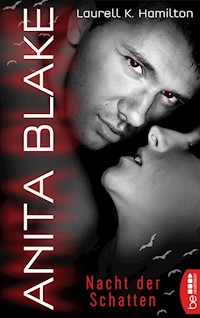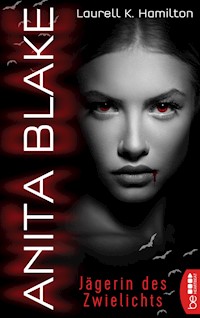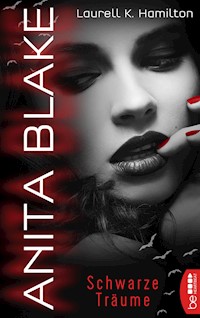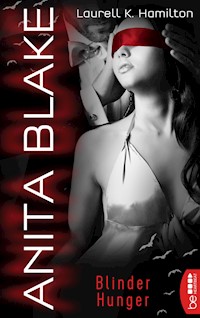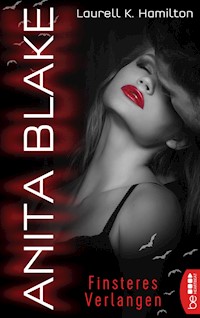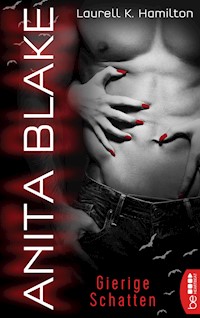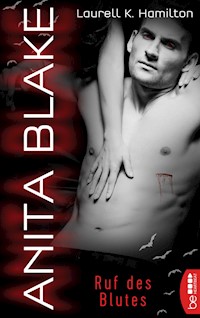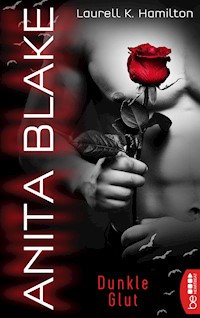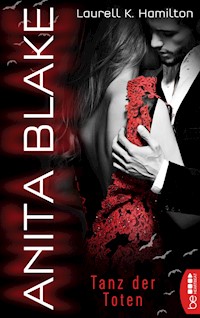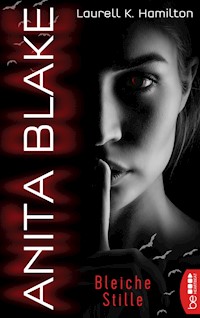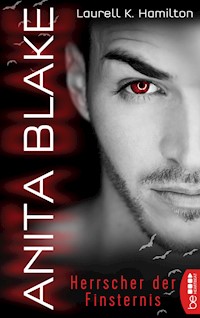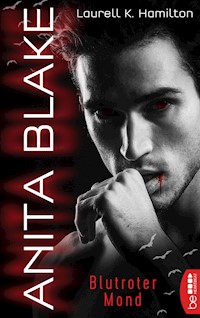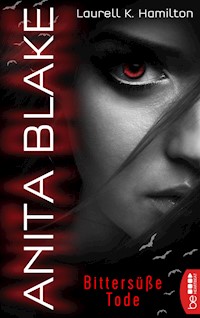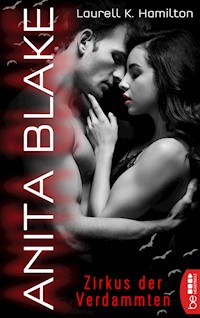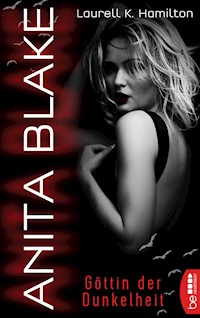
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Ein rasantes Abenteuer, das dich an der Kehle packt und nicht mehr loslässt!
Profikiller Edward ist ein alter Freund von Anita Blake und sie schuldet ihm einen Gefallen. Deshalb fährt sie nach Santa Fe, um mit ihm zusammen eine Reihe brutaler ritueller Morde aufzuklären, bei denen grausame Magie im Spiel war. Ihre Ermittlungen führen die beiden auf die Spur einer uralten Vampirin, die behauptet, eine aztekische Göttin zu sein. Es wird bald klar, dass die Morde nur der Auftakt des Grauens waren - denn der Täter versucht, eine dunkle Macht zu erwecken ...
Dieses E-Book ist der erste Band einer zweiteiligen Geschichte. Nächster Band: Anita Blake - Herrscher der Finsternis.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Über diesen Band
Über die Autorin
Triggerwarnung
Titel
Impressum
Danksagungen
Widmung
Anmerkung der Autorin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Im nächsten Band
Über die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Ein rasantes Abenteuer, das dich an der Kehle packt und nicht mehr loslässt!
Profikiller Edward ist ein alter Freund von Anita Blake und sie schuldet ihm einen Gefallen. Deshalb fährt sie nach Santa Fe, um mit ihm zusammen eine Reihe brutaler ritueller Morde aufzuklären, bei denen grausame Magie im Spiel war. Ihre Ermittlungen führen die beiden auf die Spur einer uralten Vampirin, die behauptet, eine aztekische Göttin zu sein. Es wird bald klar, dass die Morde nur der Auftakt des Grauens waren – denn der Täter versucht, eine dunkle Macht zu erwecken …
Dieses E-Book ist der erste Band einer zweiteiligen Geschichte. Nächster Band: Anita Blake – Herrscher der Finsternis.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Göttin der Dunkelheit
Aus dem amerikanischen Englischvon Angela Koonen
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Obsidian Butterfly«
»Obsidian Butterfly« ist im Deutschen in zwei Teilen erschienen:
Band 1: Göttin der Dunkelheit
Band 2: Herrscher der Finsternis
Originalverlag: Ace Books, published by The Berkley Publishing Group, a division of Penguin Putnam, New York
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2010/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Göttin der Dunkelheit«
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © iStock/ BojanMirkovic; AdobeStock/ Viorel Sima
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0245-4
be-ebooks.de
lesejury.de
Danksagungen
Ich danke Michael Miller, der mir mehr über Schusswaffen und Waffen im Allgemeinen beigebracht hat, als ich je zu lernen hoffte. Masaad Ayoob danke ich dafür, dass er waffenbezogene Irrtümer in letzter Sekunde noch korrigiert hat. Er hatte keine Gelegenheit, vor dem letzten Korrekturgang das Buch als Ganzes zu lesen, und deshalb fallen übersehene Fehler, was Waffen angeht, allein auf mich zurück. Steve (S.M.) und Jan Stirling haben den Roman daraufhin gelesen, ob ich das Flair von Santa Fe richtig eingefangen habe. Ich danke den vielen Menschen in Santa Fe und Albuquerque, die mir das Gefühl gaben, willkommen zu sein, während ich dort umherstreifte, Fragen stellte und die Atmosphäre aufsog. Dank auch an meinen Ehemann Gary, der sich um unsere Tochter Trinity gekümmert hat, während ich in New Mexico war. Und an Trinity, die mit mir auf meinem Bürosessel gesessen hat, als ich das letzte Drittel dieses Romans schrieb. Ich danke Chuck Holmes vom Bernallio County Sheriff’s Department, der mir viele Fragen beantwortete, die im letzten Moment aufkamen. Besonderer Dank gilt Deborah Millitello, weil sie mit mir die Wildnis New Mexicos gemeistert hat, und das mit verstauchtem Fuß. Wie immer danke ich meiner Schreibgruppe, den Alternate Historians, die mit mir von Anfang an dabei waren: Deborah Millitello, Mark Sumner, Sharon Shinn, Marella Sands, Tom Drennan, N.L. Drew und W. Augustus Elliot. Aus Zeitgründen konnte nicht jeder von euch dieses Buch lesen, also wird es auch für euch neu sein. Mal etwas ganz anderes.
Anmerkung der Autorin
Für alle, die noch nie einen Roman um Anita Blake gelesen haben, möchte ich kurz etwas zu ihrer Welt sagen.
Sie ist der Welt, in der wir leben, recht ähnlich, nur dass es die Geschöpfe der Nacht – Vampire, Werwölfe, Zombies und dergleichen – in dieser Welt wirklich gibt. Sie existieren im Hier und Jetzt. Wir und sie nebeneinander – nicht immer zufrieden und nicht immer friedlich.
Und manchmal lernen wir sie nur zu gut kennen …
1
Ich war von oben bis unten mit Blut bespritzt. Aber nicht mit meinem, also war’s in Ordnung. Außerdem war es nur Tierblut. Wenn die schlimmste Bluttat dieser Nacht sechs Hühner und eine Ziege betraf, konnte ich damit leben und jeder andere auch. Ich hatte hintereinander sieben Tote erweckt. Das war selbst für mich ein Rekord.
Kurz vor der Dämmerung, der Himmel war noch dunkel und voller Sterne, bog ich in meine Einfahrt ein. Ich ließ den Jeep draußen stehen, war zu müde, um mich mit dem Garagentor zu befassen. Es war Mai, kam einem aber vor wie April. Der Frühling in St. Louis ist eine Zwei-Tage-Angelegenheit zwischen der Winterkälte und der Sommerhitze. Den einen Tag friert man sich den Arsch ab, und kurz darauf sind es dreißig Grad. Aber in diesem Jahr gab es einen richtigen Frühling, einen nassen, milden Frühling.
Von den vielen Zombies abgesehen war das eine Nacht wie jede andere. Vom Bürgerkriegssoldaten, den eine Historikervereinigung befragen will, über das Testament, dem die Unterschrift fehlt, bis zur letzten Konfrontation eines Sohnes mit seiner ehemals Missbrauch treibenden Mutter war mal wieder alles dabei gewesen. Und ich hatte die ganze Nacht in einem Pulk von Anwälten und Therapeuten herumgestanden. Wenn ich nur noch einmal jemanden fragen hörte: Wie fühlst du dich dabei, Jonathan (oder Cathy oder wer auch immer)?, würde ich anfangen zu schreien. Ich wollte nie wieder sehen, wie jemand »auf Gefühle eingeht«. Wenigstens kamen bei den meisten Anwälten die Hinterbliebenen nicht mit ans Grab. Der vom Gericht bestellte Anwalt vergewissert sich, ob der erweckte Tote genügend Wahrnehmungsfähigkeit hat, um zu wissen, was er unterschreibt, dann unterzeichnet er das Dokument als Zeuge. Wenn der Tote die Fragen nicht beantworten kann, gibt es keine rechtsgültige Unterschrift. Der Tote muss dafür »geistig gesund« sein. Ich hatte noch keinen erweckt, der diese Definition geistiger Gesundheit nicht erfüllte, aber offenbar kam es manchmal vor. Jamison, einer meiner Kollegen bei Animator’s Inc., hatte es mal mit zwei Anwälten zu tun gehabt, die am offenen Grab deswegen aneinandergeraten sind. Lustig.
Es war so kühl, dass ich fröstelte, als ich auf meine Haustür zuging. Als ich gerade den Schlüssel ins Schloss fummelte, klingelte das Telefon. Ich stieß die Tür mit der Schulter auf, weil keiner kurz vor Morgengrauen anruft, wenn es nicht wichtig ist. Bei mir war das meistens die Polizei, und dann ging es um Mord. Ich trat die Tür wieder zu und lief zur Küche. Der Anrufbeantworter hatte sich bereits eingeschaltet. Meine Ansage lief aus, und Edwards Stimme war zu hören.
»Anita, hier Edward. Wenn du da bist, nimm ab.« Schweigen.
Ich rannte schneller und schlitterte auf hohen Absätzen zum Telefon, bumste gegen die Wand, ergriff den Hörer und hätte ihn fast wieder fallen lassen. Während ich ihn auffing und drehte, rief ich atemlos: »Edward, Edward, ich bin’s! Ich bin zu Hause!«
Als ich ihn endlich am Ohr hatte, hörte ich ihn leise lachen.
»Schön, dass ich auch mal amüsant bin. Was ist los?«, fragte ich.
»Ich fordere meinen Gefallen ein«, antwortete er ruhig.
Jetzt war ich es, die schwieg. Er war mir mal als Verstärkung zu Hilfe gekommen und hatte zusätzlich einen Freund mitgebracht, Harley. Das Ende der Geschichte war, dass ich Harley tötete. Na ja, er hatte versucht, mich umzubringen, und ich war schneller gewesen, aber Edward nahm das damals ziemlich persönlich. Eine heikle Sache. Edward ließ mir dann die Wahl: Entweder sollten er und ich gegeneinander antreten und ein für alle Mal herausfinden, wer der Bessere ist, oder ich wäre ihm einen Gefallen schuldig. Er würde mich dann eines Tages anrufen und mich als Verstärkung mitnehmen wie Harley damals. Ich hatte mich für die zweite Möglichkeit entschieden. Ich wollte niemals gegen Edward antreten müssen. Denn ich war ziemlich sicher, dass ich am Ende tot wäre.
Edward war ein Auftragsmörder. Spezialisiert auf Monster, Vampire, Gestaltwandler, was man sich nur denken kann. Es gab Leute wie mich, die das legal taten, aber Edward interessierte es nicht, ob etwas legal oder ethisch vertretbar war. Gelegentlich brachte er sogar Menschen um, allerdings nur, wenn sie in dem Ruf standen, gefährlich zu sein. Auftragsmörder, Kriminelle, bösartige Leute eben. Er verstand sein Handwerk und diskriminierte niemanden, Rasse, Religion, Geschlecht oder dergleichen war ihm völlig egal. Wenn derjenige gefährlich war, brachte Edward ihn zur Strecke. Dafür lebte er, das war er – das Raubtier der Raubtiere.
Einmal hatte ihn jemand auf mich ansetzen wollen. Edward hatte abgelehnt und war zu mir gekommen als mein Leibwächter, mit Harley. Ich fragte ihn damals, warum er den Auftrag nicht angenommen hatte. Seine Antwort war einfach. Hätte er angenommen, würde er nur mich töten. Wenn er mich beschützte, würde er mehr Leute töten. Edwards Logik.
Er ist entweder ein Soziopath oder so knapp dran, dass man den Unterschied nicht mehr sieht. Ich bin vielleicht einer der wenigen Freunde, die er hat, aber das ist in etwa, als sei man mit einem Leoparden befreundet. Er rollt sich am Fußende des Bettes zusammen und lässt sich den Kopf streicheln, aber er würde einem trotzdem an Kehle gehen. Nur noch nicht heute Abend.
»Anita, bist du noch dran?«
»Ja, Edward.«
»Du scheinst dich nicht zu freuen, von mir zu hören.«
»Sagen wir einfach, ich bin vorsichtig.«
Er lachte wieder. »Vorsichtig. Nein, du bist nicht vorsichtig. Du bist misstrauisch.«
»Ja«, sagte ich. »Worum geht es also?«
»Ich brauche Verstärkung.«
»Was kann so gefährlich sein, dass der Tod persönlich Verstärkung braucht?«
»Ted Forrester braucht Vampirhenker Anita Blake als Verstärkung.«
Ted Forrester war Edwards Alter ego, seine einzige legale Identität, von der ich wusste. Ted war ein Kopfgeldjäger für abnorme Wesen, ausgenommen Vampire. Für die wurde immer eine Ausnahme gemacht, weshalb es zum Beispiel gerichtlich bestellte Vampirhenker gab, aber keine gerichtlich bestellten Henker für alle anderen. Vielleicht machten sie die bessere Lobbyarbeit, zumindest bekamen sie die meiste Presse. Kopfgeldjäger wie Ted füllten die Lücke zwischen der Polizei und den zugelassenen Henkern. Sie arbeiteten meistens in Rancher-Staaten, wo es erlaubt war, Schädlinge zu jagen und sich dafür bezahlen zu lassen. Zu den Schädlingen zählten auch Lykanthropen. In sechs Staaten durfte man sie einfach abknallen, solange danach bei einer Blutuntersuchung bewiesen wurde, dass es wirklich Lykanthropen waren. Ein paar solcher Fälle waren vor Gericht gelandet und erfolgreich angefochten worden, aber geändert hatte sich nichts.
»Und wofür braucht mich Ted?« Obwohl ich wahrhaftig erleichtert war, dass Ted mich fragte und nicht Edward. Hätte er mich als Edward um Hilfe gebeten, ginge es wahrscheinlich um etwas Illegales, vielleicht sogar um Mord. Ich stand nicht auf kaltblütiges Morden. Noch nicht.
»Komm nach Santa Fe, dann erfährst du es.«
»Nach New Mexico? Santa Fe in New Mexico?«
»Ja.«
»Wann?«
»Jetzt.«
»Da ich als Vampirhenker komme, kann ich wohl meinen Ausweis zücken und mein Arsenal mitbringen.«
»Bring mit, was du willst«, sagte Edward. »Ich werde mein Spielzeug mit dir teilen, wenn du da bist.«
»Ich bin noch gar nicht im Bett gewesen. Bleibt mir noch Zeit, ein bisschen zu schlafen, bevor ich ins Flugzeug steige?«
»Ja, aber sei am Nachmittag hier. Wir haben die Leichen weggebracht, den Rest des Tatorts heben wir für dich auf.«
»Welche Art Verbrechen?«
»Ich würde sagen Mord, aber das trifft es nicht ganz. Blutbad, Gemetzel, Folter. Ja«, sagte er, als dächte er über den Begriff nach, »ein Foltermord.«
»Willst du mir Angst machen?«, fragte ich.
»Nein.«
»Dann lass das Dramatisieren und sag mir einfach, was passiert ist.«
Er seufzte, und zum ersten Mal hörte ich eine schleppende Müdigkeit in seiner Stimme. »Wir haben zehn Vermisste und zwölf Tote.«
»Scheiße«, sagte ich. »Wieso habe ich nichts in den Nachrichten gehört?«
»Die Vermisstenfälle standen in der Boulevardpresse. Ich glaube, die Schlagzeile war: ›Bermuda-Dreieck in der Wüste.‹ Die zwölf Toten sind drei Familien. Die Nachbarn haben sie heute gefunden.«
»Wie lange waren sie da schon tot?«, fragte ich.
»Seit ein paar Tagen, eine Familie seit fast zwei Wochen.«
»Himmel, wieso hat die keiner vermisst?«
»Während der letzten zehn Jahre hat sich die Bevölkerung von Santa Fe völlig verändert. Viele lassen sich hier nieder oder haben eine Ferienwohnung. Die Einheimischen nennen sie Kalifornienmacher.«
»Witzig«, sagte ich. »Aber ist Ted Forrester ein Einheimischer?«
»Ted wohnt in der Nähe der Stadt, ja.«
Eine freudige Erregung durchfuhr mich. Edward war ein wandelndes Geheimnis. Ich wusste so gut wie nichts über ihn. »Heißt das, ich werde deine Wohnung sehen?«
»Du wirst bei Ted Forrester wohnen«, antwortete er.
»Aber das bist du, Edward. Ich werde also bei dir zu Hause wohnen?«
Einen Augenblick lang war er still, dann: »Ja.«
Plötzlich fand ich die Reise viel attraktiver. Ich würde Edwards Zuhause kennenlernen. Ich würde meine Nase in sein Privatleben stecken können, falls er eins hatte. Was konnte besser sein?
Doch eins beunruhigte mich noch. »Du hast gesagt, dass die Opfer drei Familien sind. Schließt das Kinder ein?«
»Seltsamerweise nicht«, sagte er.
»Na wenigstens etwas, Gott sei Dank.«
»Bei den Kleinen bist du schon immer weich geworden«, fand er.
»Macht es dir denn gar nichts aus, tote Kinder zu sehen?«
»Nein.«
Ein, zwei Sekunden hörte ich ihm beim Atmen zu. Ich wusste, dass ihn nichts berührte, nichts bewegte. Aber bei Kindern … jeder Polizist fand es furchtbar, an einen Tatort zu müssen, wo das Opfer ein Kind ist. Das hatte etwas Persönliches. Selbst wer keine Kinder hatte, nahm das schwer. Dass Edward nicht so fühlte, machte mir etwas aus. Seltsam, aber so war es.
»Mir macht es schon etwas aus«, erwiderte ich.
»Ich weiß«, meinte er, »einer deiner bedenklichen Fehler.« Da klang ein Hauch Belustigung mit.
»Ich bin unter anderem sehr stolz darauf, dass ich im Gegensatz zu dir kein Soziopath bin.«
»Du brauchst keiner zu sein, um mir den Rücken zu decken, nur ein guter Schütze, und der bist du, Anita. Unter den richtigen Umständen tötest du genauso leicht wie ich.«
Ich versuchte es gar nicht erst mit einem Einwand, weil mir keiner einfiel. Ich beschloss, mich auf den Kriminalfall zu konzentrieren statt auf meinen moralischen Niedergang. »Santa Fe hat also viele Durchreisende.«
»Das nicht«, sagte Edward, »aber eine große Fluktuation. Wir haben viele Touristen und eine Menge Leute, die dauerhaft hierherziehen und dann doch wieder abhauen.«
»Das heißt, niemand kennt seine Nachbarn und ihren Tagesablauf.«
»Genau.« Seine Stimme hatte diese Ausdruckslosigkeit, der eine Spur Müdigkeit anhaftet, und dazu noch etwas anderes. Irgendeinen Unterton.
»Du glaubst, es gibt noch mehr Leichen. Sie wurden nur noch nicht gefunden«, schloss ich.
Er schwieg kurz, dann sagte er: »Du hast es mir angehört, stimmt’s?«
»Ja.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Dass du so genau spürst, was ich denke.«
»Entschuldigung. Ich werde versuchen, nicht so intuitiv zu sein.«
»Lass nur. Deine Intuition ist einer der Gründe, warum du noch am Leben bist.«
»Willst du dich über weibliche Intuition lustig machen?«, fragte ich.
»Nein, ich meine nur, dass du bei der Arbeit mit dem Bauch entscheidest, nach deinen Emotionen, nicht mit dem Kopf. Das ist deine Stärke und ein Schwachpunkt.«
»Zu zartbesaitet, wie?«
»Manchmal, und manchmal bist du innerlich genauso tot wie ich.«
Fast war es beängstigend, ihn das so sagen zu hören. Nicht, weil er mich mit sich in einem Atemzug nannte, sondern weil er wusste, dass in ihm etwas abgestorben war.
»Vermisst du die abgestorbenen Teile manchmal?« Ich hatte ihm noch nie eine so persönliche Frage gestellt. »Nein«, antwortete er. »Und du?«
Ich dachte einen Moment lang darüber nach. Ich wollte schon automatisch ja sagen, bremste mich aber noch. Ehrlich bleiben, es sollte immer ehrlich bleiben zwischen uns. »Nein, ich schätze nicht.«
Er gab ein kleines Geräusch von sich, fast ein Lachen. »Das ist mein Mädchen.«
Ich war zugleich geschmeichelt und leicht verärgert, dass ich »sein Mädchen« war. Im Zweifelsfall immer auf den Job konzentrieren. »Um was für ein Monster handelt es sich, Edward?«, fragte ich.
»Ich habe keine Ahnung.«
Ich stutzte. Edward war schon ein paar Jahre länger in der Branche als ich und kannte sich ein bisschen besser mit den Monstern aus. Er war um die ganze Welt gereist, um sie zu töten, und hatte Erfahrung mit Wesen, die ich nur aus Büchern kannte.
»Was soll das heißen: du hast keine Ahnung?«
»Ich habe noch nie etwas auf diese Art töten sehen, Anita.« Da schwang etwas mit, das ich von ihm nicht kannte – Angst. Edward, der Tod, wie ihn die Vampire und Gestaltwandler nannten, hatte Angst. Das war ein sehr schlechtes Zeichen.
»Du bist erschüttert, Edward. Das sieht dir gar nicht ähnlich.«
»Warte, bis du die Opfer siehst. Vom ersten Tatort gibt es nur Fotos, aber den letzten habe ich unberührt gelassen, nur für dich.«
»Was hält die Polizei davon, dass sie meinetwegen ein Band drum herum und eine Abdeckplane drüberziehen soll?«
»Ted ist bei den Polizisten hier beliebt. Er ist ein Good Old Boy. Wenn Ted ihnen sagt, dass du helfen kannst, dann glauben sie es.«
»Aber Ted Forrester bist du, und du bist kein Good Old Boy«, wandte ich ein.
»Ted ist einer«, erwiderte er ausdruckslos.
»Deine geheime Identität.«
»Ja.«
»Na schön. Ich lande am Nachmittag oder am frühen Abend in Santa Fe.«
»Flieg nach Albuquerque. Ich hole dich am Flughafen ab. Ruf mich noch mal kurz an und sage mir die Uhrzeit.«
»Ich kann mir auch einen Leihwagen nehmen«, bot ich an.
»Ich werde noch wegen einer anderen Sache in Albuquerque sein. Das ist kein Problem.«
»Was verschweigst du mir?«
»Ich etwas verschweigen?« Wieder diese leise Belustigung.
»Du bist ein wandelndes Geheimnis, Edward. Du liebst es, mir Dinge zu verschweigen. Das verschafft dir ein Gefühl von Macht.«
»Tatsächlich?«
»Jawohl.«
Er lachte leise. »Schon möglich. Buche den Flug und ruf mich an. Ich muss jetzt auflegen.« Er redete leiser, als wäre jemand ins Zimmer gekommen.
Ich hatte nicht gefragt, warum es so wichtig war. Zehn Vermisste, zwölf Tote. Es war wichtig genug. Ich hatte auch nicht gefragt, ob er auf meinen Anruf warten würde. Edward, dem es nie grauste, hatte Angst. Er wartete ganz sicher.
2
Wie sich herausstellte, ging der einzige Flug, der noch frei war, gegen Mittag, sodass ich fünf Stunden schlafen konnte, bevor ich aufstehen und zum Flugplatz hetzen musste. Ich musste auch die Kenpo-Stunde ausfallen lassen, eine Abart von Karate, die ich seit ein paar Wochen betrieb. Ich wäre lieber auf der Matte gewesen als im Flugzeug. Ich hasste das Fliegen. Ich hatte Verpflichtungen außerhalb der Stadt immer möglichst vermieden und trotzdem in letzter Zeit viel fliegen müssen. Die Angst war etwas geschrumpft, aber die Phobie war nicht weg. Ich wollte mich nicht auf einen Piloten verlassen, den ich nicht eigenhändig auf Drogen getestet hatte. Ich gehörte nicht zu den Vertrauensseligen.
Die Fluggesellschaften auch nicht. Es war nervenaufreibend, eine Waffe ins Flugzeug mitnehmen zu wollen. Zum Tragen von Waffen im Flugzeug hatte ich eigens den zweistündigen Kursus der Bundesluftfahrtbehörde absolvieren müssen. Die Teilnahmebescheinigung trug ich bei mir. Ohne die ließe man mich gar nicht an Bord. Außerdem hatte ich einen amtlichen Wisch, der bestätigte, dass ich in offiziellen Angelegenheiten unterwegs war, die das Tragen einer Waffe erforderten. Sergeant Rudolph (Dolph) Storr, der Kopf des Regional Preternatural Investigation Teams, hatte mir den Text mit dem entsprechenden Briefkopf gefaxt. Das beeindruckt immer. Jemand, der ein echter Polizist war, musste mir meinen Status bestätigen. Wenn es sich um echte Polizeiarbeit handelte, gab Dolph mir gewöhnlich, was ich brauchte, selbst wenn er nicht persönlich beteiligt war. Wenn Edward mich zu einem inoffiziellen Fall rief, das heißt zu einer illegalen Untersuchung, brauchte ich mich an Dolph gar nicht erst zu wenden. Mr. Recht und Gesetz hatte nicht gerade viel für Edward alias Ted Forrester übrig. Denn »Ted« war häufig in der Nähe, wenn es Leichen wegzuräumen gab. Dolph traute ihm nicht.
Ich schaute nicht aus dem Fenster. Ich las und versuchte so zu tun, als säße ich in einem voll besetzten Bus. Aber ich hatte nicht nur Flugangst, sondern auch Platzangst, wie sich irgendwann herausgestellt hatte. In der ausgebuchten A727 fiel mir das Atmen schwer. Ich schaltete den kleinen Ventilator über meinem Sitz auf volle Leistung und las weiter. Ein Buch von Sharon Shinn. Ihr traute ich zu, dass sie selbst Tausende Meter in der Luft, wo mich nur ein dünnes Blech von der Ewigkeit trennte, meine Aufmerksamkeit fesseln würde.
Ich kann Ihnen also gar nicht beschreiben, wie Albuquerque von oben aussieht, und der schmale Verbindungskorridor, der von der Bordtür in den Flughafen führte, war genau wie jeder andere. Allerdings spürte man darin die Hitze wie eine mächtige Hand über dem dünnen Plastik schweben. In St. Louis mochte Frühling sein, in Albuquerque war Sommer. Ich suchte die Menschenscharen nach Edward ab und sah tatsächlich zuerst an ihm vorbei, bevor ich ihn erkannte. Das lag zum einen daran, dass er einen Hut trug, einen Cowboyhut. Vorne im Hutband steckten ein paar Federn, doch der Hut selbst sah schon etwas mitgenommen aus. Der Rand war an beiden Seiten nach innen gebogen, als hätte sich das steife Material unter dem permanenten Griff seiner Hände verformt. Er trug ein weißes kurzärmliges Hemd, wie man es in jedem Laden bekommt, dazu eine dunkelblaue Jeans, die neu aussah, und ein Paar Wanderstiefel, die nicht neu aussahen.
Wanderstiefel? Edward? Er hatte nie den Eindruck gemacht, als könnte er auf dem Land leben. Nein, er war eindeutig der städtische Typ, aber da stand er, sah aus wie ein Landei und schien sich dabei wohl zu fühlen. Er kam mir erst wie Edward vor, als ich seinem Blick begegnete. Man konnte ihn in jede Verkleidung stecken, ihn als Prinz Charming auf einen Disney-Festwagen stellen, sowie man seine Augen sah, wollte man schreiend weglaufen.
Seine Augen sind blau und kalt wie der Winterhimmel. Mit seinen blonden Haaren und dem schmalen, blassen Gesicht verkörpert er den weißen Amerikaner protestantisch-angelsächsischer Herkunft. Er kann harmlos erscheinen, wenn er will. Er ist ein vollendeter Schauspieler, aber wenn er sich nicht sehr anstrengt, verraten ihn seine Augen. Wenn die Augen ein Spiegel der Seele sind, dann ist Edward in Schwierigkeiten, denn bei ihm ist keine zu sehen.
Er lächelte mich an, und das Eis in seinen Augen schmolz ein wenig ab. Er freute sich, mich zu sehen, freute sich ehrlich. Zumindest so sehr er sich beim Anblick eines anderen freuen konnte. Das wirkte nicht beruhigend auf mich. In gewisser Hinsicht machte es mich nervös, weil der Hauptgrund seiner Sympathie damit zu tun hatte, dass wir gemeinsam immer mehr Leute töteten als getrennt. Ich zumindest. Soweit ich wusste, konnte Edward ganze Armeen niedermähen, wenn er nicht mit mir zusammen war.
»Anita«, sagte er.
»Edward«, echote ich.
Das Lächeln ging in Grinsen über. »Du scheinst dich gar nicht zu freuen.«
»Und dass du dich so freust, macht mich nervös, Edward. Du bist erleichtert, dass ich hier bin, und das ist beängstigend.«
Das Grinsen ließ nach. Die ganze Heiterkeit, die Willkommensfreude sickerte aus dem Gesicht wie Wasser aus einem gesprungenen Glas, bis es leer war. »Ich bin nicht erleichtert«, sagte er, aber es klang zu ausdruckslos.
»Lügner.« Ich hätte es lieber leise gesagt, aber der Flughafenlärm war wie eine tosende Brandung, er ließ keinen Moment nach.
Er blickte mich mit diesen mitleidlosen Augen an und nickte leicht. Er gab es zu. Vielleicht hätte er das noch in Worte gefasst, aber plötzlich erschien eine Frau an seiner Seite. Sie schob lächelnd die Arme um ihn und schmiegte sich an. Sie schien irgendwo in den Dreißigern zu sein, älter, als Edward aussah, allerdings kannte ich sein Alter eigentlich gar nicht. Sie hatte kurze braune Haare, einen praktischen Haarschnitt, der ihr aber schmeichelte. Sie war sehr sparsam geschminkt und trotzdem hübsch. Um die Augen und den Mund hatte sie Fältchen, die meine Schätzung von dreißig auf vierzig hochdrückten. Sie war kleiner als Edward, größer als ich, aber immer noch zierlich, wenn auch nicht zerbrechlich. Ihre Haut war ungesund stark gebräunt, was vielleicht die Fältchen erklärte. Dabei strahlte sie eine ruhige Stärke aus, wie sie mich so anlächelte und Edwards Arm festhielt.
Sie hatte Jeans an, die so gepflegt aussahen, dass sie gebügelt sein mussten, dazu eine weiße, kurzärmlige Bluse, die ein wenig durchsichtig war, sodass sie ein Spaghettitop darunter trug. In der Hand trug sie eine braune Lederhandtasche, die fast so groß war wie meine Reisetasche. Einen Moment lang überlegte ich, ob Edward sie auch von einem Flug abgeholt hatte, aber sie wirkte so frisch und ohne Eile. Sie konnte nicht aus einem Flugzeug gestiegen sein.
»Ich bin Donna. Du musst Anita sein.« Sie streckte mir die Hand hin, und ich nahm sie. Sie hatte einen festen Händedruck, und ihre Haut war nicht zart. Sie hatte hart damit gearbeitet. Sie wusste auch, wie man jemandem die Hand schüttelt. Die meisten Frauen lernen es nie. Ich mochte sie sofort, ganz unwillkürlich, und misstraute dem Gefühl genauso schnell.
»Ted hat mir so viel von dir erzählt«, sagte Donna.
Ich sah zu Edward auf. Er lächelte, und sogar seine Augen waren gut gelaunt. Sein Gesicht, die ganze Körperhaltung hatte sich verändert. Er stand lässig da, sein Lächeln war träge. Er versprühte einen Good-Old-Boy-Charme. Als wäre er in die Haut eines anderen geschlüpft. Eine oscarreife Vorstellung.
Ich blickte Edward-Ted an und sagte: »Er hat also viel über mich erzählt, so so.«
»Oh ja«, bekräftigte Donna und berührte mich am Arm, ohne ihren Edward loszulassen. Klar, dass sie zu beiläufigen Berührungen neigte. Durch meine Gestaltwandlerfreunde war ich mittlerweile an solchen Körperkontakt gewöhnt, aber meine Art war das trotzdem nicht. Was wollte Edward – Ted – von dieser Frau?
Als Edward den Mund aufmachte, hatte er einen ganz leichten texanischen Einschlag wie ein Überbleibsel aus alten Zeiten. Normalerweise hatte er überhaupt keinen Akzent. Seine Aussprache war die sauberste, die ich kannte, und überhaupt nicht zuzuordnen, völlig unberührt von Gegenden und Leuten.
»Anita Blake, ich möchte dir Donna Parnell, meine Verlobte, vorstellen.«
Mir fiel die Kinnlade bis auf den Teppich, und ich glotzte ihn nur an. Normalerweise versuche ich mich ein bisschen kultivierter zu benehmen oder, na ja, höflicher. Mir war klar, dass ich erstaunt oder vielmehr entsetzt wirkte, aber ich konnte es nicht ändern.
Donna lachte, und es war ein gutes Lachen, warm und glucksend, ein nettes mütterliches Lachen. Sie drückte Edwards Arm. »Oh, du hast recht gehabt, Ted. Ihre Reaktion war die Fahrt wert.«
»Klar, Süße«, sagte Edward, umarmte sie und drückte ihr einen Kuss auf den Scheitel.
Ich machte den Mund zu und versuchte mich zu fassen. »Das ist … großartig«, brachte ich nuschelnd hervor. »Ich meine, wirklich … ich …« Schließlich streckte ich die Hand aus und sagte: »Herzlichen Glückwunsch.« Aber ein Lächeln bekam ich nicht hin.
Donna zog mich an meiner ausgestreckten Rechten in den Arm. »Ted meinte, es würde dich umhauen, dass er sich endlich traut, den Bund fürs Leben zu schließen.« Sie drückte mich lachend. »Aber du meine Güte, Mädchen, ein so schockiertes Gesicht habe ich noch nie gesehen.« Sie kehrte zu Edwards Armen und seinem lächelnden Ted-Gesicht zurück.
Ich kann nicht halb so gut schauspielern wie er. Es hat Jahre gedauert, bis ich auch nur ein nichtssagendes Gesicht machen konnte. Mit Mimik und Körpersprache zu lügen ging noch immer nicht. Darum machte ich ein unbewegtes Gesicht und gab Edward mit einem Blick zu verstehen, dass er einiges zu erklären haben würde.
Da er den Kopf ein bisschen von Donna weggedreht hielt, bedachte er mich mit seinem schmalen, geheimnisvollen Lächeln. Was mich stocksauer machte. Edward genoss die Überraschung. Verfluchter Mistkerl.
»Ted, wo sind deine Manieren? Nimm ihr die Tasche ab«, orderte Donna.
Edward und ich starrten auf das kleine Gepäckstück in meiner linken. Er setzte das Ted-Lächeln auf, redete aber Edward-Text: »Anita trägt ihre Sachen gern selbst.«
Donna sah mich fragend an, als könne das unmöglich wahr sein. Vielleicht war sie doch nicht so stark und unabhängig, wie sie schien, oder doch zehn Jahre älter. Eine andere Generation quasi.
»Ted hat recht«, sagte ich mit etwas zu viel Ton auf seinem Namen. »Das tue ich wirklich.«
Donna sah aus, als wollte sie mir meine offensichtlich falsche Ansicht gerne ausreden, es aber aus Höflichkeit doch nicht laut sagen. Ihre Miene, nicht ihr Schweigen, erinnerte mich an meine Stiefmutter Judith. Was meine Altersschätzung auf über fünfzig hochtrieb. Sie war entweder eine ziemlich gut erhaltene Fünfzigerin, eine Vierzigerin oder eine von der Sonne gealterte Dreißigerin. Ich konnte es wirklich nicht sagen.
Sie gingen Arm in Arm vor mir her durch den Flughafen. Ich folgte ihnen, nicht weil mein Gepäck zu schwer war, sondern weil ich ein paar unbeobachtete Minuten für mich brauchte. Ich sah zu, wie Donna den Kopf an Edwards Schulter legte und ihm strahlend das Gesicht zukehrte. Edward-Ted beugte sich zärtlich zu ihr hinab und flüsterte ihr etwas ins Ohr, das sie zum Lachen brachte.
Es reichte bald. Was machte Edward mit dieser Frau? War sie im selben Metier wie er und konnte genauso gut schauspielern? Eigentlich glaubte ich das nicht. Und wenn sie genau das war, was sie zu sein schien – eine Frau, die sich in Ted Forrester verliebt hatte, den es nicht gab – würde ich Edward in den sprichwörtlichen Hintern treten. Was fiel ihm ein, eine unschuldige Frau in seine Tarngeschichte zu ziehen! Oder – und das war ein sehr eigenartiger Gedanke – war Edward-Ted ebenfalls verliebt? Hätten Sie mich das vor zehn Minuten gefragt, hätte ich behauptet, er sei zu tieferen Gefühlen gar nicht fähig, aber jetzt … jetzt war ich vollkommen verwirrt.
Der Flughafen von Albuquerque widerlegte meine These, dass alle Flughäfen gleich sind und man ihnen nicht ansieht, in welchem Teil des Landes oder gar der Welt sie sich befinden. Wenn es Dekor gibt, dann ist es meist umgebungsfremd, wie etwa manche Bars im Inland maritim eingerichtet sind. Aber hier war das anders. Hier sah man überall den Touch des Südwestens. Bunte Kacheln oder Wandbemalungen mit einem Hang zu Türkis und Kobaltblau schmückten die meisten Läden und Werkstattfronten. Ein kleiner überdachter Stand verkaufte Silberschmuck in der Mitte eines breiten Ganges, der von der Abflughalle zum vorderen Bereich des Flughafengebäudes führte. Wir hatten die Leute und den Lärm hinter uns gelassen und bewegten uns durch eine Welt klingender Stille, die von weißen Wänden auf der einen und großen Fenstern auf der anderen Seite unterstrichen wurde. Draußen lag Albuquerque auf einer weiten, flachen Ebene von einem Ring schwarzer Berge umgeben, die wie eine Theaterkulisse wirkten, irgendwie unecht. Die Hitze spürte man trotz der Klimaanlage, man wusste gleich, welche Temperatur einen draußen erwartete. Die Landschaft wirkte vollkommen fremd und trug zu meinem Gefühl bei, mich verirrt zu haben. Etwas, das ich an Edward mochte, war, dass er sich nie veränderte. Er war, was er war, und jetzt hatte er mir auf seine eigene psychotische Art einen so heftigen Curveball zugeworfen, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie ich den Schläger halten sollte.
Donna blieb stehen und drehte sich um, indem sie Edward mitzog. »Anita, die Tasche ist doch zu schwer für dich. Bitte lass Ted sie tragen.« Sie gab ihm einen gutmütigen Schubs in meine Richtung.
Edward kam auf mich zu. Er hatte sogar diesen wiegenden Gang von jemandem, der viel Zeit auf Pferderücken verbringt. Er behielt das Ted-Lächeln bei. Nur seine Augen fielen aus der Rolle und guckten durch die Maske. Tote Augen ohne Ausdruck. Ohne Liebe darin. Verdammter Mistkerl. Er bückte sich tatsächlich ein wenig und hatte schon die Hand am Griff meiner Tasche, sodass ich nur noch loszulassen brauchte.
»Lass das«, fauchte ich und legte meine ganze Wut hinein.
Seine Augen weiteten sich ein klein wenig. Er wusste, ich meinte nicht nur die Reisetasche. Er richtete sich wieder auf und sagte über die Schulter. »Sie will sich nichts von mir tragen lassen.«
Donna machte »tsetse« und kam die zwei Schritte zu mir. »Sei doch nicht dickköpfig, Anita. Lass Ted das Gepäck tragen.«
Ich sah sie an und wusste, dass ich meinen Ärger nicht ganz verbergen konnte.
Donna riss ein bisschen die Augen auf. »Habe ich dich irgendwie gekränkt?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht sauer auf dich.«
Sie sah Edward an. »Ted, Liebling, ich glaube, du hast sie verärgert.«
»Ich fürchte, das stimmt«, sagte Edward. Seine Augen strahlten wieder vor Liebe und guter Laune.
Ich versuchte, die Situation zu retten. »Es ist nur so, dass er mir von der Verlobung hätte erzählen sollen. Ich mag keine Überraschungen.«
Donna legte den Kopf schräg und sah mich prüfend an. Sie setzte zu einem Satz an und überlegte es sich anders. »Nun, dann will ich dafür sorgen, dass du von mir keine mehr erleben wirst.« Sie lehnte sich ein bisschen mehr in Edwards Arm, und der Ausdruck ihrer braunen Augen war ein Spur unfreundlicher als vorher.
Ich begriff, dass sie mich jetzt für eifersüchtig hielt. Meine Reaktion passte nicht zu einer bloßen Freundschaft oder Geschäftsbeziehung. Da ich ihr den wahren Grund für meine Wut nicht sagen durfte, ließ ich es dabei. Besser sie dachte, dass Ted und ich mal ein Paar gewesen waren, als dass die Wahrheit herauskäme. Die Wahrheit über ihren »Ted«. Sie liebte einen Mann, den es nicht gab, egal wie echt sich seine Arme für sie anfühlten.
Ich umklammerte den Griff meiner Tasche umso fester und trat an Donnas Seite, sodass wir zu dritt nebeneinander durch den Flughafen gingen. Es gefiel ihr nicht, wenn ich hinter ihnen herging, darum hielt ich jetzt Schritt. Ich bin schon normalerweise nicht gut in Smalltalk, und jetzt fiel mir kein einziger Satz ein, den ich hätte sagen können. So entstand ein Schweigen, das für mich und für Donna immer unangenehmer wurde. Für sie, weil sie eine Frau und spontan freundlich war, und für mich, weil ich wusste, dass ihr das Schweigen unangenehm war. Ich wollte nicht, dass sie sich unbehaglich fühlte.
Sie brach das Schweigen als Erste. »Ted hat mir erzählt, dass du als Animatorin und Vampirjägerin arbeitest.«
»Eigentlich als Vampirhenker, ja.« Und da ich unbedingt höflich sein wollte, fragte ich: »Und was machst du beruflich?«
Sie ließ ein strahlendes Lächeln aufblitzen, und die Lachfalten an den Mundwinkeln umrahmten ihre ganz dezent geschminkten Lippen. Ich war froh, dass ich kein Make-up trug. Vielleicht würde sie auch daran sehen, dass ich nicht hinter Edward-Ted her war. »Ich habe eine Boutique in Santa Fe.«
»Sie verkauft übersinnlichen Kram«, erklärte Edward und lächelte mich über ihren Kopf hinweg an.
Mein Gesicht verhärtete sich, und ich hatte Mühe, mir nichts anmerken zu lassen. »Welcher Art?«
»Kristalle, Tarotkarten, Bücher, alles, was mir gefällt.«
Ich wollte sagen: »Aber du bist kein Medium« und verkniff es mir. Ich war schon Leuten begegnet, die von ihrer Gabe überzeugt waren, obwohl sie keine hatten. Wenn Donna sich in der Hinsicht Illusionen machte, so war es nicht an mir, ihre Seifenblase zum Platzen zu bringen. Stattdessen fragte ich: »Gibt es in Santa Fe viele Interessenten dafür?«
»Oh, es hat einmal viele solcher Läden bei uns gegeben. New Age war hier ganz groß, aber die Grundsteuern sind so in die Höhe geschossen und die meisten mit einer übersinnlichen Gabe sind in die Berge nach Taos gezogen. Santa Fes Energie hat sich in den letzten fünf Jahren verändert. Es ist noch immer ein sehr positiver Ort, aber Taos hat jetzt eine bessere Energie. Ich bin mir nicht sicher, warum.«
Sie redete von »Energie«, als wäre das eine anerkannte Tatsache, und sagte nichts zur Erklärung. Wie viele Leute nahm sie einfach an, dass, wer sein Geld mit Totenerweckungen verdient, auch auf anderen Gebieten übersinnliche Kräfte haben müsse. Was häufig stimmte, aber nicht immer. Was sie als Energie bezeichnete, nannte ich die Stimmung eines Ortes. Manche hatten eine Stimmung, die gut oder schlecht, stärkend oder entkräftend sein konnte. Die alte Vorstellung vom Genius loci war in der New-Age-Bewegung unter anderem Namen wieder lebendig geworden.
»Legst du Karten?«, fragte ich, um auf höfliche Art herauszufinden, ob sie glaubte, Kräfte zu besitzen.
»Oh nein«, antwortete sie. »Meine Gabe ist sehr gering. Ich würde liebend gern die Karten lesen können, aber ich bin nur eine Ladenbesitzerin. Mein Talent in diesem Leben liegt darin, anderen zu helfen, ihre Stärken zu entdecken.«
Das klang nach einem Therapeuten, der an die Wiedergeburt glaubte. Die hatte ich zur Genüge auf dem Friedhof erlebt, ich kannte ihren Jargon. »Du bist also kein Medium«, folgerte ich. Ich wollte mich nur vergewissern, ob sie es auch wusste.
»Du lieber Himmel, nein.« Sie schüttelte energisch den Kopf, und mir fiel auf, dass sie kleine goldene Henkelkreuze als Ohrringe trug.
»Das ist bei solchen Ladenbesitzern eher die Ausnahme«, sagte ich.
Sie seufzte. »Das Medium, zu dem ich zurzeit gehe, sagt, dass ich in diesem Leben blockiert bin, weil meine Gabe im vorigen missbraucht wurde. Sie sagt, dass ich im nächsten magische Kräfte haben werde.«
Sie setzte auch voraus, dass ich an die Wiedergeburt und Reinkarnationstherapien glaubte, wahrscheinlich auch wegen meines Berufs. Oder Edward-Ted hatte sie nur zum Spaß belogen. Aber ich stellte nicht heraus, dass ich Christin war und nicht an die Wiedergeburt glaubte. Schließlich gibt es mehr Religionen, die daran glauben, als welche, die es nicht tun. Wer bin ich denn, darüber zu streiten?
Die nächste Frage konnte ich mir nicht verkneifen: »Bist du Ted in deinem vorigen Leben schon begegnet?«
»Nein, er ist für mich brandneu. Brenda meint allerdings, dass er eine sehr alte Seele ist.«
»Brenda, dein Medium?«, fragte ich.
Sie nickte.
»Was die alte Seele angeht, bin ich ganz ihrer Meinung«, sagte ich.
Edward warf mir einen Blick zu, den Donna nicht sehen konnte. Es war ein argwöhnischer Blick.
»Dann hast du es auch gespürt, die Art, wie er schwingt. So beschreibt Brenda es. Als ob in ihrem Kopf eine große, schwere Glocke tönt, wenn er in der Nähe ist.«
Wahrscheinlich die Alarmglocke, dachte ich. Laut sagte ich: »Manchmal kann man seine Seele schon in einem Leben sehr schwer machen.«
Sie sah mich ratlos an. Sie war nicht dumm, in diesen braunen Augen steckte Klugheit, aber sie war naiv. Donna wollte glauben. Das machte sie zur leichten Beute für eine bestimmte Sorte Lügner wie Möchtegern-Wahrsager und Männer wie Edward. Männer, die sich hinter einer Fassade verbargen.
»Brenda würde ich gern mal kennenlernen, bevor ich wieder abreise«, schloss ich.
Edwards Augen wurden ein bisschen größer.
Donna lächelte entzückt. »Ich würde euch beide sehr gern miteinander bekannt machen. Sie ist noch nie einem Animator begegnet. Ich weiß, sie fände es richtig aufregend.«
»Da bin ich mir sicher.« Ich wollte Brenda kennenlernen, um zu sehen, ob sie wirklich ein Medium oder nur ein Scharlatan war. Wenn sie damit Geld machte, ohne die Fähigkeiten zu haben, war das ein Gesetzesverstoß, und ich würde sie anzeigen. Ich konnte es nicht mit ansehen, wenn ein Scharlatan Leute ausnutzte. Es wunderte mich immer wieder, wie viele Scharlatane trotz der Anzahl echter Talente von ihrem Betrug gut leben konnten.
Wir gingen an einem Restaurant vorbei, das blaue und rosarote Kacheln mit Gänseblümchenumrandung hatte. Auf einer Rolltreppe fuhren wir auf ein Wandgemälde mit spanischen Eroberern und Indianern im Lendenschurz zu. Meine Reisetasche schleppte ich noch immer ohne Anstrengung, wahrscheinlich durch das viele Gewichtheben.
An einer Seite gab es eine Reihe Münztelefone. »Lasst mich nur mal kurz versuchen, die Kinder zu erwischen«, sagte Donna, küsste Edward auf die Wange und lief zu einem Apparat, bevor ich reagieren konnte.
»Kinder?«
»Ja«, sagte Edward in vorsichtigem Ton.
»Wie viele?«, fragte ich.
»Zwei.«
»Alter?«
»Der Junge vierzehn, das Mädchen sechs.«
»Wo ist ihr Vater?«
»Donna ist Witwe.«
Ich sah ihn an, und der Blick genügte.
»Nein, ich war das nicht. Er war schon Jahre tot, als ich Donna kennengelernt habe.«
Ich trat nah zu ihm heran und drehte Donna den Rücken zu, damit sie mein Gesicht nicht sehen konnte. »Worauf willst du hinaus, Edward? Sie hat Kinder und ist so verliebt in dich, dass mir die Luft wegbleibt. Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Donna und Ted sind seit zwei Jahren zusammen. Sie sind ein Liebespaar. Sie hat von ihm erwartet, dass er um ihre Hand anhält, also hat er es getan.« Sein Gesicht war der lächelnde Ted, sein Ton sachlich und völlig gefühllos.
»Du redest, als wäre Ted eine dritte Person, Edward.«
»Du musst mal anfangen, mich Ted zu nennen, Anita. Ich kenne dich. Wenn du dich nicht schnell daran gewöhnst, wirst du dich verplappern.«
Ich trat noch einen Schritt dichter heran und senkte die Stimme zu einem wütenden Flüstern. »Dann hör auf mit dem Quatsch. Du bist Ted, und du hast dich verlobt. Hast du vor, sie zu heiraten?«
Er zuckte leicht die Achseln.
»Scheiße«, sagte ich. »Das kannst du nicht tun. Du kannst diese Frau nicht heiraten.«
Er lächelte breit und trat um mich herum, um Donna die Hände entgegenzustrecken. Er küsste sie und fragte: »Was machen die Zwerge?« Er zog sie halb in die Arme, sodass sie mich nicht sehen konnte. Er war der lässige Ted, aber seine Augen warnten mich: »Mach es nicht kaputt.« Aus irgendeinem Grund war ihm die Sache wichtig.
Donna drehte sich zu mir herum, und ich rang um ein neutrales Gesicht. »Was hattet ihr beide so heftig zu flüstern?«
»Über den Fall«, log Edward.
»Oh, pfui«, sagte sie.
Ich sah Edward mit hochgezogenen Brauen an. Oh, pfui. Der gefährlichste Mann, den ich kannte, hatte sich mit einer zweifachen Mutter verlobt, die Dinge wie »oh, pfui« sagte. Das war verrückt.
Donna riss die Augen auf. »Wo ist deine Handtasche? Hast du sie im Flugzeug liegenlassen?«
»Ich habe keine mitgenommen«, sagte ich. »Ich habe die Reisetasche und Jackentaschen.«
Sie sah mich an, als würde ich in Rätseln reden. »Mein Gott, ich wüsste nicht, was ich tun sollte ohne mein Ungetüm.« Sie zog ihre Riesenhandtasche nach vorn. »Ich bin eine echte Packratte.«
»Wo sind deine Kinder?«, fragte ich.
»Bei meinen Nachbarn. Sie sind Rentner und gehen ganz prima mit Becca um, meinem kleinen Mädchen.« Sie runzelte die Stirn. »Nur Peter kann zurzeit nichts so richtig zufrieden machen.« Sie sah mich an. »Peter ist mein Sohn. Er ist vierzehn und tut, als wäre er vierzig. Scheinbar ist er mit Schwung in die Pubertät gekommen. Alle haben mir gesagt, dass ein Teenager anstrengend ist, aber ich hätte nicht geglaubt, wie anstrengend.«
»Ist er in Schwierigkeiten geraten?«, fragte ich.
»Eigentlich nicht. Ich meine, er macht nichts Kriminelles.« Das Letzte betonte sie ein wenig zu eilig. »Aber neuerdings hört er nicht mehr auf mich. Vor zwei Wochen sollte er einmal von der Schule nach Hause kommen und auf Becca aufpassen. Stattdessen ist er zu einem Freund gegangen. Als ich nach Ladenschluss kam, war niemand zu Hause, und ich wusste nicht, wo die Kinder waren. Die Hendersons waren weg, also konnte Becca dort nicht sein. Oh Gott, ich war völlig aufgelöst. Eine andere Nachbarin hatte sie zu sich hereingenommen, aber wenn die auch nicht da gewesen wäre, hätte Becca stundenlang vor der Tür gestanden. Und Peter hat es nicht einmal leidgetan. Bis er endlich nach Hause kam, war ich schon überzeugt, es hätte ihn jemand entführt und er läge irgendwo tot im Straßengraben. Stattdessen kam er angeschlendert, als wäre alles in Ordnung.«
»Hat er noch Stubenarrest?«, fragte ich.
Sie nickte mit entschlossener Miene. »Allerdings. Einen Monat lang, und ich habe ihm jedes Privileg gestrichen, das nur irgend ging.«
»Was hält er davon, dass ihr heiraten wollt?« Die Frage war sadistisch, das war mir klar, aber ich konnte einfach nicht anders.
Donna sah gequält aus, wirklich gequält. »Er ist nicht gerade erpicht darauf.«
Erpicht? »Na ja, er ist vierzehn und ein Junge«, sagte ich. »Es ist ganz natürlich, dass er einen anderen Mann ablehnt, der in sein Revier eindringt.«
Donna nickte. »Ja, das fürchte ich auch.«
Ted drückte sie an sich. »Es wird alles gut, Süße. Peter und ich werden uns schon einig. Mach dir keine Sorgen.«
Es gefiel mir nicht, wie Edward sich ausdrückte. Ich musterte sein Gesicht, konnte aber nicht durch die Ted-Maske sehen. Es war, als ob er für ein paar Minuten in sein Alter ego aufgegangen wäre. Ich war noch keine Stunde da, und diese Jekyll-Hyde-Nummer ging mir schon auf die Nerven.
»Hast du noch anderes Gepäck?«, fragte Edward.
»Natürlich«, meinte Donna. »Sie ist eine Frau.«
Er lachte auf, und es klang mehr nach Edward als nach Ted. Bei diesem kleinen zynischen Geräusch blickte Donna ihn prüfend an, und ich fühlte mich gleich besser.
»Anita ist anders als alle Frauen, die ich kenne.«
Donna wiederholte ihren prüfenden Blick. Edward hatte es mit Absicht so ausgedrückt. Er hatte sie bei Überlegungen zur Eifersucht erwischt, genau wie ich, und die nutzte er jetzt aus. Damit ließ sich meine befremdliche Reaktion auf ihre Verlobung erklären, ohne die Tarngeschichte auffliegen zu lassen. Wahrscheinlich konnte ich ihm keinen Vorwurf machen, aber in gewisser Weise war das seine Rache für meinen Mangel an sozialer Kompetenz. Seine Tarnung war ihm so wichtig, dass er Donna lieber denken ließ, wir wären mal ein Paar gewesen – also sehr wichtig. Edward und ich hatten niemals auch nur einen romantischen Gedanken an den anderen verschwendet.
»Ich habe noch anderes Gepäck«, sagte ich.
»Siehst du«, meinte Donna und zupfte ihn am Ärmel.
»In die Reisetasche gingen nicht alle Waffen rein.«
Donna stockte mitten in dem Satz, den sie gerade zu Edward sagte, und drehte sich langsam zu mir herum. Edward und ich hielten an, weil sie stehen geblieben war. Sie schien den Atem anzuhalten und starrte mit großen Augen, aber nicht in mein Gesicht. Einen Mann hätte ich beschuldigt, mir auf die Brust zu glotzen, aber das war auch nicht ganz ihre Blickrichtung. Ich sah an mir hinunter und stellte fest, dass meine Jacke verrutscht war und meine Browning rausguckte. Das musste am Ende der Rolltreppe passiert sein, als ich mir die Tasche zurechtgerückt hatte. Wie gedankenlos von mir. Normalerweise achte ich sehr darauf, mein Arsenal nicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das macht die Leute meistens nervös, so wie jetzt. Ich nahm die Tasche auf die andere Schulter, sodass die Jacke über das Schulterholster fiel wie ein Vorhang.
Donna zog scharf die Luft ein, blinzelte und sah mich an. »Du trägst wirklich eine Waffe.« Sie klang verwundert.
»Das hab ich dir doch gesagt«, erinnerte Edward mit Teds Stimme.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Donna und schüttelte den Kopf. »Ich hatte nur noch nie eine Frau um mich, die … Tötest du auch so unbefangen wie Ted?«
Das war eine sehr kluge Frage, die mir sagte, dass sie vom wirklichen Edward mehr mitbekommen hatte, als ich ihr zugetraut hätte. Darum antwortete ich wahrheitsgemäß. »Nein.«
Edward zog sie in seinen Arm und schoss mir einen warnenden Blick zu. »Anita hält Gestaltwandler nicht für Tiere. Sie glaubt, die Monster könnten gerettet werden. Das macht sie mitunter zimperlich.«
Donna starrte mich an. »Mein Mann wurde von einem Werwolf getötet. Während ich und Peter dabeistanden. Peter war erst acht.«
Ich wusste nicht, was für eine Reaktion sie erwartete, darum gab ich ihr keine. Ich machte ein neutrales, interessiertes, aber kein entsetztes Gesicht. »Was hat euch gerettet?«
Sie nickte langsam. Die Frage war verständlich. Ein Werwolf hatte ihren Mann in Stücke gerissen, und sie und ihr Sohn waren verschont geblieben. Da war etwas dazwischengekommen, das sie gerettet hatte.
»John, mein Mann, hatte ein Gewehr mit Silberschrot geladen. Er hat es fallen lassen, als er angesprungen wurde. Er hatte den Wolf verwundet, aber nicht tödlich.« Bei der Erinnerung war ihr Blick in die Ferne gerichtet. Wir standen in dem hell erleuchteten Flughafengebäude, drei Leute eng beieinander in einem kleinen schweigenden Kreis. Ich brauchte Edward nicht anzusehen, um zu wissen, dass er keine Miene verzog. Donna war still geworden, das Entsetzen in ihren Augen noch ungemindert. Der Anblick genügte. Es war noch etwas Schlimmes passiert. Etwas, weshalb sie sich mindestens schuldig fühlte.
»John hatte Peter gerade in der Woche davor das Schießen beigebracht. Er war noch so klein, aber ich ließ ihn die Waffe aufheben. Ich ließ ihn das Ungeheuer erschießen. Ich ließ ihn im Angesicht dieses Wesens seinen Mann stehen, während ich wie erstarrt am Boden kauerte.«
Das war es also. Das war der wahre Schrecken für sie. Sie hatte sich von ihrem Kind beschützen lassen. Ihrem Kind erlaubt, die Rolle des erwachsenen Beschützers zu übernehmen. Sie hatte den großen Test verhauen, und der kleine Peter war in einem zarten Alter ins Erwachsenendasein gerutscht. Kein Wunder, dass er Edward ablehnte. Er hatte sich das Recht verdient, der Mann im Haus zu sein. Er hatte es mit Blut verdient, und jetzt wollte seine Mutter wieder heiraten. Ja, klar.
Donna wandte mir wieder diesen gequälten Blick zu. Blinzelnd zwang sie sich aus der Vergangenheit zurück. Sie hatte mit dem Geschehen keinen Frieden geschlossen, sonst wäre es nicht mehr so plastisch. Wenn man anfängt, Frieden zu schließen, kann man die schrecklichsten Geschichten erzählen, als wären sie jemand anderem passiert. Oder vielleicht hat man keinen Frieden geschlossen, aber man erzählt sie trotzdem wie eine interessante Geschichte, die vor langer Zeit passiert und nicht mehr wichtig ist. Ich habe Polizisten erlebt, die sich erst betrinken mussten, bevor ihr Schmerz hervorsprudeln konnte.
Donna litt. Peter litt. Edward litt nicht. Ich sah zu ihm hoch, an Donnas leise entsetztem Gesicht vorbei. Seine Augen waren leer, als er mich anblickte, abwartend und geduldig wie bei einem Raubtier. Wie konnte er es wagen, so in ihr Leben zu treten! Wie konnte er es wagen, ihnen noch mehr Kummer zu machen! Egal wie es ausging, ob er sie nun heiratete oder nicht, es würde schmerzhaft werden. Für alle, außer für ihn. Doch daran konnte ich vielleicht etwas ändern. Wenn er Donna das Leben versaute, könnte ich vielleicht seines versauen. Ja, das gefiel mir. Ich würde ihm kräftig den Spaß verderben.
Ein, zwei Sekunden lang musste es mir anzusehen gewesen sein, denn Edward machte die Augen schmal, und mir lief der Schauder über den Rücken, den er mir mit einem Blick einjagen konnte. Er war ein sehr gefährlicher Mann, doch um diese Familie zu beschützen, würde ich seine Grenzen austesten. Und meine. Edward hatte etwas getan, das mich so sauer machte, dass ich vielleicht doch noch den Knopf drückte, den ich nie hatte berühren wollen. Er sollte Donna und ihre Familie in Ruhe lassen. Er musste aus ihrem Leben verschwinden. Oder es passierte etwas. Und bei Edward konnte dieses Etwas nur eines sein: tödlich.
Wir blickten uns über Donnas Kopf hinweg an, während er sie an seine Brust drückte, ihr übers Haar strich und beruhigende Worte flüsterte. Sein Gesichtsausdruck galt mir, und er wusste ganz genau, was ich dachte. Er wusste, zu welchem Entschluss ich gekommen war, auch wenn er vielleicht nie verstehen würde, warum seine Beziehung zu dieser Familie der Strohhalm war, unter dem das Kamel zusammenbrach. Ich sah es ihm an. Er verstand nicht, warum, aber er wusste, das Kamel war zusammengebrochen und würde nur weiterlaufen, wenn er genau tat, was ich wollte. Ich war mir meiner Sache vollkommen sicher. Ich wusste, ich könnte am Lauf entlangsehen und auf Edward schießen, und ich würde es nicht auf eine Verwundung anlegen. Es lag mir wie ein kaltes Gewicht im Leib, eine Gewissheit, mit der ich mich stärker fühlte und ein bisschen einsamer. Edward hatte mir mehr als einmal das Leben gerettet. Und ich mehr als einmal seins. Und … tja … er würde mir fehlen. Trotzdem würde ich ihn töten, wenn es sein musste. Edward fragte sich immer, warum ich für die Monster so viel Verständnis hatte. Die Antwort ist einfach: Weil ich auch eins bin.
3
Wir traten in die Hitze hinaus, die uns mit einem warmen Wind entgegenprallte. Sie war beträchtlich, und da es erst Mai war, würde sie sich noch zu einem echten Scheunenbrenner entwickeln, wenn der eigentliche Sommer kam. Aber es ist wahr, dass dreißig Grad ohne Feuchtigkeit nicht annähernd so schrecklich sind wie mit Feuchtigkeit, und darum war es erträglich. Wenn man einmal gegen die Sonne anblinzelte und sich auf die Hitze einstellte, vergaß man sie fast. Man stöhnte höchstens in den ersten fünfzehn Minuten. St. Louis würde bis zu meiner Rückkehr wahrscheinlich fünfunddreißig Grad haben und zwischen achtzig und hundert Prozent Luftfeuchtigkeit. Natürlich war die Rückkehr fraglich. Wenn ich mich wirklich mit Edward anlegte, war der Ausgang keineswegs sicher. Es gab eine sehr reelle Chance, dass er mich tötete. Ich hoffte, hoffte zutiefst, dass ich ihm die Beziehung zu Donna würde ausreden können, ohne Gewalt anzuwenden.
Vielleicht wirkte die Hitze auch nicht so schlimm wegen der Landschaft. Albuquerque war von einem Kreis schwarzer Berge umgeben, die wie Kohlehalden aussahen. Ja, es sah aus wie der größte Tagebau der Welt und vermittelte den Eindruck von Abfall und Verwüstung. Von verdorbenen Dingen und einer befremdlichen Feindseligkeit, als käme man gerade ziemlich ungelegen. Ich schätze, Donna würde sagen: schlechte Energie. Ich war noch an keinem Ort gewesen, der so augenblicklich feindselig auf mich wirkte. Edward trug meine beiden Koffer, die mit dem Gepäckband gekommen waren. Normalerweise hätte ich auch einen getragen, aber jetzt nicht. Jetzt wollte ich, dass Edward beide Hände voll hatte und keine Waffe ziehen konnte. Er sollte im Nachteil sein. Ich würde nicht auf dem Weg zum Wagen eine Schießerei anfangen, doch Edward war immer pragmatischer als ich. Wenn er zu dem Schluss käme, dass ich mehr Gefahr als Hilfe bedeutete, wäre er imstande, auf dieser kurzen Strecke einen Unfall zu arrangieren. Das wäre zwar schwierig, weil Donna dabei war, aber nicht unmöglich. Nicht für Edward.
Auch deswegen ließ ich ihn vorangehen und nicht hinter mir laufen. Das war nicht paranoid, nicht bei Edward. Bei ihm war das einfach gute Überlebenstaktik.
Edward bat Donna vorauszugehen und den Wagen aufzuschließen. Er lief langsamer, bis er neben mir war, und ich legte einige Distanz zwischen uns, sodass wir mitten auf dem Bürgersteig standen und uns anblickten wie zwei alte Revolverhelden.
Er behielt die Koffer in der Hand. Ich glaube, er wusste, dass ich überreizt war. Dass ich, sowie er die Koffer abstellte, die Waffe in der Hand hätte. »Willst du wissen, warum es mir nichts ausgemacht hat, vor dir herzugehen?«
»Weil du weißt, dass ich dir nicht in den Rücken schießen würde«, sagte ich.
Er schmunzelte. »Und du wusstest, ich würde.«
Ich neigte den Kopf zur Seite und blinzelte ein bisschen gegen die Sonne. Edward trug natürlich eine Sonnenbrille. Aber da seine Augen sowieso selten etwas verrieten, war das egal. Es waren nicht seine Augen, auf die ich achten musste.
»Du liebst die Gefahr, Edward. Darum jagst du nur Monster. Du willst jedes Mal, wenn du zuschlägst, das große Risiko erleben, sonst macht es keinen Spaß.«
Ein Pärchen eilte mit einem Wagen voller Koffer an uns vorbei. Wir warteten still, bis sie weg waren. Die Frau sah uns im Vorbeigehen an, sie spürte wohl die Anspannung. Der Mann zog sie herum, damit sie nach vorn schaute, und schob den Wagen weiter.
»Hast du ein Argument?«, fragte Edward.
»Du willst wissen, wer von uns besser ist. Das willst du schon lange. Wenn du mich von hinten erledigst, bleibt die Frage unbeantwortet, und das würde dich ärgern.«
Sein Lächeln wurde breiter und zugleich freudloser. »Also schieße ich dir nicht in den Rücken.«
»Genau.«
»Und warum sorgst du dann dafür, dass ich beide Hände voll habe und vor dir hergehe?«
»Weil das ein schlechter Zeitpunkt wäre, um sich zu irren.«
Darauf lachte er leise und ein bisschen finster. Dieser Klang sagte alles. Er fand die Vorstellung, gegen mich anzutreten, aufregend. »Ich würde nur zu gerne Jagd auf dich machen, Anita. Das ist ein Traum von mir.« Er seufzte, und es klang beinahe traurig. »Aber ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, um diesen Fall zu lösen. Und so sehr ich gern die Antwort auf die große Frage wüsste, so sehr würde ich dich vermissen. Du bist vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, den ich wirklich vermissen würde.«
»Was ist mit Donna?«
»Was soll mit ihr sein?«
»Komm mir nicht so, Edward.« Ich blickte an ihm vorbei und sah Donna vom Parkplatz rüberwinken. »Wir werden beobachtet.«
Er drehte sich zu ihr um und hob einen Koffer, um zurückzuwinken. Es wäre einfacher gewesen, ihn so lange abzustellen, aber auf seine Art war Edward auch auf der Hut.
»Du wirst deine Arbeit nicht erledigen können, wenn du ständig über die Schulter gucken musst«, sagte er dann zu mir. »Also schließen wir einen Waffenstillstand, bis der Fall gelöst ist.«
»Dein Wort darauf?«
Er nickte. »Mein Wort darauf.«
»Na schön.«
Er lächelte, und es war echt. »Der einzige Grund, weshalb du mein Wort für bare Münze nehmen kannst, ist der, dass man sich auf dein Wort verlassen kann.«
Ich schüttelte den Kopf und schloss allmählich zu ihm auf. »Ich halte mein Wort, aber die Schwüre anderer Leute nehme ich nicht allzu ernst.« Als ich mit ihm auf gleicher Höhe war, spürte ich seinen Blick durch die dunkle Sonnenbrille auf mir lasten. Er war angespannt, er war Edward.
»Aber meinen schon.«
»Du hast mich noch nie belogen, Edward, nicht nachdem du mir dein Wort gegeben hattest. Du tust, was du vorher gesagt hast, auch wenn es etwas Negatives ist. Du verbirgst nicht, wie du bist, zumindest nicht vor mir.«
Wir schauten zu Donna hinüber und machten uns nebeneinander auf den Weg zu ihr, während wir taten, als würden wir uns unterhalten. »Warum hast du es erst so weit kommen lassen? Wie konntest du Ted um ihre Hand anhalten lassen?«