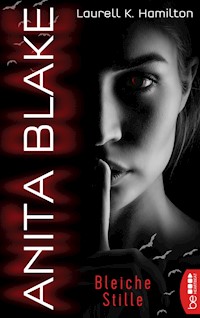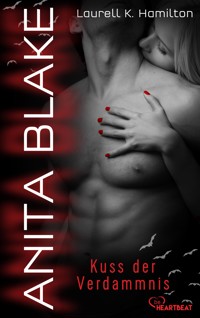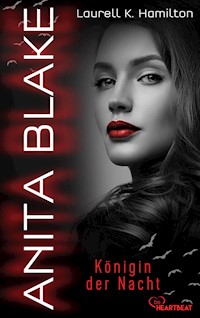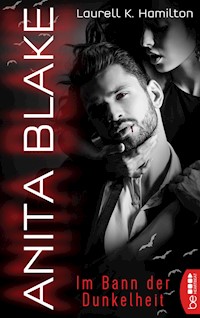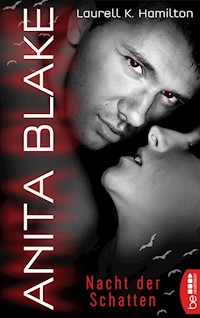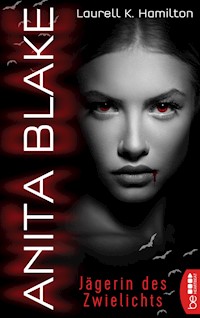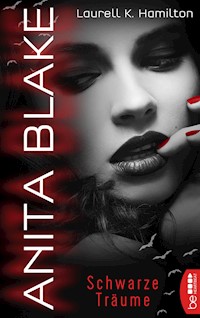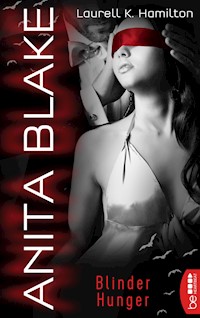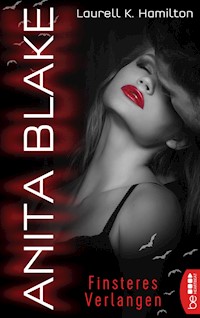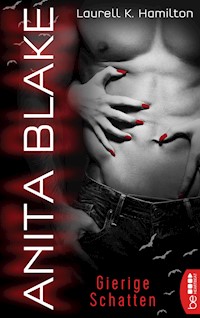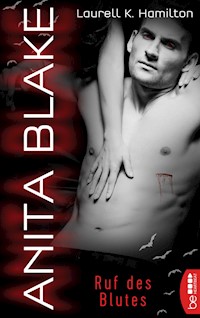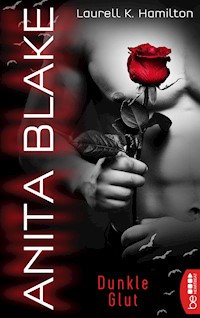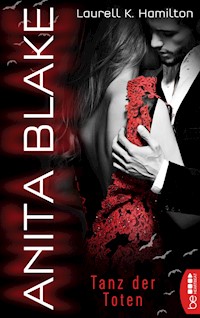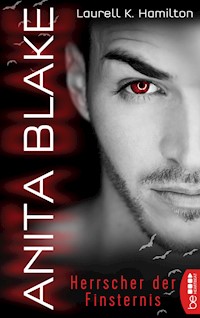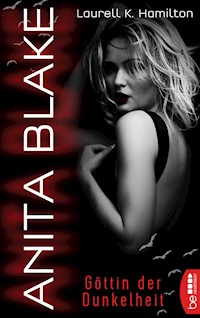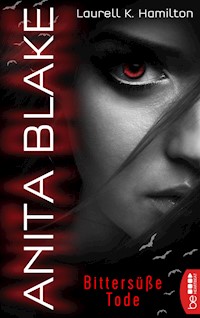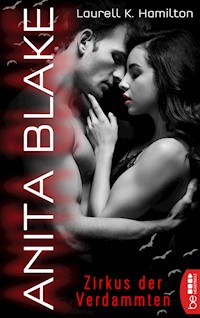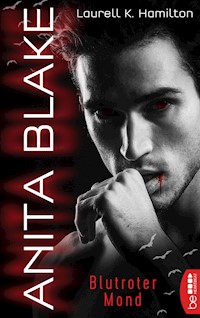
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Vergiss Buffy, die Vampirjägerin. Anita Blake zeigt dir, wie es WIRKLICH zugeht unter Vampiren, Untoten und Gestaltwandlern ...
Eine Million Dollar ist eine Menge Geld. Harold Gaynor bietet Anita Blake diese Summe für einen 'Job'. Doch dieser Auftrag hat es in sich: Anita soll einen dreihundert Jahre alten Leichnam zum Leben erwecken. Sie lehnt ab, denn sie weiß, dass dafür ein Menschenopfer nötig wäre. Doch als die Stadt kurz darauf von einer Mordwelle heimgesucht wird, ahnt Anita, dass jemand den Auftrag angenommen hat. Jemand, der weniger Skrupel hat. Nun muss sie all ihre Kraft und Fähigkeiten aufbringen, um den Killer-Zombie und die Voodoo-Priesterin, die ihn kontrolliert, auszuschalten ...
Spannend und scharf, brutal und emotional geladen - ein neuer Fall für Vampirjägerin Anita Blake.
"Was Dan Browns ‚Sakrileg - Der DaVinci Code‘ für den Vatikanthriller ist, ist die Anita-Blake-Serie für den Vampirroman!" USA Today
Nächster Band: Anita Blake - Zirkus der Verdammten.
Über die Reihe: Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin - Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen "Scharfrichterin" eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen - durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah ...
Bei der "Anita Blake"-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart - dem "Anitaverse".
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u.a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, ...).
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die Serie: Anita Blake – Vampire HunterÜber diesen BandÜber die AutorinTriggerwarnungTitelImpressumWidmungDANKSAGUNG12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940VorschauÜber die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u. a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Vergiss Buffy, die Vampirjägerin. Anita Blake zeigt dir, wie es WIRKLICH zugeht unter Vampiren, Untoten und Gestaltwandlern …
Eine Million Dollar ist eine Menge Geld. Harold Gaynor bietet Anita Blake diese Summe für einen ›Job‹. Doch dieser Auftrag hat es in sich: Anita soll einen dreihundert Jahre alten Leichnam zum Leben erwecken. Sie lehnt ab, denn sie weiß, dass dafür ein Menschenopfer nötig wäre. Doch als die Stadt kurz darauf von einer Mordwelle heimgesucht wird, ahnt Anita, dass jemand den Auftrag angenommen hat. Jemand, der weniger Skrupel hat. Nun muss sie all ihre Kraft und Fähigkeiten aufbringen, um den Killer-Zombie und die Voodoo-Priesterin, die ihn kontrolliert, auszuschalten …
Spannend und scharf, brutal und emotional geladen – ein neuer Fall für Vampirjägerin Anita Blake.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Blutroter Mond
Aus dem amerikanischen Englisch von Angela Koonen
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1994 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Laughing Corpse«
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2005/2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Blutroter Mond«
Lektorat: Mona Gabriel/Stefan Bauer
Covergestaltung: Guter Punkt, München
unter Verwendung von Motiven © iStock/BojanMirkovic; iStock; iStock/closeupimages
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0238-6
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meine Agentin Ricia Mainhardt,die schön, intelligent, zuversichtlich und aufrichtig ist.Was könnte sich ein Autor mehr wünschen?
DANKSAGUNG
Dank gebührt wie immer meinem Ehemann Gary, der nach fast neun Jahren noch immer mein Schatz ist; Ginjer Buchanan, unserem Lektor, der sofort an Anita und mich geglaubt hat; Carolyn Caughey, unserer englischen Lektorin, die Anita und mich übers Meer gebracht hat; Marcia Woolsey, die die erste Anita-Kurzgeschichte gelesen und für gut befunden hat (Marcia, rufen Sie bitte meinen Verleger an, ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten); Richard A. Knaak, der ein guter Freund und ehrenamtlicher Alternate Historian ist (du kommst schon noch dazu, den Rest des Buches zu lesen); Janni Lee Simner, Marella Sands und Robert K. Sheaf, die dafür gesorgt haben, dass dieses Buch allein besteht (viel Glück in Arizona, Janni, wir werden dich vermissen); Deborah Millitello, die mir die Hand gehalten hat, wenn ich es brauchte; M. C. Sumner, der ein Nachbar und Freund ist; den Alternate Historians auf ewig und Dank jedem, der meine Lesungen in Windycon und Capricon besucht hat.
1
Das Haus von Harold Gaynor stand mitten auf einem saftig grünen Rasen, die Bäume zu beiden Seiten in einem anmutigen Bogen. Es leuchtete in der heißen Augustsonne. Bert Vaughn, mein Boss, parkte den Wagen auf dem Kies der Auffahrt. Der Kies war so weiß, dass er aussah wie handverlesenes Steinsalz. Von irgendwo hörte man das leise Prasseln eines Sprengers. Während einer der schlimmsten Dürren in Missouri seit über zwanzig Jahren war dieser Rasen absolut perfekt. Nun gut. Ich war nicht hier, um mit Mr Gaynor über Wasserwirtschaft zu plaudern. Ich war hier, um die Erweckung eines Toten zu besprechen.
Nicht Auferstehung. So gut bin ich nicht. Ich rede von Zombies. Den schlurfenden Toten. Nacht der lebenden Toten und dergleichen. Allerdings sind sie weniger dramatisch, als Hollywood sie bisher auf die Leinwand gebracht hat. Ich bin Animator. Das ist ein Beruf, weiter nichts, wie Verkäufer.
Tote erwecken ist erst seit fünf Jahren ein amtlich genehmigtes Gewerbe. Bis dahin galt es als Plage, als religiöses Experiment oder als Touristenattraktion. In einigen Stadtteilen von New Orleans ist das noch immer so, aber hier in St. Louis ist es ein Gewerbe. Und zwar ein einträgliches, was größtenteils meinem Boss zu verdanken ist. Er ist ein Halunke, ein Lump, ein Gauner, aber wie man Geld macht, weiß er. Das ist eine gute Eigenschaft für einen Geschäftsmann.
Bert ist einszweiundneunzig und breitschultrig, ein einstiger College-Football-Spieler mit beginnendem Bierbauch. Der dunkelblaue Anzug, den er anhatte, war maßgeschneidert, sodass der Bauch nicht auffiel. Für achthundert Dollar sollte der Anzug sogar eine Herde Elefanten kaschieren. Seinem weißblonden Haar hatte er einen Bürstenschnitt verpasst – nach all den Jahren nun wieder gepflegt. Zusammen mit der Segelbräune und den hellen Augen ergab das einen dramatischen Kontrast.
Bert rückte die blaurot gestreifte Krawatte zurecht und wischte sich die Schweißperlen von der Stirn. »In den Nachrichten habe ich gehört, dass es Bestrebungen gibt, Zombies auf pestizidverseuchten Feldern einzusetzen. Das würde Leben retten.«
»Zombies verwesen, Bert, es gibt kein Mittel, um das zu verhindern, und ihre Intelligenz hält sich nicht lange genug, als dass man sie als Feldarbeiter verwenden könnte.«
»Es ist nur eine Überlegung. Die Toten haben vor dem Gesetz keine Rechte, Anita.«
»Noch nicht.«
Es war falsch, Tote zu erwecken, damit sie für uns Sklavenarbeit verrichteten. Einfach falsch, aber auf mich hörte ja niemand. Irgendwann musste die Regierung handeln. Es wurde eine landesweite Kommission aus Animatoren und anderen Experten gebildet. Wir sollten die Arbeitsbedingungen der örtlichen Zombies prüfen.
Arbeitsbedingungen. Sie verstanden das gar nicht. Einer Leiche kann man keine freundlichen Arbeitsbedingungen einräumen. Sie wissen es ohnehin nicht zu schätzen. Zombies können wohl laufen, sogar sprechen, aber sie sind sehr, sehr tot.
Bert lächelte mich nachsichtig an. Ich bekämpfte den Drang, ihm eine gerade Rechte in das selbstgefällige Gesicht zu pflanzen. »Ich weiß, dass Sie und Charles in dieser Kommission mitarbeiten«, sagte er. »In die Firmen rennen und die Zombies überprüfen. Das gibt großartige Presse für Animators, Inc.«
»Ich tue das nicht für gute Presse«, erwiderte ich.
»Ich weiß. Sie glauben an diese kleinen Dinge.«
»Sie sind ein arroganter Mistkerl«, sagte ich süß lächelnd.
Er grinste mich an. »Ich weiß.«
Ich schüttelte nur den Kopf; gegen Bert kann man beim Wettbeleidigen wirklich nicht gewinnen. Es kümmert ihn nicht im Geringsten, was ich von ihm halte, solange ich für ihn arbeite.
Meine marineblaue Kostümjacke sollte sommerlich leicht sein, aber das war gelogen. Der Schweiß rann mir die Wirbelsäule hinunter, seit ich aus dem Wagen gestiegen war.
Bert drehte sich zu mir um und kniff die Augen zusammen. Sie eigneten sich hervorragend für misstrauische Blicke. »Sie haben Ihre Waffe noch um«, stellte er fest.
»Unter der Jacke sieht man sie nicht, Bert. Mr Gaynor wird es nie erfahren.« An den Riemen meines Schulterholsters sammelte sich der Schweiß. Ich konnte spüren, wie die Seidenbluse langsam schmolz. Normalerweise versuche ich, Seide und Schulterriemen nicht zur selben Zeit zu tragen. Die Seide wird zerdrückt und unter den Riemen faltig. Die Waffe war eine 9 mm Browning Hi-Power, und ich hatte sie gern schnell zur Hand.
»Kommen Sie, Anita. Ich glaube nicht, dass Sie bei einer Besprechung mit einem Klienten mitten am Nachmittag eine Waffe brauchen.« Er sprach in dem gönnerhaften Ton, den Erwachsene bei Kindern anwenden. Nun, kleines Mädchen, du weißt, dass es nur zu deinem Besten ist.
Mein Wohlergehen war Bert gleichgültig. Er wollte nur Gaynor nicht verschrecken. Der Mann hatte uns bereits einen Scheck über fünftausend Dollar gegeben. Und das nur, damit wir zu ihm herausfuhren und mit ihm redeten. Eine Menge Geld. Deswegen war Bert schon ganz aufgeregt. Ich war skeptisch. Schließlich brauchte Bert die Leiche nicht zu erwecken. Aber ich.
Das Dumme war, dass Bert wahrscheinlich Recht hatte. Am helllichten Tag würde ich keine Waffe brauchen. Wahrscheinlich. »Also gut, öffnen Sie den Kofferraum.«
Bert schloss den Kofferraum seines fast brandneuen Volvos auf. Ich zog mir derweil die Jacke aus. Er stellte sich vor mich, um mich gegen Blicke vom Haus zu schützen. Gott bewahre, dass sie mich dabei sahen, wie ich eine Waffe in den Kofferraum legte. Was würden sie tun, die Türen verschließen und um Hilfe schreien?
Ich wickelte die Holsterriemen um die Waffe und legte sie in den sauberen Kofferraum. Er roch nach Neuwagen, nach Plastik und ein bisschen unecht. Bert schloss die Haube, und ich starrte darauf, als könnte ich durch das Blech die Waffe sehen.
»Kommen Sie?«, fragte er.
»Ja«, sagte ich. Es gefiel mir nicht, die Pistole zurückzulassen, egal, aus welchem Grund. War das ein schlechtes Zeichen? Bert winkte mir, ich solle kommen.
Ich tat es und ging mit meinen hohen schwarzen Pumps vorsichtig über den Kies. Frauen dürfen zwar viele schöne Farben tragen, aber Männer die bequemen Schuhe.
Bert heftete den Blick auf die Tür, das Lächeln war schon in Position. Es war sein professionellstes Lächeln, es triefte vor Aufrichtigkeit. Seine hellgrauen Augen versprühten gute Laune. Eine Maske. Er konnte sie so schnell auf- und absetzen, wie man einen Lichtschalter umlegt. Er würde dasselbe Lächeln aufsetzen, wenn man ihm gestände, die eigene Mutter umgebracht zu haben. Solange man ihm den Auftrag gab, sie von den Toten zu erwecken, und dafür bezahlte.
Die Tür wurde geöffnet, und ich wusste, dass Bert sich geirrt hatte. Der Mann war nur einssechsundsiebzig, aber sein orangenes Polohemd spannte über der Brust. Das schwarze Sportsakko sah zu klein aus, als ob der Stoff bei der nächsten Bewegung reißen würde, wie bei einem Insekt, das aus seiner Chitinhülle herauswächst. Die schwarzen Jeans betonten seine schmale Taille, sodass er aussah, als habe ihn jemand in der Mitte eingeschnürt, ehe der Ton trocken war. Seine Haare waren sehr blond. Er sah uns stumm an. Seine Augen wirkten leer und tot wie bei einer Puppe. Ich sah sein Schulterholster unter dem Sakko hervorblitzen und widerstand dem Drang, Bert vors Schienbein zu treten.
Entweder bemerkte mein Boss die Waffe nicht, oder er ignorierte sie. »Hallo, ich bin Bert Vaughn, und das ist meine Mitarbeiterin, Anita Blake. Ich glaube, Mr Gaynor erwartet uns.« Bert lächelte ihn charmant an.
Der Leibwächter – was sollte er sonst sein – bewegte sich von der Tür weg. Bert nahm das als Einladung und trat ein. Ich folgte ihm, überhaupt nicht sicher, ob ich das wollte. Harold Gaynor war ein sehr reicher Mann. Vielleicht brauchte er einen Leibwächter. Vielleicht war er bedroht worden. Oder vielleicht war er einer von denen, die Geld genug haben, um sich Muskelfleisch zu halten, ob sie es brauchen oder nicht.
Oder vielleicht ging hier etwas anderes vor. Etwas, wobei man Waffen und Muskeln braucht und Männer mit emotionslosen, toten Augen. Kein heiterer Gedanke.
Die Klimaanlage war zu hoch eingestellt, und der Schweiß gelierte auf der Stelle. Wir folgten dem Leibwächter durch eine lange, in der Mitte gelegene Eingangshalle, die mit dunklem, teuer aussehendem Holz getäfelt war. Der orientalische Teppich war sicher handgeknüpft.
Auf der rechten Seite gab es eine wuchtige Holztür. Der Leibwächter öffnete sie und ging zur Seite, um uns durchzulassen. Wir betraten eine Bibliothek, aber ich wettete, dass die Bücher noch keiner gelesen hatte. Die dunklen Regale reichten vom Boden bis zur Decke. Es gab sogar eine zweite Etage mit Büchern, zu der eine elegante schmale Wendeltreppe hinaufführte. Es standen nur gebundene Ausgaben da, und sie waren alle gleich groß, die Farben gedeckt und wie zu einem Gesamtbild zusammengestellt. Die Sitzmöbel waren, wie sollte es anders sein, aus rotem Leder mit Messingnägeln.
Am anderen Ende des Raumes saß ein Mann. Als wir hereinkamen, lächelte er uns an. Er war groß, hatte ein freundliches, rundes Gesicht mit einem Doppelkinn. Er saß in einem elektrischen Rollstuhl und hatte ein Plaid über dem Schoß, das seine Beine verbarg.
»Mr Vaughn und Ms Blake, wie nett, dass Sie zu mir herausgekommen sind.« Die Stimme passte zum Gesicht, klang freundlich, fast gewinnend.
Ein schlanker schwarzer Mann saß lang ausgestreckt in einem der Ledersessel, die Beine über Kreuz. Er war über einsachtzig groß, wie viel darüber war schwer zu sagen. Seine Beine waren länger als ich. Er musterte mich mit seinen braunen Augen, als würde er sich alles einprägen und später abgefragt werden.
Der blonde Leibwächter lehnte sich an ein Bücherregal. Er konnte kaum die Arme verschränken, so eng saß die Jacke. Man sollte sich nicht gegen eine Wand lehnen und versuchen, hart auszusehen, wenn man nicht die Arme verschränken kann. Ruiniert einfach die Wirkung.
Mr Gaynor sagte: »Tommy kennen Sie bereits, und das ist Bruno.« Er deutete auf den Mann im Sessel.
»Heißen Sie wirklich so, oder ist das ein Spitzname?«, fragte ich und sah Bruno fest in die Augen.
Er verrutschte leicht auf seinem Sitz. »Ich heiße so.«
Ich lächelte.
»Warum?«, fragte er.
»Ich habe noch nie einen Leibwächter gesehen, der wirklich Bruno hieß.«
»Soll das komisch sein?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf. Bruno. Er hatte nie eine Chance gehabt. Wie wenn man ein Mädchen Venus nannte. Jeder Bruno wurde Leibwächter. Das war ein Gesetz. Vielleicht auch mal Cop? Nein, doch nicht, das war ein Name für die bösen Jungs. Ich lächelte.
Mit einer geschmeidigen, kraftvollen Bewegung richtete sich Bruno in seinem Sessel auf. Er war unbewaffnet, soweit ich sehen konnte, aber er hatte etwas an sich. Achtung, gefährlich, sagte es mir.
Wahrscheinlich hätte ich nicht lächeln sollen.
Bert schaltete sich ein: »Anita, bitte. Ich entschuldige mich, Mr Gaynor … Mr Bruno. Ms Blake hat einen recht seltsamen Humor.«
»Entschuldigen Sie sich nicht für mich, Bert. Ich mag das nicht.« Ich weiß nicht, warum er überhaupt so verärgert war. Das wirklich Beleidigende hatte ich gar nicht ausgesprochen.
»Nun, nun«, sagte Mr Gaynor. »Niemand ist böse. Stimmt’s, Bruno?«
Bruno schüttelte den Kopf und sah mich stirnrunzelnd an, nicht verärgert, sondern eher verdutzt.
Bert warf mir einen wütenden Blick zu, dann wandte er sich lächelnd dem Mann im Rollstuhl zu. »Nun, Mr Gaynor, ich weiß, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Darum frage ich Sie: Wie alt ist der Tote, den Sie erwecken wollen?«
»Ein Mann, der gleich zum Wesentlichen kommt. Das gefällt mir.« Gaynor zögerte und schaute zur Tür. Eine Frau trat in die Bibliothek.
Sie war langbeinig und blond und hatte kornblumenblaue Augen. Das Kleid, falls es eins war, war rosenrot und seidig. Es schmiegte sich eng an ihren Körper, verbarg dabei, was der Anstand erforderte, und überließ wenig der Fantasie. Die langen blassen Beine steckten in pinkfarbenen Stilettos. Keine Strümpfe. Sie stelzte über den Teppich, und jeder Mann im Raum betrachtete sie eingehend. Und sie wusste es.
Sie warf den Kopf zurück und lachte, aber es kam kein Laut heraus. Ihr Gesicht hellte sich auf, die Lippen bewegten sich, die Augen strahlten, aber in vollkommener Stille, als hätte jemand den Ton abgedreht. Sie lehnte sich mit der Hüfte gegen Harold Gaynor, eine Hand auf seiner Schulter. Er fasste sie um die Taille, und die Bewegung schob das ohnehin kurze Kleid noch ein paar Zentimeter höher.
Konnte sie sich in dem Kleid setzen, ohne den ganzen Raum zu blenden? Wohl nicht.
»Das ist Cicely«, sagte er. Sie strahlte Bert an, und dieses kleine lautlose Lachen ließ ihre Augen aufleuchten. Sie sah zu mir, und ihr Blick schwankte, das Lächeln entglitt. Eine Sekunde lang waren ihre Augen voller Unsicherheit. Gaynor tätschelte ihr die Hüfte. Das Lächeln flammte wieder auf. Sie nickte uns beiden freundlich zu.
»Ich möchte, dass Sie eine zweihundertdreiundachtzig Jahre alte Leiche erwecken.«
Ich starrte ihn an und überlegte, ob er wusste, was er verlangte.
»Also«, meinte Bert, »das sind fast dreihundert Jahre. Sehr alt. Die meisten Animatoren würden das gar nicht können.«
»Das ist mir bewusst«, sagte Gaynor. »Aus diesem Grund habe ich um Ms Blake gebeten. Sie kann es.«
Bert sah mich von der Seite an. Ich hatte noch nie eine erweckt, die so alt war. »Anita?«
»Ich könnte es tun«, sagte ich.
Er lächelte Gaynor an, hocherfreut.
»Aber ich werde es nicht tun.«
Bert wandte mir langsam das Gesicht zu, das Lächeln war verschwunden.
Gaynors nicht. Die Leibwächter regten sich nicht. Cicely schaute mich freundlich an, der Blick bar jeder Bedeutung.
»Eine Million Dollar, Ms Blake«, sagte Gaynor mit seiner leisen, freundlichen Stimme.
Ich sah Bert schlucken. Seine Hände schlossen sich fest um die Stuhllehnen. Für Bert war Geld dasselbe wie Sex. Wahrscheinlich hatte er jetzt den größten Ständer seines Lebens.
»Wissen Sie, was Sie verlangen, Mr Gaynor?«, fragte ich.
Er nickte. »Ich werde die weiße Ziege zur Verfügung stellen.« Er hörte sich nach wie vor freundlich an, lächelte noch immer. Nur seine Augen waren dunkel geworden, gierig, vorwegnehmend.
Ich stand auf. »Kommen Sie, Bert, es ist Zeit zu gehen.«
Bert fasste meinen Arm. »Anita, setzen Sie sich, bitte.«
Ich blickte auf seine Hand, bis er mich losließ. Die Maske des Charmes fiel ab und zeigte mir den Ärger darunter, dann war er wieder ganz der angenehme Geschäftsmann. »Anita, das ist eine großzügige Bezahlung.«
»Die weiße Ziege ist ein Symbol, Bert. Es bedeutet ein Menschenopfer.«
Mein Boss schaute zu Gaynor, dann wieder zu mir. Er kannte mich gut genug, um mir zu glauben, aber er wollte es nicht. »Ich verstehe nicht«, sagte er.
»Je älter die Leiche, desto größer das Opfer, um sie zu erwecken. Nach ein paar hundert Jahren ist nur noch ein menschliches Opfer ausreichend«, sagte ich.
Gaynor lächelte nicht mehr. Er betrachtete mich aus dunklen Augen. Cicely sah uns noch immer liebenswürdig an. Wohnte da jemand hinter diesen ach so blauen Augen? »Möchten Sie wirklich in Gegenwart von Cicely über Mord sprechen?«, fragte ich.
Gaynor strahlte mich an, immer ein schlechtes Zeichen. »Sie kann kein Wort verstehen. Cicely ist taub.«
Ich starrte ihn an, und er nickte. Ihre Augen blieben freundlich. Wir redeten über Menschenopfer, und sie ahnte es nicht einmal. Wenn sie Lippen lesen konnte, dann verbarg sie es sehr gut. Ich nehme an, sogar Behinderte, äh, entschuldigen Sie den Ausdruck, können in schlechte Gesellschaft geraten, aber es kam mir falsch vor.
»Ich verabscheue Frauen, die in einem fort reden«, bemerkte Gaynor.
Ich schüttelte den Kopf. »Kein Geld der Welt kann mich dazu bringen, für Sie zu arbeiten.«
»Könnten Sie nicht einfach sehr viele Tiere anstatt nur eines töten?«, fragte Bert. Bert ist ein sehr guter Geschäftsmann. Aber er hat keinen blassen Schimmer von Totenerweckungen.
Ich sah eindringlich zu ihm hinunter. »Nein.«
Bert saß sehr still in seinem Lehnstuhl. Die Aussicht, eine Million Dollar zu verlieren, musste ihm körperliche Qualen bereiten, aber es war ihm nicht anzusehen. Der geborene Firmenunterhändler. »Es muss einen Weg geben, wie wir das bewerkstelligen können«, sagte er. Er klang ruhig. Ein professionelles Lächeln kräuselte seine Lippen. Er versuchte noch immer, ein Geschäft zu machen. Mein Boss verstand nicht, was sich abspielte.
»Kennen Sie einen anderen Animator, der einen so alten Toten erwecken kann?«, fragte Gaynor.
Bert blickte mich von unten an, dann auf den Boden, dann zu Gaynor. Sein Lächeln war dünn geworden. Er hatte inzwischen begriffen, dass wir über Mord redeten. Würde das etwas ändern?
Ich hatte mich schon immer gefragt, wo Bert die Grenze zog. Gleich würde ich es erfahren. Die Tatsache, dass ich nicht einschätzen konnte, ob er den Vertrag ablehnen würde, sagt eine Menge über meinen Boss. »Nein«, antwortete er sanft, »nein, ich glaube, ich kann Ihnen auch nicht helfen, Mr Gaynor.«
»Wenn es am Geld liegt, Ms Blake, ich kann das Angebot erhöhen.«
Berts Schultern durchlief ein Zittern. Armer Bert, aber er verbarg es gut. Sonderpunkt für ihn.
»Ich lasse mich nicht als Mörderin anheuern, Gaynor«, erwiderte ich.
»Ich habe mich wohl verhört«, sagte Tommy mit den blonden Haaren.
Ich schaute zu ihm hinüber. Seine Augen waren so leer wie zuvor. »Ich töte nicht für Geld.«
»Sie töten Vampire für Geld«, widersprach er.
»Legale Hinrichtungen, und ich tue es nicht um des Geldes willen«, erklärte ich. Tommy schüttelte den Kopf und bewegte sich von der Wand weg. »Ich hörte, Sie mögen es, Vampire zu pfählen. Und dass Sie nicht besonders darauf achten, wen Sie sonst noch umbringen, um an sie heranzukommen.«
»Meine Informanten haben mir erzählt, dass Sie schon Menschen getötet haben, Ms Blake«, sagte Gaynor.
»Nur in Notwehr, Gaynor. Ich morde nicht.«
Bert stand jetzt. »Ich glaube, es ist Zeit zu gehen.«
Eine flüssige Bewegung, und Bruno stand, die großen dunklen Hände locker und ein wenig gewölbt an der Seite. Ich tippte auf irgendeine Kampfsportart.
Tommy schob das Sakko zur Seite und enthüllte seine Waffe wie ein altmodischer Revolverheld. Es war eine .357 Magnum. Sie würde ein sehr großes Loch machen.
Ich stand nur da und sah die beiden an. Was konnte ich anderes tun? Ich wäre in der Lage, etwas mit Bruno anzustellen, aber Tommy hatte eine Kanone. Ich nicht. Das beendete gewissermaßen die Überlegung.
Sie taten, als wäre ich hochgefährlich. Mit einseinundsechzig bin ich nicht beeindruckend. Hat man jedoch Tote erweckt und ein paar Vampire getötet, wird man gleich von den Leuten als Ungeheuer angesehen. Manchmal ist das kränkend. Aber jetzt … eröffnete es Möglichkeiten. »Glauben Sie wirklich, ich bin unbewaffnet hergekommen?«, fragte ich. Meine Stimme klang sehr sachlich.
Bruno sah Tommy an. Der zuckte leicht die Achseln. »Ich habe sie nicht abgeklopft.«
Bruno schnaubte.
»Trotzdem, sie ist unbewaffnet«, sagte Tommy.
»Wollen Sie Ihr Leben darauf wetten?«, fragte ich und lächelte dabei, während ich ganz langsam die Hand nach hinten schob. Tommy änderte leicht die Haltung, seine Hand schwebte über der Waffe. Wenn er es darauf ankommen ließ, würde ich sterben. Aber ich würde zurückkommen und bei Bert spuken.
Gaynor sagte: »Nein. Es ist nicht notwendig, dass hier heute jemand stirbt, Ms Blake.«
»Ja«, bestätigte ich, »nicht im Geringsten.« Ich schluckte meine Aufregung hinunter und zog vorsichtig die Hand von meiner imaginären Waffe weg. Tommy nahm die Hand von seiner wirklichen Waffe. Prima für uns.
Gaynor lächelte wieder, wie ein freundlicher, bartloser Weihnachtsmann. »Sie wissen natürlich, dass es zwecklos wäre, der Polizei etwas zu erzählen.«
Ich nickte. »Wir haben keinen Beweis. Sie haben uns nicht einmal gesagt, wen Sie von den Toten erwecken wollen und warum.«
»Es stünde Aussage gegen Aussage.«
»Und ich bin sicher, Sie haben einflussreiche Freunde.« Ich lächelte, als ich das sagte.
Sein Lächeln wurde breiter, machte zwei Grübchen in seine fetten kleine Wangen. »Natürlich.«
Ich kehrte Tommy und seiner Kanone den Rücken. Bert folgte mir. Wir traten hinaus in die flimmernde Sommerhitze. Bert sah ein wenig mitgenommen aus. Das stimmte mich fast wieder milde. Es tat gut zu wissen, dass Bert eine Grenze hatte, dass es etwas gab, das er nicht tun würde, nicht einmal für eine Million Dollar.
»Hätten sie uns wirklich erschossen?«, fragte er. Seine Stimme klang nüchtern und fester, als der leicht glasige Blick vermuten ließ. Zäher Bert. Er schloss den Kofferraum auf, auch ungebeten.
»Mit Harold Gaynors Namen in unserem Terminkalender und im Computer?« Ich nahm meine Pistole heraus und zog mir das Holster über. »Ohne zu wissen, bei wem wir den Besuch hier draußen erwähnt haben?« Ich schüttelte den Kopf. »Zu riskant.«
»Warum haben Sie dann vorgegeben, bewaffnet zu sein?« Er sah mir in die Augen, und zum ersten Mal entdeckte ich in seinem Gesicht eine Unsicherheit. Der alte Geldsack brauchte ein Wort des Trostes, aber ich hatte gerade keins parat.
»Weil ich mich hätte irren können.«
2
Das Brautmodengeschäft befand sich in St. Peters ganz in der Nähe der 70th Street West. Es hieß »Jungfernfahrt«. Süß. Daneben gab es eine Pizzeria und auf der anderen Seite einen Schönheitssalon. Er hieß »Salon Schöne der Dunkelheit«. Die Fenster waren geschwärzt und mit blutrotem Neon umrandet. Man konnte sich Fingernägel und Frisur von einem Vampir machen lassen, wenn man wollte.
In den Vereinigten Staaten von Amerika war der Vampirismus erst seit zwei Jahren legal. Damit waren wir noch immer das einzige Land der Welt. Fragen Sie mich nicht, ich habe nicht dafür gestimmt. Es gab sogar eine Bewegung dafür, den Vampiren das Wahlrecht zu geben. »Keine Steuern ohne Vertretung« und all das.
Vor zwei Jahren noch bin ich, wenn ein Vampir jemanden belästigt hat, einfach hingegangen und habe den Scheißkerl gepfählt. Jetzt brauche ich einen Gerichtsbeschluss zur Hinrichtung. Ohne ihn würde man mich wegen Mordes anklagen. Ich sehne mich nach den guten alten Zeiten.
In der Auslage stand eine blonde Schaufensterpuppe, die in weißer Spitze ertrank. Ich schwärme nicht besonders für Spitze oder Staubperlen oder Pailletten. Besonders nicht für Pailletten. Ich hatte Catherine zweimal begleitet, um mit ihr das Brautkleid auszusuchen. Ich brauchte nicht lange, um zu merken, dass ich keine Hilfe war. Mir gefiel kein einziges.
Catherine war eine sehr gute Freundin von mir, anderenfalls hätte ich nicht vor diesem Laden gestanden. Sie meinte zu mir, falls ich jemals heiratete, würde ich meine Ansichten ändern. Verliebtsein braucht sicher nicht dahin zu führen, dass man den Sinn für guten Geschmack verliert. Falls ich je ein Kleid mit Pailletten kaufe, soll mich einer erschießen.
Für die Brautjungfern hätte ich sicher etwas anderes ausgesucht, aber ich war selbst schuld, dass ich nicht dabei war, als die Entscheidung fiel. Ich arbeitete zu viel, und fürs Shopping habe ich nicht das Geringste übrig. Am Ende blechte ich 120 Dollar plus Steuer für ein rosa Taftkleid. Ich sah darin aus, als wäre ich von einem Ball der Junior-High-School getürmt.
Ich betrat die kühle Stille des Brautgeschäfts, und meine hohen Absätze versanken in einem Teppichboden, der mit seinem hellen Grau knapp am Weiß vorbeigekommen war. Mrs Cassidy, die Leiterin des Geschäfts, sah mich hereinkommen. Ihr Lächeln verrutschte für einen Moment, bevor sie es unter Kontrolle bekam. Sie lächelte mich an. Tapfere Mrs Cassidy.
Ich lächelte zurück, obwohl die nächste Stunde keine Freude werden würde.
Mrs Cassidy war zwischen vierzig und fünfzig, hatte eine adrette Figur und dunkle rotbraune Haare. Sie hatte sie zu einem französischen Knoten geschlungen, nach dem Vorbild von Grace Kelly. Sie schob ihre Goldrandbrille höher auf die Nase und sagte: »Ms Blake, Sie kommen zur letzten Anprobe, wie ich sehe.«
»Ich hoffe, dass es die letzte ist«, antwortete ich.
»Nun, wir haben … an dem Problem gearbeitet. Ich glaube, uns ist etwas eingefallen.« Hinter dem Ladentisch befand sich ein kleiner Raum. Er war angefüllt mit Ständern, an denen Kleider in Plastikhüllen hingen. Mrs Cassidy zog meines zwischen zwei identischen rosa Kleidern hervor.
Mit dem Kleid über dem Arm ging sie voraus zu den Ankleidezimmern. Den Rücken hielt sie äußerst gerade. Sie wappnete sich für eine weitere Schlacht. Ich brauchte mich nicht zu wappnen, ich war längst kampfbereit. Aber mit Mrs Cassidy über die Änderungen einer Robe zu streiten war immer noch besser als eine Auseinandersetzung mit Tommy und Bruno. Es hätte wirklich schlecht ausgehen können, aber es war nicht dazu gekommen. Gaynor hatte sie zurückgepfiffen, für heute, hatte er gesagt.
Was genau bedeutete das? Wahrscheinlich verstand es sich von selbst. Ich hatte Bert, der von dem Beinahezusammenstoß noch mitgenommen war, vor dem Büro abgesetzt. Mit der schmutzigen Seite des Geschäfts kam er nicht zurecht. Die gewalttätige meine ich. Nein, dafür war ich da oder Manny oder Jamison oder Charles. Wir, die Animatoren von Animators, Inc., machten die Drecksarbeit. Bert blieb in seinem netten sicheren Büro und schickte uns die Klienten und den Ärger. Bis heute.
Mrs Cassidy hängte das Kleid an einen Haken in einer der Kabinen und ließ mich allein. Ehe ich hineingehen konnte, öffnete sich eine andere Kabine, und Kasey, Catherines Blumenmädchen, kam heraus. Sie war acht, und sie machte ein grimmiges Gesicht. Ihre Mutter, noch im Bürokostüm, kam hinterher. Elizabeth (nennen Sie mich Elsie) Markowitz war groß, schlank, schwarzhaarig, olivbraun und eine Rechtsanwältin. Sie arbeitete mit Catherine zusammen und gehörte ebenfalls zum engsten Kreis der Hochzeit.
Kasey sah aus wie eine Miniaturausgabe ihrer Mutter. Das Kind sah mich zuerst und sagte: »Tag, Anita, sieht dieses Kleid nicht doof aus?«
»Also, Kasey«, unterbrach Elsie, »es ist wunderschön. All die hübschen rosa Rüschen.«
Für mich sah es wie eine überzüchtete Petunie aus. Ich zog mir die Jacke aus und begab mich in meine Kabine, ehe ich meine Meinung laut äußerte.
»Ist das eine echte Pistole?«, fragte Kasey.
Ich hatte vergessen, dass ich sie noch umgeschnallt trug. »Ja«, sagte ich.
»Sind Sie Polizistin?«
»Nein.«
»Kasey Markowitz, du stellst zu viele Fragen.« Ihre Mutter schob sie gequält lächelnd an mir vorbei. »Entschuldigen Sie, Anita.«
»Es macht nichts«, sagte ich. Etwas später stand ich auf einer kleinen Plattform vor einem perfekten Kreis von Spiegeln. Mit den passenden pinkfarbenen hohen Schuhen hatte das Kleid schließlich die richtige Länge. Es hatte auch kleine Puffärmel, die schulterfrei saßen. Das Kleid enthüllte fast jede Narbe, die ich hatte.
Die neueste Narbe war noch rosa und heilte auf meinem rechten Unterarm. Aber das war nur ein Messerschnitt gewesen. Schnitte sind verglichen mit den anderen Narben eine saubere und ordentliche Sache. Das Schlüsselbein und der linke Arm waren mir gebrochen worden. Ein Vampir hatte sie durchgebissen und daran gerissen wie ein Hund an einem Brocken Fleisch. Dann ist da noch die kreuzförmige Brandnarbe auf dem linken Unterarm. Der einfallsreiche Diener eines Vampirs hatte das für amüsant gehalten. Ich nicht.
Ich sah aus wie Frankensteins Braut, wenn sie zum Ball geht. Schön, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber Mrs Cassidy war durchaus dieser Meinung. Sie fand, die Narben würden die Aufmerksamkeit von dem Kleid, von der Hochzeitsfeier und von der Braut ablenken. Aber Catherine, die Braut selbst, sah das anders. Sie meinte, ich habe es verdient, zum engsten Kreis zu gehören, weil wir so gute Freunde seien. Ich bezahlte gutes Geld, um öffentlich gedemütigt zu werden. Wir mussten sehr gute Freunde sein.
Mrs Cassidy reichte mir ein Paar lange rosa Satinhandschuhe. Ich zog sie an, wackelte mit den Fingern, damit sie tiefer in die winzigen Löcher rutschten. Ich habe Handschuhe noch nie gemocht. Man hat das Gefühl, die Welt durch einen Vorhang anzufassen. Aber die hellrosa Dinger bedeckten meine Arme. Alle Narben weg. Was für ein braves Mädchen. Genau.
Die Frau schüttelte den seidigen Rock auf und schaute dabei in den Spiegel. »So wird es gehen, denke ich.« Sie stand da, tippte mit einem langen lackierten Fingernagel gegen ihre geschminkten Lippen. »Ich glaube, ich habe da noch etwas, um diese … äh … nun, ja …«
»Schulternarbe?«, sagte ich.
»… Schulternarbe zu verstecken.« Sie klang erleichtert.
Mir kam zum ersten Mal in den Sinn, dass Mrs Cassidy das Wort Narbe noch nie in den Mund genommen hatte. Als wäre es schmutzig oder unzivilisiert. Ich lächelte in den Spiegel. Ein Lachen stahl sich in meine Kehle.
Mrs Cassidy hielt etwas hoch, das aus rosa Bändern und künstlichen Orangenblüten gemacht war. Das Lachen verging mir. »Was ist das?«, fragte ich.
»Das«, sagte sie, auf mich zutretend, »ist die Lösung für unser Problem.«
»Gut, aber was ist es?«
»Nun, es ist ein Halsband, eine Verzierung.«
»Ich soll das um den Hals tragen?«
»Ja.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, lieber nicht.«
»Ms Blake, ich habe alles ausprobiert, um diese … dieses Mal zu verstecken. Hüte, Frisuren, einfache Bänder, Korsagen …« Sie schlug buchstäblich die Hände über dem Kopf zusammen. »Ich bin mit meiner Kunst am Ende.«
Das glaubte ich gern. Ich holte tief Luft. »Ich fühle mit Ihnen, Mrs Cassidy, das tue ich, ehrlich. Ich bin wirklich eine Nervensäge gewesen.«
»Ich würde so etwas niemals sagen.«
»Ich weiß, darum sage ich es für Sie. Aber das hier ist das hässlichste Stück Klimbim, das mir je unter die Augen gekommen ist.«
»Falls Sie einen besseren Vorschlag haben, Ms Blake, ich bin ganz Ohr.« Sie verschränkte vornehm die Arme vor der Brust. Das anstößige Stück »Verzierung« baumelte an ihrer Taille.
»Es ist riesig«, protestierte ich.
»Es wird Ihre«, sie presste kurz die Lippen aufeinander, »Narbe verbergen.«
Innerlich klatschte ich Beifall. Sie hatte das schmutzige Wort gesagt. Hatte ich einen besseren Vorschlag? Nein. Hatte ich nicht. Ich seufzte. »Legen Sie es mir um. Ich kann es mir wenigstens einmal ansehen.«
Sie lächelte. »Bitte heben Sie Ihre Haare an.«
Ich tat wie verlangt. Sie befestigte das Ding in meinem Nacken. Die Spitze pikte, die Bänder kitzelten, und ich wollte am liebsten gar nicht hinsehen. Ich schaute auf, ganz langsam, und starrte auf mein Spiegelbild.
»Gott sei Dank haben Sie langes Haar. Ich werde es am Tag der Hochzeit selbst zurechtmachen, damit das Kaschieren gelingt.«
Das Ding um meinen Hals sah aus wie ein Hundehalsband mit dem größten Anstecksträußchen der Welt. An meinem Hals waren Bänder gesprossen wie Pilze nach einem Regenguss. Es war schrecklich, und keine noch so gute Frisur würde daran etwas ändern. Aber es verdeckte die Narbe, und zwar vollständig. Ta-da.
Ich schüttelte nur den Kopf. Was sollte ich sagen? Mrs Cassidy nahm mein Schweigen als Zustimmung. Sie hätte es besser wissen sollen. Das Telefon klingelte und rettete uns beide. »Nur eine Minute, Ms Blake.« Sie stelzte davon, und ihre hohen Absätze erzeugten auf dem dicken Teppich keinen Laut.
Ich betrachtete mich im Spiegel. Haar und Augen passen bei mir zusammen, das Haar schwarz, die Augen so dunkelbraun, dass sie nahezu schwarz aussehen. Ich habe sie von meiner südländischen Mutter. Aber meine Haut ist blass, das ist das germanische Erbe meines Vaters. Ein bisschen Schminke im Gesicht, und ich sehe aus wie eine Chinapuppe. Ein rosa Puffärmelkleid, und ich sehe zart, niedlich, zierlich aus. Zum Teufel damit.
Die übrigen Brautjungfern waren alle mindestens einssiebzig groß. Vielleicht würden einige in dem Kleid sogar gut aussehen. Ich bezweifelte es.
Um das Ganze noch schlimmer zu machen, trugen wir alle Reifröcke darunter. Ich kam mir vor wie bei »Vom Winde verweht« ausgemustert.
»Na bitte, Sie sehen doch reizend aus.« Mrs Cassidy war zurückgekehrt. Sie strahlte mich an.
»Ich sehe aus wie in Himbeersirup getaucht.«
Ihr Lächeln zog sich etwas zurück. Sie schluckte. »Es gefällt Ihnen nicht.« Ihre Stimme klang sehr steif.
Elsie Markowitz kam aus den Ankleidezimmern. Kasey schlenderte mürrisch hinter ihr her. Ich wusste, wie sie sich fühlte. »Oh, Anita«, sagte Elsie, »Sie sehen allerliebst aus.«
Allerliebst. Großartig, genau, was ich hören wollte. »Und diese schönen Schleifen am Hals. Das werden wir alle tragen, wissen Sie.«
»Das tut mir Leid«, sagte ich.
Sie blickte mich stirnrunzelnd an. »Ich finde, es unterstreicht einfach das Kleid.«
Nun war es an mir, die Stirn zu runzeln. »Das meinen Sie ernst, oder?«
Elsie sah verwirrt aus. »Aber natürlich meine ich das ernst. Gefallen Ihnen die Kleider nicht?«
Ich beschloss, nicht zu antworten, weil ich sonst vielleicht jemanden verärgerte. Ich meine, was kann man anderes von einer Frau erwarten, die einen so perfekten Vornamen wie Elizabeth hat und lieber wie eine Kuh genannt wird?
»Ist das die absolut letzte Möglichkeit, es zu kaschieren, Mrs Cassidy?«, fragte ich.
Sie nickte, einmal und sehr bestimmt.
Ich seufzte, sie lächelte. Der Sieg war ihrer, und sie wusste es. Ich hatte meine Niederlage schon geahnt, als ich nur das Kleid gesehen hatte, aber wenigstens wollte ich jemanden dafür büßen lassen. »Also gut. Einverstanden. Es bleibt so. Ich werde es tragen.«
Mrs Cassidy strahlte mich an. Elsie lächelte. Kasey grinste spöttisch. Ich hob den Reifrock bis zu den Knien hoch und verließ das Podest. Der Rock schwang wie eine Glocke, mit mir als Klöppel.
Das Telefon klingelte. Mrs Cassidy ging zum Apparat, mit munterem Schritt, einem Lied im Herzen und dem Bewusstsein, dass ich gleich ihren Laden verließ. Freude am Nachmittag.
Ich mühte mich damit ab, den weiten Rock durch die schmale Tür zu den Ankleidezimmern zu bugsieren, als sie mich rief. »Ms Blake, es ist für Sie. Ein Detective Sergeant Storr.«
»Siehst du, Mami, ich habe dir gesagt, sie ist eine Polizistin«, sagte Kasey.
Ich stellte das nicht richtig, weil Elsie mich schon vor Wochen gebeten hatte, es nicht zu tun. Sie fand, Kasey sei zu jung, um über Animatoren und Zombies und Vampirtöter Bescheid zu wissen. Als ob nicht jedes achtjährige Kind mitbekam, was ein Vampir war. Vampire waren so ziemlich das Medienereignis des Jahrzehnts.
Ich versuchte, mir den Hörer ans linke Ohr zu drücken, aber die verdammten Blumen waren im Weg. Nachdem ich mir den Hörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt hatte, griff ich in den Nacken, um das Band zu lösen. »Tag, Dolph, was gibt’s?«
»Einen Mordfall.« Seine Stimme war angenehm, klang wie ein guter Tenor.
»Welche Art Mord?«
»Ein schmutziger.«
Schließlich bekam ich das Band los und ließ den Hörer fallen.
»Anita, sind Sie noch dran?«
»Klar, hab nur ein Kleiderproblem.«
»Was?«
»Ist nicht wichtig. Warum wollen Sie, dass ich zum Tatort komme?«
»Der das getan hat, ist kein Mensch.«
»Ein Vampir?«
»Sie sind der Fachmann für Untote. Darum sollen Sie sich die Sache mal ansehen.«
»In Ordnung, nennen Sie mir die Adresse, und ich bin gleich da.« Da lag ein Notizblock aus blassrosa Papier mit kleinen Herzchen. Der Kuli hatte einen Plastikamor am Ende. »St. Charles, ich bin keine fünfzehn Minuten von Ihnen entfernt.«
»Gut.« Er hängte ein.
»Auf Wiedersehen, Dolph.« Ich sagte es ins Leere, um mich überlegen zu fühlen. Ich ging zurück in das kleine Zimmer und zog mich um.
Am Vormittag hatte man mir eine Million Dollar für einen Mord und eine Totenerweckung angeboten. Danach ab ins Brautgeschäft zur letzten Anprobe. Jetzt zum Tatort eines Mordfalls. Ein schmutziger, hatte Dolph gesagt. Anscheinend sollte das ein ereignisreicher Nachmittag werden.
3
Schmutzig hatte Dolph es genannt. Ein Meister der Untertreibung. Überall war Blut, es war auf die weißen Wände gespritzt, als hätte jemand einen Eimer Farbe geworfen. Es gab eine helle Couch mit einem goldgelb-braunen Blumenmuster. Sie verschwand fast ganz unter einem Laken. Das Laken war rot. Die blitzsauberen Fenster warfen einen hellen rechteckigen Lichtfleck. In der Sonne leuchtete das Blut kirschrot.
Frisches Blut ist in Wirklichkeit heller, als man es im Fernsehen oder im Kino sieht. In großen Mengen. Echtes Blut hat ein grelles Feuerwehrrot, wenn es viel ist, aber ein dunkleres Rot macht sich auf der Leinwand besser. So viel zum Realismus.
Nur frisches Blut ist rot, wirklich rot. Dieses Blut war alt, aber ein Trick der Sommersonne machte es frisch und leuchtend.
Ich schluckte mühsam und atmete tief ein.
»Sie sehen ein bisschen grün aus, Blake«, sagte jemand dicht neben mir.
Ich fuhr zusammen, und Zerbrowski lachte. »Hab ich Sie erschreckt?«
»Nein«, log ich.
Detective Zerbrowski war einsfünfundziebzig, hatte lockige schwarze Haare, die schon ein wenig grau wurden, braune Augen und eine dunkle Brille. Sein brauner Anzug war verknittert; der gelbbraune Schlips hatte einen Fleck, wahrscheinlich vom Mittagessen. Er grinste mich an. Das machte er ständig.
»Hab Sie erwischt, Blake, geben Sie’s zu. Wird unsere furchtlose Vampirtöterin sich auf die Opfer übergeben?«
»Haben ein bisschen Speck angesetzt, was, Zerbrowski?«
»Hach, jetzt bin ich gekränkt«, antwortete er. »Erzählen Sie mir nicht, Sie stehen nicht auf meinen Körper wie ich auf Ihren.«
»Hören Sie auf damit, Zerbrowski. Wo ist Dolph?«
»Im großen Schlafzimmer.« Zerbrowski blickte zur gewölbten Decke mit den Oberlichtern. »Ich wünschte, Katie und ich könnten so was bezahlen.«
»Ja, es ist hübsch«, stimmte ich zu. Ich schaute zu der Couch hinüber. Das Laken klebte an dem, was darunter lag, wie eine Serviette auf der Saftlache. Aber irgendetwas stimmte nicht mit den Umrissen. Dann wurde es mir schlagartig klar: Es waren nicht genug Höcker da, um einen kompletten menschlichen Körper zu ergeben. Wer immer darunter lag, ihm fehlten ein paar Teile.
Das Zimmer schwamm gewissermaßen. Ich sah weg und schluckte krampfhaft. Es war Monate her, dass mir an einem Tatort schlecht geworden war. Wenigstens lief die Klimaanlage. Das war gut. Hitze macht den Gestank schlimmer.
»He, Blake, müssen Sie tatsächlich an die frische Luft?« Zerbrowski nahm meinen Arm, als wollte er mich zur Tür bringen.
»Danke, aber mir geht’s gut.« Ich sah ihm direkt in die braunen Babyaugen und log. Er wusste, dass ich log. Es ging mir nicht gut, aber ich würde zurechtkommen.
Er ließ mich los, trat zur Seite und tippte sich spöttisch an die Stirn. »Ich stehe auf harte Bräute.«
Ich lächelte, ehe ich es verhindern konnte. »Gehen Sie weg, Zerbrowski.«
»Am Ende des Flurs die letzte Tür links. Da finden Sie Dolph.« Er mischte sich unter die Horde Männer. An einem Tatort sind immer mehr Leute, als man braucht, ich meine nicht die Gaffer draußen, sondern die Kollegen in Uniform, in Zivil, die Techniker, den Kerl mit der Videokamera. Es ist immer wie im Bienenstock, hektisch und überfüllt.
Ich fädelte mich hindurch. Die Plastikkarte mit meinem Namen hatte ich an den Kragen meiner marineblauen Jacke geklemmt. Damit die Polizei wusste, dass ich zu ihnen gehörte und mich nicht etwa eingeschlichen hatte. Das machte es auch ungefährlicher, mit einer Waffe durch eine Schar Polizisten zu gehen.
Ich drückte mich an einer Gruppe vorbei, die mitten im Gang wie ein Verkehrsstau vor einer Tür stand. Von drinnen kam Stimmengewirr. »Himmel, sieh dir das Blut an … ist die Leiche schon gefunden? … Du meinst, was davon übrig ist? … Nein.«
Ich schob mich zwischen zwei Uniformen. Eine sagte: »He!« Vor der letzten Tür auf der linken Seite war ein wenig Platz. Ich weiß nicht, wie Dolph es angestellt hatte, aber er war allein in dem Zimmer. Vielleicht waren sie hier gerade fertig.
Er kniete mitten auf dem hellbraunen Teppich. Seine dicken Hände, die in OP-Handschuhen steckten, ruhten auf den Oberschenkeln. Sein schwarzes Haar war so kurz geschnitten, dass die Ohren neben seinem derben Gesicht wie verloren wirkten. Er sah mich und stand auf. Er war zwei Meter fünf groß und gebaut wie ein Ringer. Das Himmelbett hinter ihm wirkte auf einmal klein.
Dolph war der Kopf des Spukkommandos, der neuesten Spezialeinheit. Der offizielle Name war »Regional Preternatural Investigation Team«, R. P. I. T., gesprochen »rip it«. Die Einheit befasste sich mit allen übernatürlichen Verbrechen. Sie war der Platz, wo man die Unruhestifter ablud. Ich habe mich nie fragen müssen, was Zerbrowski getan hatte, um zum Spukkommando zu kommen. Sein Humor war zu eigenartig und vollkommen gnadenlos. Aber Dolph? Er war der perfekte Polizist. Ich stellte mir immer vor, dass er jemandem von ganz oben vor den Kopf gestoßen hat, und zwar einfach damit, dass er seine Arbeit zu gut machte. Das leuchtet mir ein.
Neben ihm auf dem Teppich lag noch so ein lakenbedecktes Bündel.
»Anita.« So redete er immer, kein Wort zu viel.
»Dolph«, sagte ich.
Er kniete zwischen dem Himmelbett und dem blutgetränkten Laken. »Bereit?«
»Ich weiß ja, dass Sie nicht viele Worte machen, Dolph, aber könnten Sie mir sagen, worauf ich achten soll?«
»Ich will wissen, was Sie sehen, nicht, was ich Ihnen gesagt habe, das Sie sehen sollen.«
Für Dolph war das eine Ansprache. »Gut«, sagte ich, »dann los.«
Er zog das Laken zurück. Es schälte sich von einem blutigen Gegenstand. Ich starrte darauf und sah nichts weiter als einen blutigen Klumpen Fleisch. Es hätte alles Mögliche sein können, ein Stück Kuh, Pferd, Reh. Aber ein Mensch? Ganz sicher nicht.
Meine Augen sahen es, aber mein Verstand weigerte sich anzunehmen, was ihm gezeigt wurde. Ich ging in die Hocke und schlug mir dabei den Rock unter. Der Teppichboden war nass, als wäre ein Regenschauer darauf niedergegangen, nur dass es kein Wasser gewesen war.
»Können Sie mir ein Paar Handschuhe borgen? Meine Tatortausrüstung ist im Büro.«
»Rechte Tasche in der Regenjacke.« Er hob die Hände in die Höhe. Es waren Blutflecke daran. »Bedienen Sie sich. Die Frau hasst mich dafür, wenn Blut auf Zeug für die Reinigung kommt.«
Ich lächelte. Erstaunlich. Sinn für Humor ist manchmal zwingend erforderlich. Ich musste über die Leiche hinweggreifen. Ich zog zwei Handschuhe heraus; sie haben Einheitsgröße. Sie fühlen sich immer wie von innen gepudert an und gar nicht wie Handschuhe, mehr wie Kondome für Hände.
»Kann ich das anfassen, ohne Beweise zu vernichten?«
»Ja.«
Ich tastete es an der Seite mit zwei Fingern ab. Es fühlte sich an wie frisches Rindfleisch. Schön fest. Meine Finger spürten den Erhebungen der Knochen nach, Rippen unter Fleisch. Rippen. Plötzlich wusste ich, worauf ich blickte. Auf den Teil eines menschlichen Brustkorbs. Da war die Schulter, weißer Knochen ragte heraus, wo der Arm abgerissen worden war. Das war alles. Alles, was da war. Ich stand zu schnell auf und stolperte. Der Teppich patschte unter meinen Schritten.
Im Zimmer war es auf einmal sehr heiß. Ich wandte mich von dem Leichenteil ab und merkte, wie ich auf die Spiegelkommode starrte. Der Spiegel hatte so viel Blut abbekommen, dass es aussah, als hätte ihn jemand mit rotem Nagellack überzogen. Cherry Blossom Red, Carnival Crimson, Candy Apple.
Ich schloss die Augen und zählte ganz langsam bis zehn. Als ich sie wieder aufschlug, war es schon kälter im Raum. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass sich ein Deckenventilator drehte. Es ging mir gut. Echt klasse Vampirtöterin. Klar doch.
Dolph sagte nichts, als ich mich wieder hinkniete. Er sah mich nicht einmal an. Guter Mann. Ich versuchte, objektiv zu sein und zu sehen, was es zu sehen gab. Aber es war hart. Es wäre mir lieber gewesen, wenn ich nicht hätte erkennen können, um was für einen Körperteil es sich handelte. Jetzt sah ich nichts weiter als diese blutigen Überreste. Und ich konnte an nichts anderes denken als an den einstigen menschlichen Körper. »Einstig« war das Wort, auf das es ankam.
»Keine Anzeichen für Waffeneinwirkung, soweit ich sehe, aber das wird Ihnen der Leichenbeschauer sagen können.« Ich hielt beim Tasten inne. »Können Sie mir helfen, es anzuheben, damit ich in den Brustkorb sehen kann? Oder was davon übrig ist.«
Dolph ließ das Laken los und half mir. Aber es gab keine Unterseite. Alle Organe, die von den Rippen geschützt werden, fehlten. Es sah genauso aus wie eine Seite Rippchen, bis auf die Knochen, wo sich der Arm hätte anschließen müssen. Ein Teil des Schlüsselbeins war auch noch da. »In Ordnung«, sagte ich. Es klang atemlos. Ich stand auf und hielt die blutigen Hände von mir weg. »Decken Sie es zu, bitte.«
Er tat es und stand auf. »Eindruck?«
»Gewalt, extreme Gewalt. Übermenschliche Kraft. Der Körper wurde mit den Händen auseinander gerissen.«
»Warum mit den Händen?«
»Keine Messerspuren.« Ich lachte, aber es blieb mir im Hals stecken. »Himmel, man könnte meinen, jemand hat eine Säge benutzt wie beim Schlachten einer Kuh, aber die Knochen …« Ich schüttelte den Kopf. »Hier wurde kein Hilfsmittel benutzt.«
»Noch etwas?«
»Ja, wo ist der Rest abgeblieben?«
»Den Flur runter, zweite Tür links.«
»Der Rest der Leiche?« Es wurde wieder heiß im Zimmer.
»Gehen Sie gucken. Sagen Sie mir, was Sie da sehen.«
»Verdammt, Dolph, ich weiß ja, dass Sie Ihre Fachleute nicht beeinflussen wollen, aber ich möchte nicht blind da reingehen.«
Er schaute mich nur an.
»Beantworten Sie mir wenigstens eine Frage.«
»Vielleicht, welche?«
»Ist es schlimmer als das hier?«
Er schien einen Augenblick nachzudenken. »Nein und ja.«
»Zum Teufel mit Ihnen.«
»Sie werden verstehen, wenn Sie es sehen.«
Ich wollte nicht verstehen. Bert war begeistert gewesen, dass die Polizei mich auf Honorar haben wollte. Er hatte gemeint, es würde mir wertvolle Erfahrungen einbringen, wenn ich mit der Polizei arbeitete. Alles, was es bisher eingebracht hatte, war eine größere Auswahl Albträume.
Dolph ging voraus zum nächsten Horrorkabinett. Ich wollte den Rest der Leiche eigentlich nicht sehen. Ich wollte nach Hause. Er zögerte vor der geschlossenen Tür, bis ich neben ihm stand. An der Tür klebte ein aus Pappe ausgeschnittener Hase wie für Ostern. Darunter hing ein gesticktes Schild: »Unser Liebling«.
»Dolph.« Meine Stimme hörte sich sehr ruhig an. Die Laute aus dem Wohnzimmer waren gedämpft.
»Ja?«
»Nichts, nichts.« Ich holte tief Luft und ließ sie langsam wieder heraus. Es würde gehen. Es würde gehen. Oh Gott, ich wollte nicht. Es gibt Momente im Leben, da ist das einzige Mittel, um durchzukommen, ein wenig Gnade von oben. Ich wettete, dass dies so einer war.
Durch ein kleines Fenster strömte Sonnenlicht herein. Die Vorhänge waren weiß, Entchen und Häschen waren auf den Saum gestickt. Ausgeschnittene Tierfiguren tanzten auf den hellblauen Wänden. Es stand kein Kinderbettchen da, sondern ein Bett mit halbhohem Geländer.
In diesem Zimmer war nicht so viel Blut. Danke, lieber Gott. Wer sagt, dass Gebete nicht erhört werden? Aber in einem Lichtfleck der hellen Augustsonne saß ein Teddybär. Der Teddybär war blutrot, wie kandiert. Ein gläsernes Auge starrte rund und überrascht aus dem stacheligen Kunstfell.
Ich kniete mich daneben. Der Teppich patschte nicht, kein Blut war eingezogen. Warum saß der verdammte Bär hier und war voller Blut? In dem ganzen Raum war, soweit ich sehen konnte, sonst nirgendwo Blut.
Hatte ihn jemand hierher gesetzt? Ich sah auf, und mein Blick fiel auf eine kleine weiße Kommode mit aufgemalten Häschen. Wenn man einmal ein Motiv hatte, blieb man vermutlich dabei. Auf dem weißen Holz befand sich ein kleiner, perfekter Handabdruck. Ich kroch darauf zu und hielt meine Hand zum Vergleich dagegen. Ich habe kleine Hände, sogar für eine Frau, aber dieser Abdruck war winzig. Zwei, drei, vielleicht vier Jahre alt. Blaue Wände, wahrscheinlich ein Junge.
»Wie alt war das Kind?«
»Nach dem Foto im Wohnzimmer, Benjamin Reynolds, drei Jahre alt, steht hinten drauf.«
»Benjamin«, flüsterte ich und starrte auf den blutigen Handabdruck. »Es liegt keine Leiche im Zimmer. Hier wurde niemand umgebracht.«
»Ja.«
»Warum wollten Sie, dass ich mir das ansehe?« Ich blickte aus der Hocke zu ihm auf.
»Ihre Einschätzung ist nichts wert, wenn Sie nicht alles gesehen haben.«
»Dieser verdammte Bär wird mich verfolgen.«
»Mich auch«, sagte er.
Ich stand auf und schaffte es, mir nicht automatisch den Rock glatt zu streichen. Es war erstaunlich, wie oft ich mir in Gedanken über die Kleidung strich und mir Blutflecke machte. Aber nicht heute.
»Ist es die Leiche des Jungen, die im Wohnzimmer unter dem Laken liegt?« Als ich das sagte, flehte ich innerlich, er möge es nicht sein.
»Nein«, antwortete er.
Danke, Gott. »Der Mutter?«
»Ja.«
»Wo ist die Leiche des Jungen?«
»Wir können sie nicht finden.« Er zögerte, dann fragte er: »Kann das Ungeheuer die Leiche des Jungen aufgefressen haben?«
»Sie meinen, damit nichts zu finden ist?«
»Ja.« Er war im Gesicht eine Winzigkeit blass. Ich vermutlich auch.
»Möglich, aber selbst die Untoten können keine unendlichen Mengen fressen.« Ich atmete tief durch. »Gibt es irgendwelche Anzeichen von – Regurgitation?«
»Regurgitation.« Er lächelte. »Hübsches Wort. Nein, diese Kreatur hat nichts gefressen und es dann wieder ausgewürgt. Zumindest haben wir nichts gefunden.«
»Dann liegt der Junge vermutlich noch irgendwo.«
»Könnte er noch am Leben sein?«, fragte Dolph.
Ich sah zu ihm hinauf. Ich wollte ja sagen, aber ich wusste, die Antwort hieß wahrscheinlich nein. Ich wählte den Kompromiss. »Ich weiß es nicht.«
Dolph nickte.
»Das Wohnzimmer als Nächstes?«, fragte ich.
»Nein.« Ich ging aus dem Zimmer, ohne noch etwas zu sagen. Ich folgte ihm. Was konnte ich sonst tun? Aber ich beeilte mich nicht. Wenn er den harten, schweigsamen Polizisten spielen wollte, dann konnte er verdammt gut auf mich warten.
Ich folgte seinem breiten Rücken durchs Wohnzimmer, um die Ecke und in die Küche. Eine Glasschiebetür führte auf eine Sonnenterrasse. Glas war hier dominant. Glänzende Splitter funkelten in dem Licht, das durch ein weiteres Dachfenster fiel. Die Küche war makellos sauber, wie aus einem Hochglanzmagazin, mit blauen Kacheln und kräftigem, hellem Holz. »Hübsche Küche«, sagte ich.
Im Garten waren Männer zugange. Die Mannschaft war nach draußen gegangen. Der dichte Zaun verbarg sie vor den neugierigen Blicken der Nachbarn, wie er in der vorigen Nacht den Mörder verborgen hatte. Neben dem blinkenden Spülbecken stand ein Detective und kritzelte etwas in sein Notizbuch.
Dolph bedeutete mir, näher zu kommen. »In Ordnung«, sagte ich. »Etwas ist durch die Glastür gekracht. Es muss einen Höllenlärm gemacht haben. Wenn so viel Glas klirrt, hört man das, trotz eingeschalteter Klimaanlage.«
»Meinen Sie?«, fragte er.
»Hat einer der Nachbarn etwas gehört?«, fragte ich.
»Keiner will etwas zugeben«, sagte er.
Ich nickte. »Glas klirrt, jemand kommt, um nachzusehen, wahrscheinlich der Mann. Manche Geschlechtsspezifika sind langlebig.«
»Was meinen Sie damit?«, fragte Dolph.
»Der tapfere Jäger, der die Familie schützt«, antwortete ich.
»Gut, nehmen wir an, es war der Mann, was dann?«
»Der Mann kommt herein, sieht, was da durch die Scheibe gekracht ist, schreit nach seiner Frau. Sagt ihr vermutlich, sie soll rauslaufen. Das Kind nehmen und rauslaufen.«
»Warum nicht die Polizei rufen?«, fragte er.
»Ich habe im Schlafzimmer kein Telefon gesehen.« Ich deutete auf den Apparat an der Küchenwand. »Dieses ist vermutlich das Einzige. Man muss am schwarzen Mann vorbei, um ans Telefon zu kommen.«
»Weiter.«
Ich warf einen Blick über die Schulter ins Wohnzimmer. Die Couch war gerade eben zu sehen. »Das Wesen, was immer es war, hat den Mann mit rausgenommen, schnell, hat ihn kampfunfähig gemacht, bewusstlos geschlagen, aber nicht umgebracht.«
»Warum nicht umgebracht?«
»Stellen Sie mich nicht auf die Probe, Dolph. Es ist nicht genug Blut in der Küche. Er wurde im Schlafzimmer gefressen. Wer das getan hat, würde den Toten nicht erst ins Schlafzimmer ziehen. Es hat den Mann ins Schlafzimmer verfolgt und ihn dort getötet.«
»Nicht schlecht, wollen Sie als Nächstes einen Blick ins Wohnzimmer werfen?«
Eigentlich nicht, aber ich hielt den Mund. Von der Frau war mehr übrig geblieben. Der Oberkörper war fast intakt. Die Hände waren in Papiertüten gewickelt. Wir hatten Proben unter den Fingernägeln genommen. Ich hoffte, dass es etwas nützte. Ihre großen braunen Augen starrten an die Decke. Das Schlafanzugoberteil klebte dort, wo sonst die Taille gewesen war. Ich schluckte schwer und hob mit Daumen und Zeigefinger das Kleidungsstück an.
Die Wirbelsäule leuchtete in der grellen Sonne, nass und weiß baumelte sie herab wie eine herausgezogene Schnur.
Gut. »Sie wurde auseinander gerissen, genau wie der … Mann im Schlafzimmer.«
»Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist?«
»Sofern sie keine Gesellschaft gehabt haben, muss es der Mann sein. Sie hatten keinen Gast, oder?«
Dolph schüttelte den Kopf. »Nicht, soweit wir wissen.«
»Dann muss es der Mann sein. Sie hat noch alle Rippen und beide Arme.« Ich versuchte, meinen Ärger hinunterzuschlucken. Dolph meinte es nicht so. »Ich bin nicht einer Ihrer Cops. Ich wünschte, Sie würden aufhören, mir Fragen zu stellen, auf die Sie die Antwort schon haben.«
Er nickte. »Das wäre angebracht. Manchmal vergesse ich wirklich, dass Sie nicht einer von den Jungs sind.«
»Danke.«
»Sie verstehen, wie ich’s meine.«
»Ja, und ich weiß auch, dass Sie es als Kompliment meinen, aber können wir draußen weiterreden, bitte?«
»Sicher.« Er zog sich die blutigen Handschuhe herunter und steckte sie in den Müllsack, der offen in der Küche stand. Ich ebenfalls.
Die Hitze haftete an mir wie geschmolzenes Plastik, aber es fühlte sich gut an, irgendwie sauber. In tiefen Zügen atmete ich die heiße, brütende Luft ein. Ah, Sommer.
»Ich hatte also Recht, das war kein Mensch, der das getan hat?«, fragte er.
Zwei Uniformierte hielten die gaffende Menge vom Rasen fern und auf der Straße. Kinder, Eltern, Jugendliche auf Fahrrädern. Es sah aus wie ein richtiger Zirkus.
»Nein, das war kein Mensch. Es klebt kein Blut an der zerbrochenen Glastür.«
»Hab ich gemerkt. Was bedeutet das?«
»Die meisten Untoten bluten nicht, mit Ausnahme von Vampiren.«
»Die meisten?«
»Ein Zombie, der erst seit kurzer Zeit tot ist, kann bluten. Aber Vampire bluten fast wie ein Mensch.«
»Dann glauben Sie nicht, dass es ein Vampir gewesen ist?«
»Wenn, dann einer, der Menschenfleisch isst. Aber Vampire können keine feste Nahrung zu sich nehmen.«
»Ein Ghul?«
»Zu weit vom Friedhof weg, und es gäbe mehr Zerstörung im Haus. Ghule hätten die Möbel zerfetzt wie wilde Tiere.«
»Ein Zombie?«
Ich schüttelte den Kopf. »Offen gesagt, ich weiß es nicht. Es gibt Fleisch fressende Zombies. Sie sind selten, aber es gibt sie.«
»Sie haben mir mal erzählt, dass es drei belegte Fälle gibt. Bei jedem hielt der menschliche Eindruck länger vor, ehe der Zombie zu verwesen anfing.«
Ich lächelte. »Gutes Gedächtnis. Das stimmt. Zombies, die Fleisch essen, verwesen nicht, jedenfalls nicht so schnell.«
»Sind sie gewalttätig?«
»Bisher nicht«, sagte ich.
»Sind gewöhnliche Zombies gewalttätig?«, fragte Dolph.
»Nur, wenn es ihnen befohlen wird.«
»Was heißt das?«
»Man kann einem Zombie befehlen, Menschen zu töten, wenn man mächtig genug ist.«
»Ein Zombie als Mordwaffe?«
Ich nickte. »So ähnlich.«
»Wer könnte so etwas tun?«
»Ich bin nicht sicher, ob das hier der Fall ist«, wandte ich ein.
»Klar. Aber wer könnte so etwas tun?«
»Also, Himmel, ich könnte es, aber ich würde es nicht tun. Und niemand, den ich kenne, der es tun könnte, würde es tun.«
»Lassen Sie uns das beurteilen«, sagte er. Er hatte sein Notizbuch hervorgeholt.
»Sie wollen wirklich, dass ich Ihnen die Namen von Freunden gebe, damit Sie sie fragen können, ob sie zufällig einen Toten erweckt und ihn ausgeschickt haben, um diese Leute umzubringen?«
»Bitte.«
Ich seufzte. »Ich glaube das nicht. Also gut. Ich, Manny Rodriguez, Peter Burke und …« Ich hielt inne, als ich gerade die Silbe des nächsten Namens formte.
»Was ist?«
»Nichts. Mir ist nur eingefallen, dass ich diese Woche zu Burkes Beerdigung gehe. Er ist tot, also denke ich, er kommt nicht in Frage.«
Dolph sah mich fest an, das Misstrauen stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Sicher, dass das alle Namen sind?«
»Wenn mir noch jemand einfällt, gebe ich Ihnen Bescheid«, versprach ich. Ich machte auf großäugige Ehrlichkeit. Sehen Sie hierher, nichts im Ärmel.
»Tun Sie das, Anita.«
»Klar.«
Er lächelte und schüttelte den Kopf. »Wen schützen Sie?«
»Mich«, antwortete ich. Er machte ein ratloses Gesicht. »Sagen wir einfach, ich will nicht, dass jemand auf mich wütend wird.«
»Wer?«
Ich blickte in den klaren Augusthimmel auf. »Glauben Sie, dass es Regen gibt?«
»Verdammt, Anita. Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Die haben Sie bekommen«, sagte ich.
»Den Namen.«
»Noch nicht. Ich überprüfe das, und wenn die Sache verdächtig aussieht, verspreche ich, den Namen zu nennen.«
»Also, wenn das nicht mächtig großzügig ist!« Eine Röte kroch ihm den Hals hinauf. Ich hatte Dolph noch nie wütend werden sehen. Ich fürchtete, nun war es so weit.