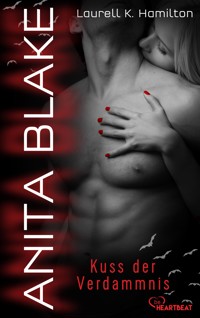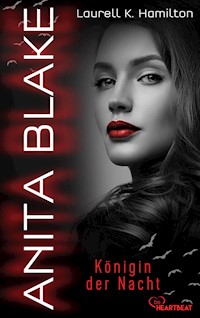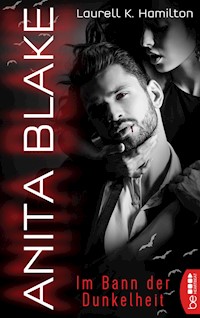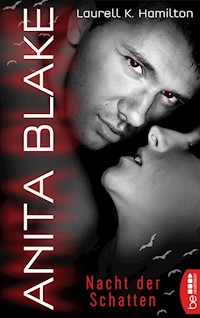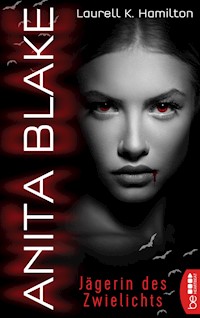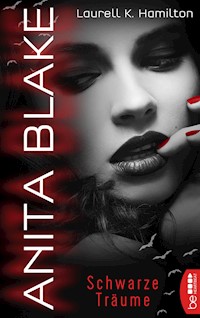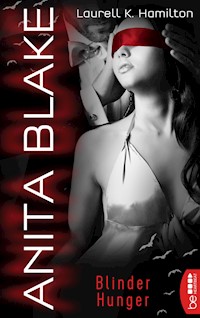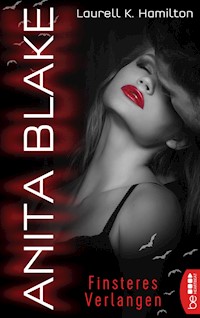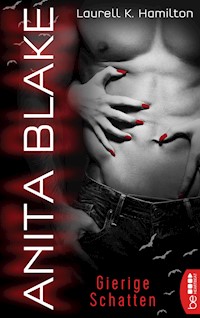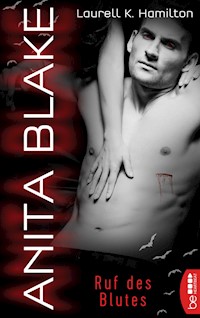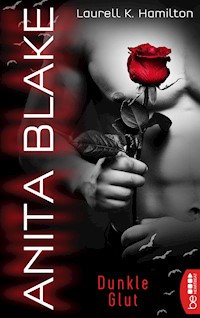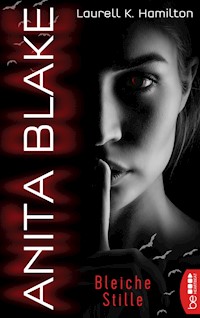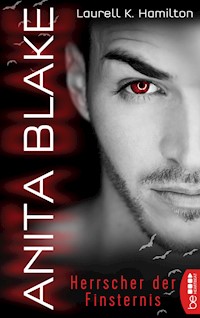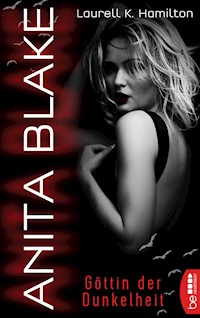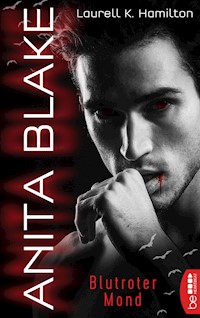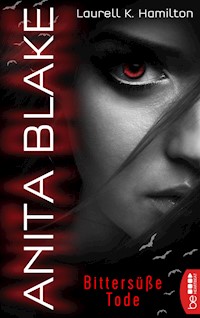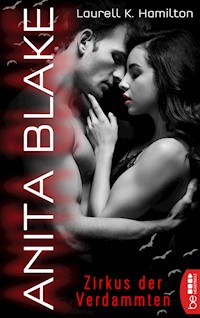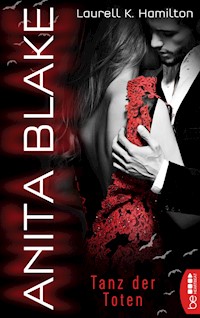
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Vampire Hunter
- Sprache: Deutsch
Anita Blake ist daran gewöhnt, die Jägerin zu sein. Doch plötzlich hat sie selbst einen Auftragskiller im Nacken sitzen und alle Hände voll damit zu tun, einfach nur zu überleben. Denn ein Unbekannter hat einen Preis von einer halben Million Dollar auf ihren Kopf ausgesetzt, und sie soll innerhalb von 24 Stunden aus dem Weg geräumt werden. Anita muss also schnellstmöglich herausfinden, wer ihr nach dem Leben trachtet. Als ob das nicht Ärger genug wäre, soll sie sich auch noch zwischen zwei Männern entscheiden. Und wenn es sich bei dem einen um einen Vampir und bei dem anderen um einen Werwolf handelt, ist diese Wahl ein riskantes Spiel mit dem Feuer ...
Nächster Band: Anita Blake - Dunkle Glut.
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber die Serie: Anita Blake – Vampire HunterÜber diesen BandÜber die AutorinTriggerwarnungTitelImpressumWidmung12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546Ich dankeIm nächsten BandÜber die Serie: Anita Blake – Vampire Hunter
Härter, schärfer und gefährlicher als Buffy, die Vampirjägerin – Lesen auf eigene Gefahr!
Vampire, Werwölfe und andere Wesen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben als anerkannte, legale Bürger in den USA und haben die gleichen Rechte wie Menschen. In dieser Parallelwelt arbeitet die junge Anita Blake als Animator, Totenbeschwörerin, in St. Louis: Sie erweckt Tote zum Leben, sei es für Gerichtsbefragungen oder trauernde Angehörige. Nebenbei ist sie lizensierte Vampirhenkerin und Beraterin der Polizei in übernatürlichen Kriminalfällen. Die knallharte Arbeit, ihr Sarkasmus und ihre Kaltschnäuzigkeit haben ihr den Spitznamen »Scharfrichterin« eingebracht. Auf der Jagd nach Kriminellen lernt die toughe Anita nicht nur, ihre paranormalen Fähigkeiten auszubauen – durch ihre Arbeit kommt sie den Untoten auch oftmals näher als geplant. Viel näher. Hautnah …
Bei der »Anita Blake«-Reihe handelt es sich um einen gekonnten Mix aus Krimi mit heißer Shapeshifter-Romance, gepaart mit übernatürlichen, mythologischen Elementen sowie Horror und Mystery. Eine einzigartige Mischung in einer alternativen Welt, ähnlich den USA der Gegenwart – dem »Anitaverse«.
Paranormale Wesen in dieser Reihe sind u. a. Vampire, Zombies, Geister und diverse Gestaltwandler (Werwölfe, Werleoparden, Werlöwen, Wertiger, …).
Die Serie besteht aus folgenden Bänden:
Bittersüße Tode
Blutroter Mond
Zirkus der Verdammten
Gierige Schatten
Bleiche Stille
Tanz der Toten
Dunkle Glut
Ruf des Blutes
Göttin der Dunkelheit (Band 1 von 2)
Herrscher der Finsternis (Band 2 von 2)
Jägerin des Zwielichts (Band 1 von 2)
Nacht der Schatten (Band 2 von 2)
Finsteres Verlangen
Schwarze Träume (Band 1 von 2)
Blinder Hunger (Band 2 von 2)
Über diesen Band
Anita Blake ist daran gewöhnt, die Jägerin zu sein. Doch plötzlich hat sie selbst einen Auftragskiller im Nacken sitzen und alle Hände voll damit zu tun, einfach nur zu überleben. Denn ein Unbekannter hat einen Preis von einer halben Million Dollar auf ihren Kopf ausgesetzt, und sie soll innerhalb von 24 Stunden aus dem Weg geräumt werden. Anita muss also schnellstmöglich herausfinden, wer ihr nach dem Leben trachtet. Als ob das nicht Ärger genug wäre, soll sie sich auch noch zwischen zwei Männern entscheiden. Und wenn es sich bei dem einen um einen Vampir und bei dem anderen um einen Werwolf handelt, ist diese Wahl ein riskantes Spiel mit dem Feuer …
Erlebe (über-)sinnliche Abenteuer mit eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Laurell K. Hamilton (*1963 in Arkansas, USA) hat sich mit ihren paranormalen Romanserien um starke Frauenfiguren weltweit eine große Fangemeinde erschrieben, besonders mit ihrer Reihe um die toughe Vampirjägerin Anita Blake. In den USA sind die Anita-Blake-Romane stets auf den obersten Plätzen der Bestsellerlisten zu finden, die weltweite Gesamtauflage liegt im Millionenbereich.
Die New-York-Times-Bestsellerautorin lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in St. Louis, dem Schauplatz ihrer Romane.
Website der Autorin: https://www.laurellkhamilton.com/.
Triggerwarnung
Die Bücher der »Anita Blake – Vampire Hunter«-Serie enthalten neben expliziten Szenen und derber Wortwahl potentiell triggernde und für manche Leserinnen und Leser verstörende Elemente. Es handelt sich dabei unter anderem um:
brutale und blutige Verbrechen, körperliche und psychische Gewalt und Folter, Missbrauch und Vergewaltigung, BDSM sowie extreme sexuelle Praktiken.
Laurell K. Hamilton
ANITA BLAKE
Tanz der Toten
Aus dem amerikanischen Englisch von Angela Koonen
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1997 by Laurell K. Hamilton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Killing Dance«
Published by Arrangement with Laurell K. Hamilton
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2007/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Tanz der Toten«
Covergestaltung: Guter Punkt, München
unter Verwendung von Motiven © iStock/BojanMirkovic; AdobeStock/ASjack
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0242-3
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Paty Cockrum,Fan, Freundin und Künstlerin.Sie sollten die Bilder sehen,die sie mir von Jean-Claude schickt.Sie ist die Stimme der Verführung.
1
Hinter meinem Schreibtisch saß die schönste Leiche, die ich je gesehen hatte. Jean-Claudes weißes Hemd leuchtete im Schein der Schreibtischlampe. Ein Wasserfall aus Spitze quoll aus dem Ausschnitt seiner schwarzen Samtjacke. Ich stand hinter ihm, mit dem Rücken an der Wand und verschränkten Armen, was meine Hände beruhigend nah an das Schulterholster mit der Browning Hi-Power brachte. Ich hatte nicht vor, sie auf ihn zu richten. Es war der andere Vampir, der mir Sorgen machte.
Nur die Schreibtischlampe brannte. Der Vampir hatte verlangt, dass das Deckenlicht ausgeschaltet wurde. Er hieß Sabin, und er stand mir gegenüber an der Wand und drückte sich ins Dunkle. Er war von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Kapuzenumhang gehüllt. Sah aus wie aus einem alten Vincent-Price-Film. Ich hatte noch nie einen echten Vampir gesehen, der sich so anzog.
Der Letzte in unserer heiteren Runde war Dominic Dumare. Er saß auf einem der Klientensessel. Er war groß und dünn, aber nicht schmächtig. Er hatte kräftige Hände, die groß genug waren, um mein Gesicht in seiner Handfläche verschwinden zu lassen. Er trug einen dreiteiligen schwarzen Anzug, der nach Chauffeur aussah, wenn man von der Anstecknadel mit dem Diamanten absah. Ein Backen- und Oberlippenbart betonten sein markantes Gesicht.
Gleich beim Hereinkommen hatte ich von ihm einen übersinnlichen Wind gespürt, der mir das Rückgrat hinunterfuhr. Mir waren erst zwei Leute begegnet, die dieses Fluidum ausstrahlten: die Nummer eins unter den mir bekannten Voodoopriestern und die Nummer zwei unter den mir bekannten Voodoopriestern. Nummer eins, eine Frau, war tot. Nummer zwei, ein Mann, arbeitete für Animators, Inc., genau wie ich. Aber Dominic Dumare war nicht hier, um sich um eine Stelle zu bewerben.
»Ms Blake, bitte nehmen Sie Platz«, begann Dumare. »Sabin findet es äußerst beleidigend zu sitzen, solange eine Dame steht.«
Ich blickte an ihm vorbei zu Sabin. »Ich werde mich setzen, wenn er sich setzt«, antwortete ich.
Dumare sah Jean-Claude an. Der schenkte ihm ein freundlich herablassendes Lächeln. »Hast du so wenig Kontrolle über deinen menschlichen Diener?«
Ich brauchte Jean-Claude nicht anzusehen, um zu wissen, wie er lächelte. »Oh, bei ma petite bist du auf dich allein gestellt. Sie ist mein menschlicher Diener, wie vor dem Rat erklärt, aber sie gehorcht niemandem.«
»Du scheinst stolz darauf zu sein«, sagte Sabin. Er klang britisch und sehr nach den oberen Zehntausend.
»Sie ist der Scharfrichter und hat mehr Vampirfähigkeiten als sonst ein Mensch. Sie ist eine so machtvolle Totenbeschwörerin, dass du immerhin um die halbe Welt gereist bist, um sie zu konsultieren. Sie ist mein menschlicher Diener, trägt aber kein Zeichen, das sie an mich bindet. Sie geht mit mir aus, ohne dass ich sie in meinen Bann schlagen muss. Warum sollte ich nicht zufrieden sein?«
Wenn man ihn so hörte, konnte man meinen, dass das alles auf seinem Mist gewachsen war. Tatsache war, dass er nichts unversucht gelassen hatte, um mir seine Vampirzeichen aufzudrücken, aber mir war es gelungen, ohne davonzukommen. Und wir gingen miteinander aus, weil er mich erpresste: Entweder ließ ich mich von ihm ausführen, oder er würde meinen Freund umbringen. Jean-Claude hatte alles zu seinem Vorteil gedreht. Wieso überraschte mich das nicht?
»Bis sie stirbt, kannst du keinen anderen Menschen zeichnen«, stellte Sabin fest. »Du hast dich um ein beträchtliches Maß an Macht gebracht.«
»Ich weiß genau, was ich getan habe«, erwiderte Jean-Claude.
Sabin lachte, und es klang gallebitter. »Wir alle tun seltsame Dinge um der Liebe willen.«
In dem Moment hätte ich viel gegeben, Jean-Claudes Gesicht sehen zu können. Ich sah nur sein langes Haar, das schwarz auf schwarz über die Samtjacke floss. Aber seine Schultern versteiften sich, die Hände strichen über die Schreibunterlage, dann wurde er völlig reglos. So abwartend reglos, wie es nur sehr alte Vampire können, als würden sie, wenn sie nur lange genug stillhalten, ganz einfach verschwinden.
»Das ist es, was dich hergeführt hat, Sabin? Die Liebe?« Jean-Claude klang neutral, nichtssagend.
Sabins Lachen zerschnitt die Luft wie eine Glasscherbe. Es fühlte sich an, als würde allein ihr Klang für innere Verletzungen sorgen. Das gefiel mir nicht.
»Schluss mit dem Geplänkel«, sagte ich, »bringen wir’s hinter uns.«
»Ist sie immer so ungeduldig?«, fragte Dumare.
»Ja«, antwortete Jean-Claude.
Dumare lächelte, strahlend und hohl wie eine Glühbirne. »Hat Jean-Claude Ihnen erzählt, warum wir Sie zu sprechen wünschen?«
»Sabin hat angeblich eine Art Krankheit erwischt, weil er unbedingt den Affen schieben wollte, ich meine, den Totalentzug versucht hat.«
Der Vampir hinten an der Wand brach wieder in Lachen aus, schleuderte es durchs Zimmer wie eine Klinge. »Den Affen schieben, herrlich, Ms Blake, herrlich.«
Das Gekicher ritzte mich wie ein Satz Rasierklingen. So etwas hatte ich noch nie beim bloßen Klang einer Stimme erlebt. Bei einem Kampf wäre es äußerst ablenkend. Zum Teufel, es war jetzt schon ablenkend. Auf meiner Stirn spürte ich etwas Feuchtes. Ich fasste hin und holte mir blutige Finger. Ich zog die Browning, trat von der Wand weg und zielte auf die schwarze Gestalt gegenüber. »Wenn er das noch einmal tut, erschieße ich ihn.«
Jean-Claude erhob sich langsam aus dem Sessel. Seine Kräfte strömten über mich wie kalter Wind und machten mir Gänsehaut. Er hob eine bleiche Hand, die fast durchscheinend war. Über seine schimmernde Haut liefen Blutstropfen.
Dumare blieb in seinem Sessel, aber auch er blutete aus einer ganz ähnlichen Schnittwunde. Er wischte sich die Stirn ab und lächelte dabei. »Das wird nicht nötig sein.«
»Du hast meine Gastfreundschaft missbraucht«, sagte Jean-Claude. Seine Stimme füllte das Zimmer mit zischenden Echos.
»Es gibt nichts, was ich zu meiner Entschuldigung anführen könnte«, sagte Sabin. »Aber ich habe es nicht absichtlich getan. Ich setze meine Kräfte nur so stark ein, um mich selbst zu erhalten. Ich habe darüber nicht mehr die Gewalt wie früher.«
Ich entfernte mich langsam von der Wand, ohne die Waffe zu senken. Ich wollte Jean-Claudes Gesicht sehen. Ich musste wissen, wie schlimm seine Verletzung war. Ich schob mich um den Schreibtisch herum, bis ich ihn aus den Augenwinkeln sehen konnte. Sein Gesicht war unangetastet und makellos, schimmerte wie Perlmutt.
Er hob die Hand, an der eine feine Blutspur herabfloss. »Das war kein Missgeschick.«
»Kommen Sie ins Licht, mein Freund«, bat Dumare. »Man muss es selbst sehen, damit man begreift.«
»Ich will so nicht gesehen werden.«
»Du hast mein Wohlwollen so gut wie verspielt«, sagte Jean-Claude.
»Meins auch«, fügte ich hinzu. Ich hoffte, dass ich Sabin bald erschießen oder aber die Waffe senken konnte. Selbst mit beiden Händen kann man eine Pistole nicht ewig im Anschlag halten. Man fängt unweigerlich an zu wackeln.
Sabin glitt auf den Schreibtisch zu. Der schwarze Umhang umspülte seine Füße wie ein Teich aus Dunkelheit. Alle Vampire hatten eine gewisse Anmut, aber das hier war lächerlich. Ich bemerkte, dass er eigentlich gar nicht ging. Er schwebte innerhalb des Umhangs.
Seine Macht floss mir über die Haut wie Eiswasser. Meine Hände waren plötzlich wieder ruhig. Nichts stählt dermaßen die Nerven, wie wenn mehrere Jahrhunderte in Gestalt eines Vampirs auf einen zukommen.
Sabin blieb an der Schreibtischkante stehen. Er verströmte seine Kräfte, nur um sich zu bewegen, um überhaupt hier zu sein, so als würde er sonst sterben, etwa wie ein Hai, der nicht in Bewegung bleibt.
Jean-Claude glitt um mich herum. Seine Macht spielte über meinen Körper, dass sich mir die Nackenhaare aufrichteten, die Haut sich zusammenzog. Er blieb auf Armeslänge vor Sabin stehen. »Was ist dir zugestoßen, Sabin?«
Sabin stand am Rand des Lichtkegels. Die Lampe hätte ein bisschen Licht unter die Kapuze bringen müssen, doch sie tat es nicht. Das Innere der Kapuze war so gleichmäßig schwarz und leer wie eine Höhle. Aus diesem Nichts kam seine Stimme. Ich zuckte zusammen.
»Die Liebe, Jean-Claude, die Liebe ist mir zugestoßen. Meine Geliebte entwickelte ein Gewissen. Sie meinte, es sei falsch, sich von Menschen zu ernähren. Wir seien schließlich auch einmal Menschen gewesen. Aus Liebe zu ihr habe ich versucht, kaltes Blut zu trinken. Ich habe es mit Tierblut versucht. Doch das reichte nicht, um sich zu ernähren.«
Ich blickte angestrengt in diese dunkle Höhlung. Ich hielt die Pistole noch auf ihn gerichtet, kam mir aber allmählich albern vor. Sabin schien davor nicht die geringste Angst zu haben, was ich entnervend fand. Aber vielleicht war es ihm einfach nur egal. Das war allerdings genauso entnervend. »Sie hat Sie überredet, Vegetarier zu werden. Großartig«, sagte ich. »Mächtig genug scheinen Sie ja zu sein.«
Er lachte, und dabei lichtete sich langsam die Dunkelheit in der Kapuze, als würde jemand die Gardinen aufziehen. Dann riss er sie mit einer schwungvollen Bewegung zurück.
Ich schrie nicht, wich aber keuchend vor ihm zurück. Ich konnte nicht anders. Als es mir bewusst wurde, zwang ich mich einen Schritt auf ihn zu, zwang mich, seinem Blick zu begegnen. Bloß nicht mit der Wimper zucken.
Sein Haar war dick und glatt und goldblond und fiel ihm wie ein strahlender Vorhang um die Schultern. Aber seine Haut – das halbe Gesicht war weggefault. Es war wie Lepra im Spätstadium, nur schlimmer. Das Fleisch war vereitert und brandig und hätte zum Himmel stinken müssen. Die andere Gesichtshälfte war noch schön. Er hatte ein Gesicht, wie es die Maler des Mittelalters für Engelsköpfe nahmen, eine goldene Makellosigkeit. Ein kristallblaues Auge rollte in seiner verwesenden Höhle, als drohte es herauszukullern. Das andere Auge saß noch fest und verfolgte jede meiner Regungen.
»Du kannst die Waffe wegstecken, ma petite. Es war doch ein Missgeschick«, sagte Jean-Claude.
Ich senkte die Browning, steckte sie aber nicht weg. »Das ist nur passiert, weil Sie aufgehört haben, sich von Menschen zu ernähren?« Diese Frage so ruhig zu stellen kostete mich mehr Anstrengung als schön war.
»Das vermuten wir«, antwortete Dumare.
Ich riss mich von Sabins Anblick los und wandte mich an Dominic. »Und Sie glauben, ich kann ihn heilen?« Meine Verblüffung ließ sich nicht unterdrücken.
»Ich hörte in Europa, welchen Ruf Sie genießen.«
Ich zog die Augenbrauen hoch.
»Keine falsche Bescheidenheit, Ms Blake. Unter unseresgleichen, die von solchen Dingen Notiz nehmen, haben Sie eine gewisse Berühmtheit erlangt.«
Berühmtheit, nicht Ruhm. Hm.
»Steck die Waffe weg, ma petite. Sabin hat für heute Abend – wie sagt man doch gleich – sein Pulver verschossen. Nicht wahr, Sabin?«
»Ich fürchte, ja. Es läuft inzwischen alles so unerfreulich.«
Ich steckte die Pistole ins Holster und schüttelte den Kopf. »Ich habe ehrlich nicht die leiseste Ahnung, wie ich Ihnen helfen soll.«
»Wenn Sie es wüssten, würden Sie mir dann helfen?«, fragte Sabin.
Ich sah ihn an und nickte. »Ja.«
»Obwohl ich ein Vampir bin und Sie ein Vampirhenker?«
»Haben Sie in diesem Land etwas getan, für das man Sie töten müsste?«
Sabin lachte. Die Haut dehnte sich, und eine Sehne riss mit einem nassen Knacken. Ich musste wegsehen. »Noch nicht, Ms Blake, noch nicht.« Er wurde schnell wieder ernst, mit dem Humor war es abrupt vorbei. »Du hast dir angewöhnt, mit keiner Miene zu verraten, was du denkst, Jean-Claude, aber ich habe das Entsetzen in deinen Augen gesehen.«
Jean-Claudes Gesicht hatte wieder die übliche milchweiße Makellosigkeit angenommen. Es war schön wie immer, hatte aber aufgehört zu schimmern. Seine mitternachtsblauen Augen waren nur Augen. Er war beinahe auf menschliche Weise schön. »Ist da nicht ein bisschen Entsetzen angebracht?«, fragte er.
Sabin lächelte, und ich wünschte, er täte das nicht. Auf der verwesten Seite arbeiteten die Muskeln nicht mehr, und sein Mund hing schief. Ich schaute weg, dann zwang ich mich hinzusehen. Wenn er gezwungen war, in dieser Haut zu stecken, konnte ich gefälligst auch hinsehen.
»Dann wirst du mir helfen?«
»Ich würde es tun, wenn ich könnte, aber es ist Anita, die du konsultierst. Sie muss selbst entscheiden.«
»Nun, Ms Blake?«
»Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen könnte«, sagte ich noch einmal.
»Verstehen Sie, wie entsetzlich diese Umstände für mich sind, Ms Blake? Wie wahrhaft grauenvoll, begreifen Sie das?«
»Verstehe ich richtig, dass die Verwesung Sie zwar nicht umbringt, aber voranschreitet?«
»Oh ja, sie schreitet voran, und zwar mächtig.«
»Ich würde Ihnen helfen, wenn ich könnte, Sabin, aber was könnte ich tun, was Dumare nicht kann? Er ist ein Totenbeschwörer, ein ebenso guter wie ich vielleicht, vielleicht sogar ein besserer. Warum brauchen Sie mich?«
»Ich verstehe, Ms Blake, dass Sie für Sabins Problem nichts Spezielles parat haben«, sagte Dumare. »Soweit ich nachgeforscht habe, ist er der einzige Vampir mit einem solchen Schicksal, aber ich dachte, wenn wir zu einem Totenbeschwörer gingen, der so gut ist wie ich«, er lächelte bescheiden, »oder fast so gut wie ich, dann könnten wir zusammen einen Zauber entwickeln, der ihm hilft.«
»Einen Zauber?« Ich sah Jean-Claude an.
Er reagierte mit diesem französischen Achselzucken, das alles und nichts bedeutete. »Ich weiß wenig über Totenbeschwörungen, ma petite. Du kannst besser als ich beurteilen, ob so ein Zauber möglich ist.«
»Es sind nicht nur Ihre Fähigkeiten als Totenbeschwörerin, die uns zu Ihnen gebracht haben«, fuhr Dumare fort. »Sie haben auch bei mindestens zwei Animatoren schon als Fokus gedient, so wird es glaube ich genannt.«
Ich nickte. »So wird das genannt. Aber wo haben Sie gehört, ich könnte als Fokus agieren?«
»Kommen sie, Ms Blake, die Fähigkeit, die Kräfte eines anderen Animators mit den eigenen zu verbinden und damit beider Macht zu verstärken, ist ein seltenes Talent.«
»Können Sie als Fokus agieren?«, fragte ich.
Er wollte bescheiden wirken und sah stattdessen selbstzufrieden aus. »Ich muss gestehen, dass ich das kann, ja. Stellen Sie sich vor, was wir beide zusammen vollbringen könnten.«
»Wir könnten Zombies stapelweise erwecken, aber das würde Sabin nicht heilen.«
»Wohl wahr.« Dumare beugte sich nach vorn. Sein schmales, gut aussehendes Gesicht errötete vor Eifer, ein echter Bekehrter, der nach Jüngern Ausschau hielt.
Aber Jüngertum war nichts für mich.
»Ich könnte Ihnen anbieten, Sie die wirkliche Nekromantie zu lehren, nicht diesen Voodoo-Dilettantismus, den Sie bisher ausgeübt haben.«
Jean-Claude gab ein Geräusch von sich, das halb Lachen und halb Husten war.
Ich warf ihm einen drohenden Blick zu, sagte aber: »Ich komme mit dem Voodoo-Dilettantismus ganz gut zurecht.«
»Das sollte keine Beleidigung sein, Ms Blake. Sie werden bald einen richtigen Lehrer brauchen. Wenn nicht mich, dann einen anderen.«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Beherrschung, Ms Blake. Rohe Gewalt, ganz gleich wie beeindruckend, ist nicht dasselbe wie die Macht, die mit großer Sorgfalt und großer Beherrschung eingesetzt wird.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich werde Ihnen helfen, wenn ich kann, Mr Dumare. Ich bin sogar bereit, bei einem Zauber mitzuwirken, nachdem ich ihn mit einer hiesigen Hexe, die ich kenne, überprüft habe.«
»Haben Sie Angst, dass ich versuchen könnte, Ihnen Ihre Macht zu stehlen?«
Ich lächelte. »Nein, solange Sie mich nicht töten, können Sie sie allerhöchstens borgen.«
»Sie sind erfahrener, als Ihr Alter nahelegt, Ms Blake.«
»Sie sind auch nicht viel älter als ich«, erwiderte ich. Da huschte etwas über sein Gesicht, nur eine Andeutung, aber ich wusste Bescheid.
»Sie sind sein menschlicher Diener, nicht wahr?«
Dominic lächelte und breitete die Hände aus. »Oui.«
Ich seufzte. »Sie haben doch gesagt, dass Sie nichts vor mir verheimlichen wollen.«
»Es ist die Aufgabe eines menschlichen Dieners, tagsüber Auge und Ohr seines Meisters zu sein. Ich wäre für meinen Meister nutzlos, wenn mich jeder Vampirjäger gleich durchschauen würde.«
»Ich habe Sie durchschaut.«
»Aber hätten Sie das auch in einer anderen Situation, ohne Sabin an meiner Seite?«
Ich dachte einen Moment lang darüber nach. »Vielleicht.« Dann schüttelte ich den Kopf. »Ich weiß es nicht.«
»Danke für Ihre Ehrlichkeit, Ms Blake.«
Sabin sagte: »Ich bin sicher, unsere Zeit ist um. Jean-Claude sagte, Sie hätten einen dringenden Auftrag, Ms Blake. Etwas Wichtigeres als mein kleines Problem.« Das kam ein wenig stichelnd.
»Ma petite hat eine Verabredung mit ihrem anderen Kavalier.«
Sabin starrte Jean-Claude an. »Du erlaubst ihr also tatsächlich, mit einem anderen auszugehen. Ich dachte, das zumindest wäre nur ein Gerücht.«
»Von dem, was man über ma petite hört, ist nur sehr weniges Gerücht. Glaube alles, was dir zu Ohren kommt.«
Sabin hüstelte und gab sich alle Mühe, nicht laut herauszulachen. »Wenn ich alles glauben würde, was ich gehört habe, wäre ich mit einer Streitmacht gekommen.«
»Du bist mit einem Diener gekommen, weil ich dir nur einen Diener gestattet habe«, erwiderte Jean-Claude.
Sabin schmunzelte. »Nur zu wahr. Komm, Dominic, wir dürfen nicht noch mehr von Ms Blakes kostbarer Zeit vergeuden.«
Dumare erhob sich gehorsam. Er ragte wie ein Turm vor uns auf. Sabin hatte etwa meine Größe. Natürlich wusste ich nicht genau, ob seine Beine noch da waren. Er konnte auch einmal größer gewesen sein.
»Ich kann Sie nicht leiden, Sabin, aber ich würde kein Wesen bewusst diesem Zustand überlassen, in dem Sie sich befinden. Was ich heute Abend vorhabe ist wichtig, aber wenn ich glaubte, Sie sofort heilen zu können, würde ich meine Pläne ändern.«
Der Vampir sah mich an. Seine ach so blauen Augen waren wie klares Meerwasser. Man spürte keine Vampirkräfte. Entweder benahm er sich gerade, oder er konnte mich wie die meisten Vampire mit seinem Blick nicht einfangen.
»Danke, Ms Blake. Ich glaube Ihnen, dass Sie es ernst meinen.« Unter seinem voluminösen Umhang streckte er eine behandschuhte Hand hervor.
Ich zögerte, dann drückte ich sie. Sie fühlte sich so teigig an, dass ich mich zusammenreißen musste, um nicht ruckartig loszulassen. Ich zwang mich, ihm die Hand zu schütteln, zu lächeln und wieder loszulassen, ohne mir die Finger am Rock abzuwischen.
Auch Dumare gab mir die Hand. Seine war kühl und trocken. »Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, Ms Blake. Ich werde mich morgen mit Ihnen in Verbindung setzen, damit wir die Dinge besprechen.«
»Ich erwarte Ihren Anruf, Mr Dumare.«
»Nennen Sie mich Dominic, bitte.«
Ich nickte. »Dominic. Wir können darüber sprechen, aber ich lehne es ab, Geld von Ihnen zu nehmen, solange ich nicht sicher bin, ob ich überhaupt helfen kann.«
»Darf ich Sie Anita nennen?«, fragte er.
Ich zögerte und zuckte die Achseln. »Warum nicht.«
»Über Geld mache ich mir keine Gedanken«, sagte Sabin. »Davon habe ich reichlich, obwohl es mir kaum nützt.«
»Wie nimmt die Frau, die du liebst, die Veränderung deines Äußeren auf?«, fragte Jean-Claude.
Sabin sah ihn an. Es war kein freundlicher Blick. »Sie findet es abstoßend, genau wie ich. Sie fühlt sich zutiefst schuldig. Sie hat mich nicht verlassen, ist aber auch nicht bei mir.«
»Sie leben seit fast siebenhundert Jahren«, sagte ich. »Warum verderben Sie sich alles wegen einer Frau?«
Sabin drehte sich zu mir um. Ein dunkles Rinnsal kroch über seine Wange wie eine schwarze Träne. »Sie fragen mich, ob es die Sache wert war, Ms Blake?«
Ich schluckte und schüttelte den Kopf. »Es geht mich nichts an, es tut mir leid, dass ich gefragt habe.«
Er zog sich die Kapuze übers Gesicht, dann drehte er sich wieder zu mir, mit dieser dunklen Höhlung, wo sein Gesicht hätte sein sollen. »Sie wollte mich verlassen, Ms Blake. Ich glaubte, ich würde alles geben wollen, um sie an meiner Seite zu behalten, in meinem Bett. Ich habe mich getäuscht.« Er wandte die schwarze Höhlung Jean-Claude zu. »Wir sehen uns morgen Nacht, Jean-Claude.«
»Ich freue mich darauf.«
Keiner der beiden Vampire streckte die Hand aus. Sabin glitt zur Tür, die Robe wallte hinter ihm her, leer. Ich fragte mich, wie viel von seinem Unterkörper noch übrig war, und entschied, dass ich es nicht wissen wollte.
Dominic schüttelte mir die Hand. »Danke, Anita. Sie haben uns Hoffnung gegeben.« Er hielt meine Hand und starrte mir ins Gesicht, als könnte er etwas herauslesen. »Und denken Sie über mein Angebot nach. Es gibt nur wenige echte Totenbeschwörer.«
Ich entzog ihm meine Hand. »Ich werde es mir überlegen. Jetzt muss ich wirklich gehen.«
Er lächelte, hielt Sabin die Tür auf, und draußen waren sie. Jean-Claude und ich standen einen Moment lang schweigend da. Ich unterbrach die Stille. »Kann man ihnen trauen?«
Jean-Claude setzte sich auf die Schreibtischkante. »Natürlich nicht.«
»Warum warst du dann einverstanden, dass sie herkommen?«
»Der Rat hat erklärt, dass kein Meistervampir in den Vereinigten Staaten einen Streit beginnen darf, bis dieses hässliche Gesetz, das da in Washington in der Schwebe ist, wieder vom Tisch ist. Ein Krieg unter den Untoten, und die Antivampirlobby drückt das Gesetz durch und schickt uns zurück in die Illegalität.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass Brewsters Gesetz auch nur die geringste Chance hat. Vampirismus ist bei uns legal, ob es mir gefällt oder nicht, und das wird sich meiner Meinung nach nicht mehr ändern.«
»Wie kannst du so sicher sein?«
»Man kann nicht zuerst behaupten, dass bestimmte Wesen lebendig sind und Rechte haben, und dann seine Meinung wieder ändern und sagen, es ist in Ordnung, wenn man sie im Vorbeifahren abschießt. Die ACLU hätte ihren großen Tag.«
Er lächelte. »Vielleicht. Dessen ungeachtet hat der Rat uns allen einen Waffenstillstand auferlegt, bis über das Gesetz entschieden ist.«
»Darum kannst du Sabin auf dein Territorium lassen. Weil der Rat ihn bei einem Fehlverhalten stellen und töten würde.«
Jean-Claude nickte.
»Aber du wärst trotzdem tot«, vermutete ich.
Er breitete anmutig die Arme aus. »Nichts ist vollkommen.«
Ich lachte. »Wahrscheinlich nicht.«
»Nun, wirst du nicht zu spät zu deiner Verabredung mit Monsieur Zeeman kommen?«
»Du gehst ja schrecklich zivilisiert damit um«, sagte ich.
»Morgen Abend wirst du mit mir zusammen sein, ma petite. Ich wäre ein schlechter … Verlierer, wenn ich Richard diesen Abend missgönnen wollte.«
»Du bist meistens ein schlechter Verlierer.«
»Also, ma petite, das ist kaum gerecht. Richard ist nicht tot, nicht wahr?«
»Nur weil du weißt, dass ich dich umbringen würde, wenn du ihn tötest.« Ich hob die Hand, ehe er widersprechen konnte. »Ich würde versuchen, dich umzubringen, und du würdest versuchen, mich umzubringen usw.« Das war ein alter Streit zwischen uns.
»Richard ist also am Leben, du gehst mit uns beiden aus, und ich bin geduldig. Geduldiger als ich je mit jemandem gewesen bin.«
Ich musterte sein Gesicht. Er gehörte zu den Männern, die mehr schön als gut aussehend sind, aber sein Gesicht war maskulin, hatte nichts Weibliches an sich, trotz der langen Haare. Tatsächlich war er sogar furchtbar männlich, egal wie viel Spitze er trug.
Er hätte mein sein können, mit Stumpf und Stiel und Reißzähnen. Aber ich war nicht sicher, ob ich ihn wollte. »Ich muss gehen«, sagte ich.
Er stieß sich vom Schreibtisch ab. Plötzlich stand er dicht bei mir. »Dann geh, ma petite.«
Ich spürte seinen Körper wie flimmernde Energie. Ich musste schlucken, ehe ich antworten konnte. »Das ist mein Büro. Du musst gehen.«
Er nahm sacht meine Arme, es war nur eine Berührung mit den Fingerspitzen. »Genieße den Abend, ma petite.« Seine Finger schlossen sich um meine Oberarme, dicht an den Achseln. Er beugte sich nicht zu mir, zog mich auch nicht das letzte Stückchen zu sich heran. Er hielt mich einfach fest und blickte auf mich herab.
Ich sah in seine dunkelblauen Augen. Es hatte eine Zeit gegeben, die gar nicht so lange her war, wo ich seinem Blick nicht begegnen konnte, ohne hineinzufallen und mich zu verlieren. Jetzt konnte ich ihm in die Augen sehen, aber in gewisser Hinsicht war ich noch genauso verloren. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und beugte mich ganz nah an sein Gesicht.
»Ich hätte dich längst umbringen sollen.«
»Du hattest mehrmals die Gelegenheit, ma petite. Stattdessen rettest du mich immer wieder.«
»Ein Fehler von mir«, stellte ich fest.
Er lachte, und der Klang strich über meinen Körper wie Pelz über nackte Haut. Ich schauderte.
»Lass das«, sagte ich.
Er küsste mich sacht, nur mit den Lippen, damit ich die Reißzähne nicht spürte. »Du würdest mich vermissen, wenn ich nicht mehr da wäre, ma petite. Gib es zu.«
Ich zog mich von ihm zurück. Seine Hände glitten an meinen Armen entlang, bis sich unsere Finger streiften. »Ich muss gehen.«
»Das sagtest du schon.«
»Raus jetzt, Jean-Claude, keine weiteren Spielchen.«
Er wurde urplötzlich ernst, als hätte einer sein Lächeln weggewischt. »Keine weiteren Spielchen. Geh zu deinem Liebhaber, ma petite.« Jetzt war er es, der mir mit einer Geste das Wort abschnitt. »Ich weiß, er ist nicht wirklich dein Liebhaber. Ich weiß, dass du für euch beide widerstehst. Tapfer, ma petite.« Es huschte etwas über sein Gesicht, vielleicht Ärger, und verschwand wie eine Kräuselwelle auf dunklem Wasser.
»Morgen Abend wirst du bei mir sein, und Richard ist an der Reihe, zu Hause zu sitzen und sich zu fragen, was wir treiben.« Er schüttelte den Kopf. »Nicht einmal für dich würde ich tun, was Sabin getan hat. Nicht einmal für deine Liebe. Es gibt Dinge, die ich nicht tun würde.« Er blickte mich plötzlich zornig an, der Zorn flammte in seinen Augen, in seinem ganzen Gesicht auf. »Was ich tue, ist schon genug.«
»Werde jetzt bloß nicht selbstgerecht«, sagte ich. »Wenn du dich nicht dazwischengedrängt hättest, wären Richard und ich jetzt verlobt, vielleicht sogar mehr.«
»Und? Du würdest hinter einem weiß gestrichenen Zaun wohnen mit zwei Komma soundso viel Kindern. Ich glaube, du belügst dich selbst viel mehr als mich, Anita.«
Es war immer ein schlechtes Zeichen, wenn er mich beim Namen nannte. »Was soll das heißen?«
»Das heißt, ma petite, dass du im häuslichen Hafen wahrscheinlich genauso wenig gedeihen würdest wie ich.« Damit glitt er zur Tür und ging. Er schloss sie leise, aber bestimmt.
Häuslicher Hafen? Wer, ich? Mein Leben war eine Mischung aus übernatürlicher Seifenoper und Actionabenteuer. Etwa mit dem Titel Rambo und die Armee der Untoten. Weiß gestrichene Zäune passten da nicht rein. Da hatte Jean-Claude recht.
Ich hatte das ganze Wochenende frei. Zum ersten Mal seit Monaten. Ich hatte mich die ganze Woche auf den Abend gefreut. Aber ehrlich gesagt war es nicht Jean-Claudes makelloses Gesicht, das mich verfolgte. Es war Sabins Gesicht, das mir immer wieder vor Augen kam. Ewiges Leben, ewige Qual, ewige Hässlichkeit. Schön, so ein Leben nach dem Tod.
2
Auf Catherines Dinnerparty waren drei Arten Leute: lebendige, tote und vorübergehend pelzige. Sechs von uns acht waren Menschen, und bei zweien davon war ich mir nicht sicher, mich eingeschlossen.
Ich trug schwarze Hosen, eine schwarze Samtjacke mit weißem Satinrevers und eine längere weiße Weste als Blusenersatz. Meine Browning passte gar nicht schlecht zu der Aufmachung, aber ich behielt sie verdeckt. Es war die erste Party, die Catherine seit ihrer Hochzeit gab. Da konnte es sich lähmend auswirken, wenn man seine Pistole offen zeigte.
Ich hatte das Silberkreuz abnehmen und in die Tasche stecken müssen, weil es zu glühen anfing, sobald der Vampir, der jetzt vor mir stand, den Raum betreten hatte. Wenn ich gewusst hätte, dass auch Vampire auf die Party kommen, hätte ich etwas Hochgeschlossenes getragen. Die Kreuze glühen im Allgemeinen nur, wenn sie offen zu sehen sind.
Robert, der fragliche Vampir, war groß, muskulös und hatte ein titelblatttaugliches Aussehen. Er war im Guilty Pleasures Stripper gewesen. Jetzt leitete er es. Vom Arbeiter zum Manager: der amerikanische Traum. Er hatte blonde, sehr kurz geschnittene Locken. Er trug ein braunes Seidenhemd, das wie angegossen saß und zum Kleid seiner Partnerin passte.
Monica Vespuccis Sonnenstudiobräune war ein bisschen verblasst, aber ihr Make-up war perfekt, die kurzen braunen Haare saßen alle am richtigen Fleck. Sie war gerade so viel schwanger, dass es auffiel, und gab sich in aufreizender Weise glücklich.
Sie strahlte mich an. »Anita, es ist viel zu lange her.«
»Nicht lange genug«, wollte ich eigentlich antworten. Bei unserer letzten Begegnung hatte sie mich dem Meistervampir der Stadt ausgeliefert. Aber Catherine hielt sie für ihre Freundin, und es war schwierig, ihr diese Illusion zu nehmen, ohne dabei die ganze Geschichte zu erzählen. Die schloss nämlich ein paar illegale Tötungen ein, von denen einige auf mein Konto gingen. Catherine ist Anwältin und ein Verfechter von Recht und Ordnung. Ich wollte sie nicht in eine Lage bringen, in der sie ihren Grundsätzen zuwiderhandeln müsste, um mich rauszuhauen. Also war Monica ihre Freundin, was bedeutete, dass ich während des gesamten Abendessens vom Aperitif bis zum Dessert höflich zu ihr blieb. In erster Linie weil sie am anderen Ende des Tisches saß. Inzwischen stand man zwanglos im Wohnzimmer herum, und meine Anwesenheit schien sie nicht zu erschüttern.
»Mir kam es gar nicht so lange vor«, erwiderte ich.
»Fast ein Jahr.« Sie lächelte zu Robert hinauf. Sie hielten Händchen. »Wir haben geheiratet.« Sie tippte sich gegen den Bauch. »Man hat uns dick gemacht.« Sie kicherte.
Ich starrte die beiden an. »Eine hundert Jahre alte Leiche kann keine dick machen.« Okay, ich war lange genug höflich gewesen.
Monica grinste mich an. »Es geht, wenn die Körpertemperatur lange genug erhöht ist und man oft genug Sex hat. Meine Hebamme meint, die heiße Badewanne hat’s gebracht.«
Das war mehr, als ich wissen wollte. »Warst du schon bei der Fruchtwasseruntersuchung?«
Ihr Lächeln verschwand, ihr Blick wurde ängstlich. Ich bedauerte, dass ich gefragt hatte. »Wir müssen noch eine Woche warten.«
»Es tut mir leid, ihr beide. Ich hoffe, das Testergebnis ist sauber.« Ich sagte nichts vom Vlad-Syndrom, aber der Gedanke stand im Raum. Es kam selten vor, aber nicht mehr so selten wie früher. Drei Jahre legaler Vampirismus, und das Vlad-Syndrom war der Geburtsfehler mit der höchsten Anstiegsrate. Es konnte zu schrecklichen Behinderungen führen, ganz zu schweigen vom Tod des Säuglings. Bei diesem Risiko sollte man meinen, dass die Leute vorsichtiger wären.
Robert nahm sie in den Arm, das ganze Leuchten war aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie sah blass aus. Ich kam mir vor wie ein Miststück.
»Neulich hieß es noch, dass über hundertjährige Vampire gar nicht zeugungsfähig sind«, sagte ich. »Die Behörden sollten ihre Angaben mal aktualisieren, schätze ich.« Das sollte beruhigend klingen, so als hätten nicht sie sich sorglos verhalten.
Monica sah mich an, und in ihrem Blick lag keine Freundlichkeit, als sie meinte: »Beunruhigt?«
Ich starrte sie in ihrer bleichen Trächtigkeit an und hätte sie gerne zur Seite geschubst. Ich schlief nicht mit Jean-Claude. Aber ich würde auch nicht hingehen und mich vor Monica Vespucci rechtfertigen, eigentlich vor niemandem.
Richard Zeeman betrat den Raum. Ich sah ihn nicht, ich spürte ihn. Ich drehte mich um und sah ihn auf uns zukommen. Er war einsfünfundachtzig, gute dreißig Zentimeter größer als ich. Ein Zentimeter mehr, und wir hätten uns ohne Stuhl nicht küssen können. Doch die Mühe wäre es wert gewesen. Er fädelte sich zwischen den Leuten hindurch und wechselte hier und da ein paar Worte. Bei seiner braunen Haut leuchtete sein Lächeln weiß und makellos, während er mit den neuen Freunden sprach, die er im Laufe des Essens bezirzt hatte. Nicht mit Sexappeal oder mit seinen Kräften, sondern mit purer Freundlichkeit. Er hatte die Seele eines Pfadfinders: war einfach umwerfend umgänglich. Er mochte Menschen und war ein wundervoller Zuhörer, zwei Eigenschaften, die reichlich unterbewertet werden.
Sein Anzug war dunkelbraun, sein Hemd dunkelgoldorange. Die Krawatte hatte ein helleres Orange und kleine Figürchen in der Mitte. Man musste dicht herangehen, um sie als Warner-Brothers-Zeichentrickfiguren zu erkennen.
Sein schulterlanges Haar war nach französischer Art eng am Kopf nach hinten geflochten, sodass von vorn der Eindruck entstand, es sei ganz kurz geschnitten. Dadurch war sein Gesicht frei und klar zu sehen. Seine Wangenknochen waren perfekt, hoch angesetzt und elegant geschwungen. Sein Gesicht war sehr maskulin und hatte ein Grübchen, das es weicher machte. Auf der Highschool wäre ich vor so einem Gesicht schüchtern geworden.
Er bemerkte lächelnd, wie ich ihn betrachtete. Seine braunen Augen fingen an zu funkeln und bekamen eine Glut, die nicht von der Raumtemperatur rührte. Ich beobachtete ihn, wie er die letzten Meter auf uns zukam, und spürte die Hitze in mir aufsteigen. Ich wollte ihn ausziehen, seine nackte Haut berühren, sehen, was unter dem Anzug war. Das wollte ich ganz dringend. Ich würde es nicht tun, weil ich auch mit Richard nicht schlief. Ich machte es weder mit dem Vampir noch mit dem Werwolf. Richard war der Werwolf. Das war sein einziger Fehler. Na gut, es gab vielleicht noch einen: Er hatte noch nie jemanden getötet. Und eines Tages würde ihn das umbringen.
Ich schob den linken Arm unter das aufgeknöpfte Jackett um seine Taille. Die solide Wärme seines Körpers strömte mir entgegen. Wenn wir nicht bald Sex hatten, würde ich einfach platzen. Wie stehen die Wetten zur Standhaftigkeit?
Monica sah mich unverwandt an und musterte mein Gesicht. »Das ist eine hübsche Halskette. Von wem hast du sie?«
Ich lächelte und schüttelte den Kopf. Sie meinte mein schwarzes Samtband mit der in Silber gefassten Kamee. He, es passte genau zu meinem Anzug. Monica war ziemlich sicher, dass Richard es mir nicht geschenkt hatte, was nach ihrem Verständnis bedeutete, dass es von Jean-Claude war. Die gute alte Monica. Sie änderte sich nie.
»Ich habe es passend zu dem Hosenanzug gekauft«, antwortete ich.
Sie riss erstaunt die Augen auf. »Ach, wirklich?« Als ob sie mir nicht glaubte.
»Wirklich. Ich stehe nicht auf Geschenke, besonders nicht bei Schmuck.«
Richard nahm mich in den Arm. »Das ist die Wahrheit. Es ist sehr schwer, sie zu verwöhnen.«
Catherine stellte sich zu uns. Ihr kupferrotes Haar umfloss ihr Gesicht als wogende Masse. Sie war die einzige meiner Bekannten, die lockigere Haare hatte als ich, und dazu war ihre Haarfarbe Aufsehen erregend. Die meisten Leute beschrieben als Erstes ihre Haare, wenn man sie nach ihr fragte. Ein leichtes Make-up verdeckte die Sommersprossen und lenkte die Aufmerksamkeit auf ihre hellen graugrünen Augen. Ihr Kleid hatte die Farbe von jungem Laub. So hübsch hatte ich sie noch nie gesehen.
»Die Ehe scheint dir gut zu bekommen«, sagte ich lächelnd.
»Du solltest es auch irgendwann versuchen«, erwiderte sie schmunzelnd.
Ich schüttelte den Kopf. »Vielen Dank.«
»Ich muss euch Anita für einen Augenblick entführen.« Wenigstens sagte sie nicht, dass sie Hilfe in der Küche brauchte. Richard hätte gewusst, dass das gelogen war. Er konnte viel besser kochen als ich.
Catherine führte mich in das zweite Schlafzimmer, wo die Gäste ihre Mäntel abgelegt hatten. Obendrauf lag ein echter Pelzmantel. Ich wettete innerlich, wem er gehörte. Monica hatte gern totes Zeug um sich.
Sobald die Tür hinter uns zu war, fasste Catherine meine Hände und kicherte, ich schwöre, sie kicherte. »Richard ist wunderbar. Meine Lehrer an der Junior High haben nie so ausgesehen.«
Ich lächelte, und zwar auf diese breite, dämliche Art. »Er sieht gut aus«, sagte ich und klang so nichts sagend wie nur möglich.
»Anita, komm mir nicht so. Ich habe es noch nie erlebt, dass du neben jemandem so strahlst.«
»Ich strahle nicht.«
»Doch, das tust du.« Sie grinste mich an und nickte.
»Tue ich nicht«, widersprach ich, doch es war schwer, trotzig zu sein, wenn man eigentlich freudig grinsen wollte. »Na gut, ich mag ihn sehr. Zufrieden?«
»Du triffst dich jetzt schon seit sieben Monaten mit ihm. Wo ist der Verlobungsring?«
Ich sah sie missbilligend an. »Catherine, nur weil du wahnsinnig glücklich verheiratet bist, muss doch nicht auch jeder andere gleich heiraten.«
Sie zuckte die Achseln und lachte.
Ich blickte in ihr strahlendes Gesicht und schüttelte den Kopf. An Bob musste mehr dran sein, als einem ins Auge fiel. Er war dreißig Pfund schwerer, als er hätte sein sollen, bekam bereits eine Glatze und trug kleine runde Brillengläser in seinem ziemlich faden Gesicht. Er war auch keine sprühende Persönlichkeit. Ich war drauf und dran gewesen, die Daumen nach unten zu richten, bis ich mitbekam, wie er Catherine ansah. Er sah sie an, als wäre sie die ganze Welt, und zwar eine hübsche, sichere, wundervolle Welt. Viele Leute sind hübsch, und witzige Schlagfertigkeit bekommt man in jeder Fernsehserie, aber Zuverlässigkeit, das ist selten.
»Ich habe Richard nicht mitgebracht, um deinen Genehmigungsstempel zu kriegen. Ich wusste auch so, dass er dir gefallen würde.«
»Warum machst du dann ein solches Geheimnis aus ihm? Ich habe schon ein Dutzend Mal versucht, ihn kennen zu lernen.«
Ich zuckte die Achseln. Die Wahrheit war, dass ich wusste, sie würde dieses Leuchten in den Augen kriegen, diesen Wahnsinnsglanz aller verheirateten Freunde, wenn man selbst nicht verheiratet ist und gerade mit irgendjemandem ausgeht. Oder schlimmer, wenn man mit keinem ausgeht und sie einen verkuppeln wollen. Diesen Blick hatte Catherine jetzt.
»Erzähl mir nicht, du hast die ganze Party geplant, um Richard kennen zu lernen.«
»Zum Teil. Wie hätte es sonst klappen sollen?«
Es klopfte an der Tür.
»Herein«, rief Catherine.
Bob öffnete die Tür. Für mich sah er immer noch durchschnittlich aus, aber nach Catherines Gesicht zu urteilen, sah sie etwas anderes. Er lächelte sie an. Das brachte sein ganzes Gesicht zum Strahlen, und vor mir stand ein Prachtkerl. Die Liebe macht uns alle schön. »Entschuldigt, dass ich euer Frauengespräch störe, aber da ist ein Anruf für Anita.«
»Wer ist es?«
»Ted Forrester. Sagt, es sei geschäftlich.«
Ich riss die Augen auf. Ted Forrester war der Deckname eines Mannes, den ich als Edward kannte. Er war ein Auftragsmörder, der sich auf Vampire, Lykanthropen und auf andere spezialisiert hatte, die nicht mehr so ganz Mensch waren. Ich hatte eine Lizenz als Vampirjäger. Da kreuzten sich gelegentlich unsere Wege. In gewisser Weise waren wir vielleicht sogar Freunde. Vielleicht.
»Wer ist Ted Forrester?«, wollte Catherine wissen.
»Ein Kopfgeldjäger«, sagte ich. Ted, alias Edward, war Kopfgeldjäger mit den dazugehörigen Papieren, ganz ordentlich und legal. Ich stand auf und ging zur Tür.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Catherine. Ihr entging nur wenig, weshalb ich sie mied, wenn ich knietief durch Alligatoren watete. Sie war klug und merkte schnell, wenn die Dinge aus dem Lot waren. Aber sie trug keine Waffe, und wenn man sich nicht verteidigen kann, ist man Kanonenfutter. Richard war ein Werwolf, und nur deshalb war er kein Kanonenfutter. Allerdings lief er Gefahr, es doch zu werden, weil er sich weigerte, Leute zu töten, Gestaltwandler oder nicht.
»Ich hatte gehofft, heute Abend mal nicht arbeiten zu müssen«, antwortete ich.
»Ich dachte, du hättest das ganze Wochenende frei«, sagte sie.
»Ich auch.«
Ich benutzte das Telefon im Arbeitszimmer, das sie sich eingerichtet hatten. Sie hatten den Raum in der Mitte geteilt. Die eine Hälfte war im Country-Stil dekoriert, mit Teddybären in kleinen Schaukelstühlen, die andere Hälfte war maskulin gehalten, mit Jagdszenen und einem Flaschenschiff auf dem Schreibtisch. Ein Kompromiss aus dem Bilderbuch.
Ich nahm den Hörer und sagte: »Hallo?«
»Hier ist Edward.«
»Woher hast du diese Nummer?«
Einen Augenblick blieb es still. »Kinderspiel.«
»Wozu spürst du mich auf, Edward? Was ist los?«
»Interessante Wortwahl«, meinte er.
»Wovon redest du?«
»Mir wurde soeben der Auftrag angeboten, dich umzubringen. Die Bezahlung ist so gut, dass es die Mühe wert wäre.«
Jetzt war ich es, die einen Moment still blieb. »Hast du ihn angenommen?«
»Würde ich dich dann anrufen?«
»Vielleicht«, antwortete ich.
Er lachte. »Stimmt, aber ich werde ihn nicht annehmen.«
»Warum nicht?«
»Aus Freundschaft.«
»Versuch’s noch mal«, bat ich.
»Ich rechne mir aus, dass ich mehr Leute umbringen kann, wenn ich auf dich aufpasse. Wenn ich den Vertrag annehme, habe ich nur dich zum Umbringen.«
»Beruhigend. Sagtest du ›aufpassen‹?«
»Ich bin morgen in der Stadt.«
»So sicher bist du, dass ein anderer den Auftrag annimmt?«
»Unter hundert Riesen mache ich nicht einmal die Tür auf, Anita. Also wird ihn jemand annehmen, und zwar ein Guter. Er wird nicht so gut sein wie ich, aber gut.«
»Irgendwelche Ratschläge, bis du hier bist?«
»Ich habe ihnen noch nicht geantwortet. Das hält sie ein bisschen hin. Wenn ich Nein gesagt habe, brauchen sie ein wenig Zeit, um einen anderen anzusprechen. Heute Nacht solltest du noch sicher sein. Genieße dein freies Wochenende.«
»Woher weißt du, dass ich frei habe?«
»Craig ist sehr gesprächig. Sehr hilfsbereit.«
»Ich werde ein Wörtchen mit ihm reden müssen«, sagte ich.
»Tu das.«
»Du bist sicher, dass heute Nacht noch kein Killer kommt?«
»Nichts im Leben ist sicher, Anita, aber mir würde es gar nicht gefallen, wenn ein Klient versucht, mich zu engagieren, und dann den Job einem anderen gibt.«
»Bist du viele Klienten eigenhändig losgeworden?«, fragte ich.
»Kein Kommentar.«
»Also noch eine Nacht in Sicherheit«, sagte ich.
»Wahrscheinlich, sei aber trotzdem vorsichtig.«
»Wer will mich umbringen lassen?«
»Das weiß ich nicht«, behauptete Edward.
»Was soll das heißen, du weißt es nicht? Du musst es wissen, damit du dein Geld bekommst.«
»Das läuft meistens über Vermittler. Das verringert die Gefahr, dass der nächste Klient ein Bulle ist.«
»Wie findest du den launischen Klienten, wenn du sauer auf ihn bist?«
»Ich kann ihn finden, aber das dauert seine Zeit. Wenn dir ein wirklich guter Killer an den Kragen will, Anita, dann hast du keine Zeit.«
»Oh, wie beruhigend.«
»Es sollte nicht beruhigend sein«, erwiderte er. »Fällt dir jemand ein, der dich so sehr hasst und so viel Geld hat?«
Ich überlegte eine Minute. »Nein. Die meisten, auf die das zutrifft, sind tot.«
»Ein guter Feind ist ein toter Feind«, meinte Edward.
»Genau.«
»Es gibt ein Gerücht, dass du mit unserem Meistervampir ausgehst. Stimmt das?«
Ich zögerte. Ich merkte, dass es mir vor Edward peinlich war. »Ja, es stimmt.«
»Ich musste es von dir hören.« Fast hörte ich durchs Telefon, wie er den Kopf schüttelte. »Verdammt, Anita, du solltest wirklich klüger sein.«
»Ich weiß«, sagte ich.
»Hast du Richard den Laufpass gegeben?«
»Nein.«
»Mit welchem Monster bist du heute Abend aus, mit dem Blutsauger oder dem Fleischfresser?«
»Geht dich überhaupt nichts an«, versetzte ich.
»Na gut. Nimm, wen du willst, und mach dir einen schönen Abend, Anita. Ab morgen werden wir dann versuchen, dich am Leben zu halten.« Er legte auf. Bei jedem anderen hätte ich geglaubt, er sei sauer auf mich, weil ich mit einem Vampir ausging. Oder vielleicht wäre »enttäuscht« das richtige Wort.
Ich legte den Hörer auf und saß eine Weile da, um das alles auf mich wirken zu lassen. Jemand wollte mich umbringen. So weit nichts Neues, aber dieser Jemand heuerte professionelle Hilfe an. Das war neu. Ich hatte noch nie einen Killer auf den Fersen gehabt. Ich wartete, dass mich die Angst überfiel, aber sie kam nicht. Na ja, da war ein verschwommenes Angstgefühl, aber nichts Angemessenes. Nicht, dass ich nicht glaubte, dass es passieren könnte. Ich glaubte es durchaus. Es war nur so, dass im Laufe des Jahres so viel passiert war, dass die Aufregung noch ausblieb. Wenn der Killer aus einem Busch heraussprang und zu schießen anfing, würde ich mich mit ihm befassen. Vielleicht bekäme ich hinterher einen Nervenzusammenbruch. Aber die wurden bei mir immer seltener. Zum Teil war ich schon abgestumpft wie ein alter Kriegsveteran. Es war einfach zu viel, was man zu verarbeiten hatte, also hörte man damit auf. Fast wünschte ich, ich hätte Angst. Die Angst hält einen am Leben, Gleichgültigkeit nicht.
Morgen würde mich irgendwo jemand auf seiner Erledigungsliste haben. Reinigung abholen, Brötchen kaufen, Anita Blake umbringen.
3
Ich ging zurück ins Wohnzimmer und nahm Blickkontakt mit Richard auf. Ich war so weit, dass ich nach Hause wollte. Zu wissen, dass ein Killer hinter mir her war, hatte dem Abend irgendwie einen Dämpfer verpasst.
»Was ist los?«, fragte Richard.
»Nichts«, sagte ich. Ich weiß, ich weiß, ich musste es ihm sagen, aber wie bringt man seinem Liebsten bei, dass ein Mörder hinter einem her ist? Nicht in einem Zimmer voller Leute. Vielleicht im Auto.
»Doch. Du hast diese leichte Anspannung zwischen den Augenbrauen, die bedeutet, dass du versuchst, nicht finster zu gucken.«
Ich blickte ihn ärgerlich an. »Habe ich nicht.«
Er lächelte. »Jetzt guckst du finster.« Er wurde ernst. »Was ist los?«
Ich seufzte. Ich trat näher an ihn heran, nicht weil das romantischer war, sondern um nicht belauscht zu werden. Vampire haben ein unglaublich gutes Gehör, und ich wollte nicht, dass Robert mich hörte. Er würde es bei Jean-Claude ausplaudern. Wenn ich wollte, dass der Bescheid wüsste, würde ich es ihm selbst sagen.
»Edward war am Telefon.«
»Was will er?« Jetzt machte Richard ein finsteres Gesicht.
»Jemand wollte ihn engagieren, um mich umzubringen.«
Auf seinem Gesicht stand grenzenloses Staunen, sodass ich froh war, dass er mit dem Rücken zu den Leuten stand. Er machte den Mund zu, öffnete ihn wieder, sagte dann: »Ich würde ja sagen, du machst Witze, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Warum sollte dich jemand umbringen wollen?«
»Es gibt viele Leute, die mich gern tot sehen würden, Richard. Aber keiner von denen hat so viel Geld, dass er es für einen Killer ausgeben würde.«
»Wie kannst du dabei nur so ruhig sein?«
»Würde es etwas nützen, wenn ich einen hysterischen Anfall bekäme?«
Er schüttelte den Kopf. »So meine ich das nicht.« Er überlegte einen Augenblick. »Du bist scheinbar gar nicht empört darüber. Du nimmst es einfach hin, fast als wäre es normal. Es ist aber nicht normal.«
»Killer sind nichts Normales, nicht einmal für mich, Richard«, entgegnete ich.
»Nur Vampire, Zombies und Werwölfe«, meinte er darauf.
Ich lächelte. »Genau.«
Er drückte mich fest und flüsterte: »Wenn man dich liebt, muss man manchmal ziemliche Ängste ausstehen.«
Ich schlang die Arme um seine Taille und lehnte das Gesicht an seine Brust. Ich schloss die Augen, um für einen Moment seinen Geruch einzusaugen. Er roch nicht nur nach Rasierwasser, da war auch der Duft seiner Haut, seiner Wärme. Er. Ganz kurz ließ ich mich gegen ihn fallen und dachte an nichts mehr. Seine Arme sollten mein Schutz sein. Ich wusste, dass eine gut gezielte Kugel das alles zerstören konnte, aber ein paar Sekunden lang fühlte ich mich sicher. Illusionen sind manchmal das einzige Mittel, um bei geistiger Gesundheit zu bleiben.
Seufzend schob ich mich von ihm weg. »Gehen wir zu Catherine und verabschieden wir uns.«
Er strich mir sanft über die Wange und sah mir in die Augen. »Wir können auch bleiben, wenn du möchtest.«
Ich schmiegte mein Gesicht in seine Hand und schüttelte den Kopf. »Wenn es morgen richtig übel wird, möchte ich den Abend nicht auf einer Party verbracht haben. Dann möchte ich lieber zurück in meine Wohnung und schmusen.«
Dafür bekam ich ein Lächeln, von dem mir bis in die Zehenspitzen warm wurde. »Scheint mir ein guter Plan zu sein.«
Ich lächelte zurück, weil ich gar nicht anders konnte. »Ich sage Catherine Bescheid.«
»Ich hole die Mäntel.«
Wir erledigten jeder seine Aufgabe und gingen. Catherine bedachte mich mit einem tiefgründigen Lächeln. Ich wünschte, sie hätte recht. Früh nach Hause gehen und sich auf Richard stürzen, das schlug die Wahrheit um Längen. Monica beobachtete, wie wir die Party verließen. Mir war klar, dass sie und Robert Jean-Claude darüber berichten würden. Schön. Er wusste, dass ich mit Richard ausging. Ich hatte niemanden belogen. Monica arbeitete als Anwältin in Catherines Kanzlei – was an sich schon ein erschreckender Gedanke war –, ein legitimer Grund also, um eingeladen zu sein. Jean-Claude hatte das nicht arrangiert, aber ich mochte es nicht, bespitzelt zu werden, egal, wie es dazu kam.
Der Weg zum Auto war nervenaufreibend. Jeder Schatten war auf einmal ein potenzielles Versteck. Jedes Geräusch ein Schritt. Ich schaffte es, nicht die Waffe zu ziehen, aber meine Hand schmerzte davon. »Verdammter Mist«, sagte ich leise. Die Abgestumpftheit nutzte sich ab. Ich war nicht sicher, ob das eine Verbesserung darstellte.
»Was ist denn?«, fragte Richard, ohne mich anzusehen. Er blickte plötzlich prüfend in die Dunkelheit. Seine Nasenlöcher zitterten leicht, und ich begriff, dass er in den Wind schnupperte.
»Bin nur nervös. Ich sehe zwar niemanden, aber ich starre plötzlich überallhin.«
»Ich rieche niemanden in unserer Nähe, aber er könnte in unserem Windschatten stehen. Die einzige Waffe, die ich rieche, ist deine.«
»Du kannst meine Pistole riechen?«
Er nickte. »Du hast sie kürzlich gereinigt, ich rieche das Öl.«
Ich schüttelte belustigt den Kopf. »Du bist so stinknormal, da vergesse ich manchmal, dass dir einmal im Monat ein Fell wächst.«
»Wenn man bedenkt, wie leicht du einen Lykanthropen erkennst, ist das glatt ein Kompliment. Glaubst du, dass ein Mörder aus dem Baum springt, wenn ich mal eben deine Hand nehme?«
Ich lächelte. »Im Augenblick sind wir wohl sicher.«
Er schloss die Finger um meine Hand, und mir lief ein Prickeln den Arm hinauf, als hätte er einen Nerv getroffen. Er rieb mit dem Daumen in kleinen Kreisen über meinen Handrücken und atmete tief durch. »Es tut beinahe gut zu wissen, dass dich diese Killersache auch nervös macht. Ich will nicht, dass du Angst hast, aber manchmal, wenn ich finde, dass du tapferer bist als ich, ist es schwer, dein Freund zu sein. Das klingt wie Machomist, oder?«
Ich sah ihn an. »Um mich herum gibt es eine Menge Machomist, Richard. Du weißt wenigstens, dass es Mist ist.«
»Darf dieser männliche Chauvi-Wolf dich küssen?«
»Jederzeit.«
Er beugte sich zu mir herab, und ich stellte mich mit einer Hand an seine Brust gestützt auf die Zehenspitzen, um ihm entgegenzukommen. Wir konnten uns auch küssen, ohne dass ich mich auf die Zehenspitzen stellte, aber Richard bekam schnell einen steifen Hals.
Der Kuss war kürzer als sonst, weil ich dieses Kribbeln im Rücken hatte, zwischen den Schulterblättern. Ich wusste, es war Einbildung, aber ich fühlte mich draußen im Freien zu ungeschützt.
Richard spürte es und ließ mich los. Er ging zur Fahrerseite seines Wagens, öffnete die Tür und beugte sich hinein, um die andere zu entriegeln. Er kam nicht, um mir die Tür aufzuhalten. Er war klüger. Ich konnte mir meine Tür gut selbst öffnen.
Sein Wagen war ein alter Mustang Mach 1. Das wusste ich, weil Richard es mir erzählt hatte. Orangene Lackierung mit schwarzem Ralleystreifen. Die Sitze waren aus schwarzem Leder, aber so klein, dass wir Händchen halten konnten, wenn er die Gangschaltung nicht bediente.
Richard fuhr auf die 270 nach Süden. Der Freitagabendverkehr strömte mit funkelnden Lichtern um uns herum. Jeder war unterwegs, um sich ein schönes Wochenende zu machen. Ich fragte mich, wie viele einen Mörder auf den Fersen hatten. Einschließlich mir höchstens eine Handvoll.
»Du bist still«, meinte Richard.
»Ja.«
»Ich will nicht fragen, was dir durch den Kopf geht. Ich kann es mir denken.«
Ich sah ihn an. Die Dunkelheit im Wagen hüllte uns ein. Autos bei Nacht sind eine eigene private Welt, still, dunkel, intim.
»Woher willst du wissen, dass ich mir nicht vorstelle, wie du ohne Klamotten aussiehst?«
Er grinste mich an. »Du quälst mich.«
Ich lächelte. »Entschuldigung. Keine sexuellen Anspielungen, bevor ich bereit bin, auf dich zu springen.«
»Die Regel hast du aufgestellt, nicht ich«, erwiderte Richard. »Ich bin schon ein großer Junge. Mach du so viele sexuelle Anspielungen, wie du willst, ich kann sie vertragen.«
»Wenn ich nicht mit dir schlafen will, scheint mir das kaum fair.«
»Lass das meine Sorge sein«, sagte er.
»He, Mr Zeeman, fordern Sie mich auf, bei Ihnen Annäherungsversuche zu machen?«
Sein Lächeln wurde breiter, ein weißer Schein im Dunkeln. »Ja, bitte.«
Ich lehnte mich so weit zu ihm rüber, wie der Sicherheitsgurt es zuließ, legte eine Hand auf seine Rücklehne und schob das Gesicht bis dicht an seinen glatten Hals. Ich atmete tief ein und langsam aus, so nah an seiner Haut, dass die warme Wolke meines Atems zu mir zurückkam. Ich küsste ihn in die Halsbeuge, strich mit den Lippen sacht darüber.
Richard machte ein kleines, zufriedenes Geräusch.
Ich zog die Knie an, strapazierte den Sicherheitsgurt, damit ich die Pulsader küssen konnte und den Kieferbogen. Er drehte den Kopf zu mir. Wir küssten uns, aber meine Nerven waren nicht so gut. Ich drehte sein Gesicht nach vorn. »Sieh auf die Straße.«
Er schaltete in den nächsten Gang und streifte mit dem Oberarm meine Brüste. Ich sank seufzend gegen ihn, fasste seine Hand auf dem Schalthebel, damit sein Arm an mich gedrückt blieb.
So blieben wir eine Sekunde lang, dann rückte er näher und rieb sich an mir. Ich konnte an meinem hämmernden Puls kaum vorbeiatmen. Ich schauderte und schlang die Arme um mich. Von seiner Berührung spannten sich bei mir alle möglichen Körperstellen an.
»Was ist?«, fragte er mit tiefer, leiser Stimme.
Ich schüttelte den Kopf. »Wir müssen damit aufhören.«
»Wenn es nur wegen mir ist: Mir ging es gut dabei.«
»Mir auch. Das ist das Problem«, sagte ich.
Richard seufzte. »Es ist nur ein Problem, weil du eins daraus machst, Anita.«
»Ja, klar.«
»Heirate mich, Anita, und das alles gehört dir.«
»Ich will dich nicht heiraten, nur damit ich mit dir schlafen kann.«
»Wenn es nur um den Sex ginge, würde ich das auch nicht wollen«, erklärte er. »Ich will mit dir auf dem Sofa schmusen, ›Singing in the Rain‹ gucken, Chinesisch essen gehen und wissen, dass ich eine Extraportion Krabbenwantans abbekomme. Ich kann in den meisten Restaurants blind für uns beide bestellen.«
»Du meinst, ich bin berechenbar?«
»Tu es nicht, mach es nicht schlecht.«
Ich seufzte. »Es tut mir leid, Richard. War nicht so gemeint. Ich …«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, denn er hatte recht. Mein Tag war ausgefüllter, wenn ich ihn mit Richard verbrachte. Ich hatte ihm eine Tasse gekauft, die ich zufällig in einem Geschäft gesehen hatte. Darauf war ein Wolf, und der sagte: »In Gottes Wildheit liegt die Hoffnung der Welt – in der großen, blühenden, unverdorbenen und unverfälschten Wildnis.« Das war ein Zitat von John Muir. Ich kaufte sie zu keiner besonderen Gelegenheit, ich sah die Tasse und wusste, sie würde Richard gefallen. Ein Dutzend Mal am Tag hörte ich etwas im Radio oder bei einer Unterhaltung und dachte, ich muss daran denken und es Richard erzählen. Und es war Richard, der mich zu meiner ersten Vogelbeobachtung seit dem College mitnahm.
Ich hatte einen Abschluss in Biologie, in übernatürlicher Biologie. Früher hatte ich einmal geglaubt, ich würde mein Leben als Naturforscher verbringen, wie eine Jane Goodall des Übernatürlichen. Die Vogelwanderung hatte mir Spaß gemacht, teils weil er bei mir war, teils weil mir so etwas auch schon früher gefallen hatte. Es war, als hätte ich vergessen, dass es abseits von Pistolenläufen und Friedhöfen noch ein anderes Leben gab. Ich hatte so viel Zeit bis zum Hals in Blut und Tod verbracht, und dann lief mir Richard über den Weg. Richard, der ebenfalls bis zum Hals in Seltsamkeiten steckte, der es aber schaffte, nebenbei ein Leben zu führen.
Ich konnte mir nichts Schöneres denken, als neben ihm aufzuwachen und als Erstes nach ihm zu tasten oder zu wissen, dass er zu Hause auf mich wartete. Seine Rodgers-Hammerstein-Sammlung zu hören, sein Gesicht zu beobachten, wenn er Gene-Kelly-Musicals sah.
Fast hätte ich den Mund aufgemacht und gesagt: Tun wir’s, lass uns heiraten. Aber ich tat’s nicht. Ich liebte Richard, dass musste ich mir eingestehen, aber das reichte nicht. Da war ein Mörder hinter mir her. Wie konnte ich den sanftmütigen Lehrer einer Junior High in diese Art von Leben hineinziehen? Er gehörte zu den Monstern, aber er akzeptierte das nicht. Er stand im Konkurrenzkampf mit Marcus, dem Anführer des örtlichen Wolfsrudels. Er hatte ihn zweimal besiegt und sich zweimal geweigert, ihn zu töten. Wer nicht töten wollte, konnte nicht Anführer werden. Richard hielt an seinen Grundsätzen fest. An Werten, die nur funktionieren, wenn man niemanden um sich hat, der einen umbringen will. Wenn ich ihn heiratete, war seine Chance auf ein normales Leben vertan. Ich lebte in einer Art Gefechtszone. Richard verdiente etwas Besseres.
Jean-Claude lebte in derselben Welt wie ich. Er machte sich keine Illusionen, was die guten Absichten von Fremden oder sonstwem anging. Der Vampir wäre über die Nachricht mit dem Killer nicht entsetzt gewesen. Er würde einfach mit mir zusammen überlegen, was dagegen zu tun war. Es würde ihn nicht umhauen, zumindest nicht besonders. Es gab Nächte, wo ich dachte, dass er und ich einander verdient hatten.
Richard bog in die Olive ein. Wir würden gleich vor meinem Haus halten, und das Schweigen wurde immer dichter. Gewöhnlich störte mich das nicht, aber dieses Schweigen doch. »Es tut mir leid, Richard. Es tut mir ehrlich leid.«
»Es wäre einfacher, wenn ich nicht wüsste, dass du mich liebst«, antwortete er. »Wenn dieser verdammte Vampir nicht wäre, würdest du mich heiraten.«
»Durch diesen verdammten Vampir haben wir uns kennen gelernt«, erwiderte ich.
»Und das bedauert er, mach dir keine Illusionen«, sagte Richard.
Ich sah ihn an. »Woher weißt du das?«
Er schüttelte den Kopf. »Du brauchst nur mal sein Gesicht zu sehen, wenn ihr zusammen seid. Ich kann Jean-Claude nicht leiden, und der Gedanke, dass du bei ihm bist, ist mir zuwider, aber wir beide sind nicht die Einzigen, die leiden. Wir sind drei, mach dir nichts vor.«