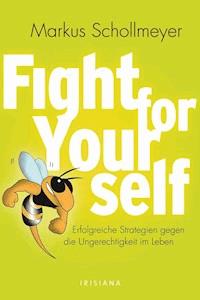Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Copyright
Für den kleinen Hasen
1
Gleich würde es überstanden sein. Vom Fensterbrett des fünften Stockwerks aus konnte man weit sehen. Von hier oben sah alles so harmonisch aus. Besonders an so einem herrlichen Frühlingstag: Die Sonne stand hoch am Himmel und tauchte die Großstadt in ein fröhliches Licht. In den belebten Straßencafés der Prachtmeile war jeder Platz besetzt. Viele Tische waren beladen mit Geschirr. Die Kellner kamen mit dem Abräumen gar nicht mehr nach, trotzdem ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste störte das nicht weiter. Wer das Glück hatte, einen Platz in der ersten Reihe ergattert zu haben, nahm ein bisschen Geschirr auf dem Tisch gern in Kauf. Zum Bestellen reichte der Blickkontakt mit dem Kellner: eine Geste auf ein leeres Glas und mit den Fingern der anderen Hand die Anzahl gezeigt, und er wusste Bescheid.
Die Luxusboutiquen mit ihren Nobelmarken spien unentwegt Menschen mit bunten Tüten aus, während sie gleichzeitig ebenso viele Menschen einsogen. Offene Cabrios mit lauter Musik rollten die Straße entlang.
Dort unten breitete sich das Flair südlicher Lebensart aus mit einer entspannenden Urlaubsatmosphäre – einfach himmlisch. Hier oben sah die Welt ganz anders aus. Hier oben war die Hölle, in der ein riesiges Fegefeuer brannte. Flammen, die auf einen ganz bestimmten Sterblichen warteten: auf mich. Ich hatte die Hoffnung, durch dieses Feuer gereinigt und von all meiner Pein erlöst zu werden.
Es fehlte nur noch ein einziger, entscheidender Schritt nach vorn für meine persönliche Lösung.
Mein Blick blieb an der Mittellinie der Straße hängen. Ursprünglich ein reines Weiß, war sie oft überfahren, abgenutzt und grau geworden. Diese Mischfarbe erinnerte mich an mein Leben als Anwalt. Ein Leben, das einst weiß und rein war, richtiggehend poliert schien, und nun hässliche, dunkle Flecke aufwies. Und nun stand ich im fünften Stock, mein Schreibtisch war aufgeräumt und alles, was noch wichtig und zu erledigen war, hatte ich niedergeschrieben.
Aber welches Leben hatte keine dunklen Flecke, wer war schon frei von Fehlern?
Meine Gedanken schweiften zurück in meine Studentenzeit. Ich war ein engagierter und enthusiastischer Idealist gewesen. Mein Ziel war Gerechtigkeit und ich war sicher, dass ich mithelfen konnte, sie in der Welt zu halten. Oder sie auch manchmal in die Welt zu bringen. Dafür studierte ich Jura, bestand alle diese schweren Prüfungen beim ersten Anlauf. Nach den beiden Examen war sofort klar, dass ich Anwalt werde. Ich wollte für die Gerechtigkeit kämpfen, sonst nichts. Das hatte ich dann auch bei der Zulassung zur Anwaltschaft geschworen. Vor allem aber hatte ich es mir aus tiefstem Herzen vorgenommen. Ich meinte jede Silbe des Schwurs ernst. »Recht und Gerechtigkeit sind mein Ziel und dabei bin ich unabhängig und frei.« Meine Karriere hatte ganz gut angefangen und ich wähnte mich zu Beginn auf dem richtigen Weg, doch jetzt stand ich nur einen Schritt vor dem endgültigen Ende. Aber was hatte mich nur an diesen absoluten Tiefpunkt meines Lebens gebracht? Welche Macht hatte auf mich eingewirkt, die mich innerlich verbogen, ja, zerrissen hat?
Ich versuchte mir diese Frage zu beantworten, während ich weiter auf die Mittellinie starrte. War ich tatsächlich am Ende angelangt? Gab es keinen anderen Ausweg als diesen, als all dem ein Ende zu setzen durch einen Sprung aus dem fünften Stockwerk? Ich fühlte mich leer, müde und traurig. Von außen betrachtet hatte ich doch alles erreicht. Der Job als Anwalt hatte mir ein Leben in Luxus erlaubt. Dennoch stand ich hier.
Mein Leben begann vor meinem inneren Auge abzulaufen: Kindheit, Freunde, Schule, Studium.
Meine Gedanken sprangen zurück an einen Tag im November. Damals war ich 29 Jahre alt, enthusiastisch und Anwalt für Strafrecht und Arbeitsrecht in einer größeren Kanzlei einer langweiligen Kleinstadt. Die Kanzlei war modern, erfolgreich und perfekt organisiert. An diesem Tag begann, was mich schlussendlich hierherbrachte.
2
Ich hatte um diesen Fall wirklich nicht gebeten, ja, ich habe ihn mir nicht einmal gewünscht. Und doch erreichte er mich – der Fall, der mein Leben verändern sollte.
Als ich mich an einem trüben Novembervormittag auf den Weg zu einer großen Polizeidienststelle machte, um einen neuen Mandanten zu treffen, hatte ich aber davon noch keine Ahnung. In der Kanzlei hatten sie mir gesagt, es sei ein ganz großes Ding. Wie schmutzig und niederträchtig dieser Fall tatsächlich war, darüber haben sie kein Wort fallen gelassen. Vielleicht, weil sie es selbst nicht wussten, vielleicht, weil sie es sich auch nicht vorstellen konnten.
Es war einer dieser Anrufe gewesen, bei denen ein Festgenommener von seinem Recht Gebrauch macht, sich einen Anwalt zu nehmen und ihn telefonisch herbeizubitten. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht, denn die Polizisten drängen in der Regel auf ein schnelles Ende des Gesprächs. Hätte ein Festgenommener nicht das gesetzliche Recht auf anwaltlichen Beistand oder zumindest einen Anruf, würde das Gespräch in den meisten Fällen ganz entfallen. Denn Polizisten schätzen die Anwesenheit von Anwälten nicht, unterstellt man diesen doch, sie hätten nur das eine Ziel: die Schuld des Festgenommenen zu verschleiern und die weiteren Ermittlungen zu erschweren. Als Anwalt bekommt man diese Einstellung des Öfteren deutlich zu spüren.
Mir war das jedoch zu diesem Zeitpunkt egal, denn ich war aus Berufung Anwalt geworden und ich glaubte an mich und die Gerechtigkeit. Ich war jung und hungrig nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wie ich sie mir naiv vorstellte. Es war aber nicht nur mein Beruf, es war meine innere Berufung, die mich über meine Grenzen hinausführen sollte.
Auf dem Weg zur Polizeidienststelle überlegte ich, um was es bei dem »großen Ding« gehen könnte. Vielleicht war es ein Raubüberfall oder sogar ein Mord? Gerade im deprimierend grauen Monat November werden brutale Verbrechen begangen, die uns aus der Alltagsroutine reißen und deren Grausamkeit die Menschen an die Zeit erinnert, als es noch keine Zivilisation gab. Eine Zeit, in der der Stärkste sich mit dem Brutalsten um die Vorherrschaft stritt. Unmenschliche Grausamkeiten glauben wir oft überwunden zu haben, doch dann holen sie uns unvermutet wieder ein. Wie eine Mahnung aufzupassen. Aufzupassen, dass wir nicht aus dem Ruder laufen. Aufzupassen, dass wir uns eine friedliche Koexistenz als Ziel stecken und nicht mit allen Mitteln nach Macht, Dominanz und Vorherrschaft streben.
Die Medien stürzen sich förmlich auf diese brutalen Straftaten und schlachten sie regelrecht aus. Die Schlagzeilen sind dann voll mit sogenannten Blutüberschriften. Man liest vom »brutalen Axtmörder«, vom »Schlächter aus der Innenstadt« oder auch von der »hinterhältigen Giftmörderin«. Bis ins Detail werden das Grauen des Tatorts und der Tathergang beschrieben. Für die Person des Täters interessieren sich Journalisten und auch Öffentlichkeit nicht. Keine Silbe ist davon zu lesen, was den Täter dazu gebracht haben könnte, eine wahrlich nicht alltägliche Grausamkeit an den Tag zu legen. Aber wen interessiert schon die schlechte Kindheit eines Täters, wenn das Mitgefühl aller den Opfern und deren Angehörigen gehört?
Für einen Anwalt ist das sehr wohl wichtig. Ein Täter darf nur nach seiner Schuld bestraft werden, so lautet die edle Maxime des Strafrechts, die jedem Jurastudenten eingebläut wird. Dazu gehört auch, dass die Probleme des Täters berücksichtigt werden. Und seine psychischen Krankheiten. Ob man einen depressiven Täter milder bestrafen sollte als einen, der das Glück hatte gesund zu sein, das war eine der typischen Fragen der Professoren. Die Schuldfrage war der Teil der Gerechtigkeit, den man im Studium besonders intensiv beigebracht bekommt. Das Beurteilungsvermögen soll den logischen Juristen vom emotionalen Menschen unterscheiden. Ob die Juristen ihre elitäre Selbsteinschätzung aus diesem Punkt beziehen? Menschen handeln, Juristen urteilen. Dazu werden sie ausgebildet, denn schließlich endet das Jurastudium in unserem Land offiziell mit der »Befähigung zum Richteramt«. Ein guter Anwalt zu sein, das hingegen muss man sich selbst beibringen.
In manchen Bundesländern müssen angehende Richter sogar eine Mindestzeit als Staatsanwalt hinter sich bringen, bevor sie auf den Richterstuhl dürfen. Die Frage, ob ein Richter, der zuvor zum Staatsanwalt »trainiert« wurde und die Sichtweise des Anklagenden verinnerlichen musste, um als Staatsanwalt zu bestehen, später eine unabhängige Meinung vom Täter haben kann, habe ich mir nie ernsthaft gestellt. Vielleicht, weil ich zu sehr beschäftigt war Anwalt zu sein, vielleicht, weil ich an das Gute im Menschen glaubte. Kann echte Gerechtigkeit entstehen, wenn ein ausgebildeter Richter auf einen Anwalt trifft, der sich selbst um seine Fähigkeiten kümmern muss? Oder beendet das die Rechtsfälle nur einfach schneller?
Mit diesen Gedanken im Kopf stellte ich meinen Wagen auf dem grau-tristen Hof der Polizei ab. Ich schnappte mir meine Aktentasche, stieg aus und zog meinen Mantel über. Mit großen, ungeduldigen Schritten ging ich zum Eingang der Polizeistation. Meiner Verantwortung und meinem Schicksal entgegen.
Dass man mich damals als den jüngsten Anwalt der Kanzlei zu einem »großen Ding« schickte, gefiel mir. Offensichtlich würdigte man meine Arbeit. Das dachte ich zumindest. Ich fühlte mich großartig. Nur noch schnell den Papierkram am Empfang erledigt, und schon ging’s mit Riesenschritten Richtung Gerechtigkeit. In Gedanken sah ich mich schon mit wehender Robe vor Gericht auf Freispruch plädieren. Welch naiver Gedanke!
Dieser Tag war mein letzter Tag als Jurist, danach wurde ich Anwalt. Ein harter, verschlagener, listiger und erfolgreicher Anwalt. Das war mir alles nicht bewusst, als ich meinen Namen an der Empfangspforte der Polizei nannte und Einlass verlangte. Ich verlangte ihn so, dass man meinen konnte, ich vertrete einen unschuldigen Dissidenten in einer übermächtigen und herzlosen Diktatur. Einen Menschen also, der dafür bestraft wird, nur weil er seine Menschenrechte wahrgenommen hat. Aber so ein Mandant wartete nicht auf mich. Eher das genaue Gegenteil. Ein echter Verbrecher! Der Polizist am Empfang reagierte ruhig und professionell, aber in seinen Augen konnte ich Verachtung lesen. Die Verachtung eines Menschen, der schon viel Leid gesehen hatte. Mir fiel nicht auf, dass diese Verachtung meinem unsensiblen Auftreten galt. Denn ich sah ihn als Feind. Einen Feind, gegen den man sich durchsetzen musste. Den man niederkämpfen musste. Genauso wie das Generationen von Anwälten vor mir gemacht hatten.
3
Es traf mich wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so heftig werden würde: Die Kanzlei hatte mich zum »Monster« geschickt. So nannte die Presse den Mann, der seit mehr als 25 Jahren Kinder missbraucht hatte. Sexueller Missbrauch von Kindern in 147 Fällen lautete der Tatvorwurf! Mir wurde schlecht und mein Bauch sagte mir, dass ich besser gehen sollte. Doch mein Kopf sagte, dass es eine große Chance sei, einen solchen Täter zu verteidigen, und ich diese Chance unbedingt nutzen sollte. Mit so einem Fall könnte man als Strafverteidiger berühmt und sehr erfolgreich werden. Finanziell erfolgreich. Außerdem wäre das doch die Gelegenheit, sich in der Kanzlei eine gute Ausgangsposition auf dem Weg zur Partnerschaft zu sichern. Davon träumen schließlich alle jungen Anwälte.
Die Partnerschaft in einer renommierten Kanzlei ist fast die einzige Möglichkeit, als Anwalt nachhaltig finanziell abgesichert zu sein. Anders als manche selbstständige Anwälte, die oft nicht das verdienen, was man für ein ordentliches Leben benötigt, braucht man sich als Partner einer guten Kanzlei keine Gedanken um das liebe Geld zu machen. Man hat es einfach und kann das Klischee bedienen, das viele Menschen von Anwälten haben: reiche Zeitgenossen, die ein luxuriöses Leben führen. Ich malte mir eine rosige Zukunft aus. Außerdem war da ja noch meine Berufung. Ich wollte nicht nur Jurist sein, sondern Anwalt! Jemand, der sich für andere einsetzt, für die Gerechtigkeit arbeitet und siegt. Schließlich hat auch ein Straftäter Anspruch auf eine ordentliche Verteidigung. So steht es im Gesetz und so haben es die Professoren an der Uni gelehrt. Sofort war ich überzeugt, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Und zimperlich war ich doch auch noch nie. Ich musste doch das Monster einfach nur verteidigen. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
Mein Bauch dagegen erkannte: Ich war gerade dabei, ein Anwalt zu werden, den jeder kaufen kann ohne auf Gerechtigkeit achten zu müssen. Ein Anwalt, der einem für Geld beisteht und dabei vor allem seinen persönlichen Vorteil im Kopf hat. Also jemand, der ohne zu fragen etwas tat, was die meisten Menschen sofort strikt ablehnen würden. Wer will sich schon auf die Seite eines Kinderschänders stellen? Ursprünglich war ich doch im Anwaltsberuf angetreten, um der Gerechtigkeit zu dienen und merkte nun nicht, dass ich dabei war mich zu prostituieren. Prostituieren nicht deshalb, weil ich diesen Mandanten überhaupt vertrat, sondern weil ich es nur wegen des eigenen Vorteils tat.
»Ich möchte meinen Mandanten sprechen«, fuhr ich den Polizisten an, und er kam anstandslos dem nach, wozu ihn das Gesetz verpflichtet: Er ließ einen Anwalt zu seinem Mandanten. Ich gab dem Beamten den Papierkram zurück, der notwendig ist, wenn man einen inhaftierten Mandanten besucht. Wesentlichster Bestandteil dieser Unterlagen war die Besucherliste. In diese Liste hatte ich mich groß und deutlich eingetragen. Ich wollte, dass die Menschen wissen, wer diesen Mandanten vertritt. Ich wollte mit diesem Fall meinen Anwaltsstern aufgehen lassen.
Wortlos zeigte der Polizist auf eine gesicherte und mehrfach verschlossene weiße Stahltür. Vor dieser Stahltür war ein Klingelknopf angebracht. »Zellenaufsicht« stand darunter. Ich ging mit schnellen Schritten zu dieser Tür und drückte den Klingelknopf, worauf ein Summen ertönte und ich die Tür öffnen konnte.
Hinter der Tür war ein kleiner Raum, an dessen Ende sich wiederum eine weiße, mehrfach gesicherte und verschlossene Stahltür befand. Einen Klingelknopf gab es an dieser Tür nicht. Ich drehte mich kurz um, als die Stahltür, durch die ich den Raum betreten hatte, mit einem satten Geräusch ins Schloss fiel. Hier gab es nun keine Klingel mehr. Ich war eingesperrt. »Man kommt hier nur raus, wenn einen die Staatsmacht auch lässt«, dachte ich und erinnerte mich an eine Vorlesung, in der Anwälte als Kämpfer für Bürgerrechte heroisiert wurden. »Niemand sollte unberechtigt eingesperrt werden, dafür haben Anwälte zu sorgen«, donnerte der Professor immer.
In diesem Augenblick konnte ich diese Macht, die von verschlossenen Türen und starken Mauern ausging, zum ersten Mal spüren. Freiheit ist unbezahlbar! Leider ist uns das viel zu wenig bewusst. Vielleicht muss man erst genommen bekommen, was man braucht, bevor man merkt, wie wichtig es ist. Ich konnte nun wenigstens erahnen, was es heißt seine Freiheit zu verlieren.
Insoweit war ich sehr froh, dass es in unserem Rechtssystem einen Haftrichter gibt, dessen Aufgabe darin besteht, über die Anordnung der sogenannten Untersuchungshaft zu entscheiden. Eine Instanz also, die Willkür und Machtmissbrauch verhindern soll. Ich hatte zwar in meinem bisherigen Anwaltsleben noch keinen Haftrichter zu Gesicht bekommen, dazu waren die bisherigen Fälle nicht groß genug. Aber ich war mir sicher, dass ich es mit ihm aufnehmen konnte und das natürlich auch in diesem Fall machen würde.
Ich verlor mich in diesen Gedanken, bis meine Aufmerksamkeit wieder zu dem Raum zurückkehrte, indem ich mich gerade befand. Es war eine Art Schleuse, ein Raum der totalen Kontrolle. In der oberen Ecke gegenüber dem Eingang hing eine Videokamera. Sie filmte jeden Winkel und gab den Wachbeamten, die in einem anderen Raum saßen, die Möglichkeit, am Monitor zu sehen was in dieser Schleuse passierte und ob sie die Tür auch tatsächlich öffnen sollten. Nur wenn die Wachbeamten den ferngesteuerten Öffner betätigten, konnte man aus diesem Raum entkommen. Die damit verbundene momentane Ohnmacht in meiner persönlichen Bewegungsfreiheit ließ mich erschaudern.
Diese Situation wirkte aber nur so lange bedrohlich, bis das laute Brummen des elektrischen Türöffners anzeigte, dass die gegenüberliegende Stahltür am Auslass geöffnet werden konnte. Sofort griff ich nach dem Türknauf und verließ die Schleuse. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass ich damit zugleich einen Schritt in ein anderes Leben machte. Es würde nichts mehr so sein wie früher.
4
Auf dem Weg zu meinem Mandanten nahm mich jetzt ein uniformierter Polizist in Empfang. Er war groß und hatte resolute Gesichtszüge. Mit diesem Wachmann war nicht zu spaßen; seine Statur und seine Ausstrahlung verrieten sofort, dass er genau wusste, wie er Menschen zur Räson bringen konnte. Ich folgte ihm zur Zelle meines Mandanten.
Und da war sie. Die Zelle, in der das Monster saß. Einen kurzen Augenblick erfasste mich Unbehagen, denn in wenigen Sekunden würde ich hineingehen und dem leibhaftigen Monster gegenübersitzen. Alles, was ich von ihm aus der Presse wusste, ließ ihn überaus gefährlich erscheinen. Doch dann meldete sich mein Stolz zu Wort, der mir sagte, dass ich schließlich sein Anwalt sei. Und das sei ja schließlich eine echte Auszeichnung. Dieser Gedanke siegte über meine Zweifel und meine Unsicherheit.
Die Tür zur Zelle wurde geöffnet und ich trat ohne zu zögern ein. In der rechten Hand hatte ich meine Aktentasche, in der linken einen Klappstuhl. Den hatte mir der Wachbeamte mitgegeben, falls ich mich beim Gespräch setzen wollte. Das fand ich seltsam. Vielleicht hatten sich andere Anwälte beschwert, weil sie nicht auf abgenutzten Zellenmöbeln sitzen wollten? Mir kam nicht in den Sinn, dass es vielleicht einfach nur keine Stühle in der Zelle gab. Um keine unnötige Diskussion mit dem Wachmann zu führen, nahm ich den Stuhl mit.
Hinter mir fiel die schwere Zellentür ins Schloss. Der Polizist verriegelte die Tür mehrfach. Von da an war ich mit meinem Mandanten allein.
Ich blickte mich in der Zelle um. Sie war ungefähr zehn Quadratmeter groß, rechteckig und durchgehend weiß gefliest. Auch die Decke hatte Fliesen. An der rechten Wand neben der Zellentür war ein Stehklo aus Aluminium, wie man es aus Urlauben im Süden kennt. In der anderen Ecke befand sich eine an der Wand befestigte Pritsche. Sonst war in dem Raum nichts – gut, dass ich einen Stuhl dabei hatte. Mein Mandant war wohl in eine Art Ausnüchterungszelle eingesperrt worden. Später sagte mir ein Polizist, dass sie das immer so machen bei frisch Festgenommenen, denen erhebliche Straftaten vorgeworfen werden. Schließlich weiß man nie, wie diese Menschen reagieren. Manche versuchen, sich das Leben zu nehmen, andere wiederum machen sich vor Angst über die Entdeckung und deren Folgen in die Hose. In beiden Fällen verursacht das eine Verunreinigung. Deshalb bringe man in dieser Dienststelle Täter, bei denen ein solcher »Verunreinigungsverdacht« besteht, lieber in eine Zelle, die man leichter reinigen kann als herkömmliche Zellen. Zur Not auch mal mit einem Dampfstrahler, der das Blut etwaiger Selbstmordversuche am besten beseitigen kann.
Offenbar bestand nach Ansicht der Polizisten auch bei diesem Inhaftierten die Gefahr einer »Verunreinigung«, eventuell durch Selbstmord. Manche Blicke, die ich auf dem Polizeirevier bemerkte, ließen in mir die Vermutung aufkommen, dass dem einen oder anderen Beamten die Erfüllung dieser Erwartung keineswegs unrecht gewesen wäre.
Und mein Mandant? Auf der Pritsche saß er, ein etwa 65-jähriger, fast winziger Mann. Ich habe ihn in diesem Augenblick auf etwa 1,60 Meter geschätzt. Später sollte ich in der Akte lesen, dass er 1,64 Meter maß. Er wog vielleicht 50 Kilo, großzügig geschätzt. An seinem schmächtigen Körper hing ein verdreckter Arbeitsoverall, wie er von Landwirten getragen wird. Seine Füße steckten in abgewetzten, schwarzen Gummistiefeln. Das Haar war wirr und sein Gesicht unrasiert. Die dürren Finger mit ungeschnittenen Nägeln, unter denen Dreck zu sehen war, komplettierten seine ungepflegte Erscheinung. Erst jetzt fiel mir der beißende Geruch auf, der die Zelle erfüllte. Es roch nicht nur nach Gülle, es stank zum Himmel. Ich empfand Ekel, zumal mir das ihm vorgeworfene Delikt in den Sinn kam. Mein Bauchgefühl meldete sich in diesem Augenblick wieder und empfahl mir, einfach wieder ins Büro zu gehen und alles zu vergessen. Doch auch an dieser Stelle hörte ich nicht auf meinen Bauch, sondern gab weiter der Stimme nach, die mir einen gewaltigen Vorteil aus der Verteidigung des Kinderschänders in Aussicht stellte. Der zukünftige große Anwalt ein Schwächling? Niemals!
Mein Mandant musterte mich mit kleinen, stechenden Augen, während ich mich vorstellte. Er wendete den Blick erst von mir ab, als ich ihn nochmals mit dem Tatvorwurf konfrontierte und viel zu höflich bat, mir seine Sicht der Dinge zu erläutern. Eine kleine Pause entstand. Er hob seinen zerzausten Kopf und sah mich zum ersten Mal direkt an. Mir wurde kalt auf meinem Klappstuhl, aber ich bewahrte Haltung. Wozu war ich denn in den USA auf eine Schauspielschule gegangen, wenn nicht dafür, in solchen Situationen meine Mimik und Gestik nicht entgleisen zu lassen.
»Was ist denn nun passiert, aus Ihrer Sicht?«, hakte ich noch einmal nach.
»Es waren nicht so viele, vielleicht zwei oder drei. Aber niemals einhundertsiebenundvierzig«, sagte er mit dünner Stimme. Eine Stimme, die so gar nicht zu einem Monster passte. Dann fuhr er monoton fort: »Und die Kinder haben es so gewollt.«
Mir wurde wieder übel, es würgte mich regelrecht. Das schlug doch dem Fass den Boden aus. Wie konnte er nur so etwas behaupten! Dachte er von mir, ich würde akzeptieren, dass er so einen respektlosen Schwachsinn auch öffentlich erzählt, etwa noch dazu in einem Gerichtssaal?
»Sind Sie eigentlich noch bei Trost? Solche Aussagen sind nicht nur Hohn und Spott für die Opfer, sie sind frech und dumm zugleich«, platzte es aus mir heraus.
Mein Mandant zuckte mit keiner Wimper, starrte mich nur regungslos an. Ich dagegen wollte nur raus, einfach weg und den ganzen Schlamassel vergessen. Aber ich riss mich zusammen. »Wenn Sie so was noch einmal sagen, dann können Sie sich einen neuen Anwalt suchen. Ist das klar?«
Er nickte ruhig und ernst.
»Erzählen Sie weiter«, herrschte ich ihn an, »sonst werden wir hier nie fertig. Ich muss ja auch noch eine mündliche Haftprüfung beantragen, sonst kommen Sie hier ja nie raus.«
Nun erzählte mein Mandant die schrecklichen Details seiner Taten, wobei er dabei blieb, dass es viel weniger Opfer seien, als man ihm vorwerfen würde. Obwohl ich ihm nicht glaubte, ließ ich ihn gewähren, um seinen Redefluss nicht zu unterbrechen. Und so beschrieb er all die unfassbaren Details, aber nur für die Delikte, für die er sich offensichtlich verantworten wollte. Alle anderen Vorwürfe stritt er ab. Erstaunlich war dabei die Art, wie er erzählte. Seine Berichte waren frei von jeder Gefühlsregung. Sie klangen wie die Erzählung eines Dritten, der in aller Sachlichkeit einen Bericht für eine Gerichtsakte formuliert. Keine Emotionen, kein Bedauern oder gar Reue, aber auch keine Rechtfertigung. Man konnte aus seinen Erzählungen nicht heraushören, warum er diese Taten vollbracht und welche Empfindungen er selbst dabei gehabt hatte. Mir war das in diesem Augenblick recht; ich wollte das nicht hören und war bemüht, zu diesen schrecklichen Taten wenigstens ein bisschen innerliche Distanz zu halten, um das alles ertragen zu können.
Das Gespräch endete damit, dass ich ihn eine Honorarvereinbarung unterschreiben ließ. Ein Vordruck, bei dem nur noch Name, Delikt und Honorarsumme eingetragen werden mussten. Ich forderte ein exorbitant hohes Honorar. Er akzeptierte den Betrag ohne zu zögern.
Ich rief den Wachmann, durchquerte die Schleuse zurück in Richtung Freiheit und fuhr zurück in die Kanzlei. Dort musste ich den Antrag auf eine mündliche Haftprüfung vorbereiten, um vor einem Richter zu begründen, warum mein Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen werden sollte. Ich war fest entschlossen, das auch wirklich zu erreichen.
5
In der Kanzlei wurde ich schon von allen erwartet, den Partnern und den angestellten Anwälten. Angestellter Anwalt in einer Kanzlei – das klingt gut, aber in Wirklichkeit ist es eine stark beschönigende Bezeichnung eines Abhängigkeitsverhältnisses. Nicht umsonst kursiert in Anwaltskanzleien ein Witz, bei dem gefragt wird, warum ein angestellter Anwalt im Grunde unkündbar sei: Sklaven, so die Pointe dieses Witzes, würden verkauft, nicht gekündigt. Immer, wenn ein Partner einem neuen Anwalt diesen Witz erzählte, lachten alle pflichtschuldigst mit, obwohl sie den Witz schon dutzende Male gehört hatten.
Neben den Partnern wartete also eine Menge dieser »Sklaven« gespannt auf meinen Bericht. Als Letzter kam der namensgebende Partner, also der Anwalt, nach dem die ganze Kanzlei benannt ist, in den Besprechungsraum, in dem sich alle versammelt hatten. Ein namensgebender Partner ist in einer Kanzlei eine Art Halbgott, der über allem und allen steht. Und das unabhängig von seinen tatsächlichen Leistungen für die Kanzlei. Dieser namensgebende Partner aber war auch ein erstklassiger Anwalt, der dank seines wachen Verstandes Sachverhalte schneller und präziser einschätzen konnte als die übrigen Anwälte der Kanzlei. Er war das »Leittier« der Kanzlei. Was er sagte, galt intern mehr als jedes Gesetz.
Schlagartig verstummten die Gespräche.
Der namensgebende Partner setzte sich, nippte an seinem Kaffee und richtete den Blick auf mich. »Nun, Herr Kollege, bitte erzählen Sie von Ihrem heutigen Mandat. Wir sind alle sehr gespannt.«
Ich erhob mich von meinem Platz und fasste alles in wenigen Sätzen zusammen. Am Ende erwähnte ich noch die Honorarvereinbarung. Alle warteten, bis der namensgebende Partner etwas sagte, doch der blieb stumm. Er schien sichtlich getroffen von den geschilderten Straftaten. Ein anderer Partner der Kanzlei äußerte wegen der Schwere der Straftaten meines Mandanten seine Bedenken. Ich rechnete fest mit einer Moralpredigt und stellte mich innerlich darauf ein, dass mein Mandat und dessen Fortführung nun zur Diskussion gestellt würden. Doch der Partneranwalt fuhr fort. Er stellte das Honorar in den Mittelpunkt seiner Betrachtung und schloss mit den Worten, dass das äußerst hohe Honorar eine gerechte Belohnung für den anstrengenden Fall sei. Danach klopfte er mit den Knöcheln auf die Tischplatte als Zeichen des Applauses und der Anerkennung. Alle anderen Partner und die angestellten Anwälte stimmten ein. In diesem Moment war ich erleichtert, ja, richtig stolz. Da hob der namensgebende Partner die Hand. Alle verstummten.
»Eine Einschränkung habe ich«, sagte er ruhig. »Sie machen nur weiter, wenn das volle Honorar als Vorschuss bezahlt wird. Geben Sie Ihrem Mandanten dafür zehn Tage Zeit; die wird er brauchen.«
Alle wussten, dass mein Mandant viele Ländereien besaß und genügend Geld hatte. Es ging also nicht darum, ob er die horrende Summe bezahlen konnte, sondern nur darum, ob er wollte. Im Gegensatz zu vielen Menschen, die sich eine gute anwaltliche Unterstützung nicht leisten und deshalb ihr Recht nicht geltend machen können und somit ihre Gerechtigkeit nicht bekommen, konnte mein Mandant, der sich großes Unrecht hatte zu Schulden kommen lassen, mit seinem vielen Geld eine erstklassige Verteidigung kaufen. In diesem Moment erkannte ich, dass die Gerechtigkeit dem schnöden Mammon gewichen war: Wer bezahlen kann, kann erstklassig verteidigt, ihm kann zu »seinem« Recht verholfen werden. Ich konnte mich nicht erinnern, so etwas auch im Studium gehört zu haben. Dort hieß es im Gegenteil, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien. Dass diese Gleichheit nur für Menschen gilt, die Geld haben, während Menschen ohne Geld kaum Chancen auf Gerechtigkeit haben, davon habe ich im Studium nie gehört oder gelesen.
Gerechtigkeit war in der Rechtspraxis also zu einer Frage des Geldes geworden. Anscheinend entscheidet allein das Honorar über das Mandat. Der alte Spruch »Judex non calculat« (Gerechtigkeit kann man nicht berechnen) bekam eine völlig neue Bedeutung. Offenbar war Gerechtigkeit sehr wohl berechenbar. Sie wurde vielmehr sogar käuflich. Aber war das nicht normal? Ich tröstete mich damit, dass wohl heute alles käuflich sei. Dabei bemerkte ich nicht, dass ich meine Werte, namentlich die Gerechtigkeit, schon wieder verraten hatte. Der Gerechtigkeit wollte ich dienen, dem Geld war ich nun ergeben. Und ist Geld nicht auch in vielen anderen Bereichen die Größe, die über alles entscheidet? Geld gebiert und Geld vernichtet Existenzen. Auf Gerechtigkeit kommt es offensichtlich niemandem mehr an; den meisten geht es um Beträge, nicht um Werte. Arbeitsplätze, Mieten, Privatschulen – alles eine Frage des Geldes, oder besser: des richtigen Betrags. Mit diesen Gedanken verdrängte ich mein Ideal der Gerechtigkeit, oder besser: Ich verkaufte es.
Nachdem die Besprechung beendet war, ging ich in mein Büro und formulierte die Haftbeschwerde. Noch am gleichen Tag ging der Schriftsatz bei Gericht ein. Der Termin zur Anhörung wurde auf den übernächsten Tag festgelegt.
Den Rest des Tages widmete ich mich meinen anderen Fällen, die auf dem Schreibtisch schon auf mich warteten. Wie jeden Tag ging ich spätabends nach Hause, und nach außen schien es ein Arbeitstag wie jeder andere gewesen zu sein.
6
Der nächste Tag begann wie üblich. Ich saß um 8 Uhr an meinem Schreibtisch und bearbeitete die Akten von verschiedenen Fällen. In Gedanken war ich jedoch bereits bei der Haftprüfung, die am folgenden Tag stattfinden sollte. Ich war fest entschlossen, meinen Mandanten aus der Haft zu holen. Diesen Erfolg wollte ich mir unbedingt ans Revers heften, an Gerechtigkeit verschwendete ich keinen Gedanken mehr. Mein Mandant würde dann seine Honorarrechnung bezahlen, und dieser Umsatz wäre das beste Argument auf dem Weg, Partner zu werden.
Schließlich machte ich mich an die Vorbereitung der Haftprüfung. Als meine Strategie stand, wollte ich meine Argumentationen mit einem Kollegen durchsprechen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich ging zum erfahrensten Strafrechtler der Kanzlei. Er war 60 Jahre alt und Kettenraucher. Jeden Tag rauchte er vier bis fünf Schachteln Zigaretten, und seinem Zigarettenkonsum entsprechend war die Luft in seinem Büro. Dicke Rauchschwaden waberten durch den Raum und auf den Büchern hatten sich Nikotinreste abgelagert. Sein Zimmer zu betreten kostete also Überwindung, doch er war ein brillanter Strafrechtler. Außerdem war er so etwas wie mein Lehrer geworden, weil er mir in der ersten Zeit alle Fragen geduldig beantwortet und immer ein offenes Ohr für mich gehabt hatte. Und er hatte ein großes Herz.
Als ich das Büro betrat, saß er wie üblich in einem dunklen, ein bisschen zu großen Anzug an seinem Schreibtisch und diktierte einen Schriftsatz. Der Aschenbecher war randvoll, in seiner Hand qualmte eine Zigarette. Auch wenn man ihm den genialen Anwalt nicht ansah: Wenn er sprach und seine messerscharfen Ausführungen darlegte, seinen überragenden Intellekt in einen Fall einbrachte oder auch einfach nur die richtigen Fragen stellte, war jedem klar, dass man es mit einem Meister des Anwaltsfachs zu tun hatte. Wer wahre Werte und echtes Können finden will, muss hinter die Fassade blicken können. Als ich dem Kollegen meine Argumentation schilderte und die Grundlagen meiner Strategie erläuterte, kam keinerlei Feedback. Das war ungewöhnlich, denn das Streitgespräch zwischen Anwälten gehört in jeder Kanzlei zum Alltag; unter Kollegen werden die unterschiedlichsten Positionen vertreten und Argumente ausgetauscht, sodass ein Fall aus allen Blickwinkeln beleuchtet und die Strategie auf mögliche Schwachstellen untersucht werden kann. Besonders in diesem Fall war ich überzeugt, mich gegen viele Gegenargumente wehren zu müssen. Doch da kam erstaunlicherweise nichts. Der Kollege blieb stumm und schaute aus seinem Bürofenster. Auch als ich mit meinen Ausführungen fertig war, herrschte Schweigen im Raum.