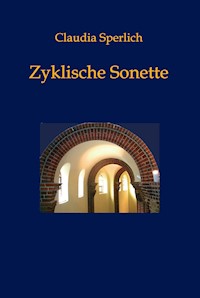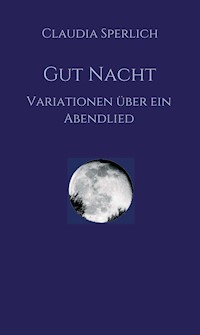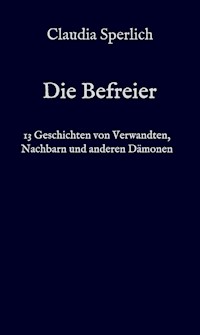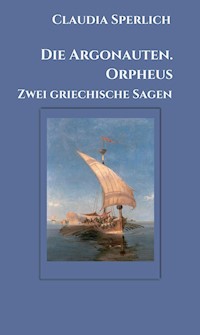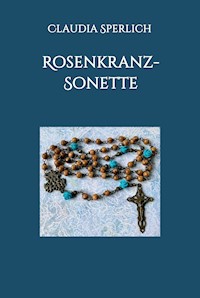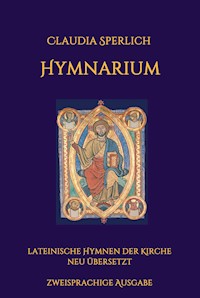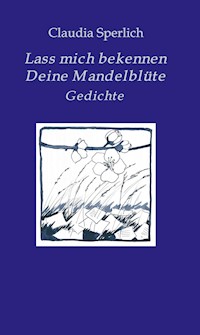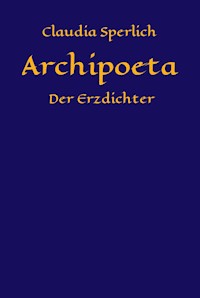
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Archipoeta wird auf Rainalds Geheiß versorgt und beherbergt, nimmt das nicht immer wahr, singt für andere, solange der Erzbischof fort ist - und unternimmt einige Dinge, die er nicht vorhat, dem hohen Herrn zu verraten. Wer kann widerstehen, wenn er nicht gerade ein Heiliger ist? Der Wein der Tavernen ist nicht so edel wie der auf Rainalds Tafel, aber unverdünnt. Beim Spiel gewinnt er einmal ein Obergewand, verliert es kurz darauf wieder. Wein und Spiel machen zugleich lustig und müde und wecken die Sehnsucht nach älteren Genüssen. Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei. Zwar darf es so nicht zugehen, aber wie soll er sich wehren gegen die Übermacht einer schier allmächtigen Venus? Der Mittagsdämon sucht ihn heim in Gestalt von Wirtstöchtern und Dirnen und einmal in Gestalt einer edlen Frouwe, als er Gelegenheit bekommt, vor einem Adligen zu singen. Er singt einige Minnelieder. Besonders gefällt ihm dergleichen nicht, aber Hausherr und Gäste sind begeistert, und die Frouwe lächelt ihm sehr liebenswürdig zu. Nach einem Becher Wein singt er ein Scherzlied, dann ein weiteres Minnelied - diesmal aber von der niederen Minne, der greifbaren. Die Frouwe unterdrückt ein Kichern, der Herr sieht einen Augenblick fast entrüstet aus, lacht dann los: "Nur weiter so, Sänger!" Er singt weiter, Lateinisch nun, was der Hausherr einigermaßen versteht, einige Gäste auch, und die anderen haben ihre Freude an den mitreißenden Melodien. Die Frouwe lächelt. Die Gefahr peitscht seine Sinne auf, als die Frouwe in das kleine Gemach kommt, das ihm für die Nacht überlassen wurde. Sie öffnet die Tür in dem Augenblick, als er sich das Hemd über den Kopf ziehen will. "Verzeih, edle Frouwe." "Lass dich nicht stören, Sänger." Im Roman sind die Lieder des Archipoeta in deutscher Übertragung enthalten. Die lateinischen Originaltexte stehen im Anhang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für Suse und Tobias
Claudia Sperlich
Archipoeta
© 2015 Claudia Sperlich
https://katholischlogisch.wordpress.com/
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Paperback ISBN 978-3-7323-7645-2
Hardcover ISBN 978-3-7323-7646-9
e-Book ISBN 978-3-7323-7647-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ebenfalls bei tredition erschienen:
Lass mich bekennen Deine Mandelblüte. Gedichte, 2015
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Archipoeta – Der Erzdichter
Die Originaltexte
- Carmen I – Bitte um Aufnahme
- Carmen II – Bitte zu Allerheiligen
- Carmen III – Abbruch des Studiums
- Carmen IV – Predigt vor Geistlichen
- Carmen V – Ablehnung eines Auftrags
- Carmen VI – Kaiserhymnus
- Carmen VII – Vagantenbeichte
- Carmen VIII – Jonasbeichte
- Carmen IX – Himmlische Vision
- Carmen X – Preislied auf Rainald
Vorwort
Der Archipoeta lebte im 12. Jahrhundert. Seine Vagantenbeichte, Estuans intrinsecus, ist in Auszügen durch Carl Orffs Vertonung bekannt geworden. Über das Leben des Autors wissen wir nicht mehr als das, was aus seinen Liedern hervorgeht. Nicht einmal sein Name ist überliefert – Archipoeta, zu Deutsch Erzdichter, ist ein Beiname. Zwar wurde behauptet, er sei mit einem Ritter Walther identisch, aber das ist eine sehr vage Hypothese.
Von seinem Werk sind nur die in dieser Erzählung vorgestellten Lieder erhalten. Sie entstanden im Umkreis seines Mäzens, des Bischofs Rainald von Dassel. Nun ist es kaum denkbar, daß ein Dichter von solcher Sprachgewalt nicht mehr geschrieben hat als dies – ich vermute, wir kennen nicht einmal ein Zehntel seines Werkes.
Sein Mäzen war der Bischof Rainald von Dassel, der Barbarossa unterstützte. Über diese beiden weiß man recht viel. Rainald von Dassel starb im August 1167 an einer Seuche; die Spur des Archipoeta verliert sich danach.
Die genannten politischen und kirchlichen Ereignisse fanden tatsächlich statt – auch die melodramatische Inthronisierung des Gegenpapstes Victor. Meine Schilderung des Archipoeta ist allerdings Fiktion.
Manche Forscher meinen, seine Klagen über seine Armut, Krankheit und Sünde seien fiktiv. Tatsächlich ist der Topos vom armen, liederlichen Dichter dem Mittelalter bekannt gewesen. Aber mir erscheint zumindest die Vagantenbeichte zu frisch, zu authentisch für den Aufguß eines Topos, ebenso die Klage über das abgebrochene Studium.
Ich habe Rainald von Dassel recht sympathisch portraitiert, weil ich es aus der angenommenen Sicht des Archipoeta tat. Rainald wurde von vielen Menschen mit Grund gehaßt; er war nicht nur Erzbischof und Erzkanzler, sondern auch ein zuweilen überaus harter Feldherr. Andererseits ist seine schrankenlose Großzügigkeit glaubwürdig bezeugt, ebenso wie seine vergebliche Bitte für die Bürger von Mailand.
Ein Bildnis Rainalds ist auf das Reliquiar in Köln eingraviert, allerdings ist es vermutlich kein genaues Portrait. Dem gewöhnlichen Besucher des Kölner Doms ist es leider nicht sichtbar, weil das Reliquiar sehr hoch steht und die Gravur auf dem dachartig geschrägten Deckel von unten nicht zu erkennen ist. Im Internet finden sich Photos davon.
Rainald war aus katholischer Sicht eine schillernde Gestalt – als Unterstützer mehrerer Gegenpäpste und eines ketzerischen Kaisers war er Häretiker, zugleich verdanken wir ihm die Erhebung Kölns zum Wallfahrtsort, dies aufgrund eines Reliquiars, in dem weder die Reliquien der Heiligen Drei Könige noch sonst etwas Heiliges je waren. Der Archipoeta war dadurch, daß er Rainald auch in kirchenpolitischer Hinsicht folgte, ebenfalls häretisch. Zugleich war er tiefgläubig und immer wieder rückfälliger, immer wieder reuevoller Sünder.
Meine Übersetzung der Lieder folgt dem Metrum der Originale. Die lateinische Sprache ist sehr viel reimfreudiger als die Deutsche; der Versuch einer genauen Nachahmung führt hier regelmäßig zu Reimereien nach dem Prinzip „reim dich oder ich fress dich“. Ich habe daher weniger gereimt als der Archipoeta.
Die lateinischen Zitate richten sich nach der im Mittelalter üblichen Schreibweise.
Im Anhang finden sich die Lieder im Original. Ich benutze die unter Philologen üblichen Bezeichnungen Carmen (Lied) I-X. Carmen X ist leider nicht vollständig erhalten; dem langen Carmen V fehlen zwei Verse.
Das mittelalterliche Latein wurde etwas anders ausgesprochen als das klassische; die klassische Sprache wird durch Längen und Kürzen, also Quantifizierung der Vokale, lebendig, die mittelalterliche nach dem uns vertrauteren Heben und Senken der Stimme.
Die Umlaute oe und ae werden im Mittellateinischen zu e zusammengezogen, das c wird vor e und i wie z ausgesprochen (und oft auch als z geschrieben); gleiches gilt für das t vor i. (Dies alles gilt für die Weltgegend, aus der der Archipoeta stammte; die lateinische Aussprache war in Prag sicher anders als in Salamanca, und vermutlich hat auch unser Dichter sich in Italien eine andere Aussprache angewöhnt. Zudem können Sprachwissenschaftler zwar herausfinden, wie es ungefähr geklungen hat – aber Genaues kann man nicht wissen.)
Es gibt zwei verschiedene Zählungen der Lieder; ich richte mich nach der chronologischen Zählung von Langosch.
Einzelne Strophen kommen in mehr als einem Lied vor. Ob der Archipoeta das so gewollt hat oder ob es an ungenauer Überlieferung liegt, ist unbekannt.
Oktober anno Domini 1158. Mehrere Städte Italiens haben sich Kaiser Friedrichs Streitmacht unterworfen; vor fünf Wochen, nach einem Monat der Belagerung, auch Mailand. Die Verhandlungen mit Mailand – vielmehr Mailands erzwungene Annahme eines Kataloges von Schuldzahlungen und Pflichten – sind abgeschlossen; man wird bald aufbrechen nach Roncaglia.
Rainald von Dassel, Domprobst von Hildesheim, Erzkanzler Deutschlands und Italiens, juristischer Berater und Stratege des Kaisers, sitzt gelangweilt in seinem Prachtzelt. Viel zu wenige Bücher konnte er mitnehmen, das Gespräch mit Gebildeten fehlt ihm, und ihm fehlt Musik – zwar gibt es Sänger im kaiserlichen Troß, aber die genügen seinen verwöhnten Ohren nicht.
Er weiß nicht, daß am Rande des Lagers, bei den Zelten der niederen Chargen, bei den von Rainald ingrimmig geduldeten Dirnen und Marketenderinnen, Lieder zu hören sind, nicht nur von grölenden Söldnern. Ein fahrender Sänger wird seit einiger Zeit von den nicht minder gelangweilten Soldaten durchgefüttert und gelegentlich auch von den Dirnen. Sein Deutsch hat einen rheinischen Einschlag, aber mit den höheren Offizieren – die sich auch zuweilen mit anderem als Marketenderinnen und Dirnen ablenken müssen - spricht er eines Scholaren würdiges Latein. Das einfachere Latein der Vaganten dient zur Verständigung mit den burgundischen, ungarischen, böhmischen und italienischen Soldaten. (Was die reichen Händler und die armen Studiosi verbreiten, ist zwar kein besonders geschliffenes Latein, aber es genügt, um sich von Prag bis Portugal durchzuschlagen.)
Etwas heiser ist er, kein Wunder bei dem dünnen Zeug, den zerrissenen Schuhen, aber die Stimme versagt ihm nicht, wenn er von süßen Weibern und ungemischtem Wein singt und von Unbehaustheit, Einsamkeit, Getriebenheit und Armut. Die Wächter und die Soldaten verstehens gut.
Zwei Tagereisen südöstlich von Mailand, vor den Toren des kaisertreuen Piacenza, wird im November über die künftige Ordnung in Reichsitalien beraten, wird die Verwaltung des nun kaiserlichen Landes im Großen wie im Kleinen geregelt. Straßen sollen sichererer werden, gegen die Plage der Wegelagerei werden Männer im Auftrag des Kaisers mit hohen Vollmachten ausgestattet. Straßenräuber riskieren den sofortigen Verlust einer Hand. Auch kommt den Studiosi und Magistri durch ein neues Gesetz besonderer Schutz zu. Rainald ist der Meinung, man dürfe es den Gelehrten nicht schwerer machen, als sie es schon haben, und die Juristen stimmen ihm zu.
Der moderne Dom von Piacenza gefällt dem kunstsinnigen Rainald, aber über zwei Wochen lang hat er fast ständig in der Nähe des Kaisers und der Bologneser Rechtsgelehrten zu weilen – in der kulturlosen Ödnis Roncaglia, die Stadt in Sichtweite wie eine verbotene Leckerei, bis man sich nach den Verhandlungen zur Winterpause in Piacenza einquartiert.
Mit pedantischem Grimm ordnet und verwaltet Friedrich auch die kirchlichen Güter, was den Frieden mit Rom nicht eben fördert und Rainald mehr als eine schlaflose Nacht beschert. Kirchliche und weltliche Gesandte aus Rom treffen im Frühjahr ein. Rainald hat keine Zeit zur Muße.
Im Juni 1159 wird Rainald in Abwesenheit zum Erzbischof, zum Archepiscopus, von Köln ernannt und damit zugleich als Archicancellarius Italiens bestätigt.
Im September wird Orlando Badinelli zum Papst gewählt mit dem stolzen Namen Alexander. Friedrich erkennt ihn nicht an; Rainald unterstützt seinen Kaiser. Der Papst wird inthronisiert - aber die mächtige Sippe der Monticelli und ihre Anhänger stürmen den Vatican, reißen dem Gekrönten Tiara und Purpurmantel herunter, stoßen ihn vom Thron. Statt seiner wird Ottaviano de’Monticelli in ghibellinischem Jubel und trotz der zornigen Rufe der Guelfen zum Papst gekrönt und wenige Wochen später im kaiserlichen Kloster Farfa geweiht. Victor nennt er sich, der Sieger, der vierte Papst dieses Namens, wohl nicht nur aus demütiger Verehrung des heiligen Märtyrers. Der vierte… es gab bereits einen vierten Victor auf dem Papstthron, aber der war ein Gegenpapst und wird von diesem Victor nicht anerkannt. Schwierig nur, daß auch dieser Victor den Guelfen als Gegenpapst gilt, während die Ghibellinen Alexander als Antipapa bezeichnen.
Der Kaiser beruft im Februar des folgenden Jahres ein Konzil ein. Im Dom zu Pavia trifft man sich, allerdings ohne den Papst Alexander, ohne die fränkischen und englischen Herren, die der guelfischen Seite treu sind.
Einer der Offiziere weist den Erzbischof darauf hin, daß ein außergewöhnlich begabter Sänger im Troß sei. Fast spreche er wie ein Gelehrter, zugleich mit dem Witz der Vaganten. Ohne große Hoffnung meint Rainald, man möge ihn am folgenden Abend kommen lassen. Der Offizier findet den Dichter im Zelt eines Untergebenen; der Soldat hat Mitleid mit dem Jungen, diesem Hänfling, der nicht recht gesund aussieht, und teilt Speck und Brot mit ihm. „Morgen Abend hast du im Zelt des Archicancellarius zu erscheinen“, schnarrt der Offizier, und der Sänger sieht ihn an, als habe er gesagt „Siehe, ich verkündige euch große Freude“.
Vor wenigen Jahren durfte er die Feierlichkeiten zu Rainalds Amtserhebung in Hildesheim sehen, bewundert Rainalds Bildung – ach Bildung! Ein vir doctus sein, ein Gelehrter! - Und nun soll er singen vor dem Großen. - Aber Hunger hat er, und kalt ist ihm, und dann wieder heiß, besonders um die Augen. Er dichtet die halbe Nacht lang; am nächsten Morgen überarbeitet er das neue Werk, findet eine Melodie.
omnia tempus habent, et ego breve postulo tempus,
ut possim paucos presens tibi reddere versus,
electo sacro, presens in tegmine macro,
virgineo more non hec loquor absque rubore.
Jegliches hat seine Zeit – der Zeit erbitt ich ein wenig,
einige meiner Verse dir vortragen zu können,
dir, dem würdgen Erwählten! In meinem schäbigen Kleide
sprech ich nicht ohne Erröten gleich einem jungen Mädchen.
Lebe, gewaltiger Herr! dem die Herrschaft sich hat überlassen,
mit deinem Rat und mit starker Hand lenkst du die Gesetze.
Aller Bischöfe Blüte bist du und größter von allen!
Unversehrt lebe, du Bürge der Klugheit, größer als Nestor.
Gütiger Herr und gerechter, laß dich durch mein Flehen bewegen,
Herr voller Geisteskraft, dem alle Welt gibt die Ehre.
Großen Herren ist ziemlich, die Geringsten zu lieben!
Neige dein Herz den Armen, wie’s deiner Redlichkeit ansteht.
Uns, die in Not sind, stütze nach der gewohnten Milde,
Herr aus dem Lande des Nordens, hilf uns, die auch aus dem
Norden!
Sicher hab ich im Leben nur durch dich eine Hoffnung.
Schon wird durch Frost und durch Hunger aller Schwung mir
genommen,
Winters Strenge tötet mich und die schaurige Kälte,
ständig leide ich Husten, gleich als hätt ich die Schwindsucht,
an meinem Pulse fühl ich, daß ich dem Tode nicht fern bin.
Daß wir arm sind, weisen wie der Leib auch die Füße,
und nur mit schüchternem Blicke trag ich dir vor meine Bitten,
stehe vor dir in diesem Zeuge nicht ohne Zagen:
Sei von Mißgeschick frei, und bleibe eingedenk meiner!