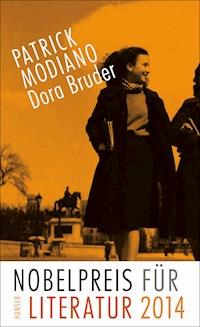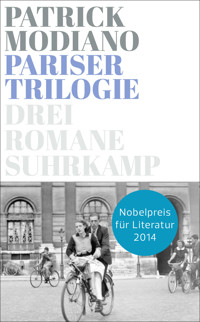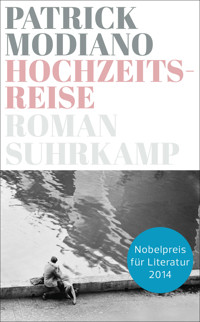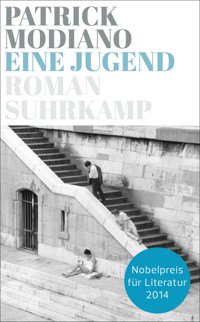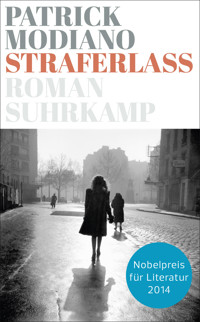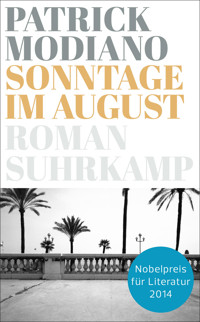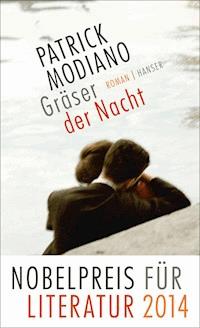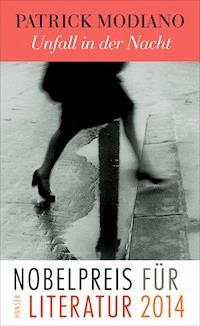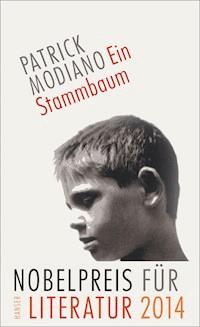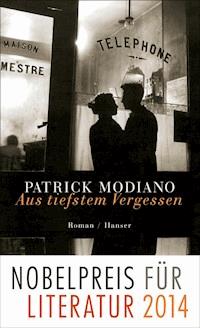
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann sieht in der Metro eine Frau, die vor dreißig Jahren seine Jugendliebe war. Damals lebte Jacqueline mit einem anderen im Quartier Latin, schnüffelte Äther und träumte von Mallorca. Heute folgt ihr der Erzähler bis zu einer Party, auf der sie sich zunächst nicht zu erkennen gibt. Eine nostalgische Liebesgeschichte aus dem Paris und London der sechziger Jahre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Patrick Modiano
Aus tiefstem Vergessen
Roman
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel
Du plus loin de l’oubli bei Gallimard, Paris
Die Übersetzerin dankt dem
Freundeskreis zur Förderung literarischer
und wissenschaftlicher Übersetzungen.
ISBN 978-3-446-24880-9
© Éditions Gallimard, Paris 1996
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2000/2014
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung eines Fotos von Willy Ronis, Ménilmontant, 1947 © Focus Hamburg
Satz: Reinhard Amann, Aichstetten
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Peter Handke
Aus dem Vergessen lockst du ...
Stefan George
Sie war mittelgroß, und er, Gérard Van Bever, ein wenig kleiner. Am Abend unserer ersten Begegnung, in jenem Winter vor dreißig Jahren, hatte ich sie bis zu einem Hotel am Quai de la Tournelle begleitet und war in ihrem Zimmer gelandet. Zwei Betten, eines neben der Tür, das andere unter dem Fenster. Der Blick ging nicht auf den Quai hinaus, und mir scheint, es war eine Mansarde.
Ich hatte keinerlei Unordnung in dem Zimmer bemerkt. Die Betten waren gemacht. Keine Koffer. Keine Kleidungsstücke. Nichts als ein großer Wecker auf einem der Nachttische. Und trotz dieses Weckers hätte man meinen können, sie wohnten hier wie in einem Versteck und vermieden es, Spuren ihrer Anwesenheit zu hinterlassen. Im übrigen waren wir an diesem ersten Abend nur einen kurzen Augenblick in dem Zimmer geblieben, gerade lang genug, um ein paar Kunstbände abzulegen, die ich nicht länger mit mir herumtragen wollte, nachdem ich vergeblich versucht hatte, sie bei einem Antiquar an der Place Saint-Michel zu verkaufen.
Und auf der Place Saint-Michel hatten sie mich am späten Nachmittag auch angesprochen, inmitten des Gewühls von Menschen, die sich in den Metroeingang drängten oder in umgekehrter Richtung den Boulevard hinaufströmten. Sie hatten mich gefragt, wo sie in dieser Gegend ein Postamt finden könnten. Ich hatte befürchtet, meine Erklärungen wären zu ungenau, denn ich habe mich nie darauf verstanden, jemandem die kürzeste Strecke von einem Punkt zum anderen anzugeben. Deshalb hatte ich es vorgezogen, die beiden bis zur Post am Odéon zu begleiten. Unterwegs war sie kurz in einem Café-Tabac verschwunden und hatte drei Briefmarken gekauft. Diese hatte sie so auf den Umschlag geklebt, daß mir ausreichend Zeit geblieben war, das Wort »Mallorca« darauf zu lesen.
Sie hatte den Brief in einen der Kästen gesteckt, ohne aufzupassen, ob es auch wirklich derjenige war, auf dem Ausland – Luftpost stand. Wir waren zur Place Saint-Michel und den Quais zurückgegangen. Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ich diese Bücher trug, die »doch bestimmt schwer waren«. Dann hatte sie mit schroffer Stimme zu Gérard Van Bever gesagt:
»Du könntest ihm helfen.«
Er hatte mir zugelächelt und sich eines der Bücher – das größte – unter den Arm geklemmt.
In ihrem Zimmer, am Quai de la Tournelle, hatte ich die Bücher auf den Boden gelegt, neben den Nachttisch mit dem Wecker. Ich hörte sein Ticken nicht. Der Zeiger stand auf drei. Ein Fleck auf dem Kopfkissen. Als ich mich hinuntergebeugt hatte, um die Bücher abzulegen, war mir Äthergeruch in die Nase gestiegen, der über Kissen und Bett schwebte. Ihr Arm hatte mich gestreift, und sie hatte die Lampe auf dem Nachttisch angeknipst.
Wir hatten in einem Café am Quai, gleich neben ihrem Hotel, zu Abend gegessen. Wir hatten vom Menü nur das Hauptgericht bestellt. Van Bever hatte die Rechnung bezahlt. Ich hatte kein Geld an jenem Abend, und Van Bever glaubte, daß ihm fünf Franc fehlten. Er hatte die Taschen seines Mantels und seines Jacketts durchwühlt und die Summe schließlich in kleinen Münzen zusammengebracht. Sie ließ ihn gewähren und schaute ihm mit einem zerstreuten Blick zu, während sie eine Zigarette rauchte. Sie hatte uns ihre Portion zum Aufteilen gegeben und sich damit begnügt, ein paar Bissen von Van Bevers Teller zu nehmen. Sie hatte sich zu mir gedreht und mit ihrer leicht heiseren Stimme gesagt:
»Das nächste Mal gehen wir in ein richtiges Restaurant ...«
Später hatten wir zu zweit vor der Hoteltür gewartet, während Van Bever ins Zimmer hinaufging, um meine Bücher zu holen. Ich hatte das Schweigen gebrochen und sie gefragt, ob sie schon lange hier wohnten und ob sie aus der Provinz oder aus dem Ausland kämen. Nein, sie stammten aus der Umgebung von Paris. Sie wohnten schon seit zwei Monaten hier. Das war alles, was sie mir an jenem Abend gesagt hatte. Und ihren Vornamen: Jacqueline.
Van Bever war wiederaufgetaucht und hatte mir meine Bücher zurückgegeben. Er wollte wissen, ob ich am nächsten Tag noch einmal versuchen würde, sie zu verkaufen, und ob diese Art von Geschäft einträglich sei. Sie hatten mir gesagt, daß wir uns wiedersehen könnten. Es war schwierig, sich für eine bestimmte Uhrzeit mit mir zu verabreden, aber sie waren oft in einem Café, an der Ecke der Rue Dante.
Manchmal kehre ich in meinen Träumen dorthin zurück. Neulich blendete mich abends die untergehende Februarsonne, als ich die Rue Dante entlangging. Sie hatte sich in all dieser Zeit nicht verändert.
Ich blieb vor der verglasten Terrasse stehen und schaute mir die Theke an, den Flipper und die wenigen Tische, die wie am Rand einer Tanzfläche aufgestellt sind.
Als ich die Mitte der Straße erreichte, warf das Hochhaus von gegenüber, vom Boulevard Saint-Germain, seinen Schatten über sie. Doch hinter mir lag der Gehsteig noch in der Sonne.
Beim Aufwachen zeigte sich mir der Abschnitt meines Lebens, in dem ich Jacqueline gekannt hatte, im selben Kontrast von Schatten und Licht. Fahle, winterliche Straßen und auch die Sonne, die durch die Ritzen in den Fensterläden dringt.
Gérard Van Bever trug einen Mantel aus einem Stoff mit Fischgrätenmuster, der ihm zu groß war. Ich sehe ihn vor mir, wie er in dem Café in der Rue Dante am Flipper steht. Aber es ist Jacqueline, die spielt. Ihre Arme und ihr Oberkörper bewegen sich kaum, während der Automat seine Knattergeräusche und Lichtsignale ausschickt. Van Bevers Mantel war weit und reichte ihm bis unter die Knie. Er hielt sich sehr gerade, hatte den Kragen heruntergeschlagen, die Hände in den Taschen vergraben. Jacqueline trug einen grauen Rollkragenpullover mit Zopfmuster und eine Jacke aus weichem, kastanienbraunem Leder.
Als ich die beiden zum ersten Mal in der Rue Dante traf, hat Jacqueline sich zu mir umgedreht, hat mir zugelächelt und ihre Partie Flipper fortgesetzt. Ich habe mich an einem Tisch niedergelassen. Ihre Arme und ihr Oberkörper erschienen mir zierlich gegenüber dem klobigen Apparat, dessen Stöße sie in jedem. Augenblick nach hinten werfen konnten. Sie bemühte sich, aufrecht stehenzubleiben, wie jemand, der Gefahr läuft, über Bord zu kippen. Dann setzte sie sich zu mir, und Van Bever stellte sich an den Flipper. Anfangs war ich erstaunt, daß sie dieses Spiel so lange spielten. Oft war ich es, der ihre Partie unterbrach, sonst hätte sie endlos gedauert.
Am Nachmittag war dieses Café fast ausgestorben, doch ab sechs Uhr abends drängten sich die Gäste um die Theke und die paar Tische im Saal. Inmitten des Stimmengewirrs, des Flippergeratters und der aneinandergepreßten Leute erkannte ich Van Bever und Jacqueline nicht sofort. Als erstes sah ich Van Bevers Fischgrätenmantel, dann Jacqueline. Ich war mehrfach vorbeigekommen, ohne sie anzutreffen, und jedesmal hatte ich mich an einen Tisch gesetzt und lange gewartet. Ich dachte, daß ich nie wieder die Gelegenheit haben würde, ihnen zu begegnen, und daß sie in dem Gewimmel und dem Krach verschwunden wären. Und eines Tages, am frühen Nachmittag, standen sie da, ganz hinten im leeren Saal, nebeneinander vor dem Flipper.
Ich erinnere mich kaum an andere Einzelheiten aus diesem Abschnitt meines Lebens. Ich habe die Gesichter meiner Eltern beinahe vergessen. Ich hatte noch einige Zeit bei ihnen gewohnt, dann mein Studium aufgegeben und verdiente mein Geld, indem ich alte Bücher verkaufte.
Kurz nachdem ich Jacqueline und Van Bever kennengelernt hatte, war ich in ein Hotel unweit von ihrem gezogen, das Hôtel de Lima. Ich hatte mich um ein Jahr älter gemacht, indem ich das Geburtsdatum in meinem Reisepaß änderte, so daß ich nun volljährig war.
In der Woche vor meinem Einzug ins Hôtel de Lima hatten sie mir, da ich nicht wußte, wo ich schlafen sollte, ihren Zimmerschlüssel überlassen und waren in eines jener Provinzkasinos gefahren, die sie regelmäßig aufzusuchen pflegten.
Vor unserer Begegnung hatten sie mit dem Kasino von Enghien und zwei oder drei anderen Kasinos in kleinen normannischen Seebädern angefangen. Und dann hatten sie sich auf Dieppe, Forges-les-Eaux und Bagnoles-de-l’Orne konzentriert. Sie fuhren gewöhnlich am Samstag los und kehrten am Montag mit einem gewissen Betrag zurück, den sie gewonnen hatten und der nie über tausend Franc lag. Van Bever hatte ein System gefunden, »um die neutrale Fünf«, wie er sagte, doch es funktionierte nur beim Boule und wenn man bescheidene Beträge setzte.
Ich habe sie nie an diese Orte begleitet. Ich wartete bis Montag, ohne das Viertel zu verlassen. Nach einer gewissen Zeit fuhr Van Bever dann nach »Forges« – wie er sich ausdrückte –, weil es nicht so weit entfernt war wie Bagnoles-de-l’Orne, und Jacqueline blieb in Paris.
Während der Nächte, die ich allein in ihrem Zimmer verbracht hatte, hing immer dieser Äthergeruch im Raum. Das blaue Fläschchen stand auf der Ablage über dem Waschbecken. Im Wandschrank sah ich ein paar Kleidungsstücke: eine Männerjacke, eine Hose, einen Büstenhalter und einen jener grauen Rollkragenpullover, die Jacqueline immer trug.
Ich hatte schlecht geschlafen in jenen Nächten. Ich wachte auf und wußte nicht mehr, wo ich war. Ich brauchte eine ganze Weile, bevor ich das Zimmer wiedererkannte. Wenn mir jemand Fragen über Van Bever und Jacqueline gestellt hätte, wäre ich in großer Verlegenheit gewesen, eine Antwort zu finden und meine Anwesenheit hier zu rechtfertigen. Würden sie zurückkommen? Am Ende zweifelte ich daran. Der Mann, der am Hoteleingang stand, hinter einem Rezeptionspult aus dunklem Holz, kümmerte sich nicht darum, wenn ich ins Zimmer hinaufging oder den Schlüssel bei mir behielt. Er begrüßte mich mit einem Nicken.
In der letzten Nacht war ich gegen fünf Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Wahrscheinlich lag ich in Jacquelines Bett, und der Wecker tickte so laut, daß ich ihn in den Wandschrank stellen oder unter einem Kissen hatte verstecken wollen. Aber ich fürchtete mich vor der Stille. Deshalb war ich aufgestanden und hatte das Hotel verlassen. Ich war den Quai bis an die Gitter des Jardin des Plantes hinuntergegangen, dann hatte ich das einzige bereits geöffnete Café betreten, gegenüber der Gare d’Austerlitz.
In der Woche zuvor waren sie zum Spielen ins Kasino von Dieppe gefahren und sehr früh am Morgen wiedergekommen. Heute würde es genauso sein. Noch ein, zwei Stunden warten ... Die Vorortbewohner strömten immer zahlreicher aus der Gare d’Austerlitz, tranken einen Kaffee an der Theke und verschwanden im Eingang zur Metro. Es war noch finster. Abermals lief ich an den Gittern des Jardin des Plantes entlang, dann an jenen des ehemaligen Weinmarktes.
Schon von weitem erkannte ich ihre Silhouetten. Van Bevers Fischgrätenmantel bildete einen hellen Fleck in der Dunkelheit. Sie saßen auf einer Bank, auf der anderen Seite des Quais, gegenüber von den geschlossenen Buden der Bouquinisten. Sie waren soeben aus Dieppe eingetroffen. Sie hatten an die Zimmertür geklopft, doch es antwortete niemand. Und kurz zuvor hatte ich das Hotel mit dem Schlüssel in der Tasche verlassen.
Mein Fenster im Hôtel de Lima ging auf den Boulevard Saint-Germain und den oberen Teil der Rue des Bernardins. Wenn ich auf dem Bett lag, sah ich den Glockenturm einer Kirche, deren Namen ich vergessen habe, sich im Rahmen dieses Fensters abzeichnen. Und während der Nacht, nachdem der Straßenlärm verstummt war, hörte man den Stundenschlag. Jacqueline und Van Bever begleiteten mich oft heim. Wir hatten in einem chinesischen Restaurant zu Abend gegessen. Wir waren in einer Kinovorstellung gewesen.
An solchen Abenden unterschied uns nichts von den Studenten, denen wir auf dem Boulevard Saint-Michel begegneten. Van Bevers etwas abgetragener Mantel und Jacquelines Lederjacke verschmolzen mit der trostlosen Szenerie des Quartier Latin. Ich trug einen alten Regenmantel, dessen Beige schmutzig geworden war, und hatte Bücher in der Hand. Nein, ich weiß wirklich nicht, was die Aufmerksamkeit auf uns hätte lenken sollen.
Auf den Meldezettel im Hôtel de Lima hatte ich geschrieben, ich sei »Student der Geisteswissenschaften«, aber das war eine reine Formalität, denn der Mann an der Rezeption hatte niemals irgendeinen Nachweis von mir verlangt. Es genügte ihm, daß ich jede Woche mein Zimmer bezahlte. Als ich eines Tages mit einer Tasche voller Bücher wegging, weil ich versuchen wollte, sie einem mir bekannten Antiquar zu verkaufen, hatte er zu mir gesagt:
»Na, wie geht’s denn so mit dem Studieren?«
Zunächst hatte ich geglaubt, eine gewisse Ironie aus seiner Stimme herauszuhören. Doch er meinte es ganz ernst.
Das Hôtel de la Tournelle bot dieselbe Ruhe wie das Hôtel de Lima. Van Bever und Jacqueline waren die einzigen Gäste. Sie hatten mir erklärt, das Hotel würde bald zumachen und solle zu Wohnungen umgebaut werden. Tagsüber waren aus den Nachbarzimmern auch Hammerschläge zu hören.
Hatten sie einen Meldezettel ausgefüllt, und was waren sie von Beruf? Van Bever antwortete mir, in seinen Papieren stünde »Hausierer«, aber ich wußte nicht, ob er scherzte. Jacqueline zuckte mit den Schultern. Sie hatte keinen Beruf. Hausierer: Im Grunde genommen hätte auch ich diese Bezeichnung in Anspruch nehmen können, denn ich verbrachte meine Zeit damit, Bücher von einer Buchhandlung in die andere zu tragen.
Es war kalt. Der Schneematsch auf den Bürgersteigen und den Quais, die schwarzgrauen Farbschattierungen des Winters kommen mir wieder in den Sinn. Und Jacqueline war immer in ihrer für diese Jahreszeit zu leichten Lederjacke unterwegs.
An genau so einem Wintertag fuhr Van Bever zum ersten Mal allein nach Forges-les-Eaux, und Jacqueline blieb in Paris zurück. Wir überquerten die Seine, um Van Bever bis zur Metrostation Pont-Marie zu begleiten, denn er sollte seinen Zug an der Gare Saint-Lazare nehmen. Er sagte, daß er vielleicht auch das Kasino von Dieppe aufsuchen werde und mehr Geld als gewöhnlich verdienen wolle. Sein Fischgrätenmantel ist im Metroeingang verschwunden, und plötzlich standen wir alleine da, Jacqueline und ich.
Ich hatte sie immer zusammen mit Van Bever gesehen, ohne daß sich die Gelegenheit ergab, wirklich mit ihr zu sprechen. Im übrigen kam es vor, daß sie einen ganzen Abend lang kein einziges Wort sagte. Oder mitunter bat sie Van Bever auch in barschem Ton, ihr Zigaretten holen zu gehen, so als wolle sie ihn loswerden. Und mich auch. Doch mit der Zeit hatte ich mich an ihr Schweigen und ihr unwirsches Wesen gewöhnt.
An jenem Tag, als Van Bever die Stufen zur Metro hinunterstieg, dachte ich, daß sie es bereute, nicht wie üblich mit ihm weggefahren zu sein. Wir folgten dem Quai de l’Hôtel-de-Ville, anstatt ans linke Ufer zurückzukehren. Sie sprach nicht. Ich rechnete damit, daß sie sich jeden Augenblick von mir verabschieden würde. Doch nein. Sie ging weiter neben mir her.
Nebel hing über der Seine und den Quais. Jacqueline mußte es in dieser dünnen Lederjacke eiskalt sein. Wir liefen am Square de l’Archevêché entlang, an der Spitze der Ile de la Cité, und sie wurde von einem Hustenanfall gepackt. Schließlich bekam sie wieder Luft. Ich sagte, sie müsse etwas Warmes trinken, und wir sind in das Café in der Rue Dante gegangen.
Es herrschte der gewohnte spätnachmittägliche Lärm. Zwei Gestalten standen am Flipper, aber Jacqueline hatte zum Spielen keine Lust. Ich bestellte ihr einen Grog, den sie mit einer Grimasse getrunken hat, als würde sie Gift schlucken. Ich sagte: »Sie sollten nicht mit dieser Jacke hinausgehen.« Seit wir uns kannten, schaffte ich es nicht, sie zu duzen, denn sie hielt mich irgendwie auf Distanz.
Wir saßen an einem Tisch ganz hinten, gleich neben dem Flipperautomaten. Sie beugte sich zu mir und sagte, daß sie Van Bever nicht begleitet habe, weil sie sich nicht besonders wohl fühle. Sie sprach ziemlich leise, und ich mußte mein Gesicht ganz nah an ihres halten. Wir berührten uns beinahe mit der Stirn. Sie hat mir etwas anvertraut: Sobald der Winter vorüber sei, hoffe sie, Paris zu verlassen. Um wohin zu gehen?
»Nach Mallorca ...«
Ich erinnerte mich an den Brief, den sie am Tag unserer ersten Begegnung eingeworfen hatte und auf dessen Umschlag »Mallorca« stand.
»Aber es wäre besser, wenn wir schon morgen aufbrechen könnten ...«
Sie war auf einmal sehr blaß. Einer unserer Nachbarn hatte sich mit dem Ellbogen auf den Rand unseres Tisches gestützt, so als würde er uns nicht sehen, und setzte das Gespräch mit seinem Gegenüber fort. Jacqueline hatte sich an das äußerste Ende der Sitzbank geflüchtet. Das Tacken des Flippers wirkte beklemmend auf mich.
Auch ich träumte davon fortzugehen, sobald der Schnee auf den Bürgersteigen geschmolzen war und ich meine alten Mokassins wieder anhatte.
»Warum eigentlich bis zum Ende des Winters warten?« habe ich sie gefragt.
Sie hat mich angelächelt.
»Weil wir erst einmal Geld zusammensparen müssen.«
Sie hat sich eine Zigarette angezündet, gehustet. Sie rauchte zuviel. Und immer die gleichen Zigaretten mit dem leicht schalen Geruch von hellem französischem Tabak.
»Durch den Verkauf Ihrer Bücher werden wir uns kein Geld zusammensparen können.«
Ich war glücklich darüber, daß sie »wir« gesagt hatte, so als wären wir, sie und ich, von nun an für die Zukunft miteinander verbunden.
»Gérard wird bestimmt eine Menge Geld aus Forges-les-Eaux und Dieppe heimbringen«, sagte ich zu ihr.
Sie hat mit den Schultern gezuckt.
»Wir spielen nun schon seit sechs Monaten nach seinem System, aber das wirft nicht viel ab.«
Dieses System »um die neutrale Fünf« schien sie nicht zu überzeugen.
»Kennen Sie Gérard schon lange?«
»Ja ... Wir haben uns in Athis-Mons kennengelernt, in der Banlieue von Paris ...«
Sie blickte mir gerade in die Augen, schweigend. Wahrscheinlich wollte sie mir klarmachen, daß es über dieses Thema nicht mehr zu sagen gab.
»Sie kommen also aus Athis-Mons?«
»Ja.«
Ich erinnerte mich gut an den Namen dieser Stadt, in der Nähe von Ablon, wo einer meiner Freunde wohnte. Er lieh sich das Auto seiner Eltern, und am Abend nahm er mich mit nach Orly. Wir besuchten regelmäßig das Kino und eine der Bars im Flughafen. Wir blieben bis spät in die Nacht, lauschten den Durchsagen über Ankunft und Abflug der Flugzeuge zu ihren fernen Bestimmungsorten, und wir schlenderten durch die große Halle. Wenn er mich dann nach Paris zurückfuhr, nahmen wir nicht die Autobahn, sondern machten einen Umweg über Villeneuve-le-Roi, Athis-Mons, andere kleine Städte der südlichen Banlieue ... Damals hätte ich Jacqueline über den Weg laufen können.
»Sind Sie viel gereist?«
Das war eine jener Fragen, die eine seichte Unterhaltung wieder in Schwung bringen sollen, und ich hatte sie mit gespielter Gleichgültigkeit ausgesprochen.
»Nicht wirklich gereist«, sagte sie. »Aber jetzt, wenn wir ein bißchen Geld zusammenkriegen ...«
Sie sprach noch leiser, als wolle sie mir ein Geheimnis anvertrauen. Und es war schwer, sie zu verstehen, wegen all dem Krach um uns herum. Ich beugte mich zu ihr, wieder berührten wir uns beinahe mit der Stirn.
»Gérard und ich, wir haben einen Amerikaner kennengelernt, der Romane schreibt ... Er lebt auf Mallorca ... Er wird dort ein Haus für uns finden ... Ein Typ, den wir in der englischen Buchhandlung am Quai getroffen haben.«