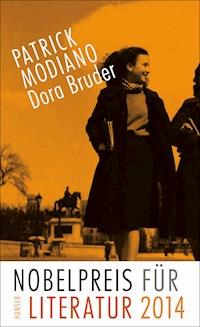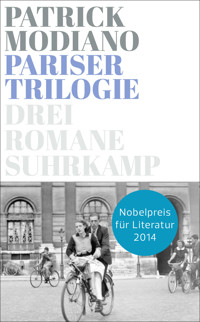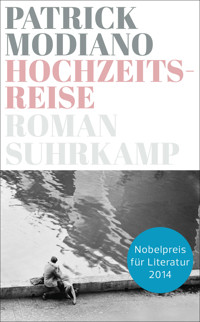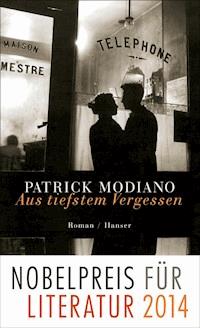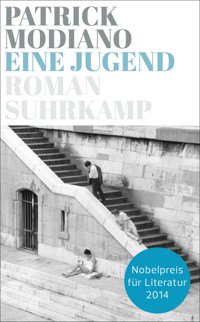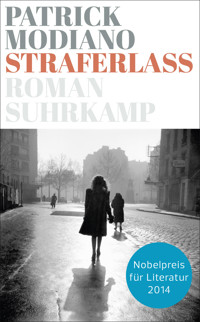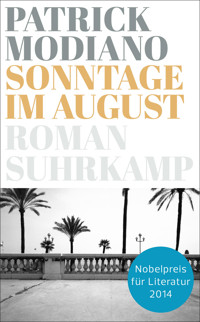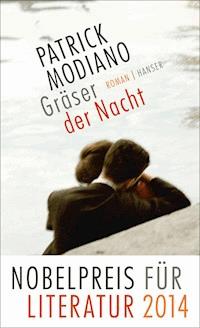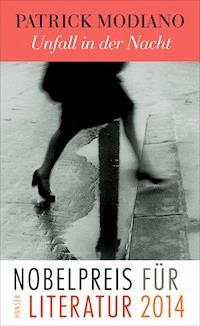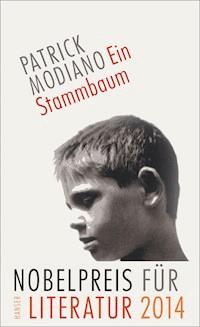Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, drei Schicksale. Modiano verleiht ihnen eine wunderbar melodische Stimme, und die drei Unbekannten erzählen von der gescheiterten und der unglücklichen Liebe. Jung sind sie, einsam und verletzlich, ohne festen Wohnsitz oder gesicherte Identität - eine leichte Beute für ihre Verführer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Patrick Modiano
Unbekannte Frauen
Aus dem Französischen vonElisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel
Des Inconnues bei Gallimard in Paris.
Wir danken dem französischen Außenministerium, vertreten durch die Französische Botschaft in Berlin, für die Förderung der Übersetzung.
ISBN 978-3-446-24883-0
© Editions Gallimard, 1999
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 2002/2014
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München unter der Verwendung einer Fotografie von Robert Doisneau/ 14.Juli, Rue des Nantes, Paris, 1955
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
1
In jenem Jahr ist der Herbst früher gekommen als gewöhnlich, mit Regen, dürren Blättern und Nebel über den Quais der Saône. Ich wohnte noch bei meinen Eltern, im unteren Teil des Fourvière-Hügels. Ich mußte dringend Arbeit finden. Im Januar war ich für sechs Monate in der Société de Rayonne et Soierie, an der Place Croix-Paquet, als Schreibkraft eingestellt worden, und ich hatte meinen ganzen Lohn gespart. Ich war in die Ferien gefahren nach Torremolinos, im Süden Spaniens. Ich war achtzehn und verließ zum ersten Mal in meinem Leben Frankreich.
Am Strand von Torremolinos hatte ich eine Frau kennengelernt, eine Französin, die seit mehreren Jahren mit ihrem Mann hier lebte und Mireille Maximoff hieß. Eine sehr hübsche Brünette. Sie und ihr Mann führten ein kleines Hotel, in dem ich ein Zimmer gemietet hatte. Sie hatte mir erklärt, im kommenden Herbst würde sie für längere Zeit in Paris sein und bei Freunden wohnen, deren Adresse sie mir gab. Ich hatte ihr versprochen, sie in Paris zu besuchen, sobald sich eine Gelegenheit bot.
Nach meiner Rückkehr ist mir Lyon furchtbar düster vorgekommen. Ganz in der Nähe unseres Hauses, rechts, in der Montée Saint-Barthélemy, war das Internat der Lazaristen. Gebäude, die an den Hang des Hügels gebaut waren und deren trostlose Fassaden über der Straße aufragten. Das Portal war in eine hohe Mauer gebrochen. Lyon, damals im September, das ist für mich die Mauer der Lazaristen. Eine schwarze Mauer, auf die manchmal die Strahlen der Herbstsonne fielen. Dann wirkte dieses Internat vollkommen verlassen. Aber im Regen war die Mauer eine Gefängnismauer, und ich hatte das Gefühl, daß sie mir die Zukunft versperrte.
Durch eine Kundin aus dem Laden meiner Eltern erfuhr ich, daß ein Modesalon Mannequins suchte. Sie meinte, man bekäme achthundert Franc im Monat dafür, zweihundert Franc mehr als in der Société de Rayonne et Soierie. Sie gab mir die Adresse, und ich beschloß, mich vorzustellen. Am Telephon sagte mir eine Frau mit autoritärer Stimme, ich solle an einem späten Nachmittag der nächsten Woche in die Rue Grolée Nummer 4 kommen.
In den folgenden Tagen redete ich mir schließlich ein, daß ich unbedingt Mannequin werden müßte, obwohl ich vorher nie an so etwas gedacht hatte. Auf diese Weise hätte ich vielleicht einen guten Grund, Lyon zu verlassen und nach Paris zu gehen. Je näher die Verabredung rückte, desto ängstlicher wurde ich. Es würde um mein Leben gehen, Kopf oder Zahl. Ich sagte mir, wenn sie mich nicht einstellen, wird sich nie wieder eine solche Gelegenheit bieten. Hatte ich wenigstens eine kleine Chance? Wie sollte ich mich für diese Prüfung anziehen? Ich hatte keine Wahl. Meine einzigen etwas eleganteren Kleidungsstücke waren ein grauer Rock und eine weiße Bluse. Ich habe mir dunkelblaue Schuhe mit einem kleinen Absatz gekauft.
Am Vorabend habe ich in meinem Zimmer den grauen Rock, die weiße Bluse, die dunkelblauen Schuhe angezogen, dann stand ich aufrecht, reglos vor dem Schrankspiegel und fragte mich, ob dieses Mädchen tatsächlich ich war. Darüber mußte ich lächeln, aber das Lächeln erstarrte bei dem Gedanken, daß morgen jemand über mein Leben entscheiden würde.
Ich hatte Angst, ich könnte zu spät zu der Verabredung kommen, und ging deshalb schon eine Stunde vorher aus dem Haus. Als ich die Place Bellecour erreichte, regnete es, und da bin ich in die Eingangshalle des Hôtel Royal geflüchtet. Ich wollte nicht mit nassen Haaren in dem Modesalon vorsprechen. Ich habe dem Hotelportier erklärt, ich sei hier Gast, und da hat er mir einen Schirm geliehen. In der Rue Grolée Nummer 4 ließ man mich warten, in einem großen Raum mit grauer Holztäfelung und Fenstertüren, vor denen Seidenvorhänge in derselben Farbe hingen. Eine Reihe von Stühlen stand an der Wand, Stühle aus vergoldetem Holz und mit roter Samtpolsterung. Nach einer halben Stunde sagte ich mir, daß sie mich wohl vergessen hatten.
Ich hatte mich auf einen der Stühle gesetzt und hörte, wie der Regen fiel. Der Lüster strahlte ein weißes Licht aus. Ich fragte mich, ob ich noch länger bleiben sollte.
Ein Mann ist hereingekommen, ungefähr fünfzig, die dunklen Haare nach hinten gekämmt, mit einem kleinen Schnurrbart und Habichtsaugen. Er trug einen marineblauen Anzug und dunkle Wildlederschuhe. Manchmal stößt er in meinen Träumen die Tür auf, kommt herein, und auch nach dreißig Jahren sind seine Haare immer noch gleich schwarz.
Er bat mich sitzenzubleiben und nahm neben mir Platz. Mit schroffer Stimme fragte er nach meinem Alter. Ob ich schon als Mannequin gearbeitet hätte? Nein. Er forderte mich auf, die Schuhe auszuziehen, zu den Fenstern hinüberzugehen und wieder zu ihm zurück. Ich ging los und fühlte mich dabei sehr befangen. Er saß vorgebeugt auf seinem Stuhl, das Kinn in die Hand gestützt, mit sorgenvoller Miene. Nach dem Hin- und Hergehen blieb ich vor ihm stehen, ohne daß er etwas sagte. Um mir meine Verlegenheit nicht anmerken zu lassen, fixierte ich meine Schuhe unter dem leeren Stuhl.
»Setzen Sie sich«, sagte er.
Ich habe mich wieder auf meinen Platz gesetzt, auf den Stuhl neben ihm. Ich wußte nicht, ob ich meine Schuhe wieder anziehen durfte.
»Ist das Ihre natürliche Farbe?« hat er mich gefragt und auf meine Haare gezeigt.
Ich bejahte.
»Ich möchte Sie gern im Profil sehen.«
Ich habe den Kopf zu den Fenstern gedreht.
»Sie haben ein ganz hübsches Profil …«
Das hatte er gesagt, als müsse er mir eine schlechte Nachricht verkünden.
»Hübsche Profile sind etwas so Seltenes.«
Der Gedanke, daß es auf der Welt nicht genug hübsche Profile gab, schien ihn zu verstimmen. Er starrte mich mit seinen Habichtsaugen an.
»Für Photos wäre das sehr gut, aber Sie entsprechen nicht dem, was Monsieur Pierre sucht.«
Ich verkrampfte mich. Hatte ich noch eine winzige Chance? Vielleicht würde er diesen Monsieur Pierre, der wahrscheinlich sein Chef war, um seine Meinung bitten. Was genau suchte er? Ich war fest entschlossen, mich allem zu fügen, was Monsieur Pierre wollte.
»Es tut mir leid … Wir können Sie nicht einstellen.«
Das Urteil war gefallen. Ich hatte nicht mehr die Kraft, irgend etwas zu sagen. Der schroffe und höfliche Ton dieses Mannes gab mir deutlich zu verstehen: Ich war es nicht einmal wert, daß Monsieur Pierre um seine Meinung gebeten wurde.
Ich habe meine Schuhe wieder angezogen. Ich bin aufgestanden. Er schüttelte mir die Hand, stumm, und begleitete mich bis zur Tür, die er eigenhändig öffnete, um mich hinaustreten zu lassen. Auf der Straße bemerkte ich, daß ich den Schirm vergessen hatte, aber das war nicht mehr wichtig. Ich überquerte die Brücke. Ich ging den Quai an der Saône entlang. Dann fand ich mich plötzlich in der Nähe unseres Hauses wieder, in der Montée Saint-Barthélemy, vor der Mauer der Lazaristen, wie so oft in meinen Träumen während der folgenden Jahre. Man hätte mich nicht unterscheiden können von dieser Mauer. Ihr Schatten hüllte mich ein, und ich nahm ihre Farbe an. Und niemand würde mich diesem Schatten jemals entreißen können. Im Gegensatz dazu war der Salon in der Rue Grolée, wo man mich hatte warten lassen, in das Licht des Lüsters getaucht, ein grelles Licht. Der Typ mit dem blauen Anzug und den Wildlederschuhen hörte nicht auf, rückwärts aus dem Zimmer zu gehen. Wie in einem alten Film, der langsam zurückgespult wird.
Immer derselbe Traum. Nach ein paar Jahren war die Mauer der Lazaristen weniger düster, und in manchen Nächten schimmerte auf ihr ein Strahl der untergehenden Sonne. Im Salon der Rue Grolée verströmte der Lüster ein sanftes Licht. Der blaue Anzug des Mannes mit den Habichtsaugen wirkte sehr blaß, ausgebleicht. Auch sein Gesicht war blaß geworden, seine Haut fast durchscheinend. Nur die Haare blieben schwarz. Seine Stimme klang heiser. Es war nicht mehr er, der sprach, sondern eine Platte, die sich drehte. Dieselben Worte wiederholten sich ewig weiter: »Ihre natürliche Farbe … Zeigen Sie mir bitte Ihr Profil … Sie entsprechen nicht dem, was Monsieur Pierre sucht«, und sie hatten ihren Sinn verloren. Beim Aufwachen wunderte ich mich jedesmal, daß diese inzwischen immer länger zurückliegende Episode aus meinem Leben mir eine so große Enttäuschung bereitet, mich so unglücklich gemacht hatte. Als ich an jenem Abend die Brücke überquerte, hatte ich sogar daran gedacht, mich in die Saône zu stürzen. Wegen so einer Lappalie.
Ich hatte nicht einmal mehr den Mut, nach Hause zu gehen, vor meine Eltern und vor den Schrankspiegel in meinem Zimmer zu treten. Ich bin die Treppen zur Altstadt hinuntergelaufen, als wäre ich auf der Flucht. Wieder ging ich den Quai am Ufer der Saône entlang. Ich betrat ein Café. Den Zettel, auf den Mireille Maximoff Adresse und Telephonnummer ihrer Freunde in Paris geschrieben hatte, trug ich immer bei mir. Ein Klingelzeichen folgte auf das andere, aber niemand hob ab, und plötzlich hörte ich eine Frauenstimme. Ich blieb stumm. Dann brachte ich doch mit einer tonlosen Stimme, die dort, in Paris, bestimmt niemand hören konnte, hervor: »Könnte ich mit Mireille Maximoff sprechen?« Sie war gerade außer Haus, ein wenig später, am Abend, würde sie jedoch wieder da sein.
Am nächsten Tag habe ich an der Gare de Perrache einen Nachtzug genommen. Das Abteil war in tiefe Dunkelheit getaucht. Schatten schliefen auf der Sitzbank, ganz hinten. Ich habe mich in die Nähe des Gangs gesetzt. Der Zug stand noch eine Weile auf dem Bahnsteig, und ich fragte mich, ob man mich fortlassen würde. Es kam mir vor, als würde ich ausreißen. Der Waggon fuhr an, ich sah die Saône langsam verschwinden, und ich fühlte mich von einer Last befreit. Ich glaube nicht, daß ich in jener Nacht geschlafen habe, höchstens ein wenig geschlummert, als der Zug, ohne daß klar wurde warum, in Dijon auf einem menschenleeren Bahnsteig hielt. Im bläulichen Schein des Nachtlichts dachte ich an Mireille Maximoff. Kein einziger Tag ohne Sonne, dort unten, am Strand von Torremolinos. Sie hatte mir erzählt, daß sie in meinem Alter in einer kleinen Stadt in den Landes wohnte, deren Namen ich vergessen habe. Am Abend vor dem Abitur war sie sehr spät zu Bett gegangen, und der Wecker hatte nicht geklingelt. Sie hatte bis Mittag geschlafen, anstatt ihr Abitur zu machen. Später hatte sie Eddy Maximoff kennengelernt, ihren Mann. Er war ein großer, gutaussehender Mann russischer Abstammung, der von allen »Der Konsul« genannt wurde und immer ein Gemisch aus Coca-Cola und Rum trank. Er wollte es auch mir zum Aperitif servieren, aber ich sagte ihm jedesmal, Coca-Cola allein wäre mir lieber. Er sprach akzentfrei Französisch. Er hatte in Paris gelebt, und ich vergaß, Mireille Maximoff zu fragen, welcher Zufall sie beide nach Spanien verschlagen hatte.
Ich bin sehr früh angekommen. In der Gare de Lyon war es noch dunkel. Übrigens habe ich den Eindruck, daß es in der ersten Zeit, die ich in Paris verbrachte, immer dunkel war. Ich hatte nur eine ganz leichte Reisetasche bei mir. Am Vormittag meiner Ankunft saß ich mit Mireille Maximoff in einem Café an der Place du Trocadéro. Ich hatte bis zehn in der Bahnhofsgaststätte gewartet, bevor ich sie anrief. Sie hatte nicht gleich verstanden, von wo ich telephonierte. Ich war als erste in dem Café. Ich fürchtete, sie könnte mich abweisend behandeln, wenn ich ihr gestand, daß ich nicht wußte, wo ich wohnen sollte. Sie kam mit einem Lächeln auf mich zu, so als würden wir uns am Strand treffen. Man hätte meinen können, wir wären erst am Abend zuvor auseinandergegangen. Sie schien froh, mich zu sehen, und stellte mir Fragen. Ich habe ihr alles erzählt: das Vorstellungsgespräch im Modesalon, die schroffe Stimme des Typen mit den Habichtsaugen, die ich in der vergangenen Nacht, hinter Dijon, im Halbschlaf immer noch hörte: »Ist das Ihre natürliche Farbe? Zeigen Sie mir bitte Ihr Profil …«
Und da bin ich vor ihr in Tränen ausgebrochen. Sie hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, das sei doch alles nicht so wichtig. Das erinnere sie an das Abitur, das sie mit siebzehn Jahren versäumt habe, weil der Wecker an dem Morgen nicht geklingelt hatte. Sie wollte mich gern in der Wohnung ihrer Freunde unterbringen.
Wir überquerten den Platz, und meine Reisetasche war wirklich nicht schwer. Es regnete wie in Lyon, aber auch der Regen kam mir leicht vor. Das Haus lag am Ende der Rue Vineuse. In den ersten Tagen trug ich den Zettel, auf dem Adresse und Telephonnummer standen, immer bei mir, falls ich mich in Paris verlaufen würde. Eine Wohnung mit hellen Wänden. Im Salon standen fast keine Möbel. Sie hat die Tür zu einem kleinen Zimmer aufgemacht, in dem eine ganze Wand mit Bücherregalen bedeckt war. Gegenüber ein mit grauem Samt bezogenes Kanapee. Kein Spiegelschrank. Das Fenster ging auf einen Hof. Sie wollte Bettwäsche holen, aber ich sagte ihr, das sei im Augenblick nicht nötig. Sie hat die Vorhänge zugezogen. Ich hatte meine Tasche neben das Kanapee gestellt, ohne sie zu öffnen. Ich bin sehr schnell eingeschlafen. Ich hörte, wie im Hof der Regen fiel, und das lullte mich ein. Von Zeit zu Zeit wachte ich auf, und jedesmal glitt ich langsam in den Schlaf zurück. Ich ging wieder die Montée Saint-Barthélemy hinauf und wunderte mich, daß die Mauer der Lazaristen auf der rechten Seite verschwunden war. Da war nur noch eine Leere und dahinter die Place du Trocadéro. Es regnete, aber der Himmel war sehr hell, blaßblau. In den folgenden Tagen nahm mich Mireille Maximoff mit auf ihren Wegen durch Paris. Wir überquerten die Seine und gingen nach Saint-Germain-des-Prés. Sie traf sich mit Freunden im Nuage, im Malène. Ich saß neben ihnen und traute mich nicht, den Mund aufzumachen. Ich hörte ihnen zu. Manchmal kam sie erst gegen sieben Uhr abends in die Wohnung zurück, und ich blieb den ganzen Nachmittag allein. Ich spazierte bis zum Bois de Boulogne. Die Sonne schien oft. Ein feiner Regen fiel, ohne daß ich es gleich bemerkte. Dann wieder Sonne auf den rotgelben Blättern der Bäume und in den Alleen des Pré Catelan, die nach nasser Erde rochen. Wenn ich zurückkam, war es bereits dunkel. Eine vage Unruhe überfiel mich bei dem Gedanken an die Zukunft. Sie schien mir vollkommen verschlossen, als stünde ich noch immer vor der Mauer der Lazaristen. Ich verjagte meine schwarzen Gedanken. Sicher konnte man in dieser Stadt Bekanntschaften machen. In der Straße, die vom Bois de Boulogne zum Trocadéro führte, hob ich den Kopf und blickte zu den erleuchteten Fenstern empor. Jedes von ihnen schien mir ein Versprechen zu sein, ein Zeichen, daß alles möglich war. Trotz welker Blätter und Nebel war die Luft von elektrischer Spannung erfüllt. Ein seltsamer Herbst. Er ist in sich geschlossen und für immer losgelöst von meinem übrigen Leben. Da, wo ich jetzt bin, gibt es keinen Herbst mehr. Ein kleiner Mittelmeerhafen, wo die Zeit für mich stehengeblieben ist. Jeden Tag Sonne, bis zu meinem Tod. Die wenigen Male, die ich in den folgenden Jahren nach Paris zurückgekehrt bin, fiel es mir schwer zu glauben, daß es die Stadt war, in der ich jenen Herbst verbracht hatte. Damals war alles gewaltsamer, geheimnnisvoller, die Straßen, die Gesichter, das Licht, als träumte ich oder hätte ein Rauschmittel genommen. Oder ich war einfach zu jung und die Spannung zu stark für mich. Als ich an einem Abend in die Rue Vineuse zurückkam, begegnete mir im Treppenhaus ein dunkelhaariger Mann in einem Regenmantel. Ich hatte ihn schon zusammen mit den anderen gesehen, die wir in Saint-Germain-des-Prés trafen. Er hat mich wiedererkannt und gelächelt. Wahrscheinlich hatte er Mireille Maximoff nach Hause begleitet. Ich läutete. Es dauerte lange, bis sie mir aufmachte. Sie trug nur einen Bademantel aus rotem Frottee, und ihre Haare waren zerzaust. Im Salon brannte kein Licht. Sie erklärte mir, sie sei eingeschlafen. Ich habe mich nicht getraut, ihr zu sagen, daß ich im Treppenhaus diesem Mann begegnet war. Ein Anflug von Wehmut schimmerte in ihrem Blick, sie umfaßte meine Schultern und küßte mich. Sie fragte, was ich am Nachmittag getan hatte und wunderte sich, daß ich allein im Bois de Boulogne spazierenging.
»Du müßtest dir einen Liebsten suchen«, sagte sie. »Weißt du, es gibt nichts Besseres als die Liebe.«
Ich fand, daß sie recht hatte, aber ich traute mich nicht, ihr zu sagen, daß ich mir auch eine Arbeit suchen mußte. Ich wollte nicht nach Lyon zurück. Wir saßen nebeneinander auf dem Diwan im Salon, sie hatte die Lampe nicht angeknipst. Die Lichter des Gebäudes von gegenüber tauchten uns in ein Halbdunkel. Ihr Arm hielt meine Schultern umfangen, und der Gürtel ihres Bademantels hatte sich gelöst. Sie roch nach einem schweren Parfüm, vielleicht Nachthyazinthe. Ich hätte mich ihr gern anvertraut, aber ich blieb stumm. Niemand wußte, daß wir hier waren. Wir lebten auf betrügerische Weise. Sie war in diese Wohnung eingebrochen. Ich hatte Angst. Ich hätte Lyon nie verlassen dürfen. Ich fühlte mich unwohl in diesem leeren Salon. Die Wohnung war lange nicht benutzt worden, und Diebe hatten die Möbel weggeschleppt. Sie fragte mich, warum ich so besorgt aussähe. Und da habe ich versucht, die richtigen Worte zu finden. Es war sehr freundlich von ihr, mich hierher mitgenommen zu haben, aber ich hatte das Gefühl, ein Eindringling zu sein. Ich hatte mich schon in eine schwierige Lage gebracht, als ich so unüberlegt aus Lyon fortgegangen war, und ich wollte keine Last für sie werden. Würde sie die Wohnungseigentümer darüber informieren, daß sie mich hier aufgenommen hatte? Kannte sie sie wirklich? Um ganz offen zu sprechen, ich fragte mich manchmal, ob wir beide das Recht hatten, hier zu sein, und ich fürchtete, die Besitzer könnten überraschend zurückkommen und uns davonjagen. Sie hat schallend gelacht. Mit ihrer sanften Stimme, mit der Gelassenheit und Unbekümmertheit, um die ich sie beneidete, hat sie meine panische Angst zerstreut. Die Frau, die hier wohnte, sei eine alte Freundin. Eine etwas verrückte Person, die mit einem reichen Pelzhändler verheiratet gewesen sei. Und wenn ich es genau wissen wollte, auch sie, Mireille Maximoff, war eines Tages in Paris gelandet. Mit dem Zug aus Bordeaux. Damals war sie allein und nicht viel älter als ich jetzt. Sie hatte zunächst in einem Hotelzimmer gewohnt, im Quartier Latin, und sie war dieser Frau begegnet, als sie sich, auf eine kleine Annonce hin, für eine Stelle als Verkäuferin im Geschäft ihres Mannes vorgestellt hatte. Diese Frau hatte sie mit allen Leuten in Saint-Germain-des-Prés bekannt gemacht, auch mit ihrem zukünftigen Ehemann Eddy Maximoff. Sie nahm die beiden an den Wochenenden in ihrem amerikanischen Wagen mit nach Montfort-l’Amaury oder nach Deauville. Das war ein schönes Leben. Ich hätte wirklich keinen Grund, mir Sorgen zu machen. Diese Frau sei sehr froh, ihr die Wohnung leihen zu können. Da brachte ich genug Mut auf und sagte ihr, daß ich mir dennoch Sorgen um meine Zukunft machte. Was sollte ohne Arbeit in Paris aus mir werden? Eine Weile hat sie mich schweigend angesehen.
»Ich hatte auch Angst«, sagte sie, »als ich nach Paris gekommen bin. Aber die Dinge renken sich irgendwie ein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welches Glück du hast, daß diese Jahre noch vor dir liegen. Und außerdem werde ich dir helfen. Ich kenne Leute in Paris. Und du kannst jederzeit mit mir nach Spanien kommen.«