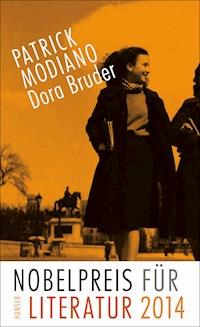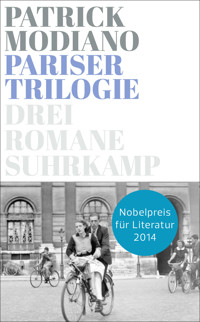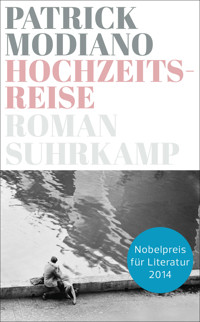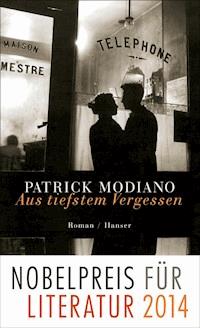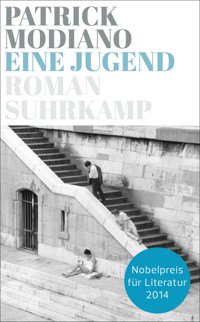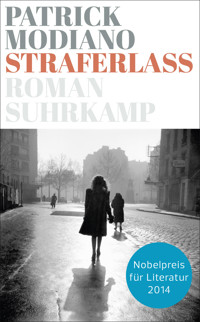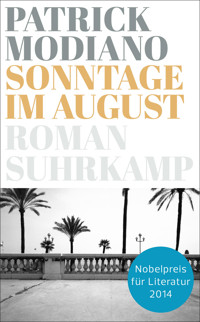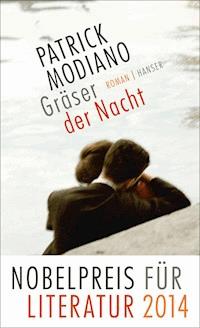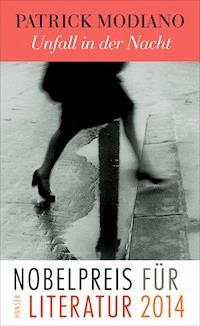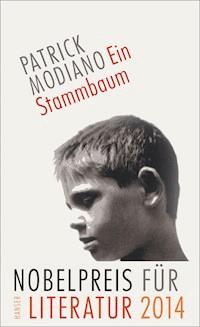Hanser eBook
Patrick Modiano
Im Café der verlorenen Jugend
Roman
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Dans le café de la jeunesse perduebei Gallimard in Paris.
ISBN 978-3-446-23964-7
© Éditions Gallimard Paris 2007
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2012
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Auf halbem Weg zum wahren Leben umgab uns eine düstere Melancholie, die aus soviel spöttischen Worten sprach, im Café der verlorenen Jugend.
Guy Debord
Von den beiden Eingängen des Cafés nahm sie immer den schmalen, der Schattentür genannt wurde. Sie setzte sich an denselben Tisch, hinten in dem kleinen Raum. In der ersten Zeit sprach sie mit keinem, dann knüpfte sie Bekanntschaft mit den Stammgästen des Condé, von denen die meisten in unserem Alter waren, ich würde sagen, so zwischen neunzehn und fünfundzwanzig. Manchmal setzte sie sich zu ihnen an den Tisch, meistens jedoch war sie ihrem Platz treu, ganz hinten.
Sie kam niemals zu einer bestimmten Zeit. Man konnte sie früh am Morgen hier antreffen. Oder sie tauchte gegen Mitternacht auf und blieb bis zur Sperrstunde. Es war das Café, das, neben dem Bouquet und der Pergola, in diesem Viertel am spätesten zumachte und dessen Gäste am merkwürdigsten waren. Ich frage mich nach all den Jahren, ob dieser Ort und diese Leute nicht erst durch ihre Anwesenheit so merkwürdig wurden, als hätte sie alle durchdrungen mit ihrem Duft.
Angenommen, man hätte Sie mit verbundenen Augen an diesen Ort gebracht, man hätte Sie an einen Tisch gesetzt, die Binde abgenommen und Ihnen ein paar Minuten Zeit gelassen, damit Sie die Frage beantworten: In welchem Viertel von Paris sind Sie? Es hätte genügt, dass Sie Ihre Tischnachbarn beobachten und deren Gesprächen lauschen, und vielleicht hätten Sie’s erraten: Im Umkreis des Carrefour de l’Odéon, und ich glaube, er ist immer noch gleich trostlos im Regen.
Ein Fotograf war eines Tages ins Condé gekommen. Nichts in seinem Äußeren unterschied ihn von den Gästen. Gleiches Alter, gleiche saloppe Kleidung. Er trug ein zu langes Jackett, eine Leinenhose und derbe Militärstiefel. Er hatte viele Aufnahmen gemacht von den Menschen, die im Condé verkehrten. Er war selber Stammgast geworden, und für die anderen war es, als knipse er Familienfotos. Viel später dann sind sie in einem Band über Paris erschienen, und als Bildunterschrift hatten sie einzig und allein die Vornamen der Gäste oder ihre Spitznamen. Und sie ist auf mehreren dieser Fotos zu sehen. Sie schien das Licht stärker einzufangen, wie man im Filmgeschäft sagt. Von all den Leuten nimmt man sie als erste wahr. Am Fuß der Seiten, in den Bildunterschriften, erscheint sie mit dem Vornamen »Louki«. »Von links nach rechts: Zacharias, Louki, Tarzan, Jean-Michel, Fred und Ali Cherif …« – »Im Vordergrund, am Tresen: Louki. Dahinter Annet, Don Carlos, Mireille, Adamov und Doktor Vala.« Sie sitzt sehr gerade da, während die anderen sich lässig geben, der erwähnte Fred zum Beispiel ist eingeschlafen, sein Kopf lehnt an der Moleskinbank, und ganz offensichtlich hat er sich schon tagelang nicht mehr rasiert. Etwas muss noch gesagt werden: Den Vornamen Louki erhielt sie ab dem Zeitpunkt, da sie regelmäßig im Condé auftauchte. Ich war zugegen, eines Abends, als sie gegen Mitternacht hereintrat und nur noch Tarzan, Fred, Zacharias und Mireille dasaßen, alle am selben Tisch. Tarzan hat gerufen: »Ah, da kommt Louki …« Im ersten Augenblick wirkte sie erschrocken, dann hat sie gelächelt. Zacharias ist aufgestanden, und im Tonfall gespielter Feierlichkeit: »Heute nacht taufe ich dich. Fortan sollst du Louki heißen.« Und als die Zeit verging und jeder sie Louki nannte, fühlte sie sich, wie mir schien, erleichtert, diesen neuen Vornamen zu tragen. Ja, erleichtert. Denn je länger ich darüber nachgrüble, desto mehr bestätigt sich mein anfänglicher Eindruck: Sie suchte Zuflucht, hier, im Condé, als wollte sie vor etwas fliehen, einer Gefahr entrinnen. Dieser Gedanke war mir gekommen, als ich sie allein gesehen hatte, ganz hinten, an diesem Ort, wo niemand sie bemerken konnte. Und auch wenn sie sich unter die anderen mischte, zog sie die Aufmerksamkeit nicht an. Sie war still und zurückhaltend und begnügte sich mit Zuhören. Und ich hatte mir sogar gesagt, um sich noch sicherer zu fühlen, waren ihr die lärmenden Gruppen lieber, die »Großmäuler«, sonst hätte sie nicht immer am Tisch von Zacharias gesessen, von Jean-Michel, Fred, Tarzan und La Houpa … In dieser Gesellschaft konnte sie mit der Einrichtung verschmelzen, sie war nur mehr eine anonyme Statistin, eine von jenen, die in Bildunterschriften »unbekannt« oder noch einfacher »X« heißen. Ja, während der ersten Zeit im Condé habe ich sie nie mit irgendwem in persönlichem Gespräch gesehen. Und im Grunde genommen machte es nichts aus, dass eines der Großmäuler sie lauthals Louki rief, es war ja nicht ihr richtiger Name.
Und doch entdeckte man bei genauerem Hinsehen gewisse Besonderheiten, die sie von den anderen unterschieden. Sie verwandte auf ihre Kleidung eine bei den Gästen des Condé ungewöhnliche Sorgfalt. Eines Abends hatte sie sich am Tisch von Tarzan, Ali Cherif und La Houpa eine Zigarette angesteckt, und mir waren ihre schlanken Hände aufgefallen. Und vor allem: ihre Fingernägel glänzten. Sie trug farblosen Lack. Dieses Detail mag nichtig erscheinen. Ich will also etwas ernsthafter werden. Dazu muss ich die Stammgäste des Condé genauer beschreiben. Sie waren zwischen neunzehn und fünfundzwanzig, mit Ausnahme von ein paar Gästen wie Babilée, Adamov oder Doktor Vala, die allmählich auf die Fünfzig zugingen, doch ihr Alter vergaß man leicht. Babilée, Adamov und Doktor Vala waren ihrer Jugend treu und dem, was man mit einem melodiösen und altmodischen schönen Namen als »Boheme« bezeichnen könnte. Ich suche im Wörterbuch nach »Bohemien«: Person, die ein unstetes Leben führt, ohne Regeln, ohne Sorge ums Morgen. Das ist eine Definition, die auf die Besucher und Besucherinnen des Condé genau passte. Manche, wie Tarzan, Jean-Michel und Fred, behaupteten, sie hätten seit ihrer frühen Jugend häufig mit der Polizei zu tun gehabt, und La Houpa war mit sechzehn aus der Besserungsanstalt Bon-Pasteur entwichen. Doch man war am linken Seineufer, und die meisten von ihnen lebten im Schatten der Literatur und der Kunst. Ich selber studierte. Das getraute ich mich aber nicht zu sagen, und ich gehörte nicht wirklich zu ihrer Gruppe.
Ich hatte gespürt, dass sie anders war als die übrigen. Woher kam sie, bevor man ihr diesen Namen gab? Oft hatten die Stammgäste des Condé ein Buch in der Hand, das sie achtlos auf den Tisch legten und dessen Einband fleckig war von Wein. Die Gesänge des Maldoror. Illuminationen. Die geheimnisvollen Barrikaden. Ihre Hände jedoch waren in der Anfangszeit stets leer. Dann wollte sie es wahrscheinlich den andern gleichtun, und eines Tages überraschte ich sie im Condé allein und lesend. Von da an kam sie nie ohne ihr Buch. Sie legte es gut sichtbar auf den Tisch, wenn sie sich in Gesellschaft von Adamov und den anderen befand, als wäre dieses Buch ihr Reisepass oder eine Aufenthaltsgenehmigung, die ihre Anwesenheit hier neben ihnen legitimierte. Doch niemand schenkte ihm Beachtung, weder Adamov noch Babilée, noch Tarzan, noch La Houpa. Es war ein Taschenbuch mit schmuddeligem Einband, eines von denen, die man billig auf den Quais erwirbt, und es trug einen Titel in fetten roten Buchstaben: Der verlorene Horizont. Damals sagte mir das nichts. Ich hätte sie nach dem Inhalt des Buches fragen sollen, aber ich hatte mir dummerweise gesagt, dass Der verlorene Horizont für sie nichts war als ein Accessoire und dass sie vorgab zu lesen, um sich den Gästen des Condé anzugleichen. Diese Gäste, ein Passant, der von draußen einen flüchtigen Blick auf sie geworfen hätte – und für einen Moment sogar die Stirn an die Fensterscheibe gepresst –, mochte sie einfach nur für Studenten halten. Doch er hätte rasch seine Meinung geändert angesichts der Alkoholmengen, die am Tisch von Tarzan, Mireille, Fred und La Houpa getrunken wurden. In den friedlichen Cafés des Quartier Latin hätte man nie so viel getrunken. Sicher, in den flauen Stunden am Nachmittag konnte einen das Condé leicht täuschen. Doch sobald der Tag weiter voranschritt, wurde es zum Treffpunkt dessen, was ein rührseliger Philosoph »die verlorene Jugend« nannte. Warum dieses Café und nicht irgendein anderes? Wegen der Wirtin, einer Madame Chadly, die sich über nichts zu wundern schien und ihren Gästen gegenüber sogar eine gewisse Nachsicht bekundete. Viele Jahre später, als in den Straßen des Viertels nur noch Schaufenster von Luxusläden zu sehen waren und ein Lederwarengeschäft Le Condé verdrängt hatte, bin ich Madame Chadly am anderen Seineufer begegnet, in der ansteigenden Rue Blanche. Sie hat mich nicht gleich wiedererkannt. Wir sind eine ganze Weile nebeneinander hergegangen und haben über das Condé gesprochen. Ihr Mann, ein Algerier, hatte das Lokal nach dem Krieg gekauft. Sie erinnerte sich an alle unsere Vornamen. Sie fragte sich oft, was aus uns geworden war, aber sie machte sich keine Illusionen. Sie hatte von Anfang an gewusst, dass es mit uns ein ganz böses Ende nehmen würde. Streunende Hunde, hat sie gesagt. Und als wir uns vor der Apotheke auf der Place Blanche verabschiedeten, meinte sie noch, und dabei sah sie mir fest in die Augen: »Am allerliebsten mochte ich Louki.«
Wenn sie mit Tarzan, Fred und La Houpa an einem Tisch saß, trank sie dann genausoviel, oder tat sie nur so, um die anderen nicht zu verstimmen? Jedenfalls konnte sie mit sehr geradem Oberkörper, mit langsamen, anmutigen Bewegungen und einem kaum merklichen Lächeln dem Alkohol verdammt gut standhalten. Am Tresen ist es leichter zu mogeln. Man nutzt die kurze Unachtsamkeit der betrunkenen Freunde und kippt sein Glas ins Spülbecken. Aber hier, an einem der Tische des Condé, war es viel schwieriger. Sie zwangen einen, bei ihren Besäufnissen mitzumachen. In dieser Hinsicht waren sie äußerst empfindlich und betrachteten einen schnell als ihrer Gruppe unwürdig, begleitete man sie nicht bis zum Schluss auf ihren sogenannten »Reisen«. Was andere Rauschgifte betraf, so hatte ich zu verstehen geglaubt, ohne mir dessen ganz sicher zu sein, dass Louki zusammen mit gewissen Gruppenmitgliedern etwas nahm. Und doch verriet nichts in ihrem Blick oder ihrem Verhalten, dass sie künstliche Paradiese aufsuchte.
Ich habe mich oft gefragt, ob irgendein Bekannter ihr vom Condé erzählt hatte, bevor sie es zum ersten Mal betrat. Oder ob sich jemand mit ihr in diesem Café verabredet hatte und nicht gekommen war. In diesem Fall hätte sie Tag für Tag, Abend für Abend Stellung an ihrem Tisch bezogen, in der Hoffnung, ihn an diesem Ort wiederzufinden, dem einzigen Bezugspunkt zwischen ihr und dem Unbekannten. Keine andere Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Weder Adresse noch Telefonnummer. Bloß ein Vorname. Aber vielleicht war sie auch zufällig hier gestrandet, so wie ich. Sie war gerade im Viertel und wollte Schutz suchen vor dem Regen. Ich habe immer geglaubt, dass manche Orte Magnete sind und dass man angezogen wird, sobald man in ihre Nähe kommt. Und zwar auf unmerkliche Weise, ohne dass man etwas ahnt. Eine abschüssige Straße kann schon genügen, ein sonniges Trottoir oder ebensogut ein Trottoir im Schatten. Oder ein Regenschauer. Und das führt einen dann genau zu dem Punkt, wo man stranden musste. Mir scheint, das Condé besaß dank seiner Lage diese magnetische Kraft, und hätte man eine Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt, wäre meine Vermutung bestätigt worden: In einem ziemlich weiten Umkreis musste man zwangsläufig zu ihm abdriften. Davon kann ich ein Lied singen.
Ein Mitglied der Gruppe, Bowing, von uns allen »Capitaine« genannt, hatte mit einem Unternehmen begonnen, das die anderen guthießen. Seit fast drei Jahren notierte er die Namen der Gäste des Condé, und zwar in der Reihenfolge ihres Eintreffens, jeweils mit Datum und genauer Uhrzeit. Er hatte zwei Freunde mit derselben Aufgabe betraut, im Bouquet und in der Pergola, welche die ganze Nacht hindurch geöffnet blieben. Leider wollten die Gäste in diesen beiden Cafés nicht immer ihre Namen sagen. Im Grunde versuchte Bowing nur, all die Schmetterlinge, die für ein paar Augenblicke um eine Lampe schwirren, vor dem Vergessen zu bewahren. Er träume, sagte er, von einem riesigen Register, in dem die Namen der Gäste aller Pariser Cafés seit hundert Jahren verzeichnet wären, samt Angabe ihres Eintreffens und ihres Weggehens. Er war besessen von etwas, das er »Fixpunkte« nannte.
In dieser ununterbrochenen Flut von Frauen, Männern, Kindern, Hunden, die vorüberziehen und sich irgendwo in den Straßen verlieren, würde man gerne von Zeit zu Zeit ein Gesicht festhalten. Ja, wie Bowing meinte, inmitten dieses Malstroms der Großstädte musste man ein paar Fixpunkte finden. Bevor er ins Ausland gegangen war, hatte er mir das Heft anvertraut, in das Tag für Tag, über drei Jahre hinweg, die Gäste des Condé eingetragen sind. Sie erscheint darin nur unter ihrem falschen Vornamen, Louki, und erwähnt wird sie zum ersten Mal an einem 23. Januar. Der Winter in jenem Jahr war besonders hart, und manche von uns verließen das Condé den ganzen Tag nicht, um sich vor der Kälte zu schützen. Der Capitaine notierte auch unsere Adressen, sodass man sich den üblichen Weg ausmalen konnte, der jeden von uns bis zum Condé führte. Auch das war für Bowing ein Mittel, Fixpunkte zu schaffen. Er vermerkt ihre Adresse nicht sofort. Erst an einem 18. März lesen wir: »14 Uhr. Louki, Rue Fermat Nr. 16, 14. Arrondissement.« Doch am 5. September desselben Jahres hat ihre Adresse sich geändert: »23 Uhr 40. Louki, Rue Cels Nr. 8, 14. Arrondissement.« Ich vermute, Bowing zeichnete unsere Wege bis zum Condé auf große Pariser Stadtpläne und gebrauchte dafür verschiedenfarbige Kugelschreiber. Vielleicht wollte er wissen, ob Aussicht bestand, dass wir einander begegneten, noch bevor wir ans Ziel kamen.
Ja, ich erinnere mich, Louki eines Tages getroffen zu haben, in einem Viertel, das ich nicht kannte und wo ich einen entfernten Cousin meiner Eltern besucht hatte. Ich trat aus dem Haus und ging in Richtung Metrostation Porte-Maillot, und da sind wir uns begegnet, ganz am Ende der Avenue de la Grande-Armée. Ich habe sie angestarrt, und auch sie hat mich mit einem ängstlichen Blick gemustert, als hätte ich sie in einer peinlichen Lage ertappt. Ich habe ihr die Hand hingestreckt: »Wir haben uns schon mal im Condé gesehen«, sagte ich, und dieses Café lag für mich plötzlich wie am anderen Ende der Welt. Sie hat verlegen gelächelt: »Ja, sicher … im Condé …« Das muss kurz nach ihrem ersten Auftauchen gewesen sein. Sie hatte sich noch nicht unter die anderen gemischt, und Zacharias hatte sie noch nicht Louki getauft. »Komisches Café, hm, Le Condé …« Sie nickte zustimmend. Wir sind noch ein Stückchen zusammen weitergeschlendert, und sie hat gesagt, sie wohne hier in der Gegend, möge dieses Viertel aber kein bisschen. Wie dumm, an diesem Tag hätte ich ihren richtigen Vornamen erfahren können. Dann haben wir uns an der Porte Maillot verabschiedet, vor dem Metroeingang, und ich habe ihr nachgeschaut, wie sie fortging in Richtung Neuilly und Bois de Boulogne, mit immer langsameren Schritten, als wollte sie noch irgendwem Gelegenheit geben, sie aufzuhalten. Ich dachte, sie würde nicht mehr ins Condé kommen und ich würde nie wieder von ihr hören. Sie würde verschwinden in dem, was Bowing »die Anonymität der Großstadt« nannte und wogegen er ankämpfen wollte, indem er die Seiten seines Heftes mit Namen füllte. Ein Clairefontaine-Heft von hundertneunzig Seiten mit rotem, laminierten Einband. Offen gestanden bringt es nicht viel. Wenn man in diesem Heft blättert, erfährt man außer Namen und flüchtigen Adressen überhaupt nichts von all diesen Personen oder von mir. Wahrscheinlich meinte der Capitaine, es reiche allemal, dass er uns benannt und irgendwo »fixiert« hatte. Und alles übrige … Im Condé stellten wir einander nie Fragen über unsere Herkunft. Wir waren zu jung, wir hatten keine Vergangenheit, die man hätte aufdecken können, wir lebten in der Gegenwart. Selbst die älteren Gäste, Adamov, Babilée oder Doktor Vala, verloren nie ein Wort über ihre Vergangenheit. Sie begnügten sich damit, hier zu sein, unter uns. Erst heute, nach all der Zeit, spüre ich ein Bedauern: Ich wünschte, Bowing hätte in seinem Heft genauere Angaben gemacht und über jeden eine kleine biographische Notiz verfasst. Glaubte er wirklich, ein Name und eine Adresse genügten, später einmal, um den Faden eines Lebens wiederzufinden? Noch dazu ein bloßer Vorname, der nicht einmal der richtige ist? »Louki. Montag, 12. Februar, 23 Uhr.« »Louki. 28. April, 14 Uhr.« Er vermerkte auch die Plätze, an denen die Gäste tagaus, tagein rund um die Tische saßen. Manchmal gibt es weder Namen noch Vornamen. Dreimal hat er im Juni jenes Jahres notiert: »Louki mit dem Brünetten in der Wildlederjacke.« Er hat ihn nicht nach seinem Namen gefragt, oder der Kerl hat ihm die Antwort verweigert. Offenbar war dieser Typ kein Stammgast. Der Brünette in der Wildlederjacke ist für alle Ewigkeit in den Straßen von Paris verschwunden, und Bowing konnte seinen Schatten nur ein paar Sekunden fixieren. Und dann gibt es auch Ungenauigkeiten in seinem Heft. Ich habe schließlich Bezugspunkte hergestellt, die mich in der Überzeugung bestärken, dass sie nicht im Januar zum ersten Mal ins Condé gekommen ist, wie Bowing glauben macht. Ich erinnere mich an sie lange vor diesem Datum. Der Capitaine erwähnt sie erst ab dem Moment, als die anderen sie Louki getauft haben, und ich vermute, dass er ihre Anwesenheit bis dahin nicht wahrgenommen hatte. Sie bekam nicht einmal eine blasse Notiz von der Art »14 Uhr. Eine Brünette mit grünen Augen«, wie der Brünette in der Wildlederjacke.