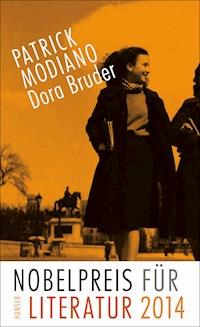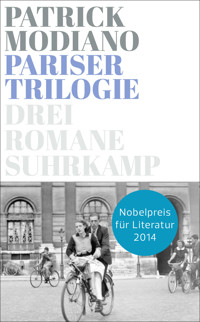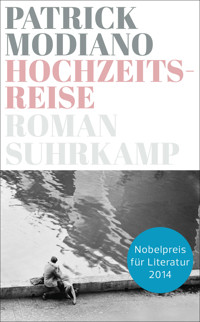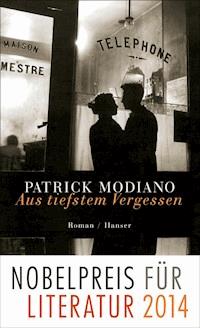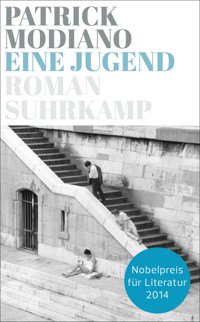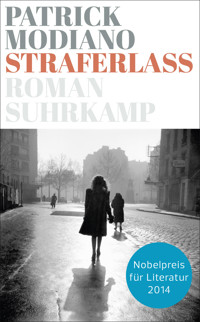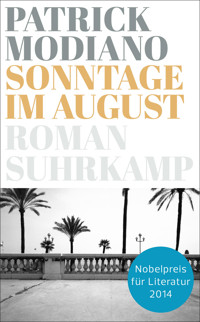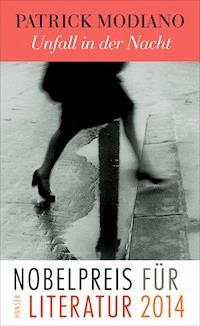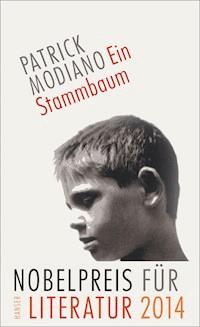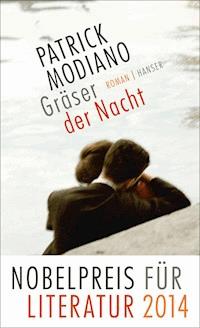
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus der Distanz eines halben Jahrhunderts erinnert sich Jean, wie er sich nach dem Algerienkrieg in die geheimnisvolle Dannie verliebte. Als er sie in den 1960er Jahren kennenlernt, lebt sie in Paris, hat so viele Namen wie Adressen und verkehrt mit einer zwielichtigen Bande, die Kontakte nach Marokko unterhält. Trotz der vage lauernden Gefahr werden der angehende Schriftsteller und die junge Frau ein Paar. Doch dann verschwindet Dannie von einem Tag auf den anderen. Und Jean wird als Zeuge in einem Mordfall verhört, der eine neue Geschichte von Dannie erzählt. Modianos Roman ist wie ein Film noir, voller Spannung, Sehnsucht und Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Patrick Modiano
Gräser der Nacht
Roman
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die französische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel L’herbe des nuits bei Gallimard in Paris.
ISBN 978-3-446-24849-6
© Éditions Gallimard Paris 2012
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2014
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München
Foto: © akg-images/Peter Cornelius
Satz im Verlag
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Orson
Aber ich habe doch nicht geträumt. Zuweilen ertappe ich mich dabei, dass ich diesen Satz auf der Straße sage, als hörte ich die Stimme eines anderen. Eine tonlose Stimme. Namen kommen mir in den Sinn, bestimmte Gesichter, bestimmte Details. Niemand mehr, mit dem ich darüber reden könnte. Zwei oder drei noch lebende Zeugen müssten sich wohl finden lassen. Doch wahrscheinlich haben sie alles vergessen. Und außerdem fragt man sich irgendwann, ob es wirklich Zeugen gegeben hat.
Nein, ich habe nicht geträumt. Der Beweis, ich besitze noch immer ein schwarzes Buch, angefüllt mit Notizen. In diesem Nebel brauche ich genaue Begriffe, und ich schaue ins Wörterbuch. Notiz: kurze Aufzeichnung, die jemand macht, um sich an etwas zu erinnern. Auf den Seiten des Notizbuchs reihen sich Namen aneinander, Telefonnummern, Termine von Verabredungen und auch kurze Texte, die vielleicht irgendetwas mit Literatur zu tun haben. Aber in welche Kategorie soll ich sie einordnen? Tagebuch? Bruchstücke von Erinnerungen? Und auch Hunderte abgeschriebene Kleinanzeigen, die in Zeitungen gestanden haben. Entlaufene Hunde. Möblierte Wohnungen. Stellengesuche und -angebote. Hellseherinnen.
Unter diesen Unmengen von Notizen haben manche einen stärkeren Nachhall als andere. Vor allem, wenn nichts die Stille beeinträchtigt. Kein Telefongeklingel mehr seit langem. Und niemand wird an die Tür klopfen. Bestimmt glauben sie, ich sei gestorben. Du bist allein, hellwach, als wolltest du Morsezeichen auffangen, die ein unbekannter Korrespondent dir aus weiter Ferne schickt. Natürlich, viele Zeichen sind gestört, und auch wenn du die Ohren spitzt, gehen sie für immer verloren. Doch ein paar Namen lösen sich ganz deutlich aus der Stille und von der weißen Seite …
Dannie, Paul Chastagnier, Aghamouri, Duwelz, Gérard Marciano, »Georges«, das Unic Hôtel in der Rue du Montparnasse … Wenn ich mich recht erinnere, war ich in diesem Viertel immer auf der Hut. Unlängst bin ich dort zufällig durchgelaufen. Ich habe ein seltsames Gefühl verspürt. Nicht, dass die Zeit vergangen war, sondern dass ein anderes Ich, ein Zwilling, sich in dieser Gegend herumtrieb, ohne gealtert zu sein, und in den kleinsten Einzelheiten und bis ans Ende aller Zeiten weitererlebte, was ich hier erlebt hatte, während einer sehr kurzen Frist.
Woher kam das Unbehagen, das ich einst empfunden hatte? Lag es an diesen paar Straßen im Schatten einer Bahnstation und eines Friedhofs? Plötzlich wirkten sie harmlos. Die Fassaden hatten eine andere Farbe. Viel heller. Nichts Besonderes. Eine neutrale Zone. Konnte es wirklich sein, dass ein Doppelgänger, den ich hier zurückgelassen hatte, immer weiter jede meiner alten Bewegungen wiederholte, meine alten Wege ging bis in alle Ewigkeit? Nein, hier war nichts mehr von uns übrig. Die Zeit hatte Tabula rasa gemacht. Das Viertel war neu, saniert, so als hätte man es an der Stelle eines baufälligen Wohnblocks errichtet. Und selbst wenn die meisten Häuser dieselben waren, so hatte man doch den Eindruck, vor einem ausgestopften Hund zu stehen, einem Hund, der dir früher einmal gehörte und den du geliebt hast, als er noch lebte.
An jenem Sonntagnachmittag versuchte ich mich während meines Spaziergangs zu erinnern, was in dem schwarzen Notizbuch stand, das ich leider nicht bei mir trug. Uhrzeiten von Verabredungen mit Dannie. Die Telefonnummer des Unic Hôtel. Die Namen der Leute, denen ich dort begegnet bin. Chastagnier, Duwelz, Gérard Marciano. Die Telefonnummer von Aghamouri im marokkanischen Pavillon der Cité universitaire. Kurze Beschreibungen verschiedener Winkel dieses Viertels, die ich »L’arrière-Montparnasse«, das Hinterland von Montparnasse, nennen wollte; dreißig Jahre später musste ich entdecken, dass der Titel bereits von einem gewissen Oser Warszawski verwendet worden war.
An einem späten Sonntagnachmittag im Oktober hatten meine Schritte mich also in jene Zone geführt, der ich an einem anderen Wochentag ausgewichen wäre. Nein, es handelte sich wirklich nicht um irgendeine Wallfahrt. Aber Sonntage, vor allem spätnachmittags, und wenn du allein bist, reißen eine Bresche in die Zeit. Du musst bloß durchschlüpfen. Ein ausgestopfter Hund, den du geliebt hast, als er noch lebte. In dem Augenblick, da ich an dem großen schmutzigweiß-beigen Haus der Rue d’Odessa Nr. 11 vorbeikam – ich ging auf dem Trottoir gegenüber, dem rechten –, habe ich so etwas wie ein Klicken gespürt, jenen leisen Schwindel, der einen jedesmal erfasst, wenn eine Bresche in die Zeit gerissen wird. Ich blieb stehen und starrte auf die Fassaden des Häuserblocks, die den kleinen Hof umrahmten. Hier hatte Paul Chastagnier immer seinen Wagen geparkt, obwohl er damals ein Zimmer in der Rue du Montparnasse bewohnte, im Unic Hôtel. Eines Abends hatte ich ihn gefragt, warum er diesen Wagen nicht vor dem Hotel lasse. Er hatte verlegen gelächelt und mit einem Schulterzucken erwidert: »Aus Vorsicht …«
Ein roter Lancia. Der konnte nur allzu leicht Blicke auf sich ziehen. Aber wenn er unsichtbar sein wollte, warum hatte er sich dann für eine solche Automarke entschieden und für eine solche Farbe … Darauf hatte er mir erklärt, ein Freund wohne in diesem Haus der Rue d’Odessa und er leihe ihm oft seinen Wagen. Ja, deshalb war er hier geparkt.
»Aus Vorsicht«, sagte er. Ich hatte schnell gemerkt, dass dieser Mann um die Vierzig, dunkler Typ, immer gepflegt, in grauen Anzügen und marineblauen Mänteln, keinem festen Beruf nachging. Ich hörte ihn im Unic Hôtel telefonieren, aber die Wand war zu dick, als dass ich dem Gespräch hätte folgen können. Nur die Stimme drang zu mir, tief, manchmal schneidend. Immer wieder langes Schweigen. Diesen Chastagnier hatte ich im Unic Hôtel kennengelernt, zugleich mit ein paar anderen Leuten, denen ich im selben Etablissement begegnet war: Gérard Marciano, Duwelz, dessen Vornamen ich vergessen habe … Ihre Gestalten sind mit der Zeit unscharf geworden, ihre Stimmen kaum hörbar. Paul Chastagnier sticht deutlicher hervor, wegen der Farben: pechschwarzes Haar, marineblauer Mantel, roter Wagen. Ich vermute, er hat ein paar Jahre im Gefängnis gesessen wie Duwelz, wie Marciano. Er war der älteste, und bestimmt ist er seither gestorben. Er stand immer spät auf und hatte seine Verabredungen weiter weg, irgendwo im Süden, diesem Hinterland um den ehemaligen Güterbahnhof, dessen Namen und Orte auch mir vertraut waren: Falguière, Alleray, und sogar noch ein Stück weiter, bis zur Rue des Favorites … Öde Cafés, in die er mich zuweilen mitnahm, wahrscheinlich, weil er dachte, hier würde niemand auf ihn aufmerksam. Ich habe nie gewagt, ihn zu fragen, ob er mit einem Aufenthaltsverbot belegt war, obwohl mir der Gedanke oft durch den Kopf ging. Aber warum parkte er den roten Wagen dann vor diesen Cafés? Wäre es nicht klüger gewesen, zu Fuß hinzugehen, ganz unauffällig? Ich dagegen streifte damals ständig durch dieses Viertel, das nach und nach zerstört wurde, an Brachen entlang, kleinen Mietshäusern mit zugemauerten Fenstern, Straßenstücken zwischen Schutthaufen, wie nach einem Bombenangriff. Und dieser rote Wagen, der hier parkte, sein Ledergeruch, dieser grelle Fleck, durch den die Erinnerungen zurückkommen … Die Erinnerungen? Nein. An jenem Sonntagabend war ich schon fast überzeugt, dass die Zeit sich nicht bewegt und dass, würde ich wirklich durch die Bresche schlüpfen, ich alles wiederfände, unversehrt. Und zuallererst diesen roten Wagen. Ich beschloss bis zur Rue Vandamme zu gehen. Dort war ein Café, in das mich Paul Chastagnier mitgeschleppt hatte und wo unser Gespräch persönlicher geworden war. Ich hatte sogar gespürt, dass er nahe dran war, vertraulich zu werden. Er hatte mir andeutungsweise vorgeschlagen, ich sollte für ihn »arbeiten«. Ich hatte ausweichend geantwortet. Er hatte nicht insistiert. Ich war sehr jung, aber sehr misstrauisch. Später hab ich dieses Café mit Dannie wieder aufgesucht.
An jenem Sonntag war es schon beinahe dunkel, als ich in der Avenue du Maine angelangt bin, und ich ging an den großen neuen Häusern entlang, auf der Seite mit den geraden Nummern. Sie bildeten eine gleichförmige Fassade. Kein einziges Licht in den Fenstern. Nein, ich hatte nicht geträumt. Die Rue Vandamme mündete ungefähr auf dieser Höhe in die Avenue, doch an jenem Abend waren die Fassaden glatt, kompakt, ohne die kleinste Lücke. Ich musste wohl oder übel einsehen: die Rue Vandamme existierte nicht mehr.
Ich bin durch die Glastür eines dieser Häuser getreten, ungefähr da, wo wir früher in die Rue Vandamme einbogen. Neonlicht. Ein langer, breiter Flur, gesäumt von gläsernen Wänden, hinter denen ein Büro auf das andere folgte. Vielleicht war ein Stück der Rue Vandamme noch irgendwo vorhanden, eingeschlossen von der Masse der neuen Gebäude. Dieser Gedanke löste bei mir ein nervöses Lachen aus. Ich ging immer weiter durch den Flur mit den Glastüren. Ich sah kein Ende und musste blinzeln, wegen des Neonlichts. Ich habe mir gedacht, dieser Flur folge ganz einfach dem alten Verlauf der Rue Vandamme. Ich schloss die Augen. Das Café lag am Ende der Straße, in ihrer Verlängerung eine Sackgasse, die an die Mauer der Eisenbahnwerkstätten stieß. Paul Chastagnier parkte seinen roten Wagen in der Sackgasse, vor der schwarzen Mauer. Ein Hotel über dem Café, das Hôtel Perceval, wegen einer Straße dieses Namens, auch sie ausgelöscht unter den neuen Gebäuden. Ich hatte alles in dem schwarzen Notizbuch festgehalten.
Gegen Ende fühlte sich Dannie nicht mehr besonders wohl im Unic – wie Chastagnier zu sagen pflegte –, und sie hatte sich ein Zimmer in diesem Hôtel Perceval genommen. Fortan wollte sie den anderen aus dem Weg gehen, ohne dass ich gewusst hätte, wem im besonderen: Chastagnier? Duwelz? Gérard Marciano? Je länger ich jetzt darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, sie habe von dem Tag an Zeichen der Unruhe erkennen lassen, da mir die Gegenwart eines Mannes im Foyer und hinter dem Pult der Rezeption aufgefallen war, ein Mann, von dem Chastagnier mir gesagt hatte, er sei der Geschäftsführer des Unic Hôtel, und dessen Name in meinem Notizbuch steht: Lakhdar, dahinter ein anderer Name: Davin, dieser in Klammern.
*
Ich hatte sie in der Cafeteria der Cité universitaire kennengelernt, wo ich oft Zuflucht suchte. Sie bewohnte ein Zimmer im Pavillon der Vereinigten Staaten, und ich fragte mich, mit welchem Recht, denn sie war weder Studentin noch Amerikanerin. Sie ist nicht mehr lange dort geblieben, nachdem wir miteinander bekannt geworden waren. Gerade einmal zehn Tage. Ich zögere, den Familiennamen auszuschreiben, den ich bei unserer ersten Begegnung in dem schwarzen Buch notiert hatte: Dannie R., Pavillon der Vereinigten Staaten, Boulevard Jourdan Nr. 15. Vielleicht trägt sie ihn heute wieder – nach so vielen anderen Namen –, und ich will die Aufmerksamkeit nicht auf sie lenken, falls sie noch lebt, irgendwo. Und doch, wenn sie diesen Namen lesen sollte, gedruckt, vielleicht würde sie sich daran erinnern, dass sie ihn zu einer bestimmten Zeit getragen hat, und ich bekäme eine Nachricht. Nein, da mache ich mir keine Illusionen.
Am Tag unserer Begegnung hatte ich »Dany« in das Notizbuch geschrieben. Und sie hatte eigenhändig mit meinem Füller die Schreibweise ihres Vornamens korrigiert: Dannie. Später habe ich entdeckt, dass dieser Vorname »Dannie« der Titel eines Gedichts war, von einem Schriftsteller, den ich damals bewunderte und den ich zuweilen am Boulevard Saint-Germain aus dem Hôtel Taranne kommen sah. Manchmal gibt es merkwürdige Zufälle.
An dem Sonntagabend, als sie aus dem Pavillon der Vereinigten Staaten ausgezogen war, hatte sie mich gebeten, sie von der Cité universitaire abzuholen. Sie wartete vor dem Eingang des Pavillons mit zwei Reisetaschen. Sie sagte mir, sie habe ein Zimmer in einem Hotel gefunden, in Montparnasse. Ich schlug ihr vor, zu Fuß hinzugehen. Die beiden Taschen waren nicht besonders schwer.
Wir sind der Avenue du Maine gefolgt. Sie war menschenleer, wie neulich abend, auch ein Sonntag, um dieselbe Zeit. Ein marokkanischer Freund aus der Cité universitaire hatte ihr das Hotel genannt, der, den sie mir in der Cafeteria bei unserer ersten Begegnung vorgestellt hatte, ein gewisser Aghamouri.
Wir haben uns auf der Höhe der Straße, die am Friedhof entlangführt, auf eine Bank gesetzt. Sie hat in ihren beiden Reisetaschen gewühlt, um nachzusehen, ob sie nichts vergessen hatte. Dann sind wir weitergegangen. Sie erklärte mir, dass Aghamouri ein Zimmer in diesem Hotel habe, weil einer der Besitzer Marokkaner sei. Aber warum hatte er dann auch in der Cité universitaire gewohnt? Weil er Student war. Er hatte außerdem noch einen anderen Wohnsitz in Paris. Und sie, war sie ebenfalls Studentin? Aghamouri wollte ihr helfen, sich an der Faculté de Censier einzuschreiben. Sie wirkte nicht sehr überzeugt und hatte diesen letzten Satz nur widerstrebend ausgesprochen. Und doch, daran erinnere ich mich, habe ich sie eines Abends mit der Metro bis zur Faculté de Censier begleitet, eine direkte Linie von Duroc bis Monge. Ein feiner Regen fiel, aber das störte uns nicht. Aghamouri hatte ihr gesagt, sie müsse der Rue Monge folgen, und schließlich hatten wir unser Ziel erreicht: eine Art Platz oder vielmehr ein Brachland, umgeben von niedrigen halbverfallenen Häusern. Der Boden war gestampfte Erde, und wir mussten im Halbdunkel den Wasserpfützen ausweichen. Ganz hinten ein moderner Bau, an dem sicher noch gearbeitet wurde, denn er war eingerüstet … Aghamouri erwartete uns am Eingang, seine Gestalt erleuchtet vom Licht im Foyer. Sein Blick schien mir weniger ängstlich als sonst, als beruhige es ihn, hier vor dieser Fakultät zu stehen, trotz Brachland und Regen. Alle diese Einzelheiten fallen mir in wirrem Durcheinander ein, stoßweise, und oft trübt sich das Licht. Und das steht im Gegensatz zu den genauen Aufzeichnungen, die sich im Notizbuch finden. Sie helfen mir, diese Aufzeichnungen, denn sie geben den Bildern ein wenig Halt, die so sehr ruckeln, dass der Film zu reißen droht. Andere Notizen, Nachforschungen betreffend, die ich zur selben Zeit anstellte, über Ereignisse, die ich nicht selbst erlebt hatte – sie reichen ins 19. und sogar ins 18. Jahrhundert zurück –, erscheinen mir seltsamerweise viel klarer. Und die Namen, die mit diesen fernen Ereignissen verbunden sind: die Baronin Blanche, Tristan Corbière, Jeanne Duval, unter anderen, ebenso Marie-Anne Leroy, am 26. Juli 1794 im Alter von einundzwanzig Jahren durch das Fallbeil hingerichtet, klingen in meinen Ohren näher und vertrauter als die Namen meiner Zeitgenossen.
Am Sonntagabend unserer Ankunft im Unic Hôtel saß Aghamouri im Foyer und wartete in Gesellschaft von Duwelz und Gérard Marciano auf Dannie. An jenem Abend habe ich die beiden kennengelernt. Sie wollten, dass wir uns den Garten hinter dem Hotel anschauen, wo zwei Tische mit Sonnenschirmen standen. »Das Fenster deines Zimmers geht auf diese Seite«, hat Aghamouri gesagt, aber diese Auskunft schien Dannie nicht zu interessieren. Duwelz. Marciano. Ich muss mich konzentrieren, um ihnen einen Anschein von Wirklichkeit zu geben, ich suche nach etwas, was sie zu neuem Leben erwecken könnte, hier, vor meinen Augen, und mit dessen Hilfe ich nach all der Zeit ihre Gegenwart spüren würde. Ich weiß nicht, ein Parfüm … Duwelz legte immer Wert auf ein gepflegtes Aussehen: blonder Schnurrbart, Krawatte, grauer Anzug, und er roch nach einem Eau de Toilette, auf dessen Namen ich viele Jahre später wieder gekommen bin, dank eines in einem Hotelzimmer vergessenen Fläschchens: Pino silvestre. Ein paar Sekunden lang hatte mir der Duft von Pino silvestre eine Gestalt in Erinnerung gerufen, eine Gestalt von hinten, die die Rue du Montparnasse hinuntergeht, ein Blonder mit eher schwerfälligem Schritt: Duwelz. Dann, nichts mehr, wie in jenen Träumen, von denen beim Erwachen nur ein matter Schimmer bleibt, der im Laufe des Tages verschwindet. Gérard Marciano dagegen war dunkelhaarig, mit weißer Haut, von eher kleinem Wuchs, sein Blick immer starr auf einen gerichtet, doch er sah einen nicht. Besser gekannt habe ich Aghamouri, mit dem ich öfter verabredet war, abends, in einem Café an der Place Monge, nach seinen Vorlesungen an der Faculté de Censier. Jedesmal hatte ich den Eindruck, er wolle mir etwas Wichtiges anvertrauen, sonst hätte er mich nicht gebeten, ihn hier zu treffen, unter vier Augen, weit weg von den anderen. Dieses Café war ruhig, wenn es im Winter dunkel wurde, und wir saßen allein da, in Sicherheit, ganz hinten im Raum. Ein schwarzer Pudel legte sein Kinn auf die Bank und beobachtete uns blinzelnd. Bei der Erinnerung an gewisse Augenblicke meines Lebens kommen mir Verse in den Sinn, und häufig suche ich nach den Namen ihrer Verfasser. Das Café an der Place Monge zur Abendzeit ist für mich mit diesem Vers verknüpft: »Les griffes pointues d’un caniche frappant les dalles de la nuit« – die spitzen Krallen eines Pudels scharren über die Steinplatten der Nacht …
Wir gingen immer bis Montparnasse. Auf diesen Fußmärschen hatte Aghamouri mir ein paar spärliche Details verraten, die ihn selbst betrafen. In der Cité universitaire hatten sie ihn aus seinem Zimmer im marokkanischen Pavillon geworfen, doch ich habe nie erfahren, ob aus politischen Gründen oder irgendeinem anderen Anlass. Er bewohnte ein kleines Appartement, das jemand ihm im 16. Arrondissement geliehen hatte, unweit der Maison de la Radio. Aber sein Zimmer im Unic Hôtel war ihm lieber, er verdankte es dem Geschäftsführer, »einem marokkanischen Freund«. Warum behielt er dann das Appartement im 16. Arrondissement? »Da wohnt meine Frau. Ja, ich bin verheiratet.« Und ich hatte gespürt, mehr würde er dazu nicht sagen. Außerdem antwortete er nie auf Fragen. Die Dinge, die er mir im Vertrauen mitgeteilt hat – aber kann man wirklich von Vertrauen sprechen? –, das war auf dem Weg von der Place Monge nach Montparnasse, zwischen langen Pausen, als ermutige das Gehen ihn zum Reden.
Irgendetwas ließ mich stutzen. War er wirklich Student? Als ich ihn nach seinem Alter gefragt hatte, war die Antwort gewesen: dreißig. Dann schien er zu bedauern, mir das gesagt zu haben. Konnte man mit dreißig noch Student sein? Ich wagte nicht, ihm diese Frage zu stellen, aus Angst, ich könnte ihn verletzen. Und Dannie? Warum wollte auch sie Studentin sein? War es so leicht, sich von heute auf morgen an dieser Faculté de Censier einzuschreiben? Wenn ich die beiden, sie und ihn, im Unic Hôtel beobachtete, wirkten sie nicht wie Studenten, und dort bei der Rue Monge schien mir das Gebäude der Fakultät, erst halb erbaut und am Ende dieser Brache, plötzlich zu einer anderen Stadt zu gehören, zu einem anderen Land, einem anderen Leben. Lag das an Paul Chastagnier, an Duwelz, an Marciano und den übrigen, die ich im Büro der Rezeption des Unic Hôtel zu Gesicht bekam? Ich fühlte mich einfach nie wohl in Montparnasse. Nein, diese Straßen waren wirklich nicht besonders heiter. In meiner Erinnerung fällt dort häufig Regen, während ich andere Viertel von Paris stets im Sommer sehe, wenn ich von ihnen träume. Ich glaube, dass Montparnasse seit dem Krieg erloschen war. Weiter unten am Boulevard strahlten noch La Coupole und Le Select ein wenig, aber das Viertel hatte seine Seele verloren. Da war kein Talent mehr und kein Herz.
An einem Sonntagnachmittag war ich allein mit Dannie, im unteren Teil der Rue d’Odessa. Es begann zu regnen, und wir hatten uns ins Foyer des Cinéma Montparnasse geflüchtet. Wir hatten uns ganz hinten in den Saal gesetzt. Es war gerade Pause, und wir wussten nicht, wie der Film hieß. Dieses riesige, heruntergekommene Kino hat mir dasselbe Unbehagen verursacht wie die Straßen des Viertels. Überall hing dieser Ozongeruch, wie wenn man über den Gitterrost eines Metroschachts geht. In den Zuschauerreihen, ein paar Soldaten auf Urlaub. Bei Einbruch der Nacht würden sie die Züge in Richtung Bretagne nehmen, nach Brest oder Lorient. Und stille Winkel, wo sich Paare verbargen, Zufallsbekanntschaften, die den Film nicht sehen würden. Während der Vorstellung würde man ihr Stöhnen hören, ihre Seufzer und unter ihnen das immer lautere Quietschen der Sitze … Ich habe Dannie gefragt, ob sie noch lange in dem Viertel bleiben wollte. Nein. Nicht mehr lange. Sie hätte lieber in einem großen Zimmer im 16. Arrondissement gewohnt. Dort war es ruhig und anonym. Und niemand konnte einen mehr finden. »Warum? Musst du dich verstecken?« – »Nein. Überhaupt nicht. Und du, magst du dieses Viertel?«
Offenbar wollte sie einer lästigen Frage ausweichen. Und ich, was konnte ich schon antworten? Ob ich dieses Viertel mochte oder nicht mochte, hatte keinerlei Bedeutung. Heute scheint mir, dass ich ein anderes Leben lebte innerhalb meines Alltagslebens. Oder, genauer ausgedrückt, dass dieses andere Leben verknüpft war mit jenem eher farblosen, alltäglichen, und ihm ein Leuchten und ein Geheimnis verlieh, die es in Wirklichkeit nicht hatte. So bekommen Orte, die einem vertraut sind und die man viele Jahre später im Traum wieder aufsucht, ein merkwürdiges Aussehen, wie diese trostlose Rue d’Odessa und das Cinéma Montparnasse mit seinem Metrogeruch.