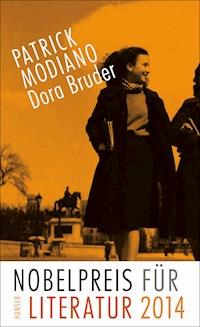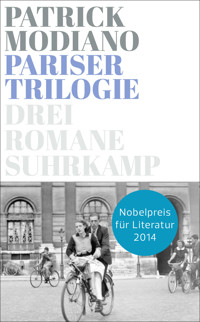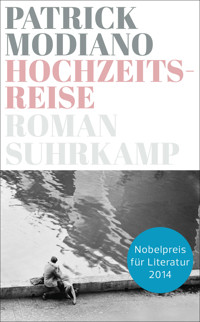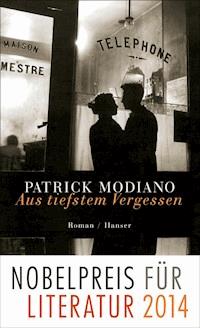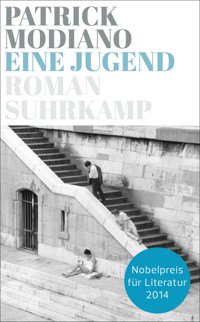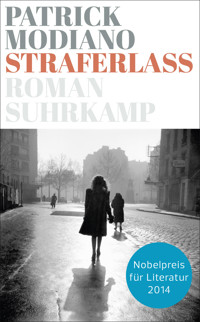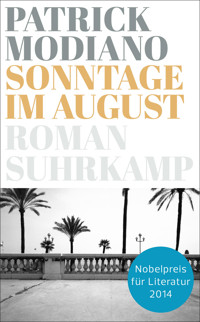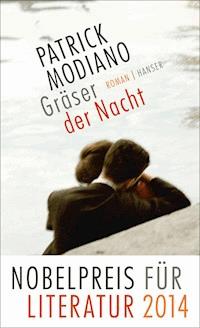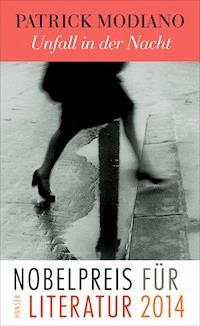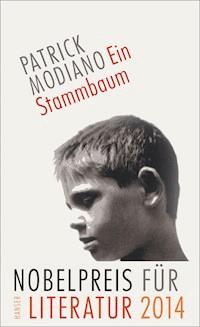Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die neunzehnjährige Thérèse sieht in der Metrostation eine Frau und glaubt, ihre Mutter wiederzuerkennen. Während sie ihr folgt, kehren die Erinnerungen zurück: an die Kindheit, in der man sie "Die kleine Bijou" nannte, an die Mutter, eine gescheiterte Ballerina, an die Wohnung am Bois de Boulogne und an die Männer, die dort ein und aus gingen. Und daran, dass die Mutter ihre kleine Tochter verließ und nach Marokko ging. Wie in einem unheimlichen Traum jagt Thérèse der Gestalt hinterher und wird dabei selbst von den Bildern der Vergangenheit gejagt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Patrick Modiano
Die Kleine Bijou
Roman
Aus dem Französischenvon Peter Handke
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
La Petite Bijou 2001 bei Gallimard in Paris.
ISBN 978-3-446-24876-2
© Éditions Gallimard 2001
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2003/2014
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München,
Foto: Henri Cartier-Bresson / Magnum/Agentur Focus
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
für Zinafür Marie
Ein Dutzend Jahre waren vergangen, seit man mich nicht mehr »Die Kleine Bijou« nannte, und ich fand mich im Vorabendgedränge an der Metrostation Châtelet. Ich bewegte mich mit der Menschenmasse auf dem Laufband in dem endlosen Korridor. Eine Frau trug einen gelben Mantel. Dessen Farbe hatte meine Aufmerksamkeit erregt. Ich sah sie auf dem Laufband von hinten. Sie ging dann in dem Korridor mit der Richtungsangabe »Château de Vincennes« weiter. Wir standen jetzt im Gedränge auf der Treppe und warteten, ohne uns zu bewegen, auf das Sichöffnen der automatischen Tür; die Frau stand neben mir. Und ich sah da ihr Gesicht. Die Ähnlichkeit dieses Gesichts mit dem meiner Mutter war so stark, daß ich dachte: Sie ist es.
Ein Photo war mir in den Sinn gekommen, eins der paar Photos, die ich von ihr aufbewahrt habe. Ihr Gesicht war wie von einem Scheinwerfer aus der Nacht beleuchtet. Immer hatte ich vor diesem Photo ein Unbehagen gespürt. Es war mir ein jedes Mal, als halte mir jemand – ein Polizeikommissar, ein Angestellter des Leichenschauhauses – ein Suchbild hin, und ich sollte die Person da identifizieren. Ich aber blieb stumm. Ich wußte nichts von ihr.
Sie setzte sich auf eine der Bänke der Station, abseits von den andern, die sich in Erwartung des Zugs am Bahnsteigrand drängten. Es war auf der Bank neben ihr kein Platz frei, und ich hielt mich im Abstand, gestützt auf einen Fahrkartenautomaten. Der Schnitt ihres Mantels war einmal sicher elegant gewesen, und seine lebhafte Farbe hatte ihm einen phantastischen Anstrich gegeben. Aber das Gelb war stumpf geworden, und der Mantel erschien beinahe grau. Sie nahm offenbar nichts wahr von ihrer Umgebung, und ich fragte mich, ob sie wohl so auf der Bank sitzen bliebe bis zur letzten Metro. Das gleiche Profil wie das meiner Mutter, die so spezielle Nase, an der Spitze leicht aufgebogen. Die gleichen hellen Augen. Die gleiche hohe Stirn. Nur die Haare waren kürzer. Nein, sie hatte sich nicht sehr verändert. Höchstens, daß die Haare nicht mehr so blond waren. Aber im Grund wußte ich nicht, ob meine Mutter richtig blond gewesen war. Der bittere Zug an ihrem Mund: und meine Gewißheit: sie ist es.
Sie hat einen Zug vorbeifahren lassen. Die Station blieb eine Zeitlang leer. Ich habe mich auf die Bank neben sie gesetzt. Dann wieder das Gedränge auf dem Bahnsteig. Ich hätte ein Gespräch beginnen können. Ich fand die Worte nicht, und es waren zu viele Leute um uns herum.
Würde sie auf der Bank einschlafen? Doch als der nächste Zug ein bloßer ferner Donner war, stand sie auf. Ich bin hinter ihr in die Metro eingestiegen. Wir hatten eine Gruppe von Männern zwischen uns, die sich sehr laut miteinander unterhielten. Die automatischen Türen schlossen sich, und da habe ich gedacht, ich hätte so wie üblich den Zug in die Gegenrichtung nehmen sollen. Beim nächsten Halt wurde ich von dem Pulk der Aussteigenden auf den Bahnsteig gedrängt. Ich bin dann wieder eingestiegen und habe mich auf sie zubewegt.
In dem grellen Licht erschien sie älter als auf dem Bahnsteig. Eine Narbe zog sich über die linke Schulter und einen Teil ihrer Wange. Wie alt mochte sie sein? Um die Fünfzig? Und wie alt war sie wohl auf den Photos? Fünfundzwanzig? Der Blick war derselbe wie mit fünfundzwanzig, klar, mit dem Ausdruck des Erstaunens oder einer vagen Furcht, und mit einem jähen Sichverhärten. Zufällig hat er sich auf mich gerichtet. Aber sie sah mich nicht. Sie hat eine Puderdose aus der Tasche ihres Mantels gezogen, sie geöffnet und den Spiegel ans Gesicht gehalten, und sie fuhr sich mit dem kleinen Finger ihrer Linken über den Lidwinkel, wie um sich ein Stäubchen aus dem Auge zu wischen. Der Zug beschleunigte, kam in ein Gerüttel. Ich hielt mich fest an der Metallstange, aber sie, sie kam nicht aus dem Gleichgewicht. Unbewegt betrachtete sie sich in der Puderdose. An der Station Bastille drängten die Zusteigenden sich mit Ach und Krach in das Abteil, und die Türen gingen fast nicht zu. Es war ihr gelungen, die Puderdose einzustecken, bevor die andern in den Waggon stürmten. Wo würde sie aussteigen? Sollte ich ihr bis zuletzt folgen? War das wirklich notwendig? Wie sich an die Vorstellung gewöhnen, daß sie in derselben Stadt lebte wie ich? Man hatte mir gesagt, sie sei vor langer Zeit schon gestorben, in Marokko, und niemals hatte ich versucht, mehr zu erfahren. »Sie ist gestorben in Marokko«: einer jener Sätze aus der Kindheit, deren Bedeutung man nicht ganz versteht. Von jenen Sätzen bleibt einem allein der Klang im Gedächtnis, so wie manche Zeilen aus Liedern, die mir Angst machten. »Es gab ein kleines Schiff …« – »Sie ist gestorben in Marokko.«
In meiner Geburtsurkunde war auch ihr Geburtsjahr vermerkt: 1917, und zur Zeit der Photos gab sie ihr Alter mit fünfundzwanzig an. Aber schon da hatte sie wohl geschwindelt und sich in den Papieren jünger gemacht. Sie stellte den Kragen des Mantels auf, als friere sie in dem Waggon, wo wir doch alle dicht beieinanderstanden. Ich habe bemerkt, daß der Saum des Kragens völlig abgewetzt war. Seit wann trug sie diesen Mantel? Seit der Epoche der Photos? Deswegen war das Gelb so verblichen? Wir kämen an die Endstation, und von dort brächte ein Bus uns in einen entlegenen Vorort. Das wäre der Augenblick, da ich sie anspräche. Nach der Gare de Lyon leerte sich allmählich das Abteil. Wieder schaute sie mich an, freilich nur mit dem Blick, den die Fahrgäste mechanisch austauschen. »Erinnern Sie sich, daß man mich Die Kleine Bijou nannte? Auch Sie, Sie haben seinerzeit einen zweiten Namen angenommen. Sogar einen falschen Vornamen, Sonia.«
Inzwischen saßen wir einander gegenüber, auf den Klappsitzen, die den Türen am nächsten waren. »Ich hatte versucht, Sie im Telephonbuch zu finden, hatte sogar die vier, fünf Personen angerufen, die Ihren wahren Namen trugen, doch sie hatten nie von Ihnen gehört. Ich sagte mir, ich sollte eines Tages nach Marokko gehen. Nur so hätte ich herausgefunden, ob Sie wirklich gestorben waren.«
Nach der Station Nation war das Abteil leer, und sie saß mir weiterhin gegenüber auf dem Klappsitz, mit ineinander verschränkten Fingern, und die Ärmel ihres angegrauten Mantels bedeckten ihre Handgelenke. Die Hände nackt, ohne einen Ring, ohne ein Armband, aufgesprungene Haut. Auf den Photos trug sie Armbänder und Ringe – massiven Schmuck, wie er damals üblich war. Heute freilich: nichts mehr. Sie hatte die Augen geschlossen. Noch drei Halte bis zur Endstation. Die Endstation der Metro wäre Château de Vincennes, und ich, ich würde mich erheben so leise wie möglich, und ich würde aus dem Zug steigen, während sie eingeschlafen auf dem Klappsitz zurückbliebe. Ich stiege in die Metro für die Gegenrichtung, Pont-de-Neuilly, wie ich es getan hätte,wäre mir zuvor, in dem Korridor, nicht der gelbe Mantel aufgefallen.
Der Zug hielt langsam an der Station Bérault. Sie hatte die Augen geöffnet, die wieder ihren harten Glanz annahmen. Sie warf einen Blick auf den Bahnsteig und stand auf. Von neuem folgte ich ihr in dem Korridor, nur daß wir jetzt allein waren. Da habe ich bemerkt, daß sie Stricksocken trug, die man »Panchos« nannte: und das unterstrich an ihr den Gang der ehemaligen Tänzerin.
Eine breite Avenue, gesäumt von Wohngebäuden, an der Schwelle zwischen Vincennes und St. Mandé. Es wurde schon Nacht. Sie hat die Avenue überquert und eine Telephonzelle betreten. Ich wartete mehrere Rot-Grün-Phasen an der Ampel ab, und bin dann meinerseits über die Straße gegangen. Sie, in der Zelle, brauchte einige Zeit, um Geldstücke oder einen Jeton zu finden. Ich tat, als blickte ich in das der Telephonzelle benachbarte Schaufenster, das einer Apotheke, wo jenes Plakat ausgestellt war, das mich in der Kindheit erschreckt hatte: der Teufel beim Feuerspeien. Ich habe mich umgedreht. Sie wählte eine Nummer, so langsam, als sei es zum ersten Mal, hielt den Hörer mit beiden Händen gegen das Ohr. Aber es kam keine Antwort. Sie hat aufgelegt, aus einer der Manteltaschen ein Stück Papier gezogen, und während sie an der Wählscheibe drehte, blickte sie unverwandt auf das Papierstück. Da war es, daß ich mich fragte, ob sie irgendwo ein Zuhause hätte.
Diesmal war eine Antwort gekommen. Sie bewegte hinter der Glasscheibe die Lippen. Immer noch hielt sie den Hörer in beiden Händen, und von Zeit zu Zeit schüttelte sie den Kopf, wie um sich zu konzentrieren. Ihren Lippenbewegungen nach redete sie immer lauter. Doch diese Heftigkeit beruhigte sich am Ende. Mit wem mochte sie telephonieren? Unter den seltenen Gegenständen, die mir von ihr geblieben waren, gab es, in der metallenen Keksbüchse ein Vormerk- und ein Adreßbuch aus derselben Zeit wie die Photos, der Zeit, da man mich Die Kleine Bijou genannt hatte. Früher hatten diese Hefte nie meine Neugier geweckt, aber seit einiger Zeit blätterte ich abends darin. Namen. Telephonnummern. Es war mir klar, daß es sinnlos war, die zu wählen. Im übrigen hatte ich auch gar keine Lust.
Sie telephonierte weiter. So beansprucht schien sie von dem Gespräch, daß ich mich nähern konnte, ohne daß sie mich bemerkte. Ich konnte sogar tun, als wartete ich, um meinerseits zu telephonieren. So könnte ich vielleicht durch die Glaswand ein paar Worte aufschnappen, die mich ahnen ließen, was aus dieser Frau im gelben Mantel und in den Panchos geworden war. Doch ich hörte nichts. Sie telephonierte vielleicht mit einem der in dem Adreßbuch Vermerkten, dem einzigen, den sie nicht aus den Augen verloren hatte, oder der noch nicht tot war. Oft begleitet jemand dich das ganze Leben lang, ohne daß es dir jemals gelingt, ihn loszuwerden. Er hat einen gekannt in den grandiosen Momenten, doch später folgt er dir durch Kummer und Not, der einzige, der dir noch einen Kredit gibt, der einzige, der an dich glaubt, in einer Art Köhlerglaubens. Ein Heruntergekommener wie du. Ein treuer Köter. Ein ewiger Prügelknabe. Ich versuchte, mir diesen Mann oder diese Frau am anderen Ende der Leitung vorzustellen.
Sie ist aus der Kabine getreten. Sie hat mir einen gleichgültigen Blick zugeworfen, ähnlich dem zuvor in der Metro. Ich habe die Glastür geöffnet. Ohne einen Jeton in den Schlitz zu werfen, habe ich zum Schein eine Nummer gewählt und gewartet, daß sie sich ein wenig entfernte. Ich hielt den Hörer am Ohr. Nicht einmal ein Freizeichen. Stille. Ich konnte mich nicht zum Auflegen entschließen.
Sie ist in das Café neben der Apotheke getreten. Ich habe gezögert, ehe ich ihr gefolgt bin. Aber dann der Gedanke: Sie wird mich nicht bemerken. Wer waren wir zwei denn? Eine Frau unbestimmbaren Alters und ein junges Mädchen, beide verloren in der Metromenschenmasse. In dieser Menschenmasse wären wir niemandem aufgefallen. Und als wir hinaus ins Freie traten, glichen wir den Tausenden und Abertausenden derer, die am Abend in ihre Vororte zurückkehrten.
Sie saß an einem Tisch ganz hinten. Der pausbäckige blonde Kellner hatte ihr einen Kir serviert. Ich wollte herausfinden, ob sie jeden Abend hierherkam, zur selben Stunde. Ich schärfte mir den Namen des Cafés ein: Calciat, 96, Avenue de Paris. Der Name stand auf der Türscheibe, geschwungen, in weißen Lettern. In der Metro, auf der Rückfahrt, wiederholte ich Namen und Adresse, um sie später aufzuschreiben. Man stirbt nicht in Marokko. Nach dem einen Leben setzt man ein geheimes anderes Leben fort. Man trinkt allabendlich einen Kir im Café Calciat, wo die Gäste sich mit der Zeit an die Frau im gelben Mantel gewöhnt haben. Nie sind ihr Fragen gestellt worden.
Ich hatte mich an einen Tisch unweit von dem ihren gesetzt. Auch ich hatte einen Kir bestellt und dabei die Stimme erhoben, damit sie vielleicht aufhorchte, in der Hoffnung, sie nähme das als Zeichen eines Einverständnisses. Aber sie reagierte nicht. Sie saß mit leicht gesenktem Kopf, der Blick zugleich hart und melancholisch, die gekreuzten Arme auf den Tisch gestützt, in derselben Haltung wie auf dem Gemälde. Was war aus ihm geworden, dem Gemälde? Während meiner ganzen Kindheit war es mir gefolgt. Es hing an der Wand meines Zimmers in Fossombronne-la-Forêt. Man hatte mir gesagt: »Es ist das Porträt deiner Mutter.« Ein Mensch mit Namen Tola Soungouroff hatte es gemalt, in Paris. Sein Name und der der Stadt standen unten links auf dem Gemälde. Die Arme waren gekreuzt wie jetzt, mit dem Unterschied, daß ein schweres Kettenarmband eins der Handgelenke umspannte. Das hätte einen Vorwand gegeben für ein Gespräch. »Sie ähneln einer Frau, deren Porträt ich in der letzten Woche auf dem Flohmarkt an der Porte de Clignancourt gesehen habe. Der Maler hieß Tola Soungouroff.« Doch ich fand nicht den Schwung, aufzustehen und mich ihr zuzuwenden. Gelänge es mir fließend ein Satz wie: »Der Maler hieß Tola Soungouroff, und Sie, Sie hießen Sonia, aber dieser Name war falsch, der wahre, in meinem Geburtsschein, war Suzanne«? Spräche ich diesen Satz aus, sehr schnell, was brächte mir das? Sie täte, als verstünde sie nichts, oder ihre Antwort staute sich an ihren Lippen, sie käme heraus ohne Zusammenhang, denn sie hatte seit langem mit niemandem mehr geredet. Auf jeden Fall würde sie lügen, würde sie die Spuren verwischen, wie sie es getan hatte zur Zeit des Gemäldes und der Photos, indem sie ihr Alter fälschte und sich einen falschen Vornamen zulegte. Und dazu einen falschen Familiennamen. Und sogar einen falschen Adelstitel. Sie gab vor, einer irischen Aristokratenfamilie zu entstammen. Wahrscheinlich war ihr ein Ire einmal über den Weg gelaufen, wie sonst wäre sie auf solch eine Idee gekommen? Ein Ire – vielleicht mein Vater –, wahrscheinlich verschwunden für immer, und den sie überdies vergessen hatte. Sicher hatte sie auch das Übrige vergessen, und sie wäre überrascht gewesen, daß überhaupt jemand sie ansprach. Es mußte da um eine andere Person gehen, nicht um sie. Die Lügen hatten sich mit der Zeit verflüchtigt. Aber ich war mir gewiß, daß sie damals an alle die Lügen geglaubt hatte.
Der pausbäckige Blonde hatte ihr einen weiteren Kir gebracht. Inzwischen standen viele Leute an der Theke. Auch alle Tische waren besetzt. In dem Krach hätten wir uns nicht verständigen können. Mir war, als säße ich immer noch in dem Metroabteil. Oder eher im Wartesaal eines Bahnhofs, ohne zu wissen, welchen Zug ich nehmen sollte. Für sie aber gab es keinen Zug mehr. Sie schob den Moment der Heimkehr auf. Sicher wohnte sie nicht weit von hier. Ich wollte unbedingt wissen, wo. Ich hatte nicht die geringste Lust, mit ihr zu reden, ich fühlte nichts Besonderes für sie. Es hatte sich so ergeben, daß zwischen uns das nicht bestand, was man so die zarten Mutter-Kind-Bande nennt. Das einzige, was ich wissen wollte: Wo war sie gestrandet, zwölf Jahre nach ihrem Tod in Marokko?
Es war eine kleine Straße, in der Umgebung des Schlosses, oder des Forts? (Ich weiß nicht so recht, was der Unterschied zwischen beiden ist.) Sie war gesäumt von niedrigen Häusern, Garagen und sogar Ställen. Im übrigen hieß sie auch Rue du Quartier-de-Cavalerie. Auf ihrer rechten Seite, in der Hälfte, hob sich ein massiger dunkler Ziegelbau ab. Es war Nacht, als wir hinaus auf die Straße traten. Zuerst ging ich noch ein paar Meter hinter ihr, aber dann verringerte ich nach und nach den Abstand. Ich war mir gewiß, sie würde mich nicht wahrnehmen, selbst wenn ich neben ihr ginge. Später bin ich bei Tag in diese Straße zurückgekehrt. Hinter dem Ziegelgebäude stieß man ins Leere. Freier Himmel. Doch am Ende der Straße sah man, daß diese überging in eine Art Terrain Vague, welches eine weit ausgedehnte Fläche säumte. Ein Schild: »Manöverfeld«. Jenseits begann der Bois de Vincennes. In der Nacht ähnelte die Straße gleichwelchen Vorstadtstraßen, in Asuières, Issy-les-Moulineaux, Levallois … Die Frau ging langsam, mit ihrem Ex-Tänzerin-Gang. Das Gehen in den Panchos war wohl nicht so einfach.
Das dunkelmassige Gebäude erdrückte alle anderen Häuser. Seltsam, daß es in dieser Straße stand. Im Erdgeschoß ein Lebensmittelladen, am Schließen. Das Neon war abgeschaltet. Ein einziges Licht war noch an, bei der Kasse. Ich sah, wie sie hinter der Scheibe eine Konservendose von dem hinteren Regal nahm, und noch eine. Dann ein schwarzes Paket: Kaffee? Zichorie? Sie preßte die Konservendosen und das Paket an ihren Mantel. Vor der Kasse unterlief ihr eine ungeschickte Bewegung, und ihre Kaufsachen fielen zu Boden. Der Mann an der Kasse hat diese aufgesammelt. Er lächelte sie an. Ihrer beider Lippen bewegten sich, und ich hätte gern gewußt, wie er sie nannte. Bei ihrem wahren, ihrem Mädchennamen? Sie ist herausgekommen. Sie preßte weiter die Konservenbüchsen und das Paket mit beiden Armen gegen ihren Mantel, als trage sie ein Neugeborenes. Ich überlegte, ihr meine Hilfe anzubieten, aber die Rue du Quartier-de-Cavalerie ist mir plötzlich sehr weit weg von Paris vorgekommen, verloren in einer hintersten Provinz, in einer Garnisonsstadt. Gleich würde alles schließen, die Stadt wäre ausgestorben, und ich würde den letzten Zug versäumen.
Sie ist durch das Gitter getreten. Sowie ich von weitem die dunkle Ziegelmasse gesehen hatte, war ich mir sicher gewesen, daß sie da wohnte. Sie überquerte den Hof, in dessen Hintergrund noch einige Wohnbauten wie das an der Straße aufragten. Sie bewegte sich immer langsamer, so als befürchte sie, ihre Vorräte würden ihr aus den Händen fallen. Von hinten sah es aus, als schleppe sie eine Last, die über ihre Kräfte ging, und als sei sie es, die mit jedem Schritt in Gefahr war zu fallen.
Sie hat eines der hintersten Gebäude betreten, zur Linken. Jeder der Eingänge war bezeichnet: Stiege A. Stiege B. Stiege C. Stiege D. Sie nahm die Stiege A. Ich blieb einen Moment vor der Fassade stehen, in Erwartung, daß in einem Fenster das Licht anginge. Aber ich wartete vergebens. Ob es einen Lift gab? Ich stellte mir vor, wie sie die Stiege A hinaufstieg und die Konservenbüchsen an sich drückte. Und diese Vorstellung verließ mich dann auch nicht bei der Rückfahrt in der Metro.
A