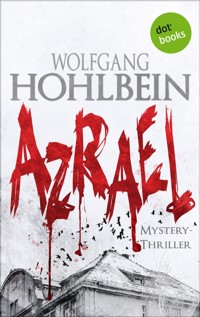
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Azrael
- Sprache: Deutsch
Der Tod wandert durch Berlin. Das Mystery-Kultbuch "Azrael" von Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein jetzt als eBook bei dotbooks. Acht Stockwerke tief: Vor den Augen von Polizist Bremer schlägt ein Mann auf dem Asphalt auf. War es Suizid? Als das Apartment des Toten aufgebrochen wird, machen die Beamten eine grausige Entdeckung: AZRAEL steht in fetten Lettern an die Wand – geschrieben mit dem Blut des Toten. Dies ist der Beginn einer mysteriösen Selbstmordserie, die ganz Berlin in Atem hält. Steckt hinter den Fällen ein perfider Killer oder ist der Todesengel selbst, der in der Stadt wütet? Selbst der Rationalist Bremer wird bald von einer einzigen Frage beherrscht: Welchem Alptraum ist dieser Wahnsinn entsprungen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Azrael" von Wolfgang Hohlbein. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 838
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Acht Stockwerke tief: Vor den Augen von Polizist Bremer schlägt ein Mann auf dem Asphalt auf. War es Suizid? Als das Apartment des Toten aufgebrochen wird, machen die Beamten eine grausige Entdeckung: AZRAEL steht in fetten Lettern an die Wand – geschrieben mit dem Blut des Toten. Dies ist der Beginn einer mysteriösen Selbstmordserie, die ganz Berlin in Atem hält. Steckt hinter den Fällen ein perfider Killer oder ist der Todesengel selbst, der in der Stadt wütet? Selbst der Rationalist Bremer wird bald von einer einzigen Frage beherrscht: Welchem Alptraum ist dieser Wahnsinn entsprungen?
Über die Autoren:
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, ist Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor. Der Durchbruch gelang ihm 1983 mit dem preisgekrönten Jugendbuch MÄRCHENMOND. Inzwischen hat er 150 Bestseller mit einer Gesamtauflage von über 44 Millionen Büchern verfasst. 2012 erhielt er den internationalen Literaturpreis NUX.
Wolfgang Hohlbein im Internet: www.hohlbein.de
Bei dotbooks veröffentlichte Wolfgang Hohlbein die Romane FLUCH – SCHIFF DES GRAUENS, DAS NETZ und IM NETZ DER SPINNEN, die ELEMENTIS-Trilogie mit den Einzelbänden FLUT, FEUER UND STURM sowie die große ENWOR-Saga.
***
Neuausgabe April 2016
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Tanja Winkler, Weichs, unter Verwendung von Illustrationen von © dife88
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-639-3
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weiteren Lesestoff aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Azrael an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: http://www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
http://instagram.com/dotbooks
http://blog.dotbooks.de/
Wolfgang Hohlbein
Azrael
Mystery-Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Artner nannte es nur das Haus der Pein. Es hieß nicht wirklich so. Auf dem längst grün gewordenen Kupferschild, das, von zwei Barockengeln getragen, über dem Eingang hing, stand ein anderer Name, und wiederum ein anderer auf dem sorgsam polierten Messingschildchen neben der Tür. Unter wieder einem anderen war es bei den Menschen in der näheren Umgebung bekannt. Und früher hatte es noch andere Bezeichnungen getragen, Namen – mit oder ohne besondere Bedeutungen –, die Geschichten erzählten und düstere Versprechungen beinhalteten. Das Haus war im Laufe seiner langen, bewegten Geschichte unter vielen Namen gefürchtet worden, aber für Artner war und blieb es: das Haus der Pein. Es hatte diesen Namen nur für ihn, und er hütete ihn wie ein kostbares Geheimnis. Niemals hätte er ihn in Gegenwart anderer benutzt, obwohl er schon ähnliche Bezeichnungen gehört hatte: Haus des Schreckens, Haus der Tränen, Haus der Schmerzen, Haus des Todes. Sie alle stimmten, denn es hatte von alledem mehr als genug gesehen; seine Mauern hatten die Tränen Zahlloser getrunken, seine Wände die Schreie Ungezählter erstickt, seine Luft den Schmerz so vieler geatmet, und es hätte noch unzählige andere, zutreffendere Bezeichnungen für das große Gebäude gegeben, und jede einzelne wäre richtig gewesen. Obwohl dieses Haus von Anfang an nur einem einzigen Zweck gedient hatte, nämlich jenen, die es betraten, zu helfen und ihren Schmerz zu lindern, hatte es doch unendlich viel von genau diesem Schmerz gesehen. Und verursacht.
Im Mittelalter, als es errichtet worden war, war es ein Kloster gewesen. Aber nicht lange. Irgendeiner der ebenso zahl- wie sinnlosen Kriege, die das Land mit der gleichen Regelmäßigkeit wie Jahreszeiten, Naturkatastrophen und Hungersnöte heimsuchten, mußte die frommen Männer vertrieben haben, kaum daß sie mit ihrer Hände Arbeit diese wehrhaften Mauern aufgerichtet hatten. Und für eine noch kürzere Zeit hatte es als Festung und Gefängnis gedient. Das Blut derer, die es errichtet hatten, war vom Blut der Gefangenen fortgespült worden und nicht lange danach von dem ihrer Wärter. Danach waren wieder fromme Männer gekommen, doch diesmal nicht nur, um zu beten. Kriege und Seuchen forderten viele Opfer in jenen Tagen, und das Kloster war zu einem Ort geworden, an dem man sich um diese Opfer kümmerte. Wieder waren es Blut und Schreie gewesen, die seine Mauern färbten und seine Luft tränkten, und daran hatte sich bis heute nicht viel geändert – das Gebäude hatte als Hospiz gedient, später, in einem moderneren und viel effektiveren Krieg, als Militärkrankenhaus, und für lange Zeit als Hospital unter kirchlicher Leitung, bis es schließlich in die Obhut der Stiftung übergeben worden war.
Geändert hatte sich nichts. Die Methoden waren feiner geworden, die Schreie nicht mehr ganz so laut, und das Blut floß nicht mehr ganz so reichlich. Und trotzdem hatte sich Artner schon mehr als einmal die Frage gestellt, ob der einzige – der wirkliche – Daseinszweck dieses Hauses vielleicht nicht nur der war, den Menschen ihre Hilflosigkeit vor Augen zu führen und ihnen klarzumachen, daß, was sie taten, zum Scheitern verurteilt worden war, noch ehe sie es begannen. Sie waren hier – er war hier –, um zu helfen, doch manchmal wunderte er sich, ob seine Hilfe nicht zumeist nur daraus bestand, alten Schmerz gegen neuen zu tauschen. Wunden zu schließen, indem er größere darüber fügte, und bekannte Qual gegen neue, unbekannte zu wechseln.
Oh, sie hatten Erfolge! Er war ein bekannter Arzt, eine Koryphäe auf seinem Gebiet, dessen Krankenblätter, die er mit dem Stempel ›Geheilt‹ zu den Akten gelegt hatte, ganze Schränke füllten. Und doch – stets wenn er hierher kam, in diesen ganz speziellen Trakt – fragte er sich, ob er auch zu Recht berühmt war, und ob geheilt auch wirklich immer geholfen hieß.
Was unterschied sie eigentlich wirklich von jenen, die vor einem halben Jahrtausend hier gewesen waren und auf ihre Weise versucht hatten, den Leidenden zu helfen? Sicher, ihre Werkzeuge waren feiner geworden, ihre Methoden subtiler, ihre Therapien erfolgreicher. Statt Knochensägen benutzten sie Laserskalpelle, statt Aderlässen winzige Mengen farbloser Flüssigkeiten, die auf Glaskolben aufgezogen waren, und selbst die brutalen Elektroschocks des vergangenen Jahrzehnts waren durch einen kaum noch spürbaren Stich in eine Vene ersetzt worden. Nur fragte er sich manchmal, ob sie ihren alten Feind, die Pein, wirklich besiegt – oder vielleicht vielmehr nur dafür gesorgt hatten, daß sie die Schreie der Gequälten nicht mehr hörten.
Der Aufzug hielt mit einem kaum spürbaren Ruck an, und Artner zwängte sich schräg gehend durch die Tür, deren Hälften wie üblich mit enervierender Langsamkeit auseinanderglitten. Das taten sie nur hier unten, und der Mechaniker der Aufzugsfirma hatte es schon vor drei Jahren aufgegeben, nach der Ursache dafür suchen zu wollen. Artner kannte sie. Es war der gleiche Grund, weswegen es hier unten immer ein wenig muffig roch und feucht war, weswegen die Wände, obwohl in freundlichen Pastelltönen gestrichen, trotzdem nichts anderes als ein finsteres Gewölbe waren, und weswegen es hier niemals richtig hell wurde, allen Neonbatterien und Halogenstrahlern zum Hohn. Dieser spezielle Trakt lag anderthalb Stockwerke unter den Kellern und zweieinhalb Stockwerke unter der Straße, und heute wie damals war es ein Ort, an dem weder die Zeit noch irgend etwas, was Menschen taten, wirklich zählte. Heute wie damals enthielt er einige wenige Räume, die den allersichersten Teil dieses Gebäudes darstellten: jene Zellen, in denen die Hoffnungslosen untergebracht waren, die Unheilbaren und gefährlich Gewalttätigen, denen man nur eine einzige Hilfe angedeihen lassen konnte; eine Hilfe, die darin bestand, sie vor sich selbst und davor zu schützen, anderen Schaden zuzufügen. Hier wurden ihm die Grenzen seines Könnens vor Augen geführt, vielleicht die absolute Grenze, die niemals überschritten werden konnte – vielleicht auch nicht sollte.
Auch das war etwas, das Artner niemals laut eingestanden hätte, aber er wußte, daß es jene Schwelle gab, an der jedes ärztliche Können scheiterte, vor der jede Chemie kapitulierte und hinter der das Wissen nichts mehr zählte. Eine Grenze, hinter der der Geist verloren war und die sich nur in eine Richtung überschreiten ließ: hinein in ein Gefängnis, dessen Mauern aus Furcht und dessen Ketten aus Grauen bestanden, und dessen Fenster groß und ohne Gitter waren und direkt in die tiefsten Abgründe der Hölle führten. Seit einem halben Jahrtausend lag hier unten die Schwelle zu jenem Grenzbereich, und so hatte dieser Ort vielleicht einfach zuviel Qual gesehen, um noch irgend etwas anderes zurückgeben zu können.
Deshalb war es für Artner ›das Haus der Pein‹. Nicht mehr und nicht weniger, und es würde sich nie ändern.
Er hatte die Sicherheitstür erreicht, zog seine Codekarte aus der Brusttasche und schob sie in den dafür vorgesehenen Schlitz, ohne auch nur hinzusehen. Die Tür öffnete sich mit einem leisen Summen, und Artner trat hindurch. Später, wenn er den Sicherheitstrakt in umgekehrter Richtung wieder verließ, würde er eine sechsstellige Codenummer eingeben und sich zudem dem mißtrauischen Auge einer Videokamera stellen müssen, um die Tür erneut zu öffnen. In gewisser Weise ähnelte der Hochsicherheitstrakt dem zweiten, inneren Gefängnis, in dem die Egos seiner Bewohner gefangen waren – man kam relativ leicht hinein, aber nur sehr schwer wieder hinaus.
Sein Blick glitt automatisch über die Türen, die den schmalen Gang mit der gewölbten Decke flankierten, fünf auf der rechten, vier auf der linken Seite, in unterschiedlichen, angenehm anzuschauenden Farben gestrichen und scheinbar nicht mehr als normale Zimmertüren, an denen es sogar Griffe gab – die sich allerdings nicht so ohne weiteres niederdrücken ließen. Nur einem sehr aufmerksamen Beobachter wäre vielleicht aufgefallen, daß diese Türen aus massivem, drei Zentimeter dickem Stahl bestanden, die Bolzen in den Angeln verschweißt waren – und neben jeder ein kleiner Videomonitor flimmerte, der das Bild einer Weitwinkelkamera auf der anderen Seite zeigte. Der tote Winkel wäre nicht einmal groß genug gewesen, eine Katze zu verbergen.
Artner passierte vier Türen und öffnete die letzte Tür auf der rechten Seite des Ganges. Dahinter lag ein kleines, fensterloses Büro, dessen nicht eben billige Einrichtung vergeblich versuchte, einen behaglichen Eindruck zu vermitteln, und das von einem knappen Dutzend kleiner Halogenlampen in schon beinahe übertriebene Helligkeit getaucht wurde. In der Wand neben der Tür flimmerten die Zwillinge der Überwachungsmonitore draußen im Gang, und ein weiterer, etwas größerer Schirm zeigte den Gang selbst. In regelmäßigen Abständen schaltete das Bild um und zeigte die Hälfte des Korridors, die vor der Sicherheitstür lag und zum Aufzug führte. Der Mann hinter dem Schreibtisch nickte Artner flüchtig zu und machte eine Notiz in irgendeiner Liste, die vor ihm lag und vermutlich vollkommen zwecklos war. Artner wußte, daß er den Großteil seiner Schicht damit zu verbringen pflegte, zweitklassige Kriminalromane zu lesen, und die Sicherheitstechnik, die sie für Unsummen hatten installieren lassen, vornehmlich nutzte, sich selbst zu bewachen und den mit etwas furchtbar Wichtigem Beschäftigten zu spielen, sobald jemand den Lift verließ und hereinkam. Artner war es gleich. Solange er seine Arbeit tat und die Patienten in den sechs belegten Zellen im Auge behielt, konnte er seinetwegen tun und lassen, was er wollte. Trotzdem, dachte er, irgendwann einmal würde er sich einfach den Spaß machen und ihm eines der Bänder Vorspielen, die die versteckte Kamera aufnahm, die ihn überwachte.
»Alles in Ordnung?« Es war keine Frage, auf die er eine Antwort erwartete – wäre nicht alles in Ordnung gewesen, dann wäre er jetzt nicht hier, wenigstens nicht allein.
Der Mann nickte auch nur, aber nach einigen Sekunden fiel ihm dann doch ein, was Artner wirklich meinte. Hastig legte er seinen Stift aus der Hand, bequemte sich endlich, seinen Blick ganz von seiner Liste und dem vermutlich darunter versteckten Jerry-Cotton-Roman zu lösen, und sah zu Artner hoch. »Zelle fünf, nehme ich an?«
Artner nickte mit unbewegtem Gesicht und verkniff sich die scharfe Antwort, die ihm auf der Zunge lag. »Gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse?«
»Nicht während meiner Schicht. Ich bin seit –«, er schob den Ärmel seiner weißen Pflegeruniform hoch und sah mit angestrengter Miene auf die Armbanduhr, als hätte er nicht schon seit Beginn seiner Schicht die Minuten gezählt, die er noch bis zum Feierabend durchstehen mußte, »– knapp sechs Stunden hier. Seitdem hat sie sich nur einmal gerührt, um aufs Klo zu gehen, danach ist sie wieder zur Salzsäule erstarrt. Soll ich aufmachen?«
Artner sagte auch jetzt nichts, sondern beließ es wieder bei einem stummen Nicken. Die anzügliche Art des Burschen ging ihm auf die Nerven, schon seit einer ganzen Weile, aber heute besonders. Aber es lohnte sich nicht, Energie darauf zu verschwenden, ihn in seine Schranken zu verweisen. Der Mann war nicht besonders intelligent, was wohl auch der Grund war, weswegen er hier unten saß und nichts anderes zu tun hatte, als sechs postkartengroße Bildschirme im Auge zu behalten und FBI-Romane zu lesen. Artner war dieser Umstand sehr recht.
»Ja«, sagte er im Hinausgehen, »und schalten Sie das Mikrophon ab.«
»Wie üblich, Doc«, antwortete der Mann, und wie auch sonst immer fügte er hinzu: »Okidoki.«
Artner verdrehte im Stillen die Augen und schwieg weiter. Er wußte, daß er das Mikrophon nicht abschalten würde, ebensowenig wie die Kamera, die die Zelle vierundzwanzig Stunden am Tag überwachte, aber das spielte keine Rolle – Artner besaß einen Schlüssel für den Raum, in dem die Bänder verwahrt wurden, und würde die Kassette später austauschen, wenn es nötig war.
Vor der letzten Tür auf der linken Seite des Ganges blieb er stehen und wartete, bis sich das leise Summen von vorhin wiederholte. Diesmal schwang die Tür nicht von selbst auf. Er mußte einen Schlüssel aus der Tasche nehmen – einen von sechs verschiedenen, für jede dieser Türen – und im Schloß herumdrehen. Und er behielt den kleinen Monitor in der Wand vor sich dabei aufmerksam im Auge. Die Gestalt, die zusammengerollt wie ein zu großer Fötus auf dem Bett lag, regte sich nicht. Weder als er das Schloß entriegelte, noch als er die Tür öffnete und eintrat. Erst als er die Tür wieder hinter sich zuschob und das charakteristische leise Metallklicken zum zweiten Mal erscholl, regte sich der weiße Schemen auf weißem Grund; eine fließende Bewegung, die immer gleich war und Artner immer aufs neue faszinierte, denn mehr als alles andere erinnerte sie ihn an eine sich öffnende Blüte – ein weißer Kelch, der auf sein Erscheinen wie auf die ersten warmen Strahlen der Sonne reagierte und sich dem Licht zuwandte. Nichts an dieser Bewegung war irgendwie plump oder derb. Claudia ging jene kraftvolle Unbeholfenheit der Bewegungen völlig ab, die die meisten Menschen bei bestimmten Geisteskranken unbewußt abstößt und die wohl zu einem guten Teil der Grund sind, weswegen sie Behinderten so befangen gegenübertreten. Ihre Bewegungen waren im Gegenteil von einer fließenden Eleganz, als wäre sie in krassem Gegensatz zu ihrem Krankheitsbild in einem ewigen Tanz gefangen, aus dem sie nicht mehr ausbrechen konnte. Verdammt zu immerwährender Grazie, die selbst die kleinste ihrer seltenen Bewegungen zu einem Zeremoniell machte.
Die Blüte entfaltete sich weiter, und nach den Blättern sah er ihr Herz: als schmales, verwundbares Gesicht, fast so weiß wie das Kleid, das sie trug, und so zerbrechlich wie Porzellan. Und auch dieses Gesicht entsprach nicht dem Bild, das man sich im allgemeinen von einer Patientin in diesem Teil des Instituts machte. Es gab keine starren, in eine von namenlosem Schrecken erfüllte Unendlichkeit blickenden Augen, keine eingefallenen Wangen um einen zu einem stummen Schrei gerundeten Mund, ihre Züge waren nicht erschlafft. Allenfalls, daß ihr Gesicht eine unnatürliche Blässe zeigte. Aber selbst das hatte einen ganz banalen Grund – sie hatte diesen Raum seit sechs Jahren kaum verlassen. Das einzige Licht, das sie kannte, war das der winzigen Halogenscheinwerfer in der gemauerten Decke ihrer Welt. Claudia war sehr schön. Sie war es schon als Kind gewesen, als sie hierhergekommen war; nicht mehr ganz Mädchen, aber noch lange keine Frau. Und jetzt – noch nicht ganz Frau, aber schon lange kein Mädchen mehr – war sie es noch viel mehr.
Artner blieb einige Sekunden unter der Tür stehen, während Claudia ihn aufmerksam musterte. Nicht mit dem leeren Blick einer Idiotin, sondern offen, neugierig und überrascht und auch ein ganz kleines bißchen mißtrauisch. Und zugleich auch sehr freundlich. Sie sah ihn immer auf die gleiche Art an, wenn er hereinkam, denn obwohl er sie fast täglich besuchte, war er doch jedesmal ein Fremder für sie.
Claudias Gedächtnis hatte vor sechs Jahren aufgehört, neue Informationen aufzunehmen. Sie lebte in einem ständigen Jetzt, das sich mit jedem Tag um weitere vierundzwanzig Stunden von der Gegenwart entfernte.
»Hallo«, sagte er.
Das Mädchen legte lauschend den Kopf auf die Seite und schien über das Wort nachzudenken, dann sagte auch sie: »Hallo.«
Artner lächelte. Heute war ein guter Tag. Es gelang ihm nicht immer, ihr Vertrauen zu erringen. Heute mochte sie den Fremden, der ihre Zelle betreten hatte. Aber das war längst nicht immer so. An manchen Tagen war ihr Mißtrauen stärker als ihre natürliche Offenheit, so daß sie nur einsilbig auf seine Fragen antwortete oder auch gar nicht mit ihm redete. Vorsichtig, um sie nicht durch eine unbedachte Bewegung zu erschrecken, ging er zum Bett und ließ sich auf der Kante nieder; nahe genug, um Vertrauen zu signalisieren, aber nicht so nahe, daß er ihre Sicherheitsdistanz unterschritten hätte.
»Wie fühlst du dich?« fragte er.
»Gut. Danke. Wer… sind Sie?«
»Ein Freund«, antwortete Artner, und dann, nach einem kurzen, letzten Zögern, fügte er hinzu: »Erinnerst du dich an mich?« Er stellte diese Frage nicht immer, denn manchmal reichte sie allein aus, alles zu zerstören. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihnen war wie ein filigranes Gespinst, das jeden Tag aus einem anderen Material zu bestehen schien: mal aus massivem Stahl, so daß nichts es erschüttern konnte, manchmal aber auch aus feinster Gaze, die schon unter der geringsten Belastung zerriß. Auch wenn ihr Gedächtnis nicht funktionierte, so schien doch allein der Versuch, sich zu erinnern, etwas in ihr auszulösen. Und nur in den allerseltensten Fällen war es etwas Gutes.
Aber heute war wirklich ein guter Tag. Claudia schüttelte nur den Kopf und fragte: »Sollte ich das?«
»Nein«, antwortete Artner lächelnd. »Es ist nicht wichtig. Ich bin nur gekommen, um mich ein bißchen mit dir zu unterhalten. Wenn du möchtest, heißt das.«
»Unterhalten? Gern. Aber worüber?«
Das war nun wirklich etwas Besonderes. Claudia entwickelte selten irgendeine Initiative. In diesem Punkt ähnelte sie tatsächlich der Blume, mit der er sie manchmal verglich: Sie konnte unter bestimmten Umständen reagieren, aber so gut wie niemals agieren. Um so mehr überraschte ihn nun diese Frage. Zugleich erfüllte sie ihn mit einer jähen Hoffnung, einer Hoffnung, die er sich im Grunde vor Jahren schon selbst verboten hatte.
Artner rief sich innerlich zur Ordnung. Er hatte schon vor Jahren aufgehört, an Wunder zu glauben, und würde jetzt bestimmt nicht wieder damit anfangen, nur weil es so schön gewesen wäre. Diese Frage war kein erster Schritt, sondern ein Zufall. Eine Bedeutungslosigkeit, in die er etwas hineingeheimniste.
»Worüber du willst«, antwortete er.
Das Mädchen überlegte einen Moment, dann sagte es: »Über uns?«
Artner erstarrte. Ein unsichtbarer Kübel mit Eiswasser ergoß sich über seinen Rücken, und sein Herz schlug plötzlich hart und so ruckartig, als müsse es jedesmal gegen einen enormen Widerstand ankämpfen. »Über uns? Was… was meinst du damit?«
Sie antwortete nicht gleich. Nicht laut. Aber zum ersten Mal, seit Artner Claudia kannte, wünschte er sich fast, ihr Blick wäre so leer und erloschen, wie er es sein sollte, denn er las die Antwort auf seine Frage überdeutlich in ihren Augen. »Aber das weißt du doch genau«, sagte sie schließlich. »Du kannst es nicht vergessen haben. Es war so schön, und du hast gesagt – «
Artner erinnerte sich im letzten Moment des Pflegers, der in seinem Wachraum auf der anderen Seite des Ganges saß und vermutlich den Teufel getan und das Mikrophon ausgeschaltet hatte, sondern mit großen Ohren lauschte und mit noch größeren Augen zusah. Er unterbrach sie hastig: »Aber du hast doch gerade selbst gesagt, daß du mich gar nicht kennst. Erinnerst du dich denn an irgend etwas? Etwas, das mit mir zu tun hat – oder mit dir?« Er sprach langsam und wählte seine Worte mit großem Bedacht. Selbst, wenn der Pfleger nicht lauschte, würde trotzdem jedes Wort auf Band aufgezeichnet, und auch wenn er die Kassette spätestens heute abend löschen würde: Man konnte nie wissen, wer sich daran zu schaffen machte.
Claudia lachte. »Das ist ein Spiel, nicht wahr?« fragte sie. »Ich verstehe. Du willst mich auf die Probe stellen. Du glaubst, ich hätte dich vergessen, nicht wahr? Aber das habe ich nicht.«
Artner schluckte schwer. Er hätte sie mit einigen wenigen Worten zum Schweigen bringen können, und alles in ihm schrie danach, es zu tun. Er wußte, wie empfindlich sie war, und er wußte noch sehr viel besser, womit er sie verletzen konnte. Aber er brachte es einfach nicht über sich. Auch wenn das, was sie sagen mochte, das Ende seiner Karriere bedeuten konnte – oder doch zumindest den Anfang von sehr, sehr viel Ärger –, er konnte ihr nicht weh tun. Dazu war sie einfach zu verwundbar. Ihre Verletzlichkeit war ihre stärkste Waffe, und sein Wissen darum, daß sie diese Waffe niemals bewußt einsetzte, machte es nur noch schlimmer.
Und es gab noch einen Aspekt: Vor allem anderen war Artner auch in diesem Moment Wissenschaftler und Arzt. Besonders Arzt. Und er hätte schon blind und taub sein müssen, um nicht zu begreifen, daß er Zeuge einer wirklich dramatischen Veränderung wurde. Sein Erschrecken wich einer ebenso heftigen wie kaum noch beherrschbaren Erregung. Hatte er noch vor ein paar Sekunden selbst gedacht, daß er nicht an Wunder glaubte? Er erlebte gerade eines!
»Ein Spiel? Ja, warum eigentlich nicht? Spielen wir ein Spiel – was hältst du davon?« Er streckte die Hand in ihre Richtung aus, berührte sie aber nicht, sondern machte eine flatternde, auffordernde Geste mit den Fingern; eine Bewegung, mit der man einen jungen Hund oder eine Katze zum Spielen herausgefordert hätte. »Wir tun einfach so, als ob ich alles vergessen hätte, und du sagst mir, woran du dich zu erinnern glaubst.
Und danach sage ich dir, was davon stimmt und was nicht. Einverstanden? «
»Aber das ist doch albern«, antwortete Claudia. »Du mußt dich doch erinnern – an den Tag, an dem du hier heruntergekommen bist und der Pfleger über seinem Kriminalroman eingeschlafen war. Du hast die Monitore abgeschaltet und bist dann hierhergekommen.«
Diesmal war es kein Eimer mit Eiswasser, sondern ein ganzer Tankzug. Das konnte sie nicht wissen. Er hatte es ihr nicht erzählt. »Woher… weißt du das?« fragte er. Seine Stimme klang belegt und schien einem Fremden zu gehören. Was ging hier vor? Was ging hier vor!
»Er hat es mir gesagt«, antwortete Claudia.
»Er? Von wem sprichst du?« Aber plötzlich wußte er es. Mit einem Mal ergab alles einen Sinn. Die anzüglichen Blicke, die plumpen Vertraulichkeiten – hatte er wirklich geglaubt, damit durchzukommen? Es war weiß Gott nicht das erste Mal, daß intellektuelle Intelligenz gegen Bauernschläue angetreten war und den kürzeren gezogen hatte. »Der Pfleger«, sagte er resignierend. »Er hat alles gesehen. Er hat es dir gesagt. Ich frage mich nur, warum. Was wollen Sie? Geld? Oder einen Freibrief, in Zukunft zu tun oder zu lassen, was immer Sie wollen?«
Die letzten Sätze hatte er lauter gesprochen, und sie galten nicht Claudia, sondern dem Mikrophon, das sicherlich noch immer jedes seiner Worte aufzeichnete. »Sie täuschen sich, ich bin nicht zu erpressen.«
Ganz plötzlich wurde ihm klar, daß das tatsächlich stimmte. Er brauchte sich keine Sorgen zu machen. Niemand würde ihn fragen, was er getan hatte. Es spielte keine Rolle. Claudia war erwacht. Gegen jede Hoffnung, gegen all seine wissenschaftliche Überzeugung und die seiner Kollegen hatte sie die Mauer niedergerissen, hinter der sich ihr Bewußtsein mehr als ein halbes Jahrzehnt verborgen gehalten hatte, und das war alles, was im Moment interessierte. Sie erinnerte sich. Vielleicht nicht einmal wirklich. Vielleicht nur an das, was ihr diese erpresserische kleine Ratte erzählt hatte, aber das war gleich. Noch gestern hatte sie nicht einmal gewußt, wer sie war.
»Wann hat er es dir erzählt?« fuhr er aufgeregt fort. Er mußte sich zusammenreißen, damit sie seine Erregung nicht zu deutlich spürte. Vielleicht war die Tür nur einen Spaltbreit geöffnet; eine unbedachte Bewegung mochte genügen, sie wieder ins Schloß zu werfen, und das möglicherweise für immer. Artner war wild entschlossen, es nicht so weit kommen zu lassen; er hatte den Fuß einmal in der Tür, und dort würde er bleiben, selbst wenn er ihm dabei zerquetscht wurde. Aber er mußte behutsam vorgehen.
»Heute? Gestern? Was genau hat er erzählt?«
»Nicht der Pfleger«, antwortete Claudia mit einem Lachen, als hätte er etwas ungemein Naives gefragt. »ER.«
»Er? Wer… Von wem sprichst du? War außer mir noch jemand hier? Einer der anderen Ärzte vielleicht?«
»Er ist noch immer hier«, antwortete Claudia. »Ich habe so lange auf ihn gewartet, aber ich wußte immer, daß er kommt. Er hat es mir gesagt, und was er sagt, das hält er auch ein.«
Artner nickte. Er war nicht überrascht. Auch nicht enttäuscht. Von all den Klischees, die über Geistesgestörte bei den – sogenannten – Normalen existierten, kamen Phantome und körperlose Stimmen, die Befehle erteilten, der Wahrheit vielleicht am nächsten. Aber er kam endlich auf die richtige Idee, den Umkehrschluß aus Claudias Worten zu ziehen und zumindest die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, daß der Pfleger das Mikrophon tatsächlich abgeschaltet hatte, und zog sein eigenes Diktiergerät aus der Tasche. Er schaltete es ein und legte es deutlich sichtbar auf die Bettdecke zwischen Claudia und sich. Das Mädchen betrachtete es neugierig. Das gleichmäßige Rotieren der winzigen Spulen faszinierte sie sichtlich.
»Dieser… Er«, begann Artner vorsichtig. »Wer ist er? Wie sieht er aus? Ich meine – ist er nur eine Stimme, oder hat er auch einen Körper?«
»Natürlich hat er einen Körper!« antwortete Claudia lachend, diesmal in einem Ton, der ganz deutlich machte, daß sie mittlerweile ihn für verrückt hielt.
»Ich nehme an, er kommt dich ab und zu besuchen«, vermutete Artner.
»Er ist hier«, antwortete Claudia.
»Immer? Ich meine: auch jetzt, in diesem Augenblick?«
»Aber natürlich«, sagte Claudia. Sie seufzte, zog die Beine unter den Körper und rückte ein kleines Stück von ihm fort. »Das ist ein dummes Spiel«, sagte sie. »Ich will es nicht mehr spielen.«
Fast ohne daß er es spürte, schlich sich ein Lächeln in Artners Züge. Er hatte beinahe vergessen, daß er es im Grunde mit einer Elfjährigen zu tun hatte, die sich nur zufällig im Körper einer jungen Frau aufhielt. Wenn das Wunder Bestand hatte, würde es sicher interessant sein zu beobachten, in welchem Tempo ihr Geist die Zeit aufzuholen imstande war, die ihr Körper ihm voraus hatte.
»Also ist er auch jetzt hier«, sagte er. »Und wo? Ich… würde ihn gerne sehen.«
»Hinter dir«, antwortete Claudia. »Du mußt dich nur herumdrehen, dann kannst du ihn sehen. Aber ich weiß nicht, ob du das wirklich willst.«
Artner drehte sich nicht herum. Er wußte, was er sehen würde – nämlich rein gar nichts. Doch er wußte auch, daß dies ein gefährlicher Moment war. Er hatte den Fuß wieder ein kleines Stückchen weiter in die Tür geschoben, aber er mußte nun aufpassen, daß er sie nicht versehentlich selbst zuwarf.
»Er spricht also mit dir«, sagte er. »Und was sagt er? Ich meine: Erzählt er dir Geschichten, oder gibt er dir Befehle? Stellt er Fragen?«
Hinter ihm war ein Geräusch. Etwas raschelte. Nein, kein Rascheln. Es war ein Laut, als würde ein prall aufgeblasener Luftballon von einer Faust zusammengedrückt. Beinahe hätte Artner sich erschrocken herumgedreht, aber er unterdrückte den Impuls im letzten Moment. Da war nichts. Da konnte nichts sein. Die Tür ließ sich nur mit dem Schlüssel öffnen, den er in der Tasche hatte – sowohl von dieser als auch von der anderen Seite.
»Er ist da«, sagte Claudia noch einmal. »Das reicht. Er muß nicht viel sagen. Er hatte versprochen, daß er kommen würde, damals, als sie… als sie mich hergebracht haben. Damals hat er es mir versprochen, und ich wußte, daß er sein Versprechen einhält. Deshalb habe ich nicht mit euch geredet. Ich durfte es nicht.«
»Warum?« fragte Artner. »Hat er es dir verboten? Und du hast dich all die Jahre daran gehalten? Die ganze Zeit?«
»Es war sehr lange«, bestätigte Claudia. »Aber ich wußte ja, daß er kommt. Er lügt nie. Das kann er gar nicht.«
Der Ballon wurde weiter zusammengedrückt. Das stumpfe Gummigeräusch nahm an Intensität zu. Es war ein sehr unangenehmer Laut, der den Effekt von Fingernägeln auf einer Schiefertafel oder einer Gabel auf einem Topfboden hatte. Artner spürte ein unbehagliches Kribbeln, das sein Rückgrat hinunterlief. Etwas wie unsichtbare Finger schien seine Kehle zu berühren – nicht, um ihn zu ersticken, aber um ihm das Atmen schwieriger zu machen. Und plötzlich hatte er das ganz intensive Gefühl, daß da tatsächlich etwas war. Er gestattete sich nicht, diesem Gefühl nachzugeben. Ebensowenig wie er dem Impuls nachgab, sich doch herumzudrehen. Das Phänomen war ihm bekannt, auch wenn er es noch nie am eigenen Leibe erlebt hatte. Claudia wäre nicht die erste Patientin, die über eine erstaunliche Suggestivkraft verfügte, und er wäre nicht der erste Arzt, der ihr erlag. Schließlich war er ihr schon einmal erlegen, wenn auch in vollkommen anderer Hinsicht.
»Es war in der Tat eine sehr lange Zeit«, sagte er. »Ich habe dir wirklich geglaubt, weißt du? Und die anderen auch. Wir dachten, du könntest dich an nichts erinnern.«
Ein deutlicher Ausdruck von Trauer erschien in Claudias Augen. »Ich durfte nichts verraten«, sagte sie. »Ich glaube, ich… ich hätte es dir auch jetzt nicht sagen sollen. Vielleicht war es ein Fehler. Er wird vielleicht zornig.«
»Und dann wird er dir etwas tun?« vermutete Artner.
»Nein. Aber ich habe Angst, daß er dir etwas tut. Ich… ich weiß, daß du mein Freund bist, und was… wir getan haben, das war sehr schön. Aber er sagt, daß es nicht gut war. Er ist zornig auf dich, und er will dich bestrafen.«
»Und wie?« fragte Artner. Das Geräusch war immer noch da. Etwas leiser jetzt, dafür aber auch deutlicher. Etwas war hier. Verdammt, es konnte nicht sein, und er würde sich einfach nicht erlauben, ausgerechnet in diesem Moment hysterisch zu werden, aber er hatte das immer deutlichere Gefühl, daß jemand – etwas – den Raum betreten hatte. Verrückt, völlig verrückt. Dabei sollte er doch der Normale hier sein!
»Geh jetzt«, sagte Claudia plötzlich. »Geh schnell. Er ist sehr wütend.«
»Auf mich?« fragte Artner.
»Ja, aber er kann dir nichts tun, solange du ihn nicht ansiehst. Dreh dich nicht herum. Bitte!«
»Er wird mir nichts antun«, sagte Artner ruhig – sehr viel ruhiger, als er in Wirklichkeit war. Er hatte die Hände fest gegen die Oberschenkel gepreßt, damit sie nicht zitterten, und es fiel ihm immer schwerer, seine Stimme unter Kontrolle zu behalten. Aber es war sehr wichtig, daß er jetzt Stärke zeigte. Wichtig für sie und… ja, und wohl auch für ihn. Arzt, dachte er, heile dich selbst!
»Und er wird auch dir nichts tun«, fuhr er fort, mit leiser, aber sehr fester Stimme. »Du brauchst keine Angst zu haben. Solange ich in deiner Nähe bin, kann dir nichts geschehen. Ich werde es dir beweisen.«
»Nein!« Claudia schrie fast. Sie hatte die Hände halb erhoben, wie um sie vor das Gesicht zu schlagen, die Bewegung aber nicht zu Ende geführt. »Nicht! Sieh ihn nicht an! Sieh ihn nicht an!«
Es war zu spät. Artner lächelte noch einmal das zuversichtlichste Lächeln, das er zustande bringen konnte, und drehte sich dann zur Tür – nicht nur, weil er es Claudia schuldig war, um das Versprechen auf Schutz einzulösen, das er ihr gegeben hatte, sondern auch, und vielleicht sehr viel mehr, weil er sich selbst beweisen mußte, daß er so stark war, wie er tat.
Er war es nicht. Artner saß einfach da und starrte die Tür an, und während er es tat, für die unendliche Dauer einer geschlagenen Minute, war sein Kopf wie leergefegt. Er empfand nichts. Keine Furcht, keine Überraschung, kein Erstaunen, gar nichts. Vielleicht war das, was er in diesem Moment empfand, die absolute Form des Horrors. Ein Entsetzen, das zu tief und zu gewaltig war, um Platz für etwas so Banales wie Erschrecken oder Angst zu lassen, und das etwas in ihm einfach getötet hatte. Schnell, schmerzlos und endgültig. Er saß einfach da und starrte die Tür an, und der einzige halbwegs klare Gedanke, den er hatte, war, daß er nun endlich wußte, woher dieser gummiartige Laut kam.
Es war die Tür.
Sie hatte sich verändert. Was gerade noch massives Metall gewesen war, schien zu einer hauchdünnen weißen Latexhaut geworden zu sein, durch die etwas hindurchwollte. Eine Art… Gestalt… Schemen… Schatten. Er wußte es nicht. Es war groß und schien die Umrisse eines Menschen zu haben, zugleich aber auch die von etwas unsagbar Fremdem – anderem –, das sich jedem Versuch einer Beschreibung entzog.
Dann schlug das Entsetzen doch zu. Warnungslos, schnell und brutal wie ein Axthieb. Artner sprang mit einem keuchenden Schrei in die Höhe und taumelte zurück. Seine Kniekehlen prallten gegen die Bettkante. Er spürte, daß er das Gleichgewicht verlieren würde, kämpfte trotzdem mit wild rudernden Armen dagegen an und beschleunigte seinen Sturz so nur noch mehr. Hilflos fiel er rücklings halb über das Bett, rollte zur Seite und prallte schwer auf den harten Steinboden.
Ein rotglühender Schmerz schoß durch seinen Ellbogen. Artner keuchte vor Pein, rollte aber trotzdem blitzschnell herum und sah zur Tür hoch. Betete, daß das Entsetzen verschwunden und die Tür wieder nichts als eine Tür aus massivem Stahl sein würde.
Sein Gebet verhallte ungehört.
Es war noch da. ER war noch da. Die dünne Membran hatte sich weiter gedehnt, und er erkannte jetzt deutlich die Umrisse eines menschlichen Körpers. Arme, Beine, Schultern und Gesicht, die sich weiter und weiter aus der Tür herausarbeiteten, gegen den zähen Widerstand ankämpften und ihn besiegten. Langsam und unendlich mühevoll, aber auch unaufhaltsam. Die Membran wurde dünner, begann hier und da ihre Farbe zu verlieren und wurde milchig, transparent. Und der schreckliche stumpfe Laut wurde immer intensiver und nahm ihm nun wirklich den Atem. Ein Arm wuchs aus der Tür hervor, eingehüllt in einen gewaltsam geschaffenen Handschuh, der aus der dünnen Latexhaut herausgezerrt wurde, dann ein zweiter, und schließlich…
… wußte er, was es war. Aber die Erkenntnis kam zu spät. Die Membran zerriß mit einem hellen, Happenden Laut, und etwas Schwarzes, Riesiges brach aus der Tür hervor. Etwas mit Flügeln und Klauen, das ganz aus fauligem Fleisch und Blut und Krallen bestand.
Artner kam nicht einmal mehr dazu, einen Schrei auszustoßen. Das Haus der Pein hatte seinen Häscher geschickt, um ihn zu holen und ihn in das wahre Geheimnis dieses Ortes einzuweihen. Doch selbst diesen Gedanken dachte er nicht mehr ganz zu Ende.
Sein Herz setzte aus.
Kapitel 2
»Kamikaze!« Prein schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, als hielte er sie tatsächlich für einen Mitsubishi- Jäger aus dem Zweiten Weltkrieg, den er ersatzweise statt auf einen amerikanischen Flugzeugträger auf den aufgeschlagenen Plastikhefter vor sich herabstürzen ließ. »Genau das ist es, was Sie tun, Sillmann, Wissen Sie eigentlich, was Sie im Begriff sind zu tun, mein lieber Junge?«
»Ich bin nicht Ihr lieber Junge«, antwortete Mark ruhig. »Und ich bin auch nicht hier, um mich mit Ihnen zu streiten, Herr Direktor.« Seine Ruhe wirkte aufgesetzt, das spürte er selbst. Aber sie war es nicht. Er hatte sich auf dieses Gespräch vorbereitet, und die Reaktion, die Prein gerade demonstrierte, war nur eine von mehreren Alternativen, die er vorausgesehen und auf die er sich vorbereitet hatte, seit sehr langer Zeit.
»Bitte – dann meinetwegen Herr Sillmann«, antwortete Prein. Obwohl er die Stimme nur um eine Winzigkeit hob, brachte er es irgendwie fertig, eine Verachtung in die letzten beiden Worte einfließen zu lassen, die Marks Ruhe erschütterte. Vielleicht war es damit doch nicht ganz so weit her, wie er sich selbst eingeredet hatte.
Der Direktor stand auf und flog einen zweiten Kamikaze- Angriff auf den Kunststoffordner, um ihn mit einem Knall zuzuklappen. Der daumendicke Hefter enthielt Marks Schulakte, wie das auf dem Deckblatt eingeklebte Foto eindeutig bewies. Er hatte schon auf dem Tisch gelegen, als er hereingekommen war. Offenbar war er nicht der einzige, der dieses Gespräch vorausgesehen hatte, und vielleicht auch nicht der einzige, der gründlich darauf vorbereitet war. Prein seufzte, rammte die Hände in die Hosentaschen und starrte einen Punkt neben Marks linkem Fuß auf dem Boden an. Er sah sehr aufgebracht aus, aber auch ein wenig müde – was in Anbetracht der Uhrzeit allerdings auch verständlich war. Ein Uhr nachts war seit ein paar Minuten vorbei.
»Also gut«, sagte er. »Versuchen wir es noch einmal in Ruhe.«
»Ich glaube nicht, daß das Sinn hat«, antwortete Mark. »Mein Entschluß steht fest.« Was leider nicht einmal annähernd für seine Stimme galt – sie zitterte jetzt, und Mark verfluchte sich in Gedanken dafür. Und noch einmal, als ihm klar wurde, daß er die Hände fest um die Armlehnen des Sessels gekrallt hatte. Der Verrat, den er seinen Worten verboten hatte, wurde von seiner Körpersprache begangen. Hastig löste er seinen Griff, und selbstverständlich blieb auch das Prein nicht verborgen. Fehler Nummer drei – aber wahrscheinlich eher Nummer dreißig.
Mark hätte sich am liebsten selbst geohrfeigt. Er hatte sich so gut auf dieses Gespräch vorbereitet. Seit Wochen hatte seine Lieblingsbeschäftigung darin bestanden, genau diese Szene immer und immer wieder in Gedanken durchzuspielen, in allen möglichen Variationen und natürlich immer mit dem gleichen Ende: einem, in dem er nicht nur als Gewinner, sondern auch eindeutig als Sieger aus diesem Büro herausmarschieren würde. Er hatte die besseren Karten. Er hatte das Recht auf seiner Seite: juristisch, und moralisch noch viel mehr. Und trotzdem hatte er immer mehr das Gefühl, den Kampf bereits verloren zu haben, noch bevor er eigentlich richtig begonnen hatte. Im Grunde hatte der Direktor ihm mit einer Winzigkeit den Wind aus den Segeln genommen – mit der aufgeschlagenen Akte, die auf seinem Tisch gelegen hatte, als Mark hereinkam. Sie machte jede Erklärung überflüssig. Prein hatte ebenso gewußt wie er, daß dieses Gespräch kommen würde, und auch, wann. Und er hatte es wahrscheinlich gar nicht nötig, sich darauf vorzubereiten.
»Ihr Entschluß steht also fest.« Prein schüttelte den Kopf, ging zu seinem Tisch zurück und ließ sich in den zerkratzten Ledersessel auf der anderen Seite fallen, daß das altersschwache Möbelstück ächzte. »Und das vermutlich seit Monaten. Seit… nicht ganz einem Jahr. Stimmt’s?«
Mark war ziemlich überrascht, aber er versuchte, es sich wenigstens nicht allzu deutlich anmerken zu lassen, und änderte nur seine Taktik, sofern er jemals eine gehabt hatte. Die Idee, einen großen Abgang zu inszenieren, sich sechs Jahre Frust und Zorn, sechs Jahre heruntergeschluckte Wut und pubertäre Rachephantasien in einer einzigen großen Szene von der Seele zu reden und mit Donnerhall und Wetterleuchten abzutreten, war hübsch als Idee, aber mehr auch nicht. Er würde einfach aufstehen und gehen. Jetzt. Er stand auf, und Prein sagte ganz ruhig und auf eine Art, die es Mark einfach unmöglich machte, nicht zu gehorchen: »Bitte setzen Sie sich wieder.«
»Herr Direktor, bitte«, sagte er. »Es hat wirklich keinen Sinn. Sie verschwenden nur Ihre Zeit, wenn Sie versuchen, mich umzustimmen.«
»Das habe ich auch nicht vor«, antwortete Prein. »Ich habe schon seit einer geraumen Weile gewußt, was Sie Vorhaben.«
»Woher?« fragte Mark.
Prein lächelte. »Niemand hat Sie verraten, wenn es das ist, was Sie glauben«, sagte er. »Ich bin der Direktor dieses Internats. Der Oberquälgeist. Glauben Sie wirklich, irgendeiner Ihrer Kameraden würde dem Statthalter Luzifers auf Erden ein Geheimnis anvertrauen?«
Mark blieb ernst. »Woher wissen Sie es dann?«
»Sie sind nicht der erste, der an seinem achtzehnten Geburtstag zu mir kommt, um genau das zu tun, was Sie vorgehabt haben: mir einmal richtig die Meinung zu sagen. Mir ins Gesicht zu sagen, was Sie von mir persönlich und diesem ganzen Scheißladen hier halten, und mir zumindest rhetorisch den Schreibtisch umzuwerfen. Das hatten Sie doch vor, oder?«
Mark machte nicht einmal den Versuch, seine Überraschung zu verbergen. Gut, dann konnte Prein eben Gedanken lesen. Das änderte auch nichts mehr.
»Wenn es Sie beruhigt«, fuhr Prein fort, als er einsah, daß Mark nicht antworten würde, »keiner hat es bisher getan. Jedenfalls ist keiner bisher damit durchgekommen. Ein paar sind frech geworden, aber die meisten sind am Ende einfach wieder gegangen – übrigens zum Großteil zurück auf ihr Zimmer, nicht zum Bahnhof.«
»Ich werde nicht auf mein Zimmer gehen«, sagte Mark.
Prein deutete ein Achselzucken an und sah auf die Uhr. »Sie wollen den Nachtzug nehmen, richtig? Dann haben wir noch etwas Zeit.«
Dieser Meinung war Mark eigentlich ganz und gar nicht. Es war beinahe Viertel nach eins, und er mußte sich im Gegenteil sputen, um noch rechtzeitig am Bahnhof zu sein. Allen Unkenrufen zum Trotz fuhr die Bundesbahn nämlich meistens doch pünktlich, und nachts eigentlich immer.
»Ich fahre Sie zum Bahnhof, wenn Sie möchten«, sagte Prein.
»Sie?«
»Ich kann Auto fahren«, versicherte ihm Prein. »Sie wissen doch – diese Dinger mit vier Rädern, zwei Türen und einem Lenkrad vorne links.«
Mark begann sich allmählich zu fragen, ob Preins Humor wirklich echt war oder nur Bestandteil seiner Taktik, ihn einzuseifen. Wenn es ums Einseifen ging, war er gut.
»Ich dachte eigentlich, daß Sie mich dazu überreden wollen, hierzubleiben.«
»Natürlich will ich das«, gestand Prein gelassen. »Aber überreden bedeutet nicht zwingen. Geben Sie mir die Chance? Bestenfalls gelingt es mir, und wenn nicht – nun, dann sind Sie bequemer und schneller zum Bahnhof gekommen als zu Fuß. Übrigens auch trockener.«
Warum eigentlich nicht? dachte Mark. Er durchschaute Preins Falle sofort, aber dummerweise war es eine von der Art, die man ruhig erkennen konnte – man tappte trotzdem hinein. Seine guten Vorsätze und der sorgsam kultivierte Zorn, den er mit in dieses Gespräch gebracht hatte, richteten sich nun gegen ihn. Er konnte die Bitte des Direktors kaum ausschlagen, ohne vollends das Gesicht zu verlieren. Und so ganz nebenbei – Prein hatte recht: Der Weg zum Bahnhof war weit, und es war verdammt kalt draußen. Widerwillig nickte er.
»Dann lassen Sie uns gehen.« Prein stand auf, verstaute mit einer schwungvollen Bewegung Marks Schulakte in der Schreibtischschublade und zog im Hinausgehen die Jacke an, die an einem Haken neben der Tür hing. Kein Zweifel – er war gut vorbereitet gewesen. Wesentlich besser als Mark.
Sie redeten nicht, während sie die zwei Treppen in die Haupthalle hinuntergingen. Die Nacht hatte das Internat fest in ihrem Griff, auf den Fluren brannten nur die blassen Lichter der Nachtbeleuchtung, die die Proportionen der Dinge verzerrten und das Gleichgewicht von Licht und Schatten vertauschten. Und eine eigentümliche Stille schien von dem ganzen weitläufigen Gebäude Besitz ergriffen zu haben; ein Schweigen, wie Mark es hier selten erlebt hatte – und er war hier nicht das erste Mal mitten in der Nacht unterwegs.
Wahrscheinlich lag es an ihm. Nichts hier hatte sich verändert. Nicht wirklich. Er war es. Es war das unwiderruflich letzte Mal, daß er diesen Weg ging, und Mark mußte sich zu seiner eigenen Überraschung eingestehen, daß er so etwas wie Wehmut empfand. Er hatte das Internat und alles, was damit zu tun hatte, gehaßt. Vom ersten Tag an, an dem er hier angekommen war, und jedem, der ihm gefolgt war. Aber plötzlich konnte er das nicht mehr. Trotz allem war dieses Internat seine Heimat, viel mehr, als ihm bisher bewußt gewesen war. Er hatte ein Drittel seines Lebens hier verbracht – eigentlich sogar weit mehr als die Hälfte, wenn er nur jenen Teil berücksichtigte, an den er sich wirklich erinnerte –, und eine solche Zeit ging nicht spurlos vorüber. Jeder Zentimeter hier war ihm vertraut, viel mehr als sein eigenes Elternhaus, das er in den letzten sechs Jahren nur viermal gesehen hatte. Er kannte jeden Schritt, er wußte, was hinter jeder Tür lag, welche Gesichter, welche Geräusche und welche Gerüche ihn erwarteten, und er empfand tatsächlich so etwas wie einen Abschiedsschmerz, der wahrscheinlich sogar noch viel intensiver gewesen wäre, hätte er sich nicht mit aller Macht dagegen gewehrt. Das Gefühl war sehr intensiv, doch er kämpfte es mit großer Willensanstrengung nieder. Später, wenn er in der Bahn saß und es kein Zurück mehr gab, konnte er sich dem großen Katzenjammer hingeben.
Sein Gepäck stand in einem Winkel neben der Tür, der vom Licht der Notbeleuchtung ausgelassen wurde. Manchmal machte der Hausmeister nachts noch eine Runde, und Mark hatte nicht das Risiko eingehen wollen, womöglich zurückzugehen und an seine Tür hämmern zu müssen, falls er die beiden Koffer und die Reisetasche fand und etwa mitnahm. Prein zog die linke Augenbraue hoch, als er Marks Fluchtvorbereitungen sah, doch sein Kommentar beschränkte sich auf ein wissendes Lächeln. Wortlos griff er in die Jackentasche, nahm den Hauptschlüssel heraus und öffnete die Tür. Ein weiterer Pluspunkt für ihn und ein weiterer Minuspunkt für Marks Planung. Er hatte vorgehabt, durch ein Fenster zu steigen. Nicht besonders gefährlich, aber unbequem, und ganz gewiß nicht das, was man sich unter einem großen Abgang vorzustellen hatte.
Dicht hinter dem Direktor verließ er das Gebäude und erlebte die nächste Überraschung, als er Preins Wagen nur wenige Meter neben der Tür geparkt sah. »Sie hätten mir sagen können, daß Sie Gedanken lesen können«, sagte er. »Das hätte mir in den letzten Jahren wahrscheinlich eine Menge Ärger erspart.«
Prein lachte. »Aber das ist Grundvoraussetzung für meinen Job«, sagte er. »Wenn man nicht telepathisch veranlagt ist, wird man gar nicht erst eingestellt – wußten Sie das etwa nicht?« Er öffnete den Kofferraum, wartete, bis Mark sein Gepäck hineingelegt hatte, und warf den Deckel dann so schwungvoll zu, daß Mark hastig die Hand zurückziehen mußte.
»Jemand hat mich verraten«, sagte Mark grimmig.
»Nein«, antwortete Prein. »Oder doch, ja, Sie selbst.«
»Ich?«
Mark blieb überrascht mitten im Schritt stehen und starrte Prein an. Aber der Direktor war schon auf der anderen Seite des Wagens und weigerte sich, Blickkontakt mit ihm aufzunehmen, sondern schloß die Tür auf und stieg ein. Erst als Mark auf dem Beifahrersitz Platz genommen und sich angeschnallt hatte, redete Prein weiter.
»Das mit dem Wagen, da war ich nicht sicher«, sagte er. »Ich habe gehofft, daß Sie mir diese Chance geben, aber ganz überzeugt war ich nicht. Aber ich war sicher, daß Sie gehen. Und zwar heute, an Ihrem achtzehnten Geburtstag. Eigentlich habe ich Sie schon eine Stunde früher erwartet. Schlag zwölf. Übrigens – herzlichen Glückwunsch.«
»Und wieso?« fragte Mark. Preins Gratulation überhörte er absichtlich. Heute war sein Geburtstag, aber es bestand absolut kein Grund zum Feiern. Der Direktor startete den Motor und schaltete nacheinander das Licht und die Scheibenwischer ein. Es nieselte leicht, und die Regentropfen zerschellten auf der Windschutzscheibe zu Millionen winziger Prismen. »Weil ich Sie kenne, mein lieber Junge«, antwortete er. »Ja, ja, ich weiß – Sie sind nicht mein lieber Junge, aber ich bleibe trotzdem dabei. Aus alter Gewohnheit, sozusagen. Sie sind seit sechs Jahren hier, und Sie waren in diesen sechs Jahren nicht unbedingt das, was man einen Musterschüler nennt, nicht wahr? Ich erinnere mich nicht an einen einzigen Monat, in dem Ihr Name nicht aus dem einen oder anderen Grund in irgendeiner Besprechung erwähnt wurde – oder bei einer Beschwerde auftauchte. Und vor einem knappen Jahr hat sich das schlagartig geändert. Sie sind immer noch kein Musterschüler, aber längst nicht mehr so renitent und aufsässig wie früher. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Erklärungen: Sie sind schlagartig vernünftig geworden oder haben sich entschlossen, die Zähne zusammenzubeißen und es irgendwie durchzustehen, ohne allzuviel Schaden zu nehmen. Und Schüler, die von einem Tag auf den anderen vernünftig werden, sind äußerst selten, das können Sie mir glauben.«
»Ich wußte nicht, daß ich so leicht zu durchschauen bin«, sagte Mark zerknirscht.
»Nur keine Sorge, das sind Sie nicht«, antwortete Prein. Plötzlich lachte er wieder. »Soll ich Ihnen verraten, woher ich so genau wußte, wann Sie abreisen? Sie haben vor zwei Wochen das Ticket gekauft. Der Mann am Fahrkartenschalter hat mich angerufen.«
»Wie bitte?« fragte Mark entrüstet.
»Das hier ist eine kleine Stadt«, sagte Prein. »Sie sind nicht der erste Internatszögling, der sich klammheimlich eine Fahrkarte besorgt und abreist. Wir haben… gewisse Vereinbarungen mit den Leuten am Bahnhof.«
»Interessant«, sagte Mark. »Aber nicht so ganz legal, oder?«
»Keine Ahnung«, gestand Prein. »Und im Moment wohl auch ziemlich gleichgültig. Haben Sie wenigstens vor, weiter zur Schule zu gehen? Sie wissen, daß Sie das Abi mit links schaffen können, wenn Sie sich nur ein bißchen anstrengen.«
»Also kommen Sie endlich zum Thema«, sagte Mark. Der Wagen hatte die Ausfahrt erreicht, und Prein warf einen raschen Blick in beide Richtungen die Straße hinunter, bevor er Gas gab. Obwohl das Internat mitten in der Stadt lag, waren sie das einzige Fahrzeug, das unterwegs zu sein schien.
»Das bin ich schon die ganze Zeit«, antwortete Prein. »Wir reden über Sie, oder etwa nicht? Und um nichts anderes geht es. Ob Sie es glauben oder nicht – ich kann Sie verstehen.«
»Das glaube ich kaum«, sagte Mark leise. Vermutlich glaubte Prein sogar genau zu wissen, was in ihm vorging, aber das konnte er gar nicht. Er hatte sechs Jahre Einzelhaft in der Hölle hinter sich, und er wußte nicht einmal, warum. In ihm saß ein Schmerz, der so tief war und so fest verwurzelt, daß er ihn wahrscheinlich nie wieder völlig loswerden würde. Man hatte ihn verletzt. Nicht nur sein Vater, die ganze Welt hatte ihn verletzt, vollkommen grundlos und sehr tief. Dafür haßte er sie: die ganze Welt, seinen Vater und am allermeisten sich selbst, daß er diese grausame Strafe so lange ertragen hatte, ohne den Mut aufzubringen, sich zu wehren. Und im Grunde tat er das auch jetzt noch nicht. Er lief davon, das war alles.
»Ich war nicht besonders begeistert, als Ihr Vater Sie damals hergebracht hat«, sagte Prein. »Ich leite zwar ein Internat, aber ich lebe trotzdem nicht im vorletzten Jahrhundert. Ich glaube nicht, daß man irgend jemanden zu seinem Glück zwingen kann. Sie wollten nicht hier sein. Sie wollten nicht kommen, und Sie wollten nicht bleiben. Und Sie waren jeden einzelnen Tag unglücklich, an dem Sie hier gewesen sind. Richtig?«
Mark schwieg, doch das war Prein Antwort genug.
»Ich kenne solche Geschichten zur Genüge«, sagte er. »Sie gehen fast immer schief. Und bei Ihnen hat es mir besonders leid getan.«
»Und wieso?« fragte Mark einsilbig. Er fühlte sich immer unbehaglicher. Er hatte erwartet, daß Prein ihm drohen oder ihn ködern oder mit einer Kombination aus beidem versuchen würde, ihn umzustimmen, doch er tat nichts von alledem, und damit verstieß er irgendwie gegen die Spielregeln. Was er tat, das war nicht fair.
»Weil ich Sie mag«, antwortete Prein ganz offen. »Sie sind ein intelligenter Junge. Sie waren damals ein intelligentes Kind, und Sie sind zu einem cleveren jungen Mann herangewachsen, der seinen Weg ganz bestimmt geht. Ich nehme meinen Beruf sehr ernst, wissen Sie. Ich glaube nicht, daß meine Pflicht sich darin erschöpft, Ihnen acht Stunden am Tag lateinische Vokabeln einzuhämmern und es Ihnen möglichst schwerzumachen, sich außerhalb der Sperrstunde aus dem Internat zu entfernen. Außerdem zahlt mir Ihr Vater eine Menge Geld dafür, daß ich mich um Sie kümmere.«
Endlich kam er zur Sache, dachte Mark. Sein Vater hatte die Hand im Spiel, natürlich hatte er das. Was hatte er erwartet? »Weiß er Bescheid?« fragte er.
»Ihr Vater?« Prein schüttelte den Kopf. »Gott bewahre, nein. Noch nicht. Ich werde ihn anrufen – das muß ich –, aber nicht sofort. Sie sind um sieben am Bahnhof, richtig? Dann reicht es, wenn ich ihn kurz danach benachrichtige. Er wird mir glauben, wenn ich behaupte, daß Ihr Verschwinden erst am Morgen aufgefallen ist. Versprechen Sie mir, nach Hause zu gehen und nicht irgendeinen Blödsinn zu machen?«
»Sie haben doch gerade selbst gesagt: Ich bin ein intelligenter Junge. Würde ein intelligenter Junge irgendeinen Blödsinn machen?«
»Gerade die Intelligentesten machen den größten Blödsinn«, sagte Prein lachend. »Sie würden sich wundern.«
Mark warf einen Blick nach vorne. Sie waren nicht mehr weit vom Bahnhof entfernt. Die Dreiviertelstunde Fußmarsch, die er einkalkuliert hatte, war auf knapp fünf Minuten zusammengeschrumpft, aber er wünschte sich fast, er hätte Preins Angebot ausgeschlagen. Der Direktor spielte dieses Spiel nach seinen Regeln, die Mark weder kannte noch beherrschte. Er sollte nicht so freundlich sein.
»Warum tun Sie das?« fragte er.
»Was?«
»Das wissen Sie genau«, antwortete Mark. »Sie geben sich doch nicht mit jedem Ihrer Schüler so große Mühe. Es ist mitten in der Nacht, und Sie sollten eigentlich wütend auf mich sein.«
»Und wer sagt Ihnen, daß ich es nicht bin?«
»Hat mein Vater Ihnen den Auftrag gegeben?« fragte Mark ganz direkt.
»Ich sagte Ihnen doch: Ihr Vater weiß nichts davon«, antwortete Prein. »Warum ich es tue? Zum einen, weil ich meinen Beruf sehr ernst nehme, wie ich schon sagte, und zum anderen, weil ich es ehrlich bedauern würde, wenn Sie jetzt alles wegwerfen. Sie könnten eine glänzende Zukunft vor sich haben. Sie sind intelligent genug, um ein Studium zu schaffen. Sie sind nicht faul, Ihr Vater hat Geld – und Sie laufen vielleicht gerade Gefahr, das alles zu verlieren.«
»Geld«, murmelte Mark düster. »Ja, das hat er. Aber sonst auch nichts.«
Prein sah ihn auf eine sonderbare Weise an. Er antwortete nicht, sondern warf einen Blick in den Rückspiegel, setzte trotz der vollkommen leeren Straßen den Blinker und bog auf den Bahnhofsvorplatz ein.
Sein vorbildliches Verhalten als Autofahrer hörte dann aber auch schon auf. Er parkte nicht nur direkt vor dem Haupteingang, sondern machte sich einen Spaß daraus, den Wagen zweimal vor und zurück zu setzen, um auch ganz genau unter dem Halteverbotsschild zum Stehen zu kommen. Erst dann drehte er den Zündschlüssel herum, lehnte sich im Sitz zurück und fragte: »Hassen Sie Ihren Vater?«
Mark mußte tatsächlich einen Moment über diese Frage nachdenken. Es war nicht das erste Mal. Er hatte sich schon oft selbst gefragt, ob er seinen Vater tatsächlich haßte, aber er hatte bisher noch nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage gefunden, und vielleicht wollte er das auch gar nicht. »Ich weiß es nicht«, sagte er. »Ich glaube nicht. Damals, als … als das mit meiner Mutter geschah und er mich hierhergebracht hat, da habe ich geglaubt, daß ich ihn hasse. Aber das stimmte nicht. Ich liebe ihn nicht besonders.«
Prein sah ihn an, als wäre dies schlimmer, als hätte er seine Frage mit einem klaren Ja beantwortet. »Wie geht es Ihrer Mutter?« fragte er.
»Ich weiß es nicht«, sagte Mark. »Ich habe seit mehr als einem halben Jahr nichts mehr von ihr gehört. Aber ich werde sie besuchen, gleich morgen.«
»Das sollten Sie auch«, sagte Prein. »Und vielleicht sollten Sie sich Gedanken über Ihre Zukunft machen. Ich meine, haben Sie sich je überlegt, wie sie aussehen soll?«
»Nein«, gestand Mark. »Aber ich weiß ziemlich genau, wie sie nicht aussehen wird. Ich werde nicht hierbleiben.«
»Sie können jederzeit zurückkommen«, versicherte Prein.
»Und warum sollte ich das?« wollte Mark wissen. »Warum erst Weggehen, um dann wiederzukommen?«
»Weil man sich oft an einem Ort wohler fühlt, zu dem man zurückkehrt«, antwortete Prein mit großem Ernst. »Es sind noch anderthalb Jahre bis zum Abitur. So lange ist das nicht. Es gibt bessere Schulen als unsere, das ist mir klar. Aber es gibt auch eine Menge schlechterer. Überlegen Sie es sich. Es ist immerhin eine Alternative. Bleiben Sie einfach ein, zwei Wochen bei Ihrem Vater, und danach kommen Sie zurück, wenn Sie wollen.«
»Und dann?« fragte Mark. Spätestens jetzt sollte er wütend auf Prein werden, denn nach all diesen semantischen Kopfständen ging er nun ziemlich plump vor. Er hatte versucht, sich anzuschleichen, und es war ihm gelungen. Aber offensichtlich wollte er nun die letzten Meter im Sturmangriff zurücklegen.
»Das wird sich zeigen«, sagte Prein. »Ein Studium, nehme ich an. Ich habe mit Ihrem Vater schon vor einer ganzen Weile darüber geredet. Er ist ein sehr eigenwilliger Mensch, und er wird es Ihnen sicher nicht leichtmachen. Aber glauben Sie mir: Sie werden bestimmen, wie es weitergeht, nicht er.«
»Das tue ich doch bereits.«
»Nein«, widersprach Prein. »Was Sie gerade machen, ist etwas anderes. Sie haben endlich die Schlüssel zu Ihrem Abteil bekommen, und jetzt reißen Sie die Tür auf und springen blindlings hinaus. Es ist nicht ganz ungefährlich, von einem fahrenden Zug zu springen. Man kann ziemlich hart landen.«
»Ich weiß«, sagte Mark. »Aber ich glaube, er fährt in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ich kann nicht warten, bis er von selbst anhält.«
»Dann ändern Sie seine Richtung«, antwortete Prein. »Sie können jetzt die Weichen stellen. Aber das geht nicht mit Gewalt. Sie wollen weg? Dann reden Sie mit Ihrem Vater, damit er Sie gehen läßt. Auf eine andere Schule meinetwegen. Obwohl ich es bedauern würde. Vielleicht in eine andere Stadt – eine, die Sie aussuchen.«
»Ja«, sagte Mark. »Und irgendwann einmal werden wir uns Wiedersehen, und ich werde älter und viel vernünftiger geworden sein und meinen Doktor gemacht haben, damit ich als Zukünftiger Chef der Sillmann-Werke auch vorzeigbar bin, und wir werden gemeinsam darüber lachen, wie dumm ich doch damals war. Nein, danke.« Seine Stimme wurde bitter. »Sie sind auch nicht anders als er.«
»Was ist so schlecht daran, vernünftig zu sein?« wollte Prein wissen.
»Nichts, sobald man sich darüber verständigt hat, was man unter dem Begriff vernünftig versteht.«
»Ich denke, so sehr unterscheiden sich unsere Auffassungen da gar nicht«, erwiderte Prein. »Denken Sie über meinen Vorschlag nach. Ich gebe Ihnen offiziell zwei Wochen frei vom Unterricht. Mehr kann ich nicht verantworten. Aber diese zwei Wochen kriege ich hin; auch Ihrem Vater gegenüber. Was halten Sie davon?«
Er hatte es geschafft, Mark ein weiteres Mal zu verblüffen. Sein Vorschlag klang verlockend, denn er schien ihm alle Optionen offen zu lassen. Aber zugleich spürte Mark auch, daß das eben nur so schien. Was Prein ihm wirklich bot, das war nicht die Möglichkeit, zurückzukommen und alles besser zu machen, sondern ein bequemer Weg, sich aus der Verantwortung zu schleichen. Nicht sehr weit und nicht für lange, aber vielleicht schon zu weit. Wenn es etwas gab, das Mark an sich selbst haßte, dann war es seine Unfähigkeit, nein zu sagen. Bei aller Zeit, die er gehabt hatte, darüber nachzudenken, war ihm sein Entschluß, an seinem achtzehnten Geburtstag ein neues Leben nach seinen Vorstellungen zu beginnen, trotzdem unendlich schwergefallen. Er hatte es getan – oder war zumindest auf dem besten Weg dazu –, aber er ahnte auch, daß er, wenn er Preins Angebot jetzt annahm, alles zunichte machen würde. Diese Zweiwochenfrist zu akzeptieren würde eben bedeuten, nicht nein zu sagen, und das nächste Mal würde es ihm noch schwererfallen.
»Ich muß jetzt gehen«, sagte er.
Prein sah auf die grün leuchtende Digitaluhr im Armaturenbrett. Er hatte noch fast eine halbe Stunde, ehe sein Zug kam. Eine lange Zeit auf einem kalten, zugigen Bahnsteig. Aber er versuchte nicht mehr, Mark zu irgend etwas zu überreden, nicht einmal dazu, die restliche Zeit im geheizten, trockenen Wagen zu verbringen, sondern stieg wortlos aus und half ihm, das Gepäck aus dem Kofferraum zu holen.
Wenigstens ersparte er ihm eine große Abschiedsszene. Er stieg einfach wieder ins Auto, während Mark die Bahnhofshalle betrat, aber er fuhr nicht weg. Erst eine halbe Stunde später, als der Zug langsam aus dem Bahnhof hinausrollte und die Fünf-Stunden-Reise durch die Nacht antrat, sah Mark ihn vom Bahnhofsvorplatz wegfahren.
Kapitel 3
Das Geräusch, mit dem der Körper auf dem Wagendach aufgeschlagen war, würde er wohl nie wieder vergessen.
Dabei war es nicht einmal besonders laut gewesen; ein sonderbar weicher, dumpfer Laut – das Geräusch eben, das ein menschlicher Körper verursachte, der mit der Beschleunigung auf ein Wagendach aufprallte, die er bei einem Sturz aus gut fünfundzwanzig Metern Höhe erfuhr. Es hatte ein bißchen wie eine überreife Tomate geklungen, die man auf eine Tischplatte fallen läßt. Das Ergebnis sah auch ganz ähnlich aus – nur daß es sich nicht um eine Tomate gehandelt hatte, sondern um einen Mann von ungefähr hundertachtzig Pfund Gewicht, dessen Überreste die beiden Krankenwagenfahrer noch immer von der Straße… entfernten, soweit sie nicht auf dem Wagendach oder auf Hansens Uniform klebten, hieß das.
Bremer musterte seinen jüngeren Kollegen mit einer Mischung aus Mitleid und Erleichterung. Mitleid, weil Hansen nach immerhin fünf Minuten noch immer nicht aufgehört hatte, sich zu übergeben, obwohl sein Magen längst leer war und er nur noch bittere Galle hervorwürgte, und Erleichterung, daß nicht er es gewesen war, dem dieser Trottel beinahe auf den Kopf gefallen wäre. Für den Toten selbst empfand er nicht einmal eine Spur von Mitleid, wohl aber einen gehörigen Zorn, und zwar deutlich mehr als nur eine Spur. Bremers privater Meinung nach – die sich von der des Polizeiobermeisters Peter Bremer manchmal gehörig unterschied – hatte jeder das Recht, über sein Leben frei zu entscheiden und es im Extremfall auch zu beenden, wann und wo er es wollte. Aber verdammt noch mal – niemand hatte das Recht, es so





























