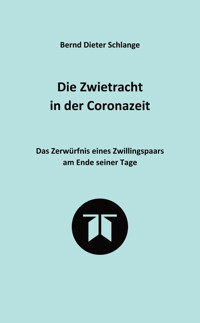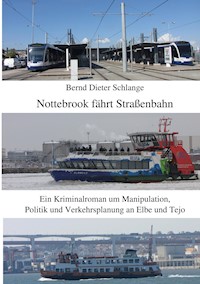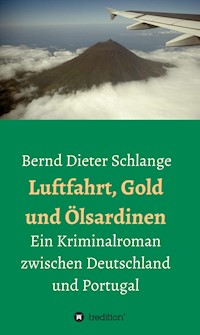3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Barbara Charlotte Smith lebte von 1936 bis 2020 in Deutschland und den USA. Sie war keine Prominente. Aber sie kann all denen als Beispiel dienen, für die Würde, Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit die Werte sind, die ihr Handeln vor allen anderen bestimmen sollen. Wer sie kannte - sei es aus dem privaten Umfeld, sei es aus ihrer politischen (in den letzten Jahren vor allem drogenpolitischen) Arbeit, sei es noch aus ihrer Zeit als Krankenschwester, weiß, wie wichtig ihr diese Werte waren und wie unwichtig persönliche Eitelkeit. Das Buch skizziert die schwerwiegenden und manchmal sehr mutigen Entscheidungen in ihrem Leben, aber auch ihren Umgang mit dem Tod, vor allem dem jener Menschen, die sie ganz besonders liebte. Das Buch schildert aber auch ihre beständige Lebensfreude, die Rolle die Musik und Reisen, vor allem aber die Liebe dabei spielten. Es schildert ihren Mut zu leben, weiterzuleben auch nach schweren Ereignissen. Es schildert ihre Entschlossenheit, für ihre Werte einzustehen, immer, für andere und für sich selbst. Und es schildert ihre Art, Abschied zu nehmen, am Ende auch ihren sehr bewussten Abschied von ihrem eigenen Leben. Vor allem aber zeigt es auf Bildern aus ihren fast 84 Lebensjahren die Entwicklung einer Frau, die sich bei der ersten Möglichkeit entschloss, ihren niedlichen Vornamen Bärbel in Barbara zu ändern, weil dieser Name besser zu ihr passt. Das Buch soll denen zur Erinnerung dienen, die Barbara Charlotte Smith kannten und liebten. Es soll aber auch denen Gelegenheit geben, etwas über diese besondere Frau zu erfahren, die sie im Leben nicht kennengelernt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dignity, freedom,
love and justice
were her highest values.
So she lived
and so she died.
Barbara pleased
to tell all of you
she is very glad
for having met you.
Würde, Freiheit,
Liebe und Gerechtigkeit
waren ihre
höchsten Werte.
So lebte sie
und so starb sie.
Barbara bat,
Euch allen zu sagen,
dass sie sehr glücklich ist,
Euch begegnet zu sein.
Inhalt
Ein Leben
Namenlos
Bärbel Charlotte Freimark
Bärbel Charlotte Auer
Barbara Charlotte Auer
Barbara Charlotte Freimark
Barbara Charlotte Smith
Barbara Charlotte Verbridge
Barbara Charlotte Smith
Barbara Smith: 100. Drogentote 1992
Barbara Smith: Hamburger Lesetage 2015
Anhang
Anreise zur Gedenkstätte in der Haake
Lebensdaten Barbara C. Smith
Bilder auf den Umschlagseiten
Dank
Zusammenstellung dieses Buches
Ein Leben
Namenlos
Geburt in der Schuhstraße in Halberstadt, der Vater SS-Offizier, die Mutter Zahntechnikerin mit christlicherpazifistischer Haltung. Das ist der Beginn eines Lebens von 83,9 Jahren.
Bärbel Charlotte Freimark
Bärbel, den Vornamen hat der Vater ausgesucht. Charlotte, das ist der Vorname der Mutter.
Die Geburtsurkunde mit dem Hakenkreuz, die gibt es noch als Kopie. Auf dem Ersatzdokument sieht man Hammer und Zirkel.
Kniepelfax, ihr Teddybär, wird sie bis in ihr Grab begleiten.
Dann der Umzug nach Merseburg, als der Vater dort ins Sanatorium kommt.
Der Ariernachweis, der nicht sehr weit zurückreicht.
Der Umzug nach Quedlinburg, als die Bombenangriffe auf die Buna- und Leunawerke zunehmen.
Und Onkel Otto, der Barbaras Mutter beschimpft, als sie Barbara beibringt, wie man aus dem Inneren eines Brötchens ein Lamm formt. Barbara wird bis an ihr Lebensende etwas Teig aus Brötchen zum Spielen verwenden.
Der gemeinsame Blick mit der Großmutter durch die Vorhänge bei Verdunklung auf die Menschen, die zum Quedlinburger Bahnhof getrieben werden – auch wenn Barbara nicht versteht, was da geschieht, versteht sie doch, dass da etwas Schreckliches geschieht. Sie wird ihr Leben lang von dieser Erfahrung erzählen.
Der Hitlerjunge, der im elterlichen Haus einquartiert wird und den sie um seine schmucke Uniform beneidet.
Die Gespräche im Elternhaus über das jüdische Ehepaar aus dem Bekanntenkreis, das Schlaftabletten genommen hat, um nicht ins KZ zu kommen.
Barbaras Bruder Peter bleibt als Folge einer Knochen-TB erst einmal im Rollstuhl.
Der demente Großvater, der nachts mit der Nachtmütze auf dem Kopf „UUUHH-UUUHH“ rufend als Gespenst durchs Haus geistert. Der deshalb ins Krankenhaus kommt und dann angeblich an Lungenentzündung stirbt. Später wird Barbara klar, dass er im Rahmen des „Euthanasieprogramms“ ermordet wurde.
Peter, der immer wieder ihr Puppenhaus demoliert, bis sie Rache an seinen Zinnsoldaten nimmt und so dieses Spiel für immer beendet.
Der Tod des Vaters im Sanatorium.
Erste Gedanken, wie die Liebe funktioniert zwischen zwei so unterschiedlichen Menschen wie ihren Eltern.
Die Bombardierung Halberstadts: Eine Speisekarte, die mit dem Ruß und Rauch aus dem brennenden Halberstadt herübergeweht wird. Und dann der Besuch in der zerstörten Stadt, zu Fuß – ganz oben auf der Ruine von Barbaras Geburtshaus das Gerippe ihres ersten Puppenwagens. Weiter unten muss Onkel Otto liegen.
Jazzmusik, die sie mit Peter auf dem „Feindsender“ hört.
Die Angst der Erwachsenen vor den russischen Soldaten.
Die Flüchtlinge im Haus mit ihrem kleinen Sohn Helmuth. Helmuth, der Barbara und ihrem Bruder beim Hausarrest Essen besorgt.
Die russischen Soldaten, die ihr nach ihrem Sturz in das kalte Wasser der Bode das Leben retten und ihr Schokolade schenken.
Milch von schlecht gehaltenen Ziegen aus Westerhausen, die sie trotz ihres Widerwillens trinken muss – der Beginn einer lebenslangen Abneigung.
Der Ausflug zum Flüchtlingslager mit Helmuth, dem sie nach einem Streit so lange mit dem Puppenwagen in die Hacken fährt, dass sie den Rückweg schließlich auf verschiedenen Straßenseiten bewältigen – immer mit wütenden Blicken über die Fahrbahn hinweg. Die Schläge mit dem Teppichklopfer, die sie nach dem Ausflug von der Mutter erhält, die schon die Polizei alarmiert hatte.
Die erste Zigarette mit ihrer Freundin, heimlich gedreht aus Tabakkrümeln und Zeitungspapier und die Enttäuschung, als sich das Ganze sofort in Flammen auflöst.
Die Fahrt der Schulklasse zum „Paten“ Otto Grotewohl, für die Barbara dank ihrer schönen Schrift das Transparent malen darf.
Die Reise ins Kindererholungsheim nach Göhren. Die Bücklinge, die sie in Göhren für ihre Familie kauft und von denen keiner Quedlinburg erreicht.
Die Weigerung Barbaras und Peters, bei den Pionieren und insbesondere an deren vormilitärischer Ausbildung teilzunehmen. Die heimlich getragenen Abzeichen der christlichen Jugend.
Das Ende von Barbaras Schulzeit nach acht Jahren, weil das Geld für den weiteren Schulbesuch nur für einen reicht und dem körperbehinderten Peter der Vorzug gewährt wird.
Die eigene Anmeldung in der Ballettschule und die Abmeldung durch die Mutter.
Die Ermahnung der Mutter, einen sicheren Beruf zu erlernen, um niemals von einem Mann abhängig zu sein – ein Rat, für den Barbara ihr Leben lang dankbar sein wird.
Jazzmusik, die sie zusammen mit Peter auf den Westsendern hört.
Der Beginn der Optikerlehre in Quedlinburg.
Die erste richtige Zigarette – Barbara wird zur Raucherin.
Die Warnungen von Freunden aus dem Rat des Kreises vor drohenden politischen Repressionen und der Beschluss, deshalb in die USA auszuwandern, wo schon zwei Freundinnen von Barbaras Mutter leben, Tante Ilse und Tante Lotte.
Die Fahrradfahrt der 15jährigen Barbara gemeinsam mit einer Tante über die Berliner Grenze – mit einem Koffer und Kniepelfax auf dem Gepäckträger. Das „Halt“ des Vopos, die Aufforderung der Tante, nicht zurückzuschauen, Barbaras Blick zurück in den Pistolenlauf und Barbaras Entschluss, weiterzufahren.