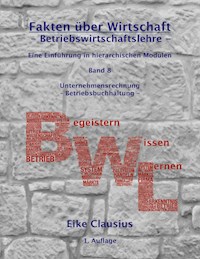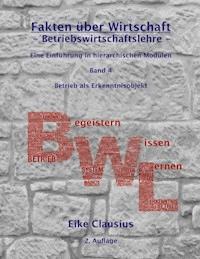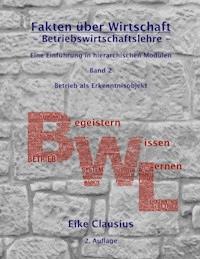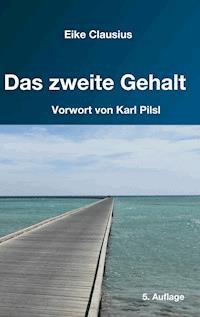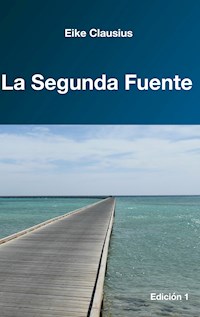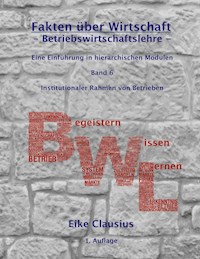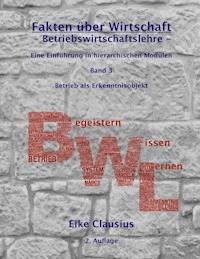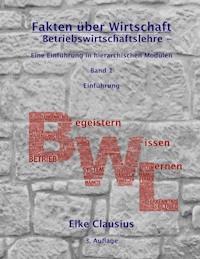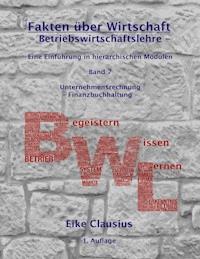
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fakten über Wirtschaft: Begeistern - Wissen - Lernen
- Sprache: Deutsch
Sie wollten schon immer in der Lage sein, über Themen der Wirtschaft kompetent mitzureden? Erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Betriebs-Wirtschafts-Lehre! Mit diesem Buch beziehungsweise Ebook aus der Reihe „Fakten über Wirtschaft: Begeistern – Wissen – Lernen“ verfügen Sie über ein multifunktionales Tool, um die Grundlagen der BWL kennen zu lernen: Das Buch lässt sich zum einen als Fließtext lesen und steht zum anderen durch ein ausführliches Sachwortregister als Nachschlagewerk zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Inhalte in übersichtlichen, hierarchischen Modulen dargestellt, um Zusammenhänge und Struktur der inhaltlichen Aspekte zu verdeutlichen. Der Band 7 der Reihe „Fakten über Wirtschaft: Begeistern – Wissen – Lernen“ richtet sich auf den instrumentalen Rahmen von Betrieben. Eingegangen wird auf die Unternehmensrechnung in der Ausprägung der Finanzbuchhaltung: Begriffsdeutungen, gesetzliche Grundlagen der Finanzbuchhaltung, Inventur, Inventar, Bilanzarten, -schemata, -bewertungsgrundsätze, -erstellung sowie Gewinn- und Verlustrechnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Der Verfasser bedankt sich an dieser Stelle bei all denjenigen, mit deren Anteilnahme und Mithilfe dieser Band entstanden ist. Besonders meine Studenten/ -innen der Einführung in die Betriebswirtschaftslehre trugen durch ihr ständiges Hinterfragen und ihre hilfreichen Anregungen zum Entstehen dieses Werkes bei.
Mein Dank geht hier auch an meinen wissenschaftlichen, studentischen Mitarbeiter (BA BWL & BA Hons Business) Kevin Reuther sowie meine wissenschaftliche Mitarbeiterin Dipl-oec. Petra Grundke. Beide haben mit intensivem Interesse und hohem persönlichen Einsatz viel zur Erstellung dieses Bandes beigetragen. Ihnen sei auch für die Ermunterungen und Diskussionen gedankt.
Mein ganz persönlicher Dank gilt meiner Frau Evelyn, die mich vor familiären und zeitlichen Blockaden bewahrt, unterstützt und mir stets Mut zugesprochen hat: Ihr widme ich diese Publikation.
Eike Clausius
Berlin/ Zwickau 2016
Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
Konstitutionaler Rahmen: Unternehmenswendepunkte
Institutionaler Rahmen von Betrieben
Instrumentaler Rahmen des Betriebes
7.1 Unternehmensrechnung – Betriebliches Rechnungswesen
7.2 Aufgaben und Formen des Rechnungswesens
7.3 Grundbegriffe des Rechnungswesens
Unternehmensrechnung: Finanzbuchhaltung
8.1 Begriff, Aufgaben und Gliederungsphasen der Finanzbuchhaltung
8.2 Buchführungssysteme und –instrumente
8.3 Gesetzliche Grundlagen der Finanzbuchhaltung
8.4 Inventur - Inventurverfahren - Inventar
8.5 Bilanz
8.5.1 Entwicklung der Bilanz aus dem Inventar
8.5.2 Bilanzarten
8.5.3 Gliederungsschema einer Bilanz
8.5.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung
8.5.5 Bewertungsgrundsätze, -maßstäbe und -vorschriften
8.5.6 Bestandskonten
8.5.7 Erfolgskonten
8.5.8 Bestands- und Erfolgskontenveränderungen
8.6 Gewinn- und Verlustbestimmung
Unternehmensrechnung: Betriebsbuchhaltung
Abkürzungsverzeichnis
Sachwortregister
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 69 - Unternehmensrechnung
Abbildung 70 - Aufgaben und Formen des Rechnungswesens
Abbildung 71 - Geldliche Ebenen im Unternehmen differenziert nach Bewegungs- und Bestandsgrößen
Abbildung 72 - Geschäftsbuchhaltung
Abbildung 73 - Offenlegungs- und Prüfungspflichten des Jahresabschlusses
Abbildung 74 - Offenlegungs- und Aufstellungsfristen (von Teilen) des Jahresabschlusses
Abbildung 75 - Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
Abbildung 76 - Inventur - Inventar
Abbildung 77 - Entwicklung der Bilanz aus dem Inventar
Abbildung 78 - Beispiel eines Inventars eines Unternehmens
Abbildung 79 - Beispiel der Entwicklung einer Bilanz aus einem Inventar
Abbildung 80 - Bilanzarten
Abbildung 81 – Gliederungsschemata von Bilanzen
Abbildung 82 - Bilanzgliederung einer Nicht-Kapitalgesellschaft
Abbildung 83 - Bilanzgliederung einer Kapitalgesellschaft
Abbildung 84 - Darstellung einer Bilanz nach tatsächlichen Verhältnissen
Abbildung 85 - Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung
Abbildung 86 - Bewertungsgrundsätze, -maßstäbe und –vorschriften
Abbildung 87 - Komponenten zur handels- und steuerrechtlichen Ermittlung der Herstellungs`kosten´
Abbildung 88 - Desaggregation und Aggregation der Bilanz in Konten
Abbildung 89 - Tabellenbetrachtung jeder Bilanzposition (T-Konto)
Abbildung 90 - Systematisierung von Konten anhand des Industriekontenrahmens (IKR)
Abbildung 91 - Industriekontenrahmen (IKR) – 1 –
Abbildung 92 - Industriekontenrahmen (IKR) – 2 –
Abbildung 93 - Desaggregation und Aggregation der Bilanz in Konten unter besonderer Berücksichtigung des Eigenkapitalkontos
Abbildung 94 - Gliederungsschema des Gesamt`kosten´verfahrens – 1 –
Abbildung 95 - Gliederungsschema des Gesamt`kosten´verfahrens – 2 –
Abbildung 96 - Gliederungsschema des Umsatz`kosten´verfahren
1 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 1.
2 Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 2.
3 Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 3.
4 Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 4.
5 Konstitutionaler Rahmen: Unternehmenswendepunkte
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 5.
6 Institutionaler Rahmen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 6.
7 Instrumentaler Rahmen des Betriebes
7.1 Unternehmensrechnung – Betriebliches Rechnungswesen
Abbildung 69 - Unternehmensrechnung
Im Hinblick auf die zielorientierte Führung von Betrieben müssen unterschiedliche Informationen beschafft, bearbeitet, bereitgestellt und ggf. gespeichert werden.
Die Unternehmensrechnung beinhaltet sämtliche Verfahren zur systematischen Erfassung und Auswertung aller quantitativen Vorgänge (Werte- und Mengenströme) im Unternehmen mit dem Ziel, den unternehmerischen Leistungsprozess transparent, steuerbar, rentabel und liquide zu gestalten.
Die Aufgabe der Unternehmensrechnung besteht darin, das wirtschaftliche Geschehen eines Betriebs in quantitativer Form als ein quantitatives Modell abzubilden. Für die Unternehmensrechnung werden Informationen beschafft, bearbeitet, bereitgestellt und gegebenenfalls gespeichert, die sich sowohl innerhalb des Betriebs als auch zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt ergeben.
Es soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass auch Informationen qualitativer oder nicht quantifizierbarer Form betriebliche Entscheidungen für die Unternehmensführung von Relevanz sein können. Diese Informationen werden jedoch in der Unternehmensrechnung lediglich zur Ergänzung der quantitativen Informationen gesehen.
Informationen werden nuanciert als
QUALITATIVE
F
ÜHRUNGSINFORMATIONEN
UND
QUANTITATIVE
F
ÜHRUNGSINFORMATIONEN.
QUALITATIVE FÜHRUNGSINFORMATIONEN
Qualitative Informationen liegen in verbaler Dimension vor wie beispielsweise `gut´, `besser als´, `schlecht´, `schlechter als´. Derartige Informationen werden in der betriebswirtschaftlichen Entscheidungstheorie verwendet, um mit dem Instrument der Nutzwertanalyse1 zu Entscheidungen zu gelangen. Sie sollen in den folgenden Ausführungen kein Schwerpunkt sein.
QUANTITATIVE FÜHRUNGSINFORMATIONEN
Quantitativen Informationen werden mengenmäßige Dimensionen zugeordnet. Handelt es sich um quantitative beziehungsweise quantifizierbare Informationen, so werden diese zur Versorgung des Unternehmens im Rahmen der Unternehmensrechnung benötigt. Besonders hervorzuheben ist, dass im Rahmen der Unternehmensführung diejenigen Informationen zur zielorientierten Planung und Kontrolle herangezogen werden, die einer Verarbeitung mit Hilfe des technischen Instrumentariums einer Elektronischen Datenverarbeitung zugänglich sind.
Die Unternehmensrechnung als quantitatives Modell des wirtschaftlichen Geschehens innerhalb eines Betriebs sowie zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt ist zwar in Beziehung auf alle quantitativen (zahlenmäßigen) Informationen formal homogen, inhaltlich jedoch heterogen, das heißt nicht aggregierbar oder vergleichbar, da die Zahlengrößen in einer Vielzahl unterschiedlicher Dimensionen gemessen werden. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit der in unterschiedlichen Dimensionen abgebildeten betrieblichen Prozesse nicht gegeben. Um eine Vergleichbarkeit sowie eine Komprimierungsmöglichkeit im Sinne einer Zusammenfassung von heterogenen Informationen zu gewährleisten, müssen unterschiedliche Dimensionen vereinheitlicht werden. Erst einheitlich dimensionalisierte Informationen erlauben es der Unternehmensführung, diese Informationen zweckmäßig für die Planung und Kontrolle zu verwenden.
So lassen sich als Subsysteme beziehungsweise Teilbereich der Unternehmensführung charakterisieren, das
F
INANZWESEN
UND
B
ETRIEBLICHE
R
ECHNUNGSWESEN
.
FINANZWESEN
Das Finanzwesen als Teilelement der Unternehmensrechnung ist ein quantitatives Modell mit seinen Ausprägungen der Investition und Finanzierung. Aufgrund der Bedeutung und Zukunftsbezogenheit der Finanzierung und Investition für einzelne betriebliche Funktionen wird im zweiten Band der Reihe eingegangen.
BETRIEBLICHE RECHNUNGSWESEN
Das Betriebliche Rechnungswesen als Teilelement (Subsystem) der Unternehmensrechnung ist ebenfalls ein quantitatives Modell des wirtschaftlichen Geschehens innerhalb des Betriebs sowie zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt, es ist jedoch durch die konstante Homogenität seiner Informationen charakterisierbar. Derartige Informationen werden in einer einheitlichen Dimension, nämlich in Geld bewertet. Das Betriebliche Rechnungswesen ist ein Teilsystem der Unternehmensrechnung, das als ein monetäres Modell verstanden wird, und das wirtschaftliche Geschehen innerhalb des Betriebs sowie zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt in Geldeinheiten darstellt. Bei dem Betrieblichen Rechnungswesen werden zur Ergänzung quantitativer Informationen qualitative beziehungsweise qualifizierbare Informationen herangezogen.
Das Betriebliche Rechnungswesen beinhaltet sämtliche Verfahren zur systematischen Erfassung und Auswertung aller monetären Vorgänge im Unternehmen mit der Aufgabe, den unternehmerischen Prozess transparent, steuerbar, rentabel und liquide zu gestalten. Da dem Teilbereich des Betrieblichen Rechnungswesens eine hervorgehobene Stellung im Betrieb zuerkannt wird, soll im Folgenden darauf besonders eingegangen werden.
Das Betriebliche Rechnungswesen ist gekennzeichnet durch unterschiedliche (Grundsatz-)Aufgaben hinsichtlich seiner
D
OKUMENTATIONS
-
UND
K
ONTROLLAUFGABE
,
D
ISPOSITIONSAUFGABE
UND
R
ECHENSCHAFTSLEGUNG
-
UND
I
NFORMATIONSAUFGABE
.
DOKUMENTATIONS- UND KONTROLLAUFGABE
Die Dokumentationsaufgabe ist zu sehen in der Erfassung des tatsächlichen Betriebsgeschehens sowie Vergleich von Ist- mit Sollwerten. Diese sind Grundlage der Kontrollaufgabe, um durch die Erstellung von Abweichungs- und Ursachenanalysen dieser Aufgabe gerecht werden zu können. Dazu zählen beispielsweise die Ermittlung von Selbstkosten, die Erfolgsermittlung, die Ermittlung von Bestandsveränderungen (Zeitraum- und Zeitpunktbetrachtungen) sowie die Sammlung von Informationsmaterialien als prozessuales Beweismittel.
DISPOSITIONSAUFGABE
Zur Dispositionsaufgabe gehört die Auswertung der Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage zur Steuerung der betrieblichen Vorgänge entsprechend der betrieblichen Leitmaxime (Zielsystem!)2 sowie zur Selbstinformation der Unternehmensführung als Grundlage für unternehmensbedingte Entscheidungen wie beispielsweise Förderungswürdigkeit von Leistungen, Kalkulation des Angebotspreises sowie Wirtschaftlichkeitsvergleiche.
RECHENSCHAFTSLEGUNG- UND INFORMATIONSAUFGABE
Die Rechenschaftslegung- und Informationsaufgaben des Betrieblichen Rechnungswesens bestehen in der Schaffung von Unterlagen, um Vermögen und Schulden, Ertrag und Aufwand und damit den Erfolg zu dokumentieren, beispielsweise Für den Staat als Besteuerungsgrundlage für Finanzbehörden, als Rechenschaftslegung gegenüber Gesellschaftern, der Öffentlichkeit, sowie dem Schutz von Gläubigern.
1 Vgl. zu `Nutzwertanalyse´ Kapitel 4.1 in Band 4 dieser Reihe.
2 Vgl. zu `Zielsystem´ Kapitel 2.3.2 in Band 2 dieser Reihe.
7.2 Aufgaben und Formen des Rechnungswesens
Abbildung 70 - Aufgaben und Formen des Rechnungswesens
Die Realisierung der drei Grundsatzaufgaben des Betrieblichen Rechnungswesens erfordert eine entsprechende Strukturierung und Arbeitsweise des Rechnungswesens, um den grundlegenden Informationsbedürfnissen der unterschiedlichen Adressaten innerhalb und außerhalb des Unternehmens gerecht zu werden. Wird die Unterscheidung des Betrieblichen Rechnungswesens nach dem Adressaten vorgenommen, so kann differenziert werden zwischen
EXTERN ORIENTIERTES
R
ECHNUNGSWESEN
UND
INTERN ORIENTIERTES
R
ECHNUNGSWESEN
.
EXTERN ORIENTIERTES RECHNUNGSWESEN
Als extern orientiertes Rechnungswesen wird der Teil des Rechnungswesens verstanden, der Personen oder Interessengruppen Einblick in das Unternehmen geben soll, die zwar außerhalb des Unternehmens stehen, die aber als Kapitalgeber in Form von Gesellschaftern, Gläubigern oder Anteilseignern, als Lieferanten und als Staat (Steuergläubiger) an einer Substanzerhaltung und -erweiterung des Unternehmens interessiert sind.
Damit der oben genannte Personenkreis seine für ihn notwendigen Interessen wahrnehmen kann, hat der Gesetzgeber die Unternehmen gesetzlich verpflichtet, die offenzulegenden Informationen nach einheitlichen Gesichtspunkten zu erarbeiten und zu dokumentieren. Das extern orientierte Rechnungswesen hat als Aufgaben (gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig) zu erfüllen
die Rechenschaftslegung und
die Informationserstellung über die Vermögens- (beziehungsweise Investitions-) und Schulden- (beziehungsweise Finanzierungs-) sowie Aufwands- und Ertragslage des Unternehmens.
Die Hauptgebiete des extern orientierten betrieblichen Rechnungswesens betreffen die Rechenschaftslegung durch die Erstellung unterschiedlicher Informationsmaterialien. Nach dem Kriterium der Rhythmizität lassen sich diese unterscheiden in
RHYTHMISCHE
U
NTERLAGEN
UND
ARHYTHMISCHE
U
NTERLAGEN
.
RHYTHMISCHE UNTERLAGEN
Die rhythmischen beziehungsweise periodischen Unterlagen werden als Finanz- beziehungsweise Geschäftsbuchhaltung bezeichnet, die gekennzeichnet sind durch eine äquidistante Erstellung von Jahresabschlüssen mit unterschiedlichen Bestandteilen. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Informationsmaterialien werden die einzelnen Teile der Geschäftsbuchhaltung gesondert besprochen. Als Bestandteile des Jahresabschlusses lassen sich nennen die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der Lagebericht.
ARHYTHMISCHE UNTERLAGEN
Arhythmische beziehungsweise aperiodische Unterlagen werden außerhalb der äquidistant zu erstellenden Bilanzen (sogenannte Sonderbilanzen) verfasst bei außerplanmässigen Geschäftstätigkeiten wie beispielsweise
Gründungsbilanzen,
Liquiditätsbilanzen,
Vermögensbilanzen,
Verschuldungsbilanzen,
Fusionsbilanzen,
Liquidationsbilanzen,
Insolvenzbilanzen sowie
Auseinandersetzungsbilanzen.
INTERN ORIENTIERTES RECHNUNGSWESEN
Als intern orientiertes Rechnungswesen wird der Teil des Rechnungswesens bezeichnet, der an jenen Personenkreis gerichtet ist, der sich für das Unternehmen, dessen Erhaltung und dessen Vermögensmehrung verantwortlich zeichnet. Diese Personen benötigen entscheidungsunterstützende Informationen, um im Rahmen ihrer Aufgaben zur (kurz-, mittel- und langfristigen) Existenzsicherung des Unternehmens beitragen zu können. Das intern orientierte Rechnungswesen ist als Leitungsunterstützungsinstrument so zu gestalten, dass es den unternehmensindividuellen Bedürfnissen des Unternehmens entspricht, und wird als Betriebsbuchhaltung beziehungsweise Kosten- und Leistungsrechnung bezeichnet. Diese ausschließlich betriebsintern nutzbaren Informationen sollten nur Entscheidungsträgern und ausgewählten Personen zugänglich sein.
Auf diesen Teil des Rechnungswesens wird detailliert in Band 8 – Unternehmensrechnung – Betriebsbuchhaltung - dieser Reihe eingegangen.
Das Hauptaufgabengebiet des intern orientierten Betrieblichen Rechnungswesens ist der Erstellung unterschiedlicher, ausschließlich für den unternehmensinternen Gebrauch relevanten Informationen gewidmet. Der Kosten- und Leistungsrechnung obliegen die Aufgaben,
Informationen bereitzustellen für dispositive Zwecke der Unternehmensführung,
die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit vorzunehmen und
die Rentabilität des Unternehmens bestimmen zu können.
Aufgaben der Betriebsbuchhaltung sind die Erfassung, Verteilung und Zurechnung der Werteverzehre und -zugänge eines definierten Betrachtungszeitraums, die aus dem betrieblichen Prozess resultieren. Als Instrumente kommen dabei in Betracht die
K
OSTENRECHNUNG
,
L
EISTUNGSRECHNUNG
,
K
URZFRISTIGE
E
RFOLGSRECHNUNG
,
P
LANUNGSRECHNUNG
,
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
S
TATISTIK
UND
S
ONDERRECHNUNGEN DES INTERN ORIENTIERTEN
R
ECHNUNGSWESENS
.
KOSTENRECHNUNG
Die Aufgaben der Kostenrechnung3 sind in der Ermittlung der relevanten Kosten als Grundlage zur Unternehmenssteuerung, der Kalkulation der betrieblichen Leistungen und der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit zu sehen. Die Kostenrechnung ist eine nach innen gerichtete Rechnung mit der Unterteilung in Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung.
Da der Kostenrechnung eine zentrale Aufgabe im Rahmen eines Unternehmens zukommt, soll sie in einem eigenen Kapitel4 besprochen werden.
LEISTUNGSRECHNUNG
Die Aufgaben der Leistungsrechnung5 besteht in der Ermittlung und Bereitstellung relevanter Leistungsdaten für dispositive Zwecke wie die Ermittlung marktorientierter Erlöse und leistungsorientierter Unterlagen für Aktivitäten der Leistungsverwertung. Durch das Aufstellen von Sollleistungen ist die Durchführung einer Kontrolle der Ergiebigkeit möglich sowie eine Analyse von Abweichungen.
KURZFRISTIGE ERFOLGSRECHNUNG
Aufgabe der Kurzfristigen Erfolgsrechnung beziehungsweise kurzfristigen Betriebsergebnisrechnung ist die laufende Erfolgskontrolle, durch die Aufschlüsselung nach Kosten- und Leistungsquellen (Erfolgsanalyse) sowie einer Gewinnermittlung.
PLANUNGSRECHNUNG
Die Aufgaben der Planungsrechnung liegen in der Erstellung von visionären, unternehmenspolitischen oder strategischen Vorgabewerten für zukünftige Entwicklungen und in der Vorbereitung unternehmerischer Entscheidungen für alle betrieblichen Bereiche, beispielsweise Entscheidungen über Eigen- oder Fremdbezug, Ersatzzeitpunkte von maschinellen Anlagen, optimale Bestellmengen, kostenminimale Maschinenbelegung.
Als Instrumente mit planerischen Aspekten dienen die Kostenrechnung, die Investitionsrechnung, die Finanzierungsrechnung und die Methoden des Operations Research, beispielsweise Netzplantechnik, Warteschlangentheorie oder mathematische Programmierung.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE STATISTIK
Aufgabe der betriebswirtschaftlichen Statistik ist eine Verknüpfung von internen Informationen mit externen Informationen, um das betriebliche Geschehen permanent transparent zu gestalten und kontrollieren zu können. Dazu zählen beispielsweise die Aufstellung von Umsatz-, Kosten-, Unfall-, Ausschussquoten- und Krankheitsstatistiken sowie Ermittlung von Kennziffern.
SONDERRECHNUNGEN DES INTERN ORIENTIERTEN RECHNUNGSWESENS
Diese Sonderrechnungen, die neben den Hauptgebieten des internen Rechnungswesens geführt werden und dabei in unterschiedlichen Funktionsbereichen des Unternehmens erstellt werden, liefern Basisdaten für weitere interne Rechnungen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die
K
ONTOKORRENTRECHNUNG
,
M
ATERIALRECHNUNG
,
L
OHN
-
UND
G
EHALTS
(
AB
)
RECHNUNG
UND
A
NLAGEN
(
AB
-)
RECHNUNG
.
KONTOKORRENTRECHNUNG
Schulden und Forderungen gegenüber Geschäftspartnern von ihrer Entstehung bis zu ihrer Begleichung sind in dieser Rechnung verzeichnet. Neben einer kontinuierlichen Verfolgung von zu erwartenden Zahlungseingängen obliegt es der Kontokorrentrechnung, Daten für die Aufstellung bestimmter betrieblicher Vorgänge zu liefern.
MATERIALRECHNUNG
Die Material(ab)rechnung (Lagerbuchhaltung) erfasst die Bestände und verbucht Zu- und Abgänge an unterschiedlichen Werkstoffen. Sie schafft sowohl Daten zur wertmäßigen Bestandsermittlung für Vorräte als auch für die Kalkulation von Angebotspreisen.
LOHN- UND GEHALTS(AB)RECHNUNG
Die Lohn- und Gehalts(ab)rechnung befasst sich mit der Berechnung des Personalaufwands sowie der Berechnung der auszuzahlenden Beträge. Gleichzeitig ermittelt sie Aufwandsdaten für die Gewinn- und Verlustrechnung und stellt personalbezogene Größen für die Kalkulation von Arbeitsleistungen zur Verfügung.
ANLAGEN(AB-)RECHNUNG
Aufgaben der Anlagen(ab)rechnung [Betriebsmittel(ab)rechnung] sind die Erfassung des Betriebsmittelbestands, die Verbuchung von Zu- und Abgängen sowie deren Werteverluste (Abschreibungen). Sie ermittelt das gesamte im Unternehmen vorhandene Sachanlagevermögen in Form der Grundstücke, technischen Anlagen und Maschinen als auch weiterer Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese Informationen werden im Jahresabschluss in der Regel als Anlagenspiegel dargestellt.
3 Vgl. zu `Kostenrechnung´ Kapitel 9.1 in Band 8 dieser Reihe.
4