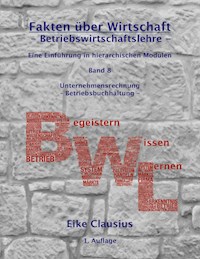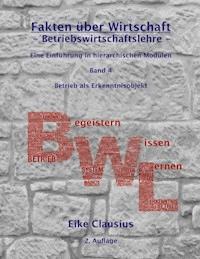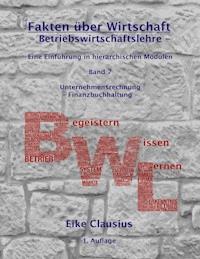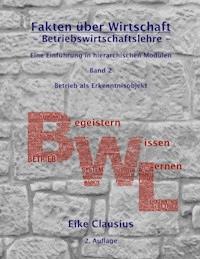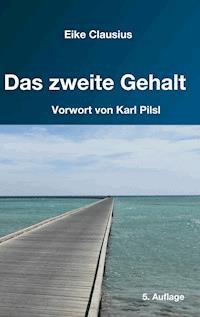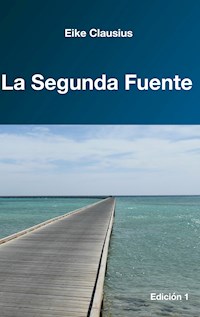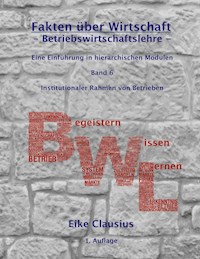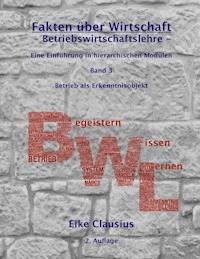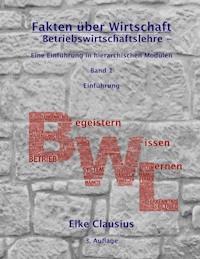Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir im Zuge unserer Ausbildung so viel über rationale Kriterien lernen? Angeblich, weil diese die Zukunft unserer Unternehmen sichern - es stellt sich jedoch die Frage, ob das der Wahrheit entspricht. Ist es wirklich rationales Wissen, auf das es in Zukunft ankommen wird? Oder aber vielmehr der Umgang mit diesem Wissen, welches uns durch das Internet nahezu unbegrenzt zur Verfügung steht? Sind es nicht Menschen, Teams, Netzwerke und Beziehungen, die der entscheidende Faktor in der Wirtschaft sind? Welche Möglichkeiten stehen uns heute zur Verfügung, um unsere Softskills zu verbessern und unseren ausbildungstechnischen Fokus zeitgemäß anzupassen? Die vorliegende Forschungsarbeit liefert unter anderem Einblicke in das Spannungsfeld der Sichtweisen von Unternehmensführern und ihren Mitarbeitern: Was denken Angestellte über ihre Vorgesetzten und wie werden sie wiederum von diesen eingeschätzt? Welche Bedeutung messen Mitarbeiter und Unternehmensführer emotionalen und rationalen Aspekten zu? Und welche Branchen sind eher emotional oder rational orientiert? Bei der Beantwortung dieser Fragen wurde mit Modellen, Konzepten und Theorien gearbeitet, die jenseits der naturwissenschaftlichen Paradigmen zu finden sind und somit den wichtigen Einblick in emotionale Aspekte in der Wirtschaft ermöglichen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Neugierde beim Lesen dieses Buches und dem Erkunden der verschiedenen empirischen Analysen und hoffe, dass es mir gelingt Ihr Interesse für die emotionale Intelligenz als Erfolgsfaktor der Zukunft zu wecken. Mit freundlichen Grüßen, Eike Clausius
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Mein erster Dank gilt meiner Hochschule, der Westsächsischen Hochschule Zwickau, die mir den Raum schaffte, die Grundlagen für diese Arbeit in einem Forschungssemester (WS 10/ 11) zu legen und dies sowohl konzeptionell, ausrüstungsmäßig als auch inhaltlich. Mein Dank gilt auch meinen Kollegen der Fakultät Wirtschaft (in alphabetischer Reihenfolge) Klaus Schumann, Herbert Strunz und Matthias Richter sowie meinen studentischen Hilfskräften (in alphabetischer Reihenfolge) Amy Cheng, Franziska Kaleta, Kerstin Köhler, Martin Rudolph sowie Claudia Weidelt.
Besonders bedanken möchte ich mich auch bei meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dipl. -Ing. oec. Petra Grundke für ihren persönlichen Einsatz sowie meinem wissenschaftlichen, studentischen Assistenten (BA BWL & BA Hons Business in spe) Kevin Reuther, der mich mit seinen beeindruckenden kreativen Computer- und organisatorischen Kenntnissen unterstützte.
Mein Dank gilt auch Herrn Dr. Eckart Lau für sein besonnenes Lektorat.
Mein besonderer Dank gilt meiner Ehefrau – Evelyn –, die ich für Ihre unendliche Geduld, Fürsprache und emotionalen Rückhalt liebe und schätze. Sie unterstützte mich sehr in der langen Zeit dieser Forschungstätigkeit: Ihr widme ich diese Publikation.
Eike ClausiusBerlin 2015
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
1.2 State of the Art
1.3 Problemstellung und Zielsetzung
1.4 methodische Vorgehensweise
2 Definitionen der Begriffe des Untersuchungsgegenstandes
2.1 Paradigmenwechsel
2.2 Abgrenzung der verwendeten Intelligenzbegriffe
3 Analyse von statistischen Daten mittels SPSS
3.1 Einführung
3.2 Statistische Daten – Häufigkeitsanalyse
4 Statistische Auswertung „Paradigmenwechsel in der Wirtschaft – von der rationalen zur emotionalen Intelligenz“
4.1 Einführung
4.2 Gestaltung des Fragebogens
4.3 A-Fragen: Grundlegende Aspekte unternehmerischer Vorgehensweisen?
4.4 B-Fragen: Welche Aspekte werden für den Unternehmenserfolg wahrgenommen?
4.5 C-Fragen: Ausprägungen der Wahrnehmung der rationalen und emotionalen Aspekte
4.6 D-Fragen: Allgemeine Anmerkungen zum Fragebogen
4.7 E-Fragen: Statistisch relevante Fragen: Angaben über unternehmens- und teilnehmerbezogene Daten der Befragten
5 Analyse der empirischen Ergebnisse
5.1 Einführung
5.2 Statistisch relevante Fragen
5.3 Herkunft des Erfolges (rational oder emotional) -Grundlegende Aspekte unternehmerischer Vorgehensweisen
5.4 Subjektive Einschätzung der Bedeutung rationaler und emotionaler Aspekte im Unternehmensgeschehen
5.5 Subjektive Einschätzung der Bewertung von rationalen und emotionalen Aspekten
5.6 Gegenüberstellung von Bedeutung und Einschätzung zu subjektiver Bewertung der untersuchten rationalen und emotionalen Aspekte
5.7 Emotionale oder rationale Abhängigkeiten
6 Konsequenzen aus den Ergebnissen des Fragebogens
6.1 Allgemeine Aspekte in Bezug auf die Befragung
6.2 Spezielle Aspekte in Bezug auf die Befragung
6.3 Prospektive Expansion des Forschungsobjektes
Literaturverzeichnis
Anhang - Fragebogen
Über den Autor
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1 - Beispiel eines Säulendiagramms
Abbildung 2 - Beispiel eines gestapelten Säulendiagramms
Abbildung 3 - Beispiel eines gruppierten Säulendiagramms
Abbildung 4 - Beispiel eines überlappenden Säulendiagramms
Abbildung 5 - Beispiel eines Balkendiagramms
Abbildung 6 - Zweidimensionales Kreisdiagramm an einem Beispiel
Abbildung 7 - dreidimensionales Kreisdiagramm an einem Beispiel in verzerrter Darstellung, bei der sich die Flächen nicht mehr vergleichen lassen
Abbildung 8 - Darstellung verschiedener Daten als Kreis- und Säulendiagramm
Abbildung 9 - Negativbeispiel: Darstellung von absoluten Werten als Anteile eines nicht vorhandenen Ganzen.
Abbildung 10 - Negativbeispiel: Darstellung von absoluten Werten als Anteile eines nicht vorhandenen Ganzen.
Abbildung 11 - Branchenzugehörigkeit der beteiligten Unternehmen
Abbildung 12 - Funktion der Befragten im Unternehmen
Abbildung 13 - Anzahl der Mitarbeiter
Abbildung 14 - Präsenz des Unternehmens am Markt (in Jahren)
Abbildung 15 - Alter der befragten Personen
Abbildung 16 - Geschlecht der befragten Personen
Abbildung 17 - Annahmen über den Erfolg der Unternehmensführung (unabhängig ob Unternehmensführer, Mitarbeiter oder Freiberufler)
Abbildung 18 - Annahmen über den Erfolg der Unternehmensführung (Sichtweise - Unternehmensführer)
Abbildung 19 - Annahmen über den Erfolg der Unternehmensführung (Sichtweise – Mitarbeiter)
Abbildung 20 - Gegenüberstellung des Erfolges des Unternehmens aus der Sicht der …Unternehmensführung … Mitarbeiter
Abbildung 21 - Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter
Abbildung 22 - Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter, unterschieden nach Funktionen im Unternehmen
Abbildung 23 - Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter (MA) aus Sicht der Unternehmensführung
Abbildung 24 - Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter aus Sicht der Mitarbeiter
Abbildung 25 - Gegenüberstellung der Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter aus Sicht der …Unternehmensführung … Mitarbeiter
Abbildung 26 - Eine positive Unternehmenskultur als Richtlinie für die Mitarbeiter ist zentraler Bestandteil der Unternehmensführung
Abbildung 27 - Annahme, dass Unternehmenskultur Richtlinie für die Mitarbeiter ist (Sichtweise - Unternehmensführung)
Abbildung 28 - Annahme, dass Unternehmenskultur Richtlinie für die Mitarbeiter ist (Sichtweise - Mitarbeiter)
Abbildung 29 - Gegenüberstellung der Annahmen, dass die Unternehmenskultur Richtlinie für die Mitarbeiter aus der Sicht der …Unternehmensführung …Mitarbeiter
Abbildung 30 - Mitarbeiter werden direkt durch unternehmerische Maßnahmen motiviert
Abbildung 31 - Annahmen über die Maßnahmen der Motivation für die Mitarbeiter (Sichtweise - Unternehmensführer)
Abbildung 32 - Annahmen über die Maßnahmen der Motivation für die Mitarbeiter (Sichtweise – Mitarbeiter)
Abbildung 33 - Gegenüberstellung die Maßnahmen der Motivation für die Mitarbeiter eine Rolle spielen aus der Sicht der …Unternehmensführung…Mitarbeiter
Abbildung 34 - Güte der Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und den Mitarbeitern
Abbildung 35 - Annahme über die Qualität der Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und Mitarbeitern (Sichtweise – Unternehmensführer)
Abbildung 36 - Annahme über die Qualität der Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und Mitarbeitern (Sichtweise – Mitarbeiter)
Abbildung 37 - Gegenüberstellung der Qualität des kommunikativen Austausches der Unternehmensführung mit den Mitarbeiter aus der Sicht der …Unternehmensführung…Mitarbeiter
Abbildung 38 - Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen
Abbildung 39 - Annahmen über die Wichtigkeit der Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen unterschieden nach Funktionen im Unternehmen
Abbildung 40 - Annahmen über die Wichtigkeit der Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen (Sichtweise – Unternehmensführer)
Abbildung 41 - Annahmen über die Wichtigkeit der Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen (Sichtweise – Mitarbeiter)
Abbildung 42 - Gegenüberstellung der Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmenszielen aus der Sicht der …Unternehmensführung … Mitarbeiter
Abbildung 43 - Individualziele der Mitarbeiter korrespondieren mit dem Unternehmensziel
Abbildung 44 - Individualziele der Mitarbeiter korrespondieren mit dem Unternehmensziel aus der Sicht der Unternehmensführung
Abbildung 45 - Individualziele der Mitarbeiter korrespondieren mit dem Unternehmensziel aus der Sicht der Mitarbeiter
Abbildung 46 - Gegenüberstellung über die Annahme, dass Individualziele von Mitarbeitern mit dem Unternehmensziel korrespondieren aus der Sicht …Unternehmensführung …der Mitarbeiter
Abbildung 47 - Motivation der Mitarbeiter läuft eher über Geld
Abbildung 48 - Motivation der Mitarbeiter läuft eher über Geld . . .aus Sicht der Unternehmensführung
Abbildung 49 - Motivation der Mitarbeiter läuft eher über Geld . . .aus Sicht der Mitarbeiter
Abbildung 50 - Gegenüberstellung der Annahme, dass die Motivation der Mitarbeiter eher über Geld . . . läuft aus Sicht der …Unternehmensführung … Mitarbeiter
Abbildung 51 - Einflussnahme emotionaler Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept
Abbildung 52 - „Einflussnahme emotionaler Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept“ aus Sicht der Unternehmensführung
Abbildung 53 - Betrachtung aus Sicht der Mitarbeiter: „Einflussnahme emotionaler Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept“ aus Sicht der Mitarbeiter
Abbildung 54 - Gegenüberstellung der Einflussnahme emotionaler Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept aus der Sicht der …Unternehmensführung …Mitarbeiter
Abbildung 55 - betrieblicher Erfolg durch Rationalität oder Emotionalität (bei 4 Kategorien)
Abbildung 56 - betrieblicher Erfolg durch Rationalität oder Emotionalität (bei 4 Kategorien) aus Sicht der Unternehmensführung
Abbildung 57 - betrieblicher Erfolg durch Rationalität oder Emotionalität (bei 4 Kategorien) aus Sicht der Mitarbeiter
Abbildung 58 - Gegenüberstellung, der Einschätzung inwiefern emotionale oder rationale Aspekte für den Unternehmens -erfolg ausschlaggebend sind aus der Sicht der … Unternehmensführung …Mitarbeiter
Abbildung 59 - Bedeutung der Kennzahl: Rentabilität
Abbildung 60 - Bedeutung der Kennzahl: Produktivität
Abbildung 61 - Bedeutung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit
Abbildung 62 - Bedeutung der Kennzahl: Gewinn
Abbildung 63 - Bedeutung der Kennzahl: Umsatz
Abbildung 64 - Einschätzung des Kriteriums: Umweltschutz
Abbildung 65 - Einschätzung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen
Abbildung 66 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter
Abbildung 67 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden.
Abbildung 68 - Einschätzung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft
Abbildung 69 - Bewertung der Kennzahl: Rentabilität
Abbildung 70 - Bewertung der Kennzahl: Produktivität
Abbildung 71 - Bewertung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit
Abbildung 72 - Bewertung der Kennzahl: Gewinn
Abbildung 73 - Bewertung der Kennzahl: Umsatz
Abbildung 74 - Bewertung des Kriteriums: Umweltschutz
Abbildung 75 - Bewertung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen
Abbildung 76 - Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter
Abbildung 77 - Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden
Abbildung 78 - Bewertung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft
Abbildung 79 - Bedeutung der Kennzahl: Rentabilität vs. Bewertung der Kennzahl: Rentabilität
Abbildung 80 - Bedeutung der Kennzahl: Produktivität vs. Bewertung der Kennzahl: Produktivität
Abbildung 81 - Bedeutung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit vs. Bewertung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit
Abbildung 82 - Bedeutung der Kennzahl: Gewinn vs. Bewertung der Kennzahl: Gewinn
Abbildung 83 - Bedeutung der Kennzahl: Umsatz vs. Bewertung der Kennzahl: Umsatz
Abbildung 84 - Einschätzung des Kriteriums: Umweltschutz vs. Bewertung des Kriteriums: Umweltschutz
Abbildung 85 - Einschätzung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen vs. Bewertung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen
Abbildung 86 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter vs. Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter
Abbildung 87 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden vs. Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden
Abbildung 88 - Einschätzung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft vs. Bewertung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft
Abbildung 89 - Emotionale oder rationale Aspekte in Abhängigkeit von der Branchenzugehörigkeit
Abbildung 90 - Emotionale oder rationale Aspekte in Abhängigkeit von der Funktion der Beteiligten im Unternehmen
Abbildung 91 - Relevanz der Emotionalität für den Unternehmenserfolg in Abhängigkeit vom Lebensalter der Befragten
Abbildung 92 - Relevanz der Emotionalität für den Unternehmenserfolg bei Unternehmensführern in Abhängigkeit von deren Lebensalter
Abbildung 93 - Unternehmensführung offen für Kritik von Mitarbeitern (allg.)
Abbildung 94 - Unternehmensführung offen für Kritik von Mitarbeitern (nach Position)
Abbildung 95 - Bewertung der Unternehmenskultur (nach Position)
Abbildung 96 - Maßnahmen zur Motivation von Mitarbeitern (nach Position)
Abbildung 97 - Kommunikativer Austausch zwischen Unternehmensführung und Mitarbeitern (nach Position)
Abbildung 98 - Gegenüberstellung der Identifikation mit Unternehmenszielen aus Sicht der Unternehmenführer und der Mitarbeiter (allg.)
Abbildung 99 - Identifikation mit Unternehmenszielen (nach Position)
Abbildung 100 - Individuelle Ziele unterstützen Unternehmensziel (nach Position)
Abbildung 101 - Extrinsische oder intrinsische Motivation (nach Position)
Abbildung 102 - Zusammenhang der Emotionalen Intelligenz mit dem Unternehmenskonzept in Relation zur Position der Befragten
Abbildung 103 - Vergleich rationaler/ emotionaler Entscheidungskriterien in Abhängigkeit vom Lebensalter
Abbildung 104 - Entscheidungsmerkmal Rationalität in Abhängigkeit vom Lebensalter der Teilnehmer
Abbildung 105 - Entscheidungsmerkmal Emotionalität in Abhängigkeit vom Lebensalter der Teilnehmer
Verzeichnis der Tabellen
Tabelle 1 - Beispiele wissenschaftlicher Revolutionen
Tabelle 2 - tabellarische Darstellung einer Umsatzverteilung an einem Beispiel
Tabelle 3 - Hauptmotive von Mitarbeitern
Tabelle 4 - Branchenzugehörigkeit der beteiligten Unternehmen
Tabelle 5 - Funktion der Befragten im Unternehmen
Tabelle 6 - Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen
Tabelle 7 - Präsenz des Unternehmens am Markt (in Jahren)
Tabelle 8 - Alter der Befragten
Tabelle 9 - Geschlecht der Befragten
Tabelle 10 - Annahmen über den Erfolg der Unternehmensführung (unabhängig ob Unternehmensführer, Mitarbeiter oder Freiberufler)
Tabelle 11 - Offenheit der Unternehmensführung gegenüber Kritik der Mitarbeiter
Tabelle 12 - Eine positive Unternehmenskultur als Richtlinie für die Mitarbeiter ist zentraler Bestandteil der Unternehmensführung
Tabelle 13 - Mitarbeiter werden direkt durch unternehmerische Maßnahmen motiviert
Tabelle 14 - Qualität der Kommunikation zwischen der Unternehmensführung und den Mitarbeitern
Tabelle 15 - Identifikation der Mitarbeiter mit Unternehmenszielen
Tabelle 16 - Individualziele der Mitarbeiter korrespondieren mit dem Unternehmensziel
Tabelle 17 - Motivation der Mitarbeiter läuft eher über Geld
Tabelle 18 - Einflussnahme emotionaler Aspekte im Zusammenhang mit dem Unternehmenskonzept
Tabelle 19 - Betrieblicher Erfolg durch Rationalität oder Emotionalität
Tabelle 20 - Bedeutung der Kennzahl: Rentabilität
Tabelle 21 - Bedeutung der Kennzahl: Produktivität
Tabelle 22 - Bedeutung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit
Tabelle 23 - Bedeutung der Kennzahl: Gewinn
Tabelle 24 - Bedeutung der Kennzahl: Umsatz
Tabelle 25 - Einschätzung des Kriteriums: Umweltschutz
Tabelle 26 - Einschätzung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen
Tabelle 27 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter
Tabelle 28 - Einschätzung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden
Tabelle 29 - Einschätzung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft
Tabelle 30 - Bewertung der Kennzahl: Rentabilität
Tabelle 31 - Bewertung der Kennzahl: Produktivität
Tabelle 32 - Bewertung der Kennzahl: Wirtschaftlichkeit
Tabelle 33 - Bewertung der Kennzahl: Gewinn
Tabelle 34 Bewertung der Kennzahl: Umsatz
Tabelle 35 - Bewertung des Kriteriums: Umweltschutz
Tabelle 36 - Bewertung des Kriteriums: Umgang mit natürlichen Ressourcen
Tabelle 37 - Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Mitarbeiter
Tabelle 38 - Bewertung des Kriteriums: Zufriedenheit der Kunden
Tabelle 39 - Bewertung des Kriteriums: Ansehen des Unternehmens in der Gesellschaft
1Einleitung
1.1Ausgangslage
Die Verbesserung der deutschen Wirtschaft durch einen Paradigmenwechsel von intellektueller Intelligenz zu emotionaler Intelligenz stellt sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft ein herausforderndes Betrachtungsfeld dar. Dies gilt insbesondere für die aus deutscher Sicht elementaren industriell fertigenden und beratenden Unternehmen, jedoch auch für Unternehmen des Handelsgewerbes.
In der einschlägigen Literatur existieren zwar einige Ansatzpunkte, sowohl zur Ausgestaltung der intellektuellen Intelligenz, als auch der emotionalen Intelligenz, ein integriertes Konzept zur Anwendung in der betrieblichen Praxis wird man jedoch vergeblich suchen. Eine Verbindung zwischen dem Arbeiten mit Zahlen, Daten, Fakten – der intellektuellen Intelligenz – und dem Arbeiten mit Emotionen – der emotionalen Intelligenz – gibt es bisher nicht. Die bisherigen Arbeiten grenzen beide Themenbereiche strikt voneinander ab, aufgrund der Ansicht, dass Zahlen – Daten – Fakten (ZDF) losgelöst von Emotionalität zu sehen sind.
Ziel dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen intellektueller und emotionaler Intelligenz herzustellen und unter Bezugnahme auf den praktischen Einsatz fundierte Erkenntnisse über die Ausgestaltung, den Einsatz und die Wirkungsweise eines integrierten Konzeptes von intellektueller und emotionaler Intelligenz zu gewinnen.
Hintergrund dieser Untersuchung ist die Hypothese, dass diejenigen Unternehmen, die Entscheidungen auf rationaler Grundlage treffen gegenüber denjenigen Unternehmen im Nachteil sind, die Entscheidungen auch auf Grundlage emotionaler Motive treffen.
1.2State of the Art
Der Begriff der „Emotionalen Intelligenz“ ist seit der gleichnamigen Veröffentlichung von Goleman im Jahr 1995 zu einem zentralen Aspekt sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit geworden. Nun könnte angenommen werden, dass dieser Begriff neu sei, aber seine Historie reicht weit zurück. So interessierten sich schon vor Goleman bereits andere Wissenschaftler im 20. Jahrhundert für die „Emotionale Intelligenz“. Ihre Wurzeln reichen sogar bis 19. Jahrhundert zurück, denn erste Veröffentlichungen sind mit den Arbeiten von Edward Thorndike über soziale Intelligenz aus dem Jahr 1920 festzustellen.
Der Schwerpunkt früherer Arbeiten über dieses Thema lag auf der Beschreibung, Definition und Untersuchung sozial kompetenten Verhaltens.1 Edgar Doll entwarf das erste Konzept zur Messung emotional intelligenten Verhalten bei Kindern im Jahr 1935.
Möglicherweise beeinflusst durch die Arbeiten von Thorndike und Doll konzipierte David Wechsler (1938) einen Test für kognitive Intelligenz, der darauf ausgerichtet war, Aspekte der sozialen Intelligenz zu messen. Dabei bezog er erstmalig Aspekte wie Begriffsvermögen (Comprehension) und bildliche Vorstellungskraft („Picture Arrangement“) in seine Untersuchungen ein. Ein Jahr nach der Veröffentlichung dieser Tests im Jahre 1939 beschrieb Wechsler den Einfluss „nicht intelligenter Faktoren auf generell intelligentes Verhalten“ und verbreiterte damit die Basis zu seinem ursprünglichen Konstrukt.2 In seinen weiteren Publikationen machte er stets deutlich, dass Modelle zur Bestimmung Emotionaler Aspekte auch um nicht-intelligente Faktoren erweitert werden sollten.3
Mit der Zeit wandelte sich der Schwerpunkt der Arbeiten zum Thema Emotionale Intelligenz von der reinen Beschreibung und Beurteilung sozialer Intelligenzen hin zu mehr Verwendung von Faktoren zur Bestimmung zwischenmenschlichen Verhaltens und welche Funktionen diese für eine effektive, gezielte Anpassungsfähigkeit spielen.4 Fortan wurden bei Forschungen soziale Aspekte mit berücksichtigt. Hinzu kam, dass damit ein wesentlicher Teil von Wechslers Definition der Intelligenz im Allgemeinen: „Die Fähigkeit des Menschen, zielstrebig zu handeln“5 bekräftigt wurde. Dadurch wurde die allgemeine Intelligenz um die Komponente soziale Intelligenz erweitert.
Die ersten Definitionen von ‚social intelligence‘ bildeten die Grundlage dafür, wie Emotionale Intelligenz später entworfen wurde. Zeitgenössische Wissenschaftler wie Peter Salovey und John Mayer sahen die Emotionale Intelligenz zunächst als einen Teil der Sozialen Intelligenz.6 Damit wird unterstellt, dass beide Konzepte verbunden sind und eventuell in Wechselwirkung stehende Teile desselben Konstrukts beschreiben.
Zeitgleich – als Forscher anfingen Soziale Intelligenz zu studieren, zu beschreiben und zu definieren, begannen wissenschaftliche Untersuchungen an jungen Menschen, die unfähig waren eigene Gefühle zu erkennen und mitzuteilen.7
Diese zwei neuen Richtungen, die sich parallel entwickelten und auch als Gefühlsblindheit oder gar Gefühlslegasthenie beschrieben wurden, waren die seelisch bedingte Gefühllosigkeit (‚psychological mindedness‘8)und emotionale Achtsamkeit beziehungsweise die emotionale Bewusstheit (,emotional awareness’9).
Die Schwerpunkte unterschiedlicher Forschungen lagen sowohl auf der Recherche von neutralen Umständen, die emotionale Aufmerksamkeit beeinflussen10, als auch auf weiteren emotionalen und sozialen Aspekten dieses Konzepts11. Diese Untersuchungen lieferten anschauliche Belege für die grundsätzlichen, natürlichen Aspekte dieses erweiterten Models, auch wenn es von einigen als nicht nachvollziehbarer Mythos abgetan wurde12.
Zahlreiche Wissenschaftler verbanden in ihren Untersuchungskonzeptionen emotionale und soziale Aspekte: Howard Gardner (1983) erklärte beispielsweise, dass seine Konzeption der ‚personal intelligence‘ auf der ‚intrapersonal (emotional) intelligence‘ und ‚interpersonal (social) intelligence’ basieren.
Darüber hinaus beschreibt Carolyn Saarni (1990) ‚Emotionale Kompetenz‘ als Gesamtheit von acht zusammenhängenden emotionalen und sozialen Fähigkeiten.
Bar-On erweitert das Konzept der emotionalen Intelligenz um soziale Aspekte und bezeichnet es als emotional-sozial Intelligenz. Diese ‚emotional-social intelligence‘ ist aus zusammengesetzt aus diversen intrapersonalen und interpersonalen Kompetenzen und Fähigkeiten, die miteinander verbunden das menschliche Verhalten effektiv determinieren.13 Nach seinem Konzept ist es angebrachter von ‚emotional-social intelligence‘ statt ‚emotional intelligence‘ oder ‚social intelligence’.
Seit der Zeit von Thorndike14 (1920) sind unterschiedliche Konzeptionen ‚emotional-social intelligence‘ (ESI) aufgetaucht. Dies führte zu einer interessanten Mischung aus Verwirrung, Kontroverse und Opportunismus bezüglich des besten Ansatzes Emotionaler Intelligenz.
Ein Systematisierungsversuch unterschiedlicher Konzepte ist in der ‚Encyclopedia of Applied Psychology‘15zu finden:
Das Salovey-Mayer Modell,
16
welches die Fähigkeit beschreibt, Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und zu steuern, um damit das Denken zu erleichtern. Dies wird auf einer fähigkeitsbezogenen Skala gemessen.
17
Das Goleman-Modell
18
, welches im Konzept der Emotionalen Intelligenz ein weites Feld von Kompetenzen und Fähigkeiten sieht, die Management Performance vorantreibt. Es wird mittels einer Multi-Rater Bewertung gemessen.
19
Das Bar-On-Modell
20
ist ein Modell, das einen Querschnitt von zusammenhängenden emotionalen und sozialen Kompetenzen beschreibt, welche intelligentes Verhalten beeinflussen. Gemessen wird es mittels Fragebögen zur Selbstbeurteilung
21
innerhalb eines potentiell erweiterbaren multimodalen Ansatzes, der ebenso Interviews und Multi-Rater Bewertungen enthält.
22
Das Konzept der Emotionalen Intelligenz von Daniel Goleman harmonisiert erstmals in der Management-Literatur den „Kopf“ und das „Herz“.23 Er postuliert bereits im Jahre 1996, dass die Gesellschaft die emotionale Seite des Menschen vernachlässigt und dass Menschen in entscheidenden Momenten ihrem emotionalen Impuls folgen. In scheinbar irrationalen Gewaltausbrüchen oder in Depressionen kommen unterdrückte Gefühle zum Vorschein, die es auch neurowissenschaftlich zu verstehen gilt, da diese Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten wichtige Erkenntnisse über die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns hervorgebracht hat. Je mehr sich Menschen ihre Fähigkeit erhalten, die Gefühle anderer wahrzunehmen und damit umzugehen, umso mehr akzeptieren sie die Gefühlsregungen ihrer Mitmenschen ohne sie kontrollieren oder unterdrücken zu wollen. Bereits Goleman bedauert, dass Fächer wie Emotionale Intelligenz nicht in Schulen oder Hochschulen gelehrt werden.24
Wie wichtig die Kommunikation für das Miteinander im Unternehmen ist, schrieb schon Watzlawick (1971) im seinem Werk über menschliche Kommunikation.25 Ihm zu Folge existieren fünf „Axiome“ der Kommunikation:
„Axiom 1“: Es gibt keine Nicht-Kommunikation.
„Axiom 2“: jede Kommunikation hat stets zwei Ebenen: eine inhaltliche und eine emotionale (Beziehungs-) Ebene.
„Axiom 3“: Kommunikation verläuft nach einem Muster, das Interpunktion genannt wird.
„Axiom 4“: Kommunikation geschieht sowohl digital als auch analog.
„Axiom 5“: Kommunikation läuft symmetrisch oder komplementäre ab.
Diese fünf „Axiome“ können dabei helfen, typische Störungen in der Kommunikation zu erkennen und zu klären.
Unter dem Titel: „Gut durchs Leben kommen – 16 Kompetenzen, die unsere Seele stärken“26 wird charakterisiert, welche drei möglichen Lebenskompetenz-Bereiche grundsätzlich unterscheidbar sind: