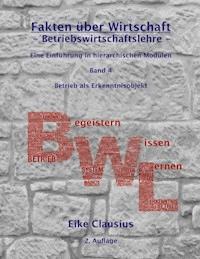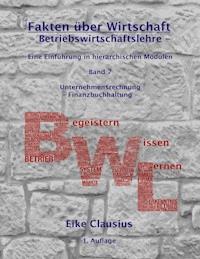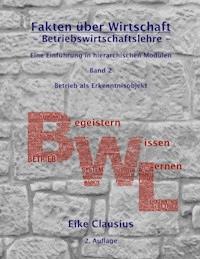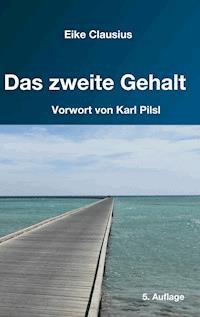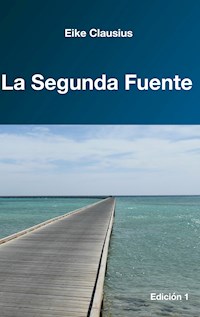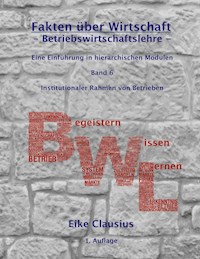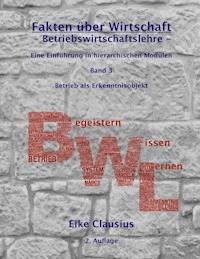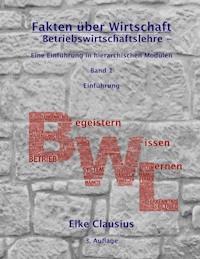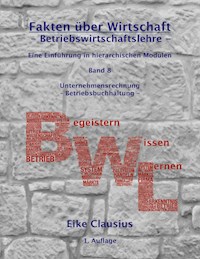
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fakten über Wirtschaft: Begeistern - Wissen - Lernen
- Sprache: Deutsch
Sie wollten schon immer in der Lage sein, über Themen der Wirtschaft kompetent mitzureden? Erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Betriebs-Wirtschafts-Lehre! Mit diesem Ebook aus der Reihe „Fakten über Wirtschaft: Begeistern – Wissen – Lernen“ verfügen Sie über ein multifunktionales Tool um die Grundlagen der BWL kennen zu lernen: Das Buch lässt sich zum einen als Fließtext lesen und steht zum anderen durch ein ausführliches Sachwortregister als Nachschlagewerk zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Inhalte in übersichtlichen, hierarchischen Modulen dargestellt um Zusammenhänge und Struktur der inhaltlichen Aspekte zu verdeutlichen. Zu Band 8: Der Band 8 der Reihe „Fakten über Wirtschaft: Begeistern – Wissen – Lernen“ richtet sich auf den instrumentalen Rahmen von Betrieben. Eingegangen wird auf die Unternehmensrechnung in der Ausprägung der Betriebsbuchhaltung: Begriffsdeutungen, Abgrenzungsrechnung, Systeme der Kostenrechnung, Stufen der Kostenrechnung in Kostenarten, -stellen-, -trägerrechnung, Kurzfristige Erfolgsrechnung auf Voll- und Teilkostenbasis. Viel Freude beim Lesen und allerhand neue Erkenntnisse!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Der Verfasser bedankt sich an dieser Stelle bei all denjenigen, mit deren Anteilnahme und Mithilfe dieser Band entstanden ist. Besonders meine Studenten/ -innen der Einführung in die Betriebswirtschaftslehre trugen durch ihr ständiges Hinterfragen und ihre hilfreichen Anregungen zum Entstehen dieses Werkes bei.
Mein Dank geht hier auch an meine wissenschaftliche Mitarbeiterin Dipl-oec. Petra Grundke. Sie hat mit intensivem Interesse und hohem persönlichen Einsatz viel zur Erstellung dieses Bandes beigetragen. Ihr sei auch für die Ermunterungen und Diskussionen gedankt.
Mein ganz persönlicher Dank gilt meiner Frau Evelyn, die mich vor familiären und zeitlichen Blockaden bewahrt, unterstützt und mir stets Mut zugesprochen hat: Ihr widme ich diese Publikation.
Eike Clausius
Berlin/ Zwickau 2016
Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
Konstitutionaler Rahmen: Unternehmenswendepunkte
Institutionaler Rahmen von Betrieben
Unternehmensrechnung: Finanzbuchbuchhaltung
Unternehmensrechnung: Betriebsbuchhaltung
8.1 Betriebsbuchhaltung und deren Aufgabe
8.2 Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
8.3 Abgrenzungsrechnung (neutrale Ergebnisrechnung)
8.4 Systeme der Kostenrechnung
8.5 Stufen der Kostenrechnung
8.6 Kostenartenrechnung
8.7 Kostenstellenrechnung
8.7.1 Aufgaben der Kostenstellenrechnung
8.7.2 Instrumente der Kostenstellenrechnung
8.8 Kostenträgerrechnung
8.8.1 Aufgaben und Formen der Kostenträgerrechnung
8.8.2 Instrumente der Kostenträgerrechnung
8.9 Kurzfristige Erfolgsrechnung auf Vollkostenbasis
8.9.1 Aufgaben der Kurzfristigen Erfolgsrechnung
8.9.2 Instrumente der Kurzfristigen Erfolgsrechnung
8.10 Kurzfristige Erfolgsrechnung auf Teilkostenbasis
8.10.1 Überblick über Teilkostenrechnungssysteme
8.10.2 Deckungsbeitragsrechnung – Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis als Direct Costing
Abkürzungsverzeichnis
Sachwortregister
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 97 - Unternehmensrechnung
Abbildung 98 - Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung – Teil 1 –
Abbildung 99 - Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung – Teil 2 –
Abbildung 100 - Abgrenzungsbereiche von Bewegungsgrößen des betrieblichen Rechnungswesens
Abbildung 101 - Aufwand – Kosten: eine dezidierte Betrachtung
Abbildung 102 - Ertrag - Leistung: eine dezidierte Betrachtung
Abbildung 103 - Aufgaben, Vorgehensweise und Instrumente der Abgrenzungsrechnung
Abbildung 104 - Herleitung der Ergebnistabellen zur Abgrenzungsrechnung – grobe Einteilung der Rechnungsbereiche I und II
Abbildung 105 - Ergebnistabelle der Abgrenzungsrechnung – grobe Einteilung der Rechnungsbereiche I und II
Abbildung 106 - Merkmale von Kostenrechnungssystemen
Abbildung 107 - Matrix der Kostenrechnungssysteme
Abbildung 108 - Schematische Darstellung der abrechnungstechnischen Beziehungen innerhalb des Triumvirats der Kostenrechnung
Abbildung 109 - Kostenartenrechnung - Aufgaben und Instrumente
Abbildung 110 - Kostenstellenrechnung
Abbildung 111 - Kostenstellenrechnungsinstrumente
Abbildung 112 - Grundstruktur eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB)
Abbildung 113 - Kostenträgerrechnung - Aufgaben und Formen
Abbildung 114 - Kalkulationsverfahren in Abhängigkeit vom Leistungserstellungsverfahren
Abbildung 115 - Systematik von Kalkulationsverfahren
Abbildung 116 - Schematische Darstellung einer differenzierenden Zuschlagskalkulation
Abbildung 117 - Schematische Darstellung der abrechnungstechnischen Beziehungen innerhalb des Triumvirats der Kostenrechnung sowie der Kurzfristigen Erfolgsrechnung auf Vollkostenbasis
Abbildung 118 - Systeme der Teilkostenrechnung und der Deckungsbeitragsrechnung
Abbildung 119 - Verfahren der Kosten- und Leistungsrechnung auf Vollkosten- und Teilkostenbasis
Abbildung 120 - Deckungsbeitragsrechnung – Umsatzkostenverfahren auf Teilkostenbasis als Direct Costing
Abbildung 121 - Schematische Darstellung der abrechnungstechnischen Beziehungen innerhalb des Triumvirats der Kostenrechnung sowie der Kurzfristigen Erfolgsrechnung auf Teilkostenbasis
Abbildung 122 - Grundschema der Deckungsbeitragsrechnung in Form des einstufigen Direct Costing am Beispiel eines zweistufigen Leistungserstellungsprogramms
Abbildung 123 - Beispiel einer graphischen Darstellung einer Gewinnschwellenrechnung
Abbildung 124 - Grundschema der Deckungsbeitragsrechnung in Form des mehrstufigen Direct Costing am Beispiel eines zweistufigen Leistungserstellungsprogramms
1 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 1.
2 Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 2.
3 Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 3.
4 Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 4.
5 Konstitutionaler Rahmen: Unternehmenswendepunkte
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 5.
6 Institutionaler Rahmen von Betrieben
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 6.
7 Unternehmensrechnung: Finanzbuchbuchhaltung
Siehe Betriebs-Wirtschaft-Lehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 7.
8 Unternehmensrechnung: Betriebsbuchhaltung
8.1 Betriebsbuchhaltung und deren Aufgabe
Abbildung 97 - Unternehmensrechnung
Im Kapitel Hauptaufgaben des Rechnungswesens´ ist das intern orientierte Rechnungswesen als Teilbereich des betrieblichen Rechnungswesens charakterisiert worden, der die Informationsversorgung unternehmensinterner A-dressaten sicherstellt. Ebenso wie im Bereich des extern orientierten Rechnungswesens hat das intern orientierte Rechnungswesen Informationen zahlenmäßiger Abbildungen des Wirtschaftsgeschehens zwischen dem Betrieb und seiner Umwelt sowie innerhalb des Betriebs bereitzustellen. Die Adressaten des intern orientierten Rechnungswesens benötigen dazu entscheidungsunterstützende Informationen, um im Rahmen der betrieblichen Planungsbeziehungsweise Entscheidungs- und Kontrollprozesse ihrer Aufgabe der Existenzsicherung des Unternehmens und der Unternehmensvermögensmehrung gerecht werden zu können.
Das intern orientierte Rechnungswesen hat primär die Aufgabe, das Management mit denjenigen Informationen aus dem Rechnungswesen zu versorgen, die notwendig sind, seine Aufgaben der Unternehmensführung zielorientiert und adäquat erfüllen zu können.
Die Hauptbestandteile des intern orientierten Rechnungswesens bilden die
K
OSTEN
-
UND
L
EISTUNGSRECHNUNG UND
K
URZFRISTIGE
E
RFOLGSRECHNUNG
.
KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG
Das intern orientierte Rechnungswesen setzt sich aus den Komponenten zusammen der
K
OSTENRECHNUNG UND
L
EISTUNGSRECHNUNG
.
KOSTENRECHNUNG
Als Aufgaben der Kostenrechnung sind zu sehen
die Ermittlung der relevanten Kosteninformationen für dispositive Zwecke (Dispositionsaufgaben der Kostenrechnung) sowie
die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Geschehens (Kontrollaufgaben der Kostenrechnung) und damit einen Beitrag zur Sicherstellung der Rentabilität zu leisten.
Die Dispositionsaufgaben der Kostenrechnung erstrecken sich auf
die Ermittlung der Selbstkosten eines Kostenträgers (Kalkulation der betrieblichen Leistung) zur Bestimmung der kostenorientierten Preisuntergrenze als Stückrechnung einer Leistung;
die veranlassungsgerechte Ermittlung entscheidungsrelevanter Kosten, um diesen die Marktleistung eines Betrachtungszeitraums gegenüberstellen zu können;
die Ermittlung von kostenorientierten Rechnungsgrundlagen für Programm- und Verfahrensentscheidungen;
die Ermittlung von Wertansätzen für die Bilanz zur Bewertung von Zwischen- und Endleistungen.
Die Kontrollaufgabe der Kostenrechnung besteht in
der Ermittlung von Sollkosten, um ständig das Verhältnis von Sollkosten zu (Ist-)Selbstkosten festzustellen, damit eine Kontrolle der Wirtschaftlichkeit in seiner Ausprägung als Sparsamkeitsprinzip stattfinden kann sowie
der Ermittlung von Abweichungen von Plan- und Istberechnungsgrößen (Planabweichungsanalyse).
LEISTUNGSRECHNUNG
Als Aufgaben der Leistungsrechnung – oft auch als Erlösrechnung beschrieben – sind in Analogie zur Kostenrechnung zu nennen:
die Ermittlung der relevanten Leistungsinformationen für dispositive Zwecke (Dispositionsaufgaben der Leistungsrechnung) sowie
die Kontrolle der Wirtschaftlichkeit des betrieblichen Geschehens (Kontrollaufgabe der Leistungsrechnung).
Die Dispositionsaufgaben der Leistungsrechnung erstrecken sich auf
die Ermittlung der zu erwartenden Erlöse einer Leistung (Kalkulation der marktorientierten Leistung);
die Ermittlung von leistungsorientierten Unterlagen über die Aktivitäten der Leistungsverwertung des Betriebs nach bestimmten Kriterien (Abnehmergruppen, regionale Aspekte).
Die Kontrollaufgabe der Leistungsrechnung setzen sich zusammen aus
der Ermittlung von Sollleistungen, um das Verhalten von Soll- und Istleistungen (Erlösen) festzustellen, um die Berechnung der Wirtschaftlichkeit in seiner Ausprägung als Ergiebigkeitsprinzip durchführen zu können sowie
der Ermittlung von Abweichungen auf Soll- und Istleistungen, um diese analysieren zu können.
KURZFRISTIGE ERFOLGSRECHNUNG
Die Kurzfristige Erfolgsrechnung des intern orientierten Rechnungswesens unterscheidet sich grundlegend gegenüber der Erfolgsrechnung des extern orientierten Rechnungswesens.
Im extern orientierten Rechnungswesen wird der Jahreserfolg des Betriebs in der Bilanz beziehungsweise der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt, in der bestimmte bewertungsrechtliche Vorschriften einzuhalten sind. Der Jahreserfolg ermittelt sich durch die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.
Die Kurzfristige Erfolgsrechnung des intern orientierten Rechnungswesens – oder kurz: die Kurzfristige Erfolgsrechnung – wird als Ergänzung zur jährlichen Rechnung des extern orientierten Rechnungswesens gesehen, um auf der Basis unterjähriger (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich) Kosten und Leistungen (Erlöse) für dispositive Zwecke der Unternehmenssteuerung bereitzustehen.
Für dispositive Aufgaben ist die Finanzbuchhaltung ungeeignet, da
die Informationen über den ermittelten (Jahres-)Erfolg für die Informationsbedürfnisse der Unternehmensführung bezüglich des zu kontrollierenden betrieblichen Bereichs zu spät vorliegen;
die Ermittlung des bilanziell ermittelten Jahreserfolgs aufgrund bewertungsrechtlicher bilanzieller Wahlrechte zu erfolgen hat und somit im Interesse externer Adressaten, aber nicht der internen Adressaten erfolgt;
die Quellen des Erfolgs im Einzelnen nicht erkennbar sind, sondern lediglich das Gesamtunternehmen betrachtet wird und keine Differenzierung nach Leistungen, Leistungsgruppen oder Unternehmensbereiche vorgenommen wird;
der Jahreserfolg der Finanzbuchhaltung aus vergangenheitsorientierten Informationen besteht (Istinformationen) und für eine echte Kontrolle des betrieblichen Erfolgs der Form Soll-Ist-Vergleich nicht stattfinden kann.
Als Aufgaben der Kurzfristigen Erfolgsrechnung sind zu nennen
die Ermittlung des unterjährigen, meist monatlichen Betriebserfolgs auf der Basis der entscheidungsrelevanten Kosten und der tatsächlichen oder zu erwartenden Erlöse, differenziert nach einzelnen Erfolgsquellen (Leistungsart, Leistungsgruppe oder betrieblicher Teilbereich);
die Ermittlung von Informationen, um frühzeitiger als durch die Finanzbuchhaltung betriebliche Fehlentwicklungen erkennen und beseitigen zu können;
die Bereitstellung von Informationen für dispositive Zwecke.
8.2 Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung
Abbildung 98 - Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung – Teil 1 –
Abbildung 99 - Grundbegriffe der Kosten- und Leistungsrechnung – Teil 2 –
Als `negative´ Bewegungsgrößen wurden bereits in einem früheren Kapitel herausgearbeitet Auszahlung, Ausgabe, Aufwand und Kosten sowie als `positive´ Bewegungsgrößen Einzahlung, Einnahme, Ertrag und Leistung. 1
Die folgende Abbildung grenzt graphisch die unterschiedlichen Begriffe voneinander ab, so dass sich einerseits die jeweiligen Bewegungsgrößen teilweise tangieren und somit inhaltlich übereinstimmen, andererseits inhaltlich jedoch eigenständig sind.
Abbildung 100 - Abgrenzungsbereiche von Bewegungsgrößen des betrieblichen Rechnungswesens
Um den Aufgaben der Kostenrechnung und Leistungsrechnung gerecht zu werden, wird nachfolgend ausführlich auf die Grundbegriffe in Bezug auf die Unterscheidung zwischen Aufwand und Kosten sowie Ertrag und Leistung eingegangen:
A
BGRENZUNG
: A
UFWAND
– K
OSTEN UND
A
BGRENZUNG
: E
RTRAG
– L
EISTUNG
.
ABGRENZUNG: AUFWAND – KOSTEN
Abbildung 101 - Aufwand – Kosten: eine dezidierte Betrachtung
* Die Anderskosten können größer oder kleiner als der nicht als Kosten verrechnete Zweckaufwand sein.
Aufwand ist der bewertete Verzehr an Gütern in Form von Sach- und/ oder Dienstleistungen2 innerhalb eines Betrachtungszeitraums, unabhängig von der Verwertung des Guts. Ein Aufwand stellt jegliche Verringerung des Bestands `Gesamtvermögen´ innerhalb eines Betrachtungszeitraums dar, der sich aufgrund gesetzlicher Vorschriften und bewertungsrechtlicher Möglichkeiten für die Finanzbuchhaltung ermitteln und verrechnen lässt.
Kosten sind der bewertete Verzehr an Gütern in Form von Sach- und/ oder Dienstleistungen3