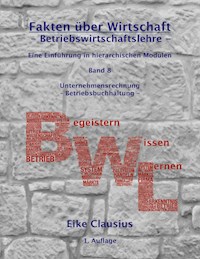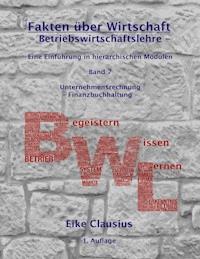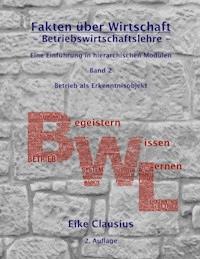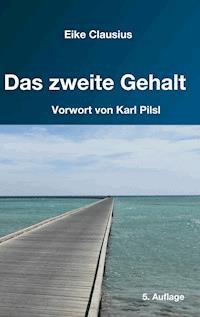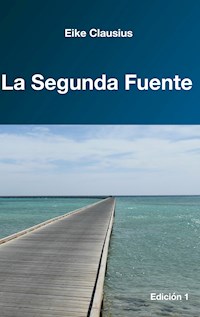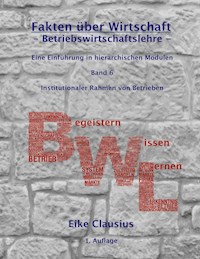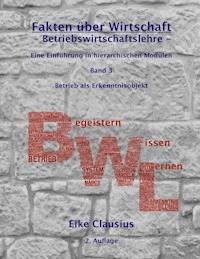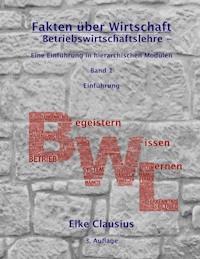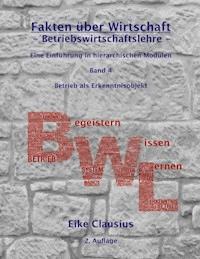
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fakten über Wirtschaft: B-egeistern - W-issen - L-ernen
- Sprache: Deutsch
Sie wollten schon immer in der Lage sein, über Themen der Wirtschaft kompetent mitzureden? Erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Betriebswirtschaftslehre! Mit diesem Ebook aus der Reihe `Fakten über Wirtschaft: B-egeistern -- W-issen -- L-ernen´ verfügen Sie über ein multifunktionales Tool, um die Grundlagen der BWL kennenzulernen: Das Buch lässt sich als Fließtext lesen und steht auch durch ein ausführliches Sachwortregister als Nachschlagewerk zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Inhalte in übersichtlichen, hierarchischen Modulen dargestellt um Zusammenhänge und Struktur der inhaltlichen Aspekte zu verdeutlichen. Zu Band 4: Der Band 4 der Reihe `Fakten über Wirtschaft: B-egeistern - W-issen - L-ernen´ beschreibt die unterschiedlichen privatrechtlichen Formen von Betrieben. Eingegangen wird auf der Grundlage von Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl auf Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften sowie besonderer Rechtsformen und unternehmensrechtlicher Mischformen. Viel Freude beim Lesen und allerhand neue Erkenntnisse! Eike Clausius
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 62
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Der Verfasser bedankt sich an dieser Stelle bei all denjenigen, mit deren Anteilnahme und Mithilfe dieser Band entstanden ist. Besonders meine Studenten/ -innen der Einführung in die Betriebswirtschaftslehre trugen durch ihr ständiges Hinterfragen und ihre hilfreichen Anregungen zum Entstehen dieses Werkes bei.
Mein ganz persönlicher Dank gilt meiner Frau Evelyn, die mich vor familiären und zeitlichen Blockaden bewahrt, unterstützt und mir stets Mut zugesprochen hat: Ihr widme ich diese Publikation.
Eike Clausius
Berlin/Zwickau 2018
Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
4.1 Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl von privatrechtlichen Betrieben
4.2 Einzelbetrachtung privatrechtlicher Unternehmensformen
4.2.1 Einführung - Betrachtung einzelner privatrechtlicher Unternehmensformen anhand von Bestimmungsfaktoren
4.2.2 Einzelunternehmen
4.2.3 Personengesellschaften
4.2.4 Kapitalgesellschaften
4.2.5 Besondere Rechtsformen
4.2.6 Unternehmensmischformen
Konstitutionaler Rahmen: Unternehmenswendepunkte
Institutionaler Rahmen von Betrieben
Sachwortregister
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 31 - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl von privatrechtlichen Betrieben
Abbildung 32 - Betrachtung einzelner privatrechtlicher Unternehmensformen anhand von Bestimmungsfaktoren
Abbildung 33 - Einzelunternehmen - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
Abbildung 34 - Zusammensetzung von Personengesellschaften
Abbildung 35 - Offene Handelsgesellschaft - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
Abbildung 36 - Kommanditgesellschaft - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
Abbildung 37 - Zusammensetzung von Kapitalgesellschaften
Abbildung 38 - Aktiengesellschaft - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
Abbildung 39 - Beziehungsgeflecht der Organe einer Aktiengesellschaft (AG)
Abbildung 40 - Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
Abbildung 41 - Organe der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Abbildung 42 - Besondere Rechtsformen
Abbildung 43 - Unternehmensmischformen
Abbildung 44 - Das Beziehungsgeflecht einer GmbH & Co. KG ieS
Abbildung 45 - GmbH & Co. KG – Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl
1 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebswirtschaftslehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 1.
2 Betrieb als Erkenntnisobjekt der Betriebswirtschaftslehre
Siehe Betriebswirtschaftslehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 2.
3 Konstitutionaler Rahmen von Betrieben
Siehe Betriebswirtschaftslehre – eine Einführung in hierarchischen Modulen – Band 3.
4 Konstitutionaler Rahmen: privatrechtliche Rechtsformen von Betrieben
4.1 Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl von privatrechtlichen Betrieben
Abbildung 31 - Bestimmungsfaktoren für die Rechtsformwahl von privatrechtlichen Betrieben
BESTIMMUNGSFAKTOREN FÜR DIE RECHTSFORMWAHL VON PRIVATRECHTLICHEN BETRIEBEN
Für die Entscheidung über die Wahl der geeigneten Rechtsform können mannigfaltige Faktoren herangezogen werden, die sich im überwiegenden Maße einer quantitativen Bewertung entziehen. Je nach subjektiver Einschätzung der Träger des Betriebs kann für die Entscheidung über die Rechtsform die Nutzwertanalyse als rationale, intersubjektiv nachvollziehbare Entscheidungstechnik für konstitutive Entscheidungen herangezogen werden. Diese wird insbesondere dann angewendet, wenn bei den Entscheidungsträgern multidimensionale Zielsetzungen bestehen und nicht alle Entscheidungskonsequenzen monetär quantifizierbar sind. Die Entscheidungsparameter zur Rechtsformwahl lassen sich untergliedern in
R
ISIKONEIGUNG DER
K
APITALGEBER
,
QUALITATIVE E
IGNUNG DER
K
APITALGEBER
,
S
OLIDARITÄTSVERHALTEN DER
K
APITALGEBER UND
Ö
KONOMISCHE
A
SPEKTE
.
RISIKONEIGUNG DER KAPITALGEBER
Die Risikoneigung der Kapitalgeber beschreibt die Bereitschaft des Einzelnen, Wagnisse einzugehen, die subjektiv als sehr unterschiedlich empfunden werden. Risikoaspekte sind zu beachten bezüglich der
M
ITGLIEDERZAHL
,
G
ESTALTUNG DER
H
AFTUNG UND
R
ÜCKVERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN VON
A
NTEILEN
.
MITGLIEDERZAHL
Die Mitgliederzahl einer Gesellschaft und die Anzahl der Gründer korrelieren i.d.R. bei Personengesellschaften direkt miteinander, während bei Kapitalgesellschaften die Zahl der Gründer und die Mitgliederzahl zum überwiegenden Teil voneinander abweichen. Mit größer werdender Mitgliederzahl nimmt die direkte Einflussnahme auf das Unternehmensgeschehen ab.
GESTALTUNG DER HAFTUNG
Die Haftung bei Personen- und bei Kapitalgesellschaften ist grundsätzlich verschieden. Hier schlägt sich das Risikoverhältnis der (Eigen-)Kapitalgeber gegenüber Gläubigern besonders deutlich nieder.
Bei Personengesellschaften ist die Anzahl der Gründungsmitglieder bzw. der Gesellschafter eng verknüpft mit der Gestaltung der persönlichen Haftung. Bei ihnen haftet grundsätzlich zumindest eine Person voll und unbeschränkt, d.h. sie haftet auch mit ihrem Privatvermögen.
Bei Kapitalgesellschaften ist die Haftung grundsätzlich auf das Betriebsvermögen beschränkt. Werden sämtliche Vermögensteile liquidiert, so steht den Gläubigern lediglich das daraus resultierende liquide Vermögen zur Verfügung. Die an der Kapitalgesellschaft Beteiligten verlieren bei der Liquidation ausschließlich ihre Einlagen/ Beträge ihrer Anteile.
RÜCKVERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN VON ANTEILEN
Die Gesellschafteranteile bei Personengesellschaften sind meist schwer zu veräußern oder es sind gesellschaftervertraglich bestimmte Regelungen vorhanden, ohne die die Gesellschaft bei Personenwechsel aufgelöst werden würde. Die Personengesellschaft beruht auf dem einvernehmlichen Verhältnis der Personen untereinander.
Kapitalgesellschaftsanteile sind bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung leichter zu veräußern als bei Personengesellschaften, jedoch mit analogen Einschränkungen. Bei der Kapitalgesellschaftsform der Aktiengesellschaft sind die verbrieften Anteile (Aktien) jederzeit am Aktienmarkt veräußerbar. Damit kann jeder Anteilseigner einer Aktiengesellschaft bei Vertrauensschwund in das Unternehmen sich seinen Aktienwert über den (Aktien-)Markt rückvergüten lassen. Dieser Gesichtspunkt der hohen Fungibilität der Anteile eröffnet gleichzeitig für die Aktiengesellschaft die Möglichkeit, die Kapitalbasis durch Finanzierungen durch die Aufnahme neuer Kapitalgeber (Aktionäre) zu erweitern.
QUALITATIVE EIGNUNG DER KAPITALGEBER
Ein oft existentieller Gesichtspunkt bei der Wahl der Rechtsform ist die Frage, wie eine adäquate Unternehmensführung gewährleistet wird. Die Befugnis zur Leitung kann entweder auf den Schultern der Kapitalgeber ruhen oder das Unternehmen wird durch geeignete Personen (Manager/-in) geführt.
Darüber hinaus ist es wichtig, die Einflussmöglichkeiten als Kapitalgeber auf die Geschäfte des Unternehmens zu hinterfragen. So ist das Recht auf die Geschäftsführung der einzelnen Kapitalgeber bezüglich der Rechtsform sehr unterschiedlich. Dies findet seinen Ausdruck bei
L
EITUNGSBEFUGNIS UND
S
TIMMRECHT
.
LEITUNGSBEFUGNIS
Bezüglich der Leitungsbefugnis bzw. den Rechten und Pflichten der Kapitalgeber muss entschieden werden, ob die Leitung als Leitungsorgan selbst vorgenommen wird (Selbstorganschaft) und ob die qualitative Eignung zur Führung eines Unternehmens objektiv ausreichend ist, auch wenn subjektiv die Einschätzung positiv ausfällt, oder ob eine Fremdorganschaft angestrebt wird. Personengesellschaften stellen aufgrund ihrer persönlichen Integration ins Unternehmen i.d.R. höhere personelle und fachliche Qualitätsansprüche als Kapitalgesellschaften.
Streben die Kapitalgeber die Führung des Unternehmens an, so können sie zwischen einer Personengesellschaft mit gleichzeitig voller Haftung oder einer Gesellschaft mit begrenzter Haftung wählen.
Bei Kapitalgesellschaften ist eine gewisse Unabhängigkeit der (eventuell sogar selbst-)angestellten Geschäftsführer gegenüber Eingriffen durch die Anteilseigner gegeben.
Juristisch ist in Bezug auf die Leitungsbefugnis zu unterscheiden zwischen
der
Geschäftsführung,
die sich auf das Innenverhältnis bezieht, und
der
Vertretung,
die das Außenverhältnis der Gesellschaft gegenüber Dritten betrifft.
Während die Geschäftsführung bei allen Rechtsformen weitgehend zweckentsprechend in Abweichung von gesetzlichen Regelungen ausgestaltet werden kann (dispositive Regelungen), ist die Vertretungsmacht in ihrem Umfang weitgehend fixiert, um den rechtsgeschäftlichen Sachgüter-, Dienstleistungs- und Informationsverkehr zu erleichtern und abzusichern.
STIMMRECHT
Das Stimmrecht des Einzelnen, und damit die Möglichkeit mit seinen Ideen und Konzeptionen Einfluss auf das unternehmerische Geschehen zu nehmen, ist bei Personengesellschaften ausgeprägter als bei Kapitalgesellschaften. Dementsprechend ist das Stimmrecht bei Personengesellschaften prägnanter als bei Kapitalgesellschaften, da bei Ihnen aufgrund der großen Anzahl der Anteilseigner Koalitionen eingegangen werden müssen.
SOLIDARITÄTSVERHALTEN DER KAPITALGEBER
Die Gemeinsamkeiten, der persönliche Zusammenhalt und das Verhalten gegenüber Arbeitnehmern in einem Unternehmen werden als Solidaritätsverhalten der Kapitalgeber angesehen. Seine Ausprägung findet dieses Verhalten in den Personengesellschaften durch den vom Gesetzgeber herrührenden Aspekt des gemeinschaftlichen Handelns. Bei Kapitalgesellschaften steht mehr das finanzielle Interesse im Vordergrund als das Zusammenwirken von mehreren Personen hin auf ein gemeinsames Ziel.
Dieses auf emotionalen Gründen beruhende Solidaritätskriterium steht im Vordergrund der Betrachtung bei der
F
IRMIERUNG
,
G
EWINN- UND
V
ERLUSTBETEILIGUNG
,
P
UBLIZITÄTSVERPFLICHTUNG UND
M
ITBESTIMMUNG DER
A
RBEITNEHMER
.
FIRMIERUNG
Allgemein gilt bezüglich des Firmenrechts (§§17 ff. HGB), dass als Name eines Unternehmens (Firma) nicht nur das Führen von Personenfirmen und Sachfirmen erlaubt ist, sondern auch Phantasiefirmen gestattet sind.
Die Nennung der/ des Vollhafters selbst bei Personengesellschaften bzw. der Geschäftszweck oder ein Gesellschaftername bei juristischen Personen (Kapitalgesellschaften) ist nicht (mehr) obligatorisch wie dies in der alten HGB-Version des Firmenrechts galt. Nach neuem Firmenrecht ist lediglich ein rechtsformcharakterisierender Zusatz vorgeschrieben, der entweder eine auszuschreibende oder verständlich abzukürzende Bezeichnung ist.
Es ist Aufgabe der Kapitalgeber sich gemeinsam (vor allem bei der Gründung eines Unternehmens) auf einen zweckdienlichen Namen zu einigen. Die Grenze zwischen Phantasiefirma und irreführender Firmenbezeichnung muss gewahrt sein.
GEWINN- UND VERLUSTBETEILIGUNG
Die Gewinn- und Verlustbeteiligung