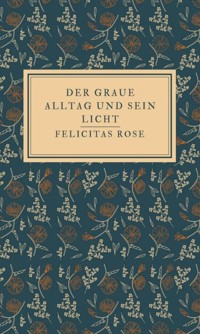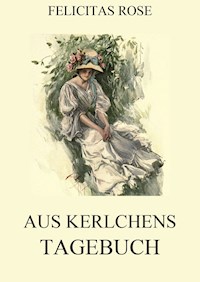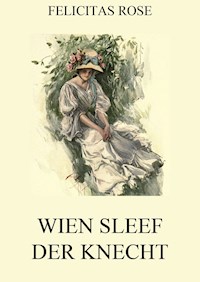0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Ebook sind vier Erzählungen von Felicitas Rose enthalten: Bilder aus den vier Wänden Tagebuch einer Dienstmagd Unsere Male auf Urlaub Das Tagebuch einer Närrin Aus der Erzählung "Tagebuch einer Närrin": Die Närrin bin ich. - Jedes Lebewesen soll ja nach untrüglichen Beweisen seinen Sparren, mindestens sein Spärrchen haben. Man kann alt dabei werden und hoch angesehen sterben. Ersteres habe ich vor, letzteres hoffe ich. Eine alte Jungfer, welche Tagebuch führt, hat ja immer in den Augen der lieben Nächsten etwas Anormales, wofern sie nicht in schweren Kriegszeiten, oder umgeben von großen Menschen, Dichtern, Denkern und Feldherrn gelebt hat, und das habe ich nicht. Deshalb wird mein Buch im Kleinkram stecken bleiben, im Kleinkram meiner Vaterstadt Wiedenburg. Früher galt ich als die Gescheiteste in der Familie, jetzt faßt man sich an den Kopf, wenn von mir die Rede ist. - Und als ich dies vor mir liegende Buch, von welchem man wußte, daß es meine Bekenntnisse aufnimmt, neulich einmal auf meinem Schreibtisch vergessen hatte, fand ich andern Tags von Onkel Heinrich von Berndt's Hand hineingekritzelt: »Tagebuch einer Närrin«. - Ich tat nicht dergleichen, denn Onkel Heinrich ist leberleidend, und wenn ich bei den Angehörigen auch oft als respektlos gelte, - vor Lebern, Nieren und Herzen meiner Sippe habe ich achtungsvolle Scheu. - Es hat stille Stunden der Einkehr gegeben, in denen ich mich fragte, ob es nicht an Wiedenburg und seinen verrückten, engherzigen Anschauungen läge, daß ich ein so hoffnungsloser Fall für meine zärtlichen Verwandten geworden bin, aber ich weiß es jetzt ganz genau, daß es an mir liegt. Tiefe Selbsterkenntnis ist nicht der bekannte Weg zur Besserung, - bei mir nicht. Ich bin eine bewußte Närrin. ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bilder aus den vier Wänden
Bilder aus den vier WändenBilder aus den vier WändenTagebuch einer DienstmagdUnsere Male auf UrlaubDas Tagebuch einer NärrinImpressumBilder aus den vier Wänden
Felicitas Rose
Erzählungen
Bilder aus den vier Wänden
Eine sogenannte ›Vernunftehe‹ hatten die beiden nicht geschlossen. Aber sie paßten ganz gut zusammen; ›er‹ war ein junger Beamter und ›sie‹ hatte auch nichts. Nur eine schöne Aussteuer, schön nach den Begriffen der jungen, anspruchslosen Frau, denn die Freundinnen rümpften ein wenig die Nasen, daß Geheimrats Jüngste ›nicht mal'n Büfett mitkriegte‹. Und nur drei Zimmer und Küche; und nichts, aber auch gar nichts ›stilvoll‹.
Sie hatten ganz recht, die Freundinnen, sie sahen eben das ganze Nestchen mit ihren Augen an und sahen deshalb nicht das ›Glück‹, das aus jedem Winkelchen der hellen, freundlichen Wohnung lachte. Und wie hatte ›Muttchen Geheimrat‹ gesorgt und gerechnet, damit ihre kleine Lise eben diese drei Zimmer ›mitbekommen‹ konnte und eine gute Wäscheaussteuer dazu. Fünf Kinder als Beamtenwitwe durchzudringen, sie zu tüchtigen Menschen zu erziehen, ist nicht so leicht. – Aber nun waren sie alle versorgt, die Söhne in geachteten Lebensstellungen, die beiden älteren Töchter gut, ja reich verheiratet und das Lebensschifflein der Lise, der übermütigen Jüngsten, die so ganz ihrem Vater glich und ihren Kopf für sich hatte, war vor einigen Tagen aus dem stillen Hafen des Elternhauses in die Welt gesteuert.
»Gott gebe seinen Segen! Jung ist sie noch sehr, noch nicht ganz neunzehn, – ach, wenn ›er‹ nur Geduld hat – – – –«
Eine Hochzeitsreise wollten sie beide nicht, sie fuhren gleich in die neue Heimat und ›richteten ein‹. Natürlich hatte Lise sämtliche Schlüssel vergessen und ihre erste Flasche Wein im neuen Haushalt trank das junge Paar mit dem Schlosser zusammen, der die Schränke aufbrach.
»Wie interessant!« rief fröhlich die junge Frau. »Das darf nicht wieder vorkommen,« meinte der junge Ehemann mit einer gewissen ernsten Würde, die ihn sehr gut kleidete.
Und nun war man eingerichtet und der erste lange Brief ging an ›Muttchen‹ ab, die sich bis dahin mit Postkarten begnügt hatte.
*
Liebstes Muttchen!
Die Welt ist doch wunder-wunderschön! Ich sitze im Wohnstübchen, welches so klein ist, daß nur zwei Menschen drin wohnen können, die sich furchtbar lieb haben. Na, das haben wir ja. Hans ist im Büro, der Urlaub zu Ende. Der erste Abschied war natürlich sehr schmerzlich und ich winkte mit dem Taschentuch, bis Hans um die nächste Straßenecke verschwand. Dann wurde mir sehr sonderbar zumute, und ich bekam Heimweh nach Dir, mein Mutti! Da hab' ich eine halbe Stunde gesessen und bin mir recht unglücklich vorgekommen. Schließlich habe ich in meinen Mädchensachen herumgekramt; ich hatte auf die Kiste: › Tabu‹ geschrieben, und Hans hat sie infolgedessen nicht angerührt. Zu unterst lag meine alte Puppe Emmy (lach' mich tüchtig aus), ich habe sie aus- und angezogen, und da wurde ich wieder vergnügt. Heute soll ich zum erstenmal kochen, mir graut, – ich glaube, Hans auch. Bis jetzt aßen wir im Speisehaus und mir schmeckte es prachtvoll, aber Hans sagte, er hätte alles schon ›über‹, besonders die Saucen. Es gibt heute Fleischbrühe bei uns, dann Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Zur ›Fleischbrühe‹ habe ich mir ein Pfund Markknochen holen lassen, sie kochen schon lange, aber als ich vorhin kostete, schmeckte es nach nichts, man kann ebensogut die Zunge zum Fenster heraushängen.
Kommt denn da noch was dran? Meine Minna versteht ebensowenig vom Kochen wie ich, sie ist erst sechzehn Jahr, aber sehr willig und nett ist sie; vorhin haben wir einen kleinen Walzer zusammen getanzt.
Ich hätte so gern einen Braten heute gemacht, aber ich hatte so Angst. Wiener Würstchen müssen ja mal weich werden, aber ein Braten – – –
Liebstes Muttchen, die Fantasie impromptue von Chopin kann ich jetzt perlend, auch nicht ein Fehler läuft mehr unter; ich will sie Hans nach der Suppe vorspielen, damit er wieder vergnügt wird. Tante Emmy ist doch ein Engel, daß sie uns das schöne Klavier geschenkt hat; jetzt sparen wir zu einem Flügel, fünfzehn Pfennig hab' ich schon; gestern schenkte mir Hans zehn, und heute fand ich fünf Pfennige unter dem Teppich. Die grünen Sessel machen sich prachtvoll im Salon, aber wir dürfen bloß Leute darauf sitzen lassen, die unsere ärgsten Feinde sind; sie sind schauderhaft unbequem und man spürt sein Kreuz tagelang, wenn man bloß fünf Minuten darauf gesessen hat.
Ich wollte doch, ich hätte die Sessel bei Dir auf dem Boden stehen lassen, wo sie seit Generationen standen, nachdem schon unsere Urahne damit reingefallen war. Aber äußerlich sind sie, wie gesagt, stilvoll. Vor ein paar Tagen kam Assessor G. und besuchte uns. Wir können ihn beide ja nicht ausstehen und fanden es taktlos, daß er uns jetzt schon überfiel. Deshalb nötigte Hans ihn auch gleich in den einen Sessel, wo er sich zuerst, wie es jedermann geht, sehr behaglich vorkam. Nach zehn Minuten empfahl er sich plötzlich, Hans behauptet, er habe sich direkt ins Krankenhaus fahren lassen. – Liebste Mutter, mein Hans ist furchtbar nobel, denk mal, er gibt mir 75 Mark Wirtschaftsgeld monatlich, ich weiß gar nicht, wie ich das klein kriegen soll und denke, den Flügel habe ich bald erspart.
Könnte ich doch besser kochen! Unsere Marie, die alte, gute Seele ist dran schuld. Immer sollte ›gnädiges Fräulein‹ geschont werden, und nun stehe ich vor meinem Herd und sage ›Bäh‹. Hans nennt mich sehr zart: ›Mein Lämmchen‹; wenn er bloß im Innern nicht ›Schaf‹ denkt!
Wovor ich mich so sehr fürchte, das sind die Besuche, die wir demnächst doch machen müssen; ich wollte, wir brauchten gar keine neuen Menschen kennen zu lernen und ich bliebe immer bei Hans und Hans bei mir. Für das Kneipenlaufen ist er ja gottlob gar nicht, er hat einen Kegelabend in der Woche mit den Kollegen, das soll so gesund sein, sagt Hans. Nächste Woche will er zum ersten Male als ›Ehemann‹ hin und muß dann gleich ein Faß Bier zum besten geben. Denk nur, ein ganzes Faß! Das kann doch nicht gesund sein! Aber ich sage nicht ein Tönchen, denn ich habe mir fest vorgenommen, meinen Mann niemals seinen Freunden abwendig zu machen, – staune über Deine verständige Tochter! Hans ist ja auch sonst ein Idealmensch, er spielt nicht, trinkt nicht, ›he schnieft nich un pieft nich‹. Aber nun ade, ich will jetzt die Würstchen ansetzen, es ist 10 Uhr, um ½ 2 Uhr kommt Hans, ich denke, dann werden sie gar sein.
Grüße die gute, alte Marie! Dein glückliches Kind.
*
Nachschrift. 4 Uhr nachmittags.
Liebe Mama!
Lise und ich kommen soeben aus dem Speisehause, wo wir ausnahmsweise gut gegessen haben, weshalb ich sehr friedlich bin. Lisel ist ein süßes Geschöpf, aber ihr Debüt konnte einen Hund jammern. Die Fleischbrühe war als ›Vorspieglung falscher Tatsachen‹ schon an sich strafbar, dann bekam ich wieder eine Suppe mit Fleischkrümeln und Stücken Haut darin, Lisel behauptet weinend, es wären ›Wiener Würstchen‹. Den Kartoffelsalat habe ich nicht erst angerührt, weil ich mein junges Leben nicht hinmorden und dem Staat eine tüchtige Kraft erhalten wollte. Beunruhige Dich aber nicht, liebste Mutter, ich wußte ja, daß mein holder Liebling ›Lilie auf dem Felde war‹; sie wird alles nachlernen bei ihrem festen, guten Willen und ihrer großen Jugend. Mutter, ich bin sehr, sehr glücklich!
Dein dankbarer Sohn Hans.
*
Liebes Muttchen!
Weißt Du noch, wie Du früher immer sagtest: »Reinlichkeit ist das halbe Leben, aber man braucht deshalb nicht in seinem Wäscheschrank herumzuwüsten?«
Jetzt denke ich so oft an Deinen Ausspruch, dessen Tragweite ich damals nie recht überlegte. Ich ›wüstete‹ tatsächlich im Anfange unserer Ehe im Wäscheschrank herum, fand es so reizend, immer frische Tischtücher mit neuen Mustern herauszunehmen, besonders da Hans ein Meister in Ungeschicklichkeit ist, und Sauce und Kompott sich vor seinem Teller auf dem weißen Damast immer ein anmutiges Stelldichein geben. Nun, und auf schöne und frische Leibwäsche gab ich ja allezeit mehr, als auf Kleiderkrimskrams. Wie wurde mir aber zumute, als schon nach drei Wochen der Korb mit der schmutzigen Wäsche überquoll! (Verzeih Mutti, ich konnte mich nicht entschließen, sie geordnet auf dem Boden aufzuhängen, und Mäuse haben wir hier auch Gott sei Dank nicht.) Also er quoll über und Minna sagte mit kritischem Blick: »Na nu wird das Zeit mit die Wäsche, sonst versaufen wir drin.« Wäsche! Hu, wie greulich! Unsere alte Marie machte das doch bei uns so geräuschlos als möglich mit der ›Kiesewettern‹, so daß ich eigentlich nie etwas vom Wäschetag merkte. Nur das eine Mal ließest Du mich kochen, weil Hans zu Tisch kam und das Hausmädchen krank war, und ich machte ihm sein Leibessen: ›Thüringer Kartoffelpuffer‹, vergaß aber die Kartoffeln abzuwaschen, weshalb sie sandig waren. Hans fiel mir aber doch nach Tisch dankbar um den Hals und sagte, alles Unrechte wäre mit diesem Gericht aus seinem Magen herausgescheuert worden, und das sei nicht zu unterschätzen.
Aber ich wollte Dir von der Wäsche erzählen. Minna besorgte also eine Waschfrau, die ›bei ihrer Freundin ihrer Schwägerin ihrer Cousine‹ wusch und sehr tüchtig sein sollte. Ach, es war keine freundliche Frau Kiesewettern aus Thüringen, die immer so gemütlich des Morgens grüßte: »Dienerchen, Dienerchen, Frau Räten,« und des Abends: »Na machen Se scheene atje, Frau Räten,« nein, es war ein Drache, Teufels Großmutter in Person. Um 5 Uhr früh weckte uns ein ganz unvernünftiges Sturmläuten an unserer Haustür. Das heißt, es weckte mich, denn Hans rührte sich nicht und Minna könnte man nachts fortschleppen, ohne daß sie es merkte. Ich kleidete mich zitternd und notdürftig an und fragte durch die Sicherheitskette: »Wer ist das?«
»So 'ne Frage! Ik bin dat! De Helfrichen! Ik stehe da, un bimmele mir Brandblasen an de Finger un hab mer de Beine schon 'n Zollener achte ins Leib jestanden.« Ich ließ sie herein und erinnerte mich mit einem Male, daß die Kiesewettern auch immer in aller Herrgottsfrühe kam, freilich hatte ich damals noch keine Pflichten und durfte süß weiterschlummern. Ich weckte nun schleunigst die Minna und wollte mich aufatmend in meine Kemenate zurückziehen, da rief die grobe Stimme wieder:
»Ik darf mir den Kaffee woll in die Küche zu's Jemüte führen?«
Himmel, der Kaffee! Ich hatte gar keinen gekocht, und es würde viel zu lange dauern, wenn ich auf Minna warten wollte. Zum Glück fand sich vom vergangenen Tage noch genügend Stoff vor, ein qualmendes Brikett im Herd erleichterte mir das Feueranzünden und so hatte ich verhältnismäßig rasch den braunen Trank aufgewärmt. Inzwischen schnitt sich Frau Helfrich selbst zwei ordentliche Brotkanten, so richtige ›Runxen‹ ab, bestrich sie zwei Finger dick mit meiner besten Grasbutter, die eigentlich für Hans zum Frühstück bestimmt war und setzte sich beschaulich zum Trinken hin. Freilich ließ sie gleich nach dem ersten Schluck die Tasse sinken, und meinte: »Ik, wat ik bin, pflege mein Spülwasser immer in 'n Ausjuß zu jießen,« und als ich sie empört ansah, blickte sie beinahe tragisch in ihre Tasse und sagte: »Armer Mokka, an dir hat Zuntzen seine selige Witwe keinen Anteil!«
Ich drehte ihr den Rücken zu, um zu zeigen, daß ihre Monologe kein Interesse für mich hätten, aber meine Ohren konnte ich nicht verstopfen. »Na, mein sojenanntes Kaffeeken, wenn du denn ok nich stark bist wie Herkulessen, un nich so schwarz wie die Nacht und nich heiß wie die Hölle, so will ik dir süß wie die Liebe machen – – –«
Mutti, – meine Zuckerdose kann's bezeugen, daß sie es getan hat.
Gott sei Dank kam jetzt Minna, die Frau Helfrichs Ausdrucksweise schon von ›ihrer Freundin ihrer Schwägerin ihrer Cousine‹ her kannte, und ich verließ die Küche. Nach einer halben Stunde wurde die Tür unseres Schlafzimmers geöffnet und Frau Helfrichs Stimme ertönte: »Seefe!«
Ach so – die Seife hatte ich ganz vergessen. Ich kramte im Fache meines Toilettentisches herum, wo ich einen ganzen Kasten feiner Seife, ein Geschenk von Hans, aufbewahrte. Sie war mir natürlich beinahe zu schade für diesen Zweck, aber schließlich nahm ich drei große Stücke Glyzerinseife, die ich am wenigsten gern habe, und ging damit in die Küche. Als ich sie aber auf den Tisch des Hauses niederlegte, traf mich ein Blick, Mutti – ich fühlte, wie ich bis über beide Ohren rot wurde, so viel höhnische Verachtung lag darin. Dann richtete sich Frau Helfrich hoch, nahm ihre knochigen Finger der einen Hand einzeln abzählend in die andere und schrie mich an: »Drei Pfund Soda, drei Pfund Schmierseife, drei Pakete Bleichsoda, ein Pfund Stärke, ein Paket Waschblau, drei Pfund Terpentinseife, for 20 Pfennige Chlor.«
Bebend händigte ich Minna einen Taler ein, und sie stürzte fort.
Der ganze Vormittag war schrecklich. Frau Helfrich beanspruchte Minna ganz für sich, ich mußte alles allein tun, dabei war der Spiritus unter der Kaffeemaschine aufgebrannt, und ich mußte auf dem Herd kochen. Das Feuer wollte aber nicht brennen, und mein armer Hans mußte ohne Kaffee ins Büro. Er sah mich sehr ernst an, – o Mutti, das tat so weh und ich schluchzte laut, als die Tür hinter ihm ins Schloß fiel. Aber für seine Enttäuschung wollte ich ihm auch glänzenden Ersatz schaffen. Ich griff tief in mein Wirtschaftsgeld, holte eigenhändig vom Schlachter ein Pfund Schweinskoteletts, die Hans so gern ißt, bei dem Delikateßhändler holte ich drei Pfund feinste Salatkartöffelchen und eine Flasche bayrisches Bier.
Es schmeckte alles tadellos, aber als ich der Waschfrau und Minna jeder ein Kotelett und Salat gegeben hatte, war der Überrest für Hans und mich kläglich. Ich beschloß also satt zu sein und rief die dienstbaren Geister aus der Waschküche herauf. Das erste, was Frau Helfrich tat, war, daß sie die einzige Flasche bayrisches Bier, die ich für Hans bestimmt, entkorkte, indem sie sagte: »Tantalus war'n Waisenknabe jejen mich.«
Dann aß sie mit großem Behagen, aber ich dachte, mich rührt der Schlag, als sie kauend bemerkte: »Det is vernünftig, det Sie Vorspeisen jeben, wenn och de Portionen noch mal so jroß sin könnten.«
Vorspeise! Kotelett und Kartoffelsalat Vorspeise! Und ich hatte nichts, aber auch nichts weiter im Hause! Ich stürzte hinaus und überließ es Minna, ihr den Tatbestand zu erklären. Das hat sie denn auch getan und erzählte mir nachher, Frau Helfrich habe erst etwas herumgewütet, aber dann gesagt, ich sei ja noch jung und bildungsfähig und wenn ich zum Nachmittagkaffee einen ordentlichen Napfkuchen anfahren ließe, wollte sie mir's noch mal verzeihen.
Ich besorgte denn auch tüchtig Kuchen und Honigsemmeln und ging gegen 3 Uhr mit einer mächtigen Kaffeekanne hinunter, der braune Trank wurde geprobt und für würdig befunden, Madame Helfrich und Fräulein Minna zu laben. Aber nun kam etwas Schreckliches. Ich guckte so von ungefähr in den Wäschezuber und – – lauter fremdes Zeug starrte mir entgegen, starrte in des Wortes verwegenster Bedeutung, Ich nahm dieses Stück hoch und jenes; grobe, schmutzige Wäsche überall, nur in zwei entfernteren Behältern, die nicht einmal mir, sondern der Wirtin gehörten, lag eingeweicht, aber noch nicht gekocht oder gewaschen meine Wäsche. Ich stand angewurzelt auf meinem Platz und sah Frau Helfrich an, ein großer, ehrlicher Zorn hatte mich gepackt, aber ich konnte kein Wort herausbringen. Sie lachte höhnisch und doch unbehaglich.
»Na?« sagte sie endlich herausfordernd. »Man nich so s–tarr un s–tumm vor S–taunen s–tehn! Was is denn los? Reden Se doch en Ton! Jroßer Gott, jejen Sie is ja Lots Weib det reene Perpetuum mobile!« Ich zeigte immer noch stumm auf die fremde Wäsche. – »Na ja doch!« rief sie. »Bei mir heeßt dat: Erst's Jeschäft und dann's Verjnüjen, Ihre Wäsche zu waschen, die kaum en eenzjes Fleckchen hat, is en Verjnüjen, un da wasch ik nu vorher von 'ner andern Familie.«
»Sie sind unverschämt,« rief ich zornig, da kam ich aber böse an. Sie wurde beinahe zur Furie, raste in der Waschküche umher, zog die fremden Stücke wutschnaubend durch die Ringmaschine, warf sie in einen Korb und währenddessen sprudelte sie eine Menge durchaus unparlamentarischer Redensarten heraus. Zuletzt stellte sie sich herausfordernd vor mich hin und schrie: »Na nu, adjes! Die zwei Mark fuffzig, die ik eijentlich von Sie beanspruchen kann, will ik Ihnen schenken, Sie können sich davor 'n verjnügten Dag machen. Aber ik jehe. Ik lasse mir nich ›unverschämt‹ nennen von en Kücken, wovon ik de Urhenne sin könnte.«
Damit zog sie mit dem Wäschekorb ab, und unsern ganzen Kuchen nahm sie mit, Minna und ich starrten ihr schreckensbleich nach.
Da lag nun meine Wäsche, nicht ein Stück war in Angriff genommen. Ich rang die Hände, aber Minna war resolut und sagte: »Nur ruhig Blut, Anton, ich mache frisch Feuer und dann waschen gnä Frau und ich druff los. Was zu doll aussieht, stecken mer in Chlor.«
Na, das geschah, abends um 8 Uhr stand ich noch weinend am Waschfaß, das Blut floß über meine Finger, als Hans aus dem Dienst kam, und an seinem Herzen weinte ich mich dann noch einmal gründlich aus. Eine freundliche Frau aus dem Hinterhause erbot sich, die Wäsche fertig zu machen und sie erlöste auch sofort meine Tischtücher aus der Chlorbrühe, gottlob, – nur zwei waren verbrannt, die aber auch gründlich.
Ach Mutti, ich war so unglücklich über mich selbst und Hans dabei so einzig gut! Er küßte mir die Tränen fort und sagte zu all meinen Selbstanklagen, ich sei ein süßes, gutes, liebes Geschöpfchen und das bin ich doch nicht, ich bin nichts als Dein
dummes, dummes Kind Lisel.
*
»Hans, wir müssen nun endlich die Liste für die Besuche aufstellen.«
»Hm.«
»Ja, du ›hm'st‹ immer bloß, aber was sollen die Leute denken!«
»Die denken nichts.«
»Hans, sieh mal, die Flitterwochen sind doch vorüber – –«
»So? Schon? Ich dachte, die dauerten länger –«
»Ach, Hans, du weißt ja doch, was ich meine. Wir müssen jetzt unter die Leute. Also hier ist ein Zettel und ein Bleistift. Zuerst dein Chef – –«
»Lisel – – – – «
»Na, was ist? Warum bist du so verlegen?«
»Komm mal her, kleines, liebes, süßes Frauchen. Sag', kannst du wohl einen Puff vertragen?«
»Hans, du ängstigst mich. Was willst du damit sagen?«
»Sieh, Lisel, – du warst bis jetzt ein rechtes Gesellschaftstierchen, du bist unter Staatsuniformen und zweierlei Tuch groß geworden und ich hoffe, dich auch später wieder in die ersten Kreise führen zu können. Vorläufig aber –«
»Hans!!!«
»Da ist nichts zu erschrecken! Sieh, wir könnten ja die Besuche machen – aber – sei nicht traurig, Kleines, die Herrschaften würden uns einfach nicht einladen, ich bin eben erst am Anfang meiner Karriere, wohin sollte das wohl führen, wenn der Chef seine jungen Beamten alle mit den Frauen einladen wollte, – oft sind die Frauen auch gar nicht danach – – –«
»Aber ich, Hans? Papa war doch ›Geheimer Ober-Rat zweiter Klasse.‹
»Ja doch, ja doch! Aber wenn er auch der Erzengel Gabriel gewesen wäre, so bin ich eben nur der simple Soundso, noch nicht mal Rat fünfter Güte, und du bist nichts, – als meine Frau.«
»Hans!!«
»Ist das so schrecklich, Liebling? Sieh, in drei bis vier Jahren hoffe ich soweit zu sein, meinen holden Schatz in die Gesellschaft einführen zu können, der ich sie übrigens gar nicht gönne.«
»In vier Jahren? Da bin ich ja 'ne Greisin.«
»Na, na Lisel! Dreiundzwanzig knapp! Bis dahin leben wir still für uns, suchen uns ein paar nette Spezialkollegen, da ist z.B. der Rödel –«
»Ich danke! Der und nett! Mit dem könnte ich hundert Jahr auf 'ner wüsten Insel leben – –«
»Das wollt' ich mir energisch verbeten haben!«
»Ich meine ja bloß – Hans – – «
»Lisel, sei doch froh, daß wir die Abfütterungen noch nicht mitzumachen brauchen, mein Gehalt ist ja mehr als knapp –«
»Und meine reizenden Kleider, Hans? Wem soll ich sie zeigen? Das mattblaue, das weiße, und dann das mit den süßen Plissees?«
»Ja, den ›süßen Plissees‹ zuliebe können wir die Gesellschaftsordnung nicht umstoßen, aber du kannst sie Sonntagsnachmittags anziehen, und dann stell' ich mich mit dir vor die Haustür – – «
»Hans!!!«
»So heiß' ich.«
»Aber noch eins, Hans! Du hast doch früher bei deinem Chef verkehrt, du warst doch Maître de plaisir, du bist doch Reserveoffizier – –«
»Jaaaa – als Junggeselle – –! Darüber zerbrich dir nicht den Kopf, Kleines, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde – –«
»Und so weiter, und so weiter!«
»Nicht kribbelig sein, Schatz! Wir wollen frohlocken und jauchzen. Zu einer Kochfrau langt's sowieso nicht, und du könntest unseren Gästen doch nicht ›Wassersuppe mit Wiener Würstchenkrümeln‹ – – «
»Du sprichst von Zeiten, die vergangen sind – –«
»Na, na!«
»Im übrigen – Hans, ich glaube, du hast recht! Ich werde in den vier Jahren kochen lernen und – und – und«
»Lisel! Herzensschatz! Du bist eine Perle deines Geschlechts!«
*
Liebstes Muttchen!
Wieder muß ich für mein langes Schweigen um Verzeihung bitten, wir hatten etwas sehr Ärgerliches erlebt, ein Nachspiel mit Frau Helfrich, die, aufgehetzt von anderen und bösartig von eigener Natur, sich umbesonnen hatte und nun doch noch die zwei Mark fünfzig Pfennig Taglohn verlangte, für die sie doch absolut nichts geleistet hatte. Auch über das Essen schimpfte sie laut und machte uns einen ganz greulichen Auftritt, so daß Hans sie schließlich hinauswarf. Ich habe ihn noch nie so böse gesehen und zitterte vor Angst, – ach, wenn ich dächte, er könnte zu mir einmal so sein! Ich will mir furchtbare Mühe geben, daß ich so etwas nie, nie verdiene.
Aber wie zur Entschädigung kam auf den Schreck etwas ganz Herrliches. Ich habe einen großen Ball mitgemacht, den ersten in meinem ganzen Leben. Unsere Verwaltung hat einen Verein ihrer Mitglieder gegründet und diesen Verein besuchten wir neulich. Fein bescheidentlich saß ich neben Hans am untersten Ende der Tafel, an meiner anderen Seite hatte ich ›Kollege Rödel‹, der mich mit ›Fliegenden Blätterwitzen‹ anödete. Er hatte sie alle auf einen langen Zettel aufgeschrieben und lachte zu jedem Witz dröhnend, so daß sich die Leute nach uns umsahen. Dabei stammten die Sachen von Methusalems Großmutter her.
An der Quertafel, weit, in nebelgrauer Ferne thronte der Chef von Hans. Ich warf ab und zu einen Blick hin zu ihm und seiner liebenswürdigen Gattin, die so ein gutes Gesicht hat und Dir ähnlich sieht, mein Mütterchen. Und nun höre und staune: Zwischen dem Eis und dem Käse, nach einem Toast auf die Kollegialität, erhob sich der Chef, stieß mit den Umsitzenden an und kam plötzlich auf unsere bescheidene Ecke zu, tippte Hans an und sagte: »Wollen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin vorstellen?« Ich versank in einem tiefen Knicks und er nahm meine Hand und sagte, er habe eben erfahren, ich sei eine geborene S. und er habe meinen lieben Vater hochverehrt. O, wie glücklich war ich über dies Wort! Die Tränen kamen mir in die Augen, – ich habe ja so oft unsern herrlichen Vater rühmen hören, vor allem seine wahrhafte Herzensgüte. Über das Grab hinaus bin ich ihm dankbar für dies Erbteil, was er uns hinterlassen hat, wertvoller als Geld und Gut. – Viel und lange plauderte der Chef mit mir, ich redete schließlich ganz zutraulich, wie mir der Schnabel gewachsen war; ein paarmal hatte ich gewiß 'was Dummes gesagt, denn er lachte laut, und Hans kniff mich auf der andern Seite braun und blau. Nachher führte mich der Chef zu seiner Gattin und nach kaum einer Viertelstunde schwärmte ich bereits für sie, so reizend ist ihr ganzes Wesen. Nach Aufhebung der Tafel ließen sich mit einem Male alle Herren mir vorstellen und ich tanzte dann ununterbrochen wie ein Wasserfall. Hans benahm sich etwas sonderbar und stand die ganze Zeit mit gerunzelter Stirn an einem Eckpfeiler, er war aber nicht etwa eifersüchtig, – du lieber Himmel, – was sind auch alle Männer der Welt gegen ihn! – Greuliche, langweilige Nullen, nuller wie null!
»Mei Hans is mei alles, Mei Glück un mei Lebe, An bessern wie Hans is. Den kann's gar nit gebe. Ob's regnet, ob's schneit, Ob's donnert, ob's blitzt, I fürchte mi gar nit. Wenn mei Hans bei m'r sitzt. Holdrihohü!!!«
Aber Hans erzählte mir nachher, das liebenswürdige Vorgehen des Chefs hätte ihm natürlich sofort Neider zugezogen und Kollege Rödel sagte schon den ganzen Abend spöttisch ›Exzellenz‹ zu Hans. Nun, Kollege Rödel ist zwar ein Greuel, aber ich selbst bin der Ansicht, daß Hans eine prächtige Exzellenz abgeben wird, das sagte ich ihm auch, aber er blieb verstimmt. Trotzdem hat er gleich am andern Tage mit mir beim Chef Besuch gemacht, denn dieser hatte uns direkt dazu aufgefordert, und heute ist eine Einladung zum Ball gekommen und wir mußten sie natürlich annehmen. Hans kopfschüttelt: »Wohin soll das führen, was werden die Kollegen sagen?« Ich habe ihn aber beruhigt. Die ganze Sache wird zu einer kleinen netten Abendgesellschaft führen, womit wir uns ›rippeln‹, und wenn die Kollegen uns ärgern, bleibe ich bei dem nächsten Toast auf die Kollegialität sitzen. Über den Ball beim Chef berichte ich Dir später ausführlich; ich werde wohl einen ganzen Abend zum Briefschreiben Zeit haben, denn Hans hat tags darauf Kegelabend mit ›Wegessen‹ eines Kollegen, er kommt dann erst ›früh‹ heim, wie er mir schonend mitteilte. Ich finde das zwar schrecklich, aber – – Du weißt, was ich mir vorgenommen habe.
Dein sehr, sehr glückliches Kind.
*
Liebste Mutter!
Der erste Abend, den ich ohne Hans verlebe! Ich habe ganz schreckliche Sehnsucht nach ihm und unser Abschied war herzbrechend. Beinahe hätte er alles im Stich gelassen und wäre bei mir geblieben; aber er hatte mir vorher erzählt, die Kollegen hätten ihn gefragt, ob er auch kommen › dürfe‹, und diese alberne Junggesellenfrage wurmt ja jeden Ehemann. So bat ich ihn denn selbst höchst heroisch, zu dem Feste zu gehen und er tat es mit erleichtertem Aufatmen. Jetzt ist es zwei Uhr nachts. Schilt nur nicht mit mir, daß ich nicht schon längst mein Lager aufgesucht habe, – ich graulte mich, allein zu schlafen und wir haben es uns recht gemütlich gemacht, Minna sitzt neben mir und häkelt eine schwarze Spitze. Wie sie das fertig bringt mit weißem Garn, das wissen nur die Götter und ihre Finger, Ich selbst habe eine wundervolle Decke angefangen für Hans' Geburtstag, sie ist riesengroß und bedarf vieler Mühe. O, meine Mutti, nun kommt aber die Hauptsache, wie war der Ball beim Chef schön! Wie haben mich alle verwöhnt! Ganz beschämt war ich und doch sehr glücklich, denn Hans, mein einziger Hans.
*
Eine Stunde später.
Ich bin wie zerschlagen, Mutter! Wer hätte das gedacht! Minna fleht mich an. Dir alles zu schreiben, aber mir zittert die Hand. Wer hätte das von Hans gedacht, von meinem herrlichen, angebeteten Mann!
Ach – vorbei, vorbei! Ob ich morgen schon zu Dir komme mit Sack und Pack? Ach, mir ist der Kopf ganz wirr und das Herz tut so weh – aber Du sollst alles wissen! Wir hörten vor ungefähr einer Stunde ein fürchterliches Poltern und Rummeln auf der Treppe, dazu laute Stimmen, Minna und ich klammerten uns ängstlich aneinander an. Mit einem Male wird die Tür aufgeschlossen, ich schreie um die Wette mit Minna, da steht Hans in der Tür, neben ihm unser Wirt lachend über das ganze Gesicht, auf der andern Seite ›Kollege Rödel‹. Beide hielten meinen Hans, ja – sie hielten ihn, Muttchen, denn er – war – er war be – – nein – ich kann es Dir nicht sagen. »Man keene Bange nich,« rief mir unser Wirt zu, »jefährlich is er nich, aber schleunigst rin in die Klappe mit ihm, sonst stehe ich for nischt.«
Kollege Rödel machte mir ein paar stumme Verbeugungen und hatte so viel Takt, sich gleich zu empfehlen, der Wirt ging auch und nun balancierte Hans auf mich zu, nachdem er vergebens versucht hatte, den beiden Herren zum Abschied einen Kuß zu geben. Ich entfloh schreiend und verschanzte mich hinter den Tisch, da nahm er Minna an der Hand und tanzte und sang: »Minna, du bist meine Freuiiide, ja Freuiiide!«
Minna wußte gar nicht, wie ihr geschah, sie fing auch an zu schreien, und kündigte uns den Dienst. Ich hielt Hans eine ganze lange Rede, die er mit blödem Lächeln anhörte. Als ich fertig war, sagte er nur: »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!«
Nachdem ich noch glücklich verhindert, daß er sich auf den guten Teppich legte, begab er sich unaufhörlich singend in das Schlafzimmer, aus dem jetzt entsetzliche Töne dringen. Und er hat doch sonst nie geschnarcht.
Minna und ich wachen, wir halten uns fest bei der Hand und Minna tröstet mich auf ihre Weise. »Das sind die besten Menschen, die viel trinken,« sagt sie, »un sie können nischt davor, Suff is erblich.«
Ach Mutter! – – – – – – – – – – –
Schreibe mir, wann Dein unglückliches Kind zu Dir heimkehren darf, ich kann doch nach dem Vorgefallenen unmöglich bei Hans bleiben!
*
Mittags 12 Uhr.
Liebste Mutter, ich bleibe doch bei Hans, er ist sehr krank. Den ganzen Morgen hat er geweint, es ist schrecklich anzusehen, wie er leidet. Mich nennt er nur: ›unglückseliges Weib‹ und mit Minna ist er auch rührend gut und redet sie mit ›edles Wesen‹ an; aber dann weint er immerzu. Ich rief heute den Arzt, welcher ›akute Alkoholvergiftung‹ feststellte. Wie schrecklich! Kann das schlimm werden? Hans hat ein ganzes Fäßchen saurer Heringe neben sich stehen und schon mehrere Seidel Bier getrunken.
Der Doktor scheint die Sache sehr leicht zu nehmen, er ist noch jung und hat das ganze Gesicht voller Schmisse.
Ein Rezept wollte er nicht schreiben.
»Legen Sie nur Hundehaare auf, gnädigste Frau,« sagte er.
Aber wo nehme ich die her?
Jetzt schläft Hans und ich will mich auch etwas hinlegen.
*
Abends.
Gottlob, Hans ist wieder gesund, aber sehr gnittrich und verstimmt, Minna und ich gehen in großem Bogen um ihn herum. Ich habe ihm erzählt, was er alles in seiner Krankheit getan hat und nun ist er entsetzlich wild geworden, am meisten aber hat er gescholten, daß ich den Arzt geholt habe. Man kann es den Männern selten recht machen. Zu dieser Weisheit habe ich mich schon aufgeschwungen. Leb' wohl, liebste Mutter! Ängstige Dich nicht weiter um uns.
Dein Lisel.
*
Liebstes Muttchen!
Das hättest Du doch wohl nie geahnt, daß Dein unschuldiges Kind einmal würde vor Gericht erscheinen müssen. Einmal, und hoffentlich nie, nie wieder! Mir schlagen noch immer die Zähne im Fieberfrost zusammen, wenn ich an den ›Termin‹ denke, während Hans die Geschichte bereits lachend seinen Kollegen erzählt hat. Sehr zart besaitet ist er nicht. Also es klingelte eines Tages sehr stark und dann kam Minna herein, blaß und aufgeregt und sagte: »Gnä Frau, ein Polizist sind draußen, ich bin aber unschuldig.«
Ich ging zagend hinaus (ein Polizist ist immer etwas Unheimliches), und da stand er auch da, groß und breitschultrig wie ein geborner Herrscher. Auf seinem Gesicht las ich deutlich: »Noch so jung, und schon dem Gericht verfallen'!« Er fragte nach Hans, und da dieser im Büro war, schob er unverrichteter Sache wieder ab.
Minna erging sich in den kühnsten und schrecklichsten Vermutungen, was wohl den Mann des Gesetzes zu uns geführt haben könnte; es kam aber zuerst nichts danach, bis nach acht Tagen der Briefträger mir einen Bogen brachte, den ich mit Herzklopfen las, während der Bote extra auf ein Blatt schrieb, daß er die Vorladung dem Adressaten selbst abgeliefert hätte. Ach, ich armer Adressat! Ich sollte Dienstag den soundsovielten, vormittags 11 Uhr im Gerichtsgebäude als Zeugin in Sachen Helfrich kontra Bitterlich vernommen werden.
Ich war starr. Frau Helfrich kannte ich ja, es war meine verflossene Waschfrau schlimmen Angedenkens, aber Frau Bitterlich – –
Wenn der liebe Gott sie nicht besser kannte, als ich –
»Frau Bitterlich ist die dicke Rentiöse von vorne eine Treppe hoch,« sagte Minna. »Sie hat 'n elenden Krach mit die Helfrichen gehabt und da hab' ich ihr erzählt, daß gnä Frau auch uff'n Kriegsfuß mit das Waschweib ständen.«
»Das war sehr überflüssig, Minna,« erwiderte ich. »Nun vertrödeln wir einen ganzen Vormittag mit dieser unangenehmen Sache und Sie müssen gewiß auch mit, denn Sie sind auch Zeugin von Frau Helfrichs Unverschämtheit gewesen.«
»Ik jehe nich,« sagte Minna bestimmt, »Solche Leute wie mir sperren se gleich in. Von gnä Frau nehmen se en Lösegeld, ik kenn mich aus mit die Gerichten.«
Zitternd vor Angst begab ich mich also am Dienstag vormittag 11 Uhr in das Gerichtsgebäude und Hans, der mich begleitete, konnte es sich nicht versagen, auf eine der vergitterten Zellen zu deuten mit dem Bemerken: »Denke nur nicht an Flucht, die Dinger sind viel zu hoch!«
Wie zerschlagen saß ich auf der Zeugenbank. Von 11 Uhr Vormittag bis 2 Uhr Nachmittag warteten wir erst mal, dann begann unser Termin. Als der Richter mir den Eid vorsprach, wurde mir ganz schwach, und wie ich die rechte Hand hob, ach – da sprach ich nicht nur in vorgeschriebener Formel, da gelobte ich innerlich recht, recht gut zu werden, nie mehr meinen Hans anzufahren, nie mit dem Fuße zu stampfen, recht schön kochen zu lernen, überhaupt eine ganz mustergültige Hausfrau zu werden. Dann sollte ich erzählen von dem Wäschetag bei uns und ich war schon mitten drin, da schrie ein Mann mich an: »Ich ersuche die Zeugin lauter zu sprechen!« Es war der Verteidiger von der Frau Helfrich. Nun fing ich an zu weinen, und da verstand man erst recht nichts. Dann erzählte Frau Helfrich von der Wäsche bei uns, natürlich furchtbar übertrieben, und als sie die Verpflegung schilderte und den Geschmack des Kaffees, da lachte der ganze Zuschauerraum schallend, und ich wäre am liebsten in den Erdboden gesunken! Der Vorsitzende wurde aber böse und drohte den Zuschauerraum räumen zu lassen; da war's denn still und schließlich wurde Frau Helfrich verdonnert und gleich in Haft genommen, wegen ›ungebührlichen Betragens vor Gerichts‹.
Sie folgte dem Polizisten mit erhobenem Kopf und triumphierendem Lächeln, ich dagegen schlich ganz geknickt hinaus und Hans erzählte mir, eine Frau aus dem Volke, die wohl nicht viel von der ganzen Verhandlung verstanden, hätte von mir geäußert: »Das arme, junge, blasse Wurm, das hält ja 's Sitzen gar nicht aus.«
Hans nahm vor der Tür zartfühlend eine Droschke, und ich konnte ungestört heulen wie ein Schloßhund. Minna weinte auch, als ich nach Hause kam, es ist doch eine treue Seele. Sie schüttelte mir beinahe die Hand ab vor Freude, daß ich wieder da war. Das versöhnte mich mit ihrer Dummheit, denn denke Dir, sie hatte einen Kranz an die Tür gehängt mit der Inschrift »Wilkomen aus den Gefänknies!«
Gottlob, es war während der Zeit niemand die Treppen herauf und hinunter gegangen. Frau Bitterlich von ›vorne, eine Treppe hoch‹ lud mich noch zu einer Tasse Kaffee ein, um das freudige Ereignis zu begießen; aber ich lehnte ab, ich legte mich schachmatt gleich ins Bett. Hans lacht mich aus; aber ich möchte am liebsten gar nicht mehr auf die Straße gehen. Gestern grüßte mich schon ein Polizist.
Leb' wohl, geliebtes Muttchen.
Dein sehr trauriges Kind.
*
Geliebte Mutter!
Unsere erste Gesellschaft haben wir glücklich hinter uns. Der Ausdruck ist aber schlecht gewählt, ›unglücklich‹ paßte eher. Böse Mächte müssen sich an dem Tage gegen uns verschworen haben. Meine Speisekarte lautete:
›Bouillon in Tassen, Grüne Erbsen mit Schinken, Kalbsbraten mit Kartoffeln, Kompott, Salat, Pudding. Butter und Käse‹
Eingeladen hatten wir den Chef mit seiner Gattin und Tante, einer alten, strengen Dame, die sehr gefürchtet ist. Dann den unvermeidlichen Kollegen Rödel, ferner Assessor G., der uns erzählte, er hätte nach dem ersten Besuch bei uns wochenlang an Hexenschuß gelitten, worauf wir uns verständnisvoll ansahen, da wir ja wissen, daß die Sessel schuld haben.
Ich hatte die Bouillon schon einen Tag vorher sehr langsam und liebevoll gekocht, schön abgefettet und auf den Herd gestellt. Als ich sie um 7 Uhr heiß machen wollte, war sie fort – Minna hatte sie (Hans behauptet, ›in einem Anfall von Wahnsinn‹) in den Ausguß geschüttet. Auf mein Händeringen sah mich Minna bloß furchtbar dämlich an (sie steht der Erfindung des Pulvers weltfremd gegenüber) und entschuldigte sich: ›die Suppe roch nicht‹. Das ist natürlich böswillige Entstellung der Tatsachen, denn was an Fleisch fehlte, hatte ich reichlich mit Sellerie, Porree und Petersilienwurzel ergänzt, sie muß gerochen haben. Mein Schlachter brachte mir zum Glück noch Fleisch, das im Galopp gekocht und mit ›Liebig‹ aufgemuntert wurde; aber natürlich war nicht viel Saft und Kraft drin. Ich sah wohl, wie der Chef nach jedem Schluck zuschmeckte, als sollte nun erst das ›Eigentliche‹ kommen; es kam aber nicht. Beim Heißmachen der Pasteten ließ Minna fünf dieser appetitlichen Dinger im Feuer aufgehen, so daß Hans und ich keine bekamen und außerdem nicht zweimal angeboten werden konnte. Es sah jammervoll aus. Die grünen Erbsen waren etwas mehlig schon, sättigten aber dafür prachtvoll und der Schinken war ausgezeichnet. Der Kalbsbraten – liebste Mutter – so schlecht war er wirklich nicht, wie Hans ihn darstellt, er behauptet, ›eine Kuh sei dazu kurz vor ihrer goldenen Hochzeit geschlachtet worden‹. Dagegen muß ich vom Pudding selbst sagen, daß er sehr nach Gelatine schmeckte; ich hatte die doppelte Menge genommen, aus Angst, daß er sich nicht stürzen ließe. Von Butter und Käse wurde wieder viel gegessen, Minna mußte dreimal herumreichen, es ist das eigentlich noch auf keiner Gesellschaft der Fall gewesen.
Beim ›Mahlzeitsagen‹ meinte der Chef, so ein junges Paar brauchte sich gar nicht zu revanchieren, man sähe so liebe Menschen immer so gern bei sich, ohne ans Wiederhingehen zu denken. – Ich fand das reizend gedacht, während Hans meint, der Wink mit dem Zaunpfahl sei deutlich genug, daß der Chef nicht beabsichtige, sich bei uns den Magen öfter als einmal an ›Wassersuppe, alten Kühen und Gelatine‹ zu verrenken.
Nach Tisch lotsten wir den Chef aufs Sofa, wo er behaglich bei einer guten Zigarre saß; unglücklicherweise kam die Tante aus eigener Schuld auf einen Sessel, weshalb sie bis jetzt bettlägerig ist. Wir bringen heute die Sessel auf den Boden. Hans behauptet, sie seien die ›Mörder seiner Karriere‹. Jedenfalls ist es für lange Zeit unsere letzte ›Gesellschaft‹ gewesen; sie hat ein großes Loch in mein Wirtschaftsgeld gerissen, so daß ich meinen ›Flügel‹ wieder in nebelgraue Ferne gerückt sehe.
Leb' wohl, leb' wohl!
*
Liebste Mutter!
Vielen Dank für Deine herzlichen Wünsche und reizenden Gaben zu Hans' Geburtstag. Du hast Dir so viel Mühe und Ausgaben gemacht, Herzensmutter und – alles umsonst. Laß mich Dir den schrecklichen und doch schönen Geburtstag schildern, den ersten, den wir in unserem lieben Nestchen feierten. Ich hatte alles geschmackvoll aufgebaut. In der Mitte prangte der wundervolle Makartstrauß, daneben die großen Lichter und auf der Geburtstagsbrezel, die ich eigenhändig mit viel Liebe gebacken (sie war deshalb auch glitschig geworden), 28 Lichtchen, so richtige bunte Geburtstagslichtchen. Dann kam die wunderschöne Decke von mir und der zarte Tischläufer von Dir nebst Portemonnaie und Schlipsen; Olga und Karl hatten sich mit einem feudalen Tafelaufsatz losgelassen, der uns immer noch fehlte. Schwester Paula, die liebe, unermüdlich Fleißige, hatte vier Paar Strümpfe gestrickt; Minna hatte ihm Topflappen gehäkelt für die Küche, ein wirklich schönes, praktisches Geschenk, worüber aber Hans natürlich Lachkrämpfe bekam. – Ich stecke also die Lichter an, gehe zu Hans und Minna ins Wohnzimmer, wo eben die feierliche Überreichung der Topflappen stattgefunden hatte und spiele den Geburtstagschoral. Als ich fertig war, schloß mich Hans tiefgerührt an sein Herz, ich schlang meine Arme um seinen Hals und dünkte mich das glücklichste Geschöpf auf Gottes Erdboden, Minna heulte wie ein Schloßhund, und dann führte ich Hans nach dreimaligem Klingeln ins Geburtstagszimmer.
Mutti – – ein Flammenmeer erwartete uns. Alles brannte, Kuchen, Geschenke, Tischdecke, und das Makartbukett schickte wahre Funkengarben auf Sofa und Sessel. So blickte Lots Weib auf Sodom und Gomorrha! Dann versuchten wir zu retten – aber vergeblich. Minna goß planlos einen Eimer Wasser nach dem anderen auf den Geburtstagtisch, sie goß noch, als alles schon ein rauchender Trümmerhaufen war und hörte nicht auf, bis Hans sie fragte, ob sie eine Schwimmanstalt einrichten wollte. O, wie das Zimmer aussah! Noch jetzt bekommen wir den strengen Brandgeruch nicht heraus. Und alles verdorben, verbrannt, verwüstet, mit Ausnahme der Sessel, dieser Unglückstiere, die aus dem Funkenregen unversehrt hervorgegangen sind. Ich weinte natürlich ganze Bäche, Hans suchte mich zu trösten und faßte die Sache humoristisch auf. »Ach der wunderbare Tischläufer!« sagte er zu einem Endchen verkohlten Zeug, »dieser wonnige Stoff, diese Farbenpracht!« »Der Kuchen soll auch nicht umkommen,« meinte er dann, schnitt das Prachtstück an und versuchte davon zu essen, gab es aber schleunigst wieder auf, denn die Lichte waren in den Teig hineingeflossen. Minna holte vom nächsten Bäcker noch etwas Kuchen, der aber nicht frisch war und ich brachte das trockene Zeug nur durch reichliche Anfeuchtung mit meinen Tränen hinunter. Nachher ging Hans in den Dienst, nachdem wir noch schnell die verbrannten Sachen weggeschlossen, um sie dem Versicherungsbeamten zu zeigen; wir hoffen ja, sie ersetzt zu bekommen. Freilich die Liebe, die Du hineingearbeitet, geht uns verloren, aber wir küssen Dir beide die fleißigen, sorgenden Hände. Als Hans fort war und Minna und ich Ordnung schafften, besah mich Minna mit kritischen und sorgenvollen Blicken und sagte plötzlich: »Wenn gnädige Frau man nich sitzen müssen!«
»Was soll das heißen,« fragte ich streng, aber ein Schauer kroch mir über Leib und Leben.
»Na,« erwiderte sie gedehnt – »Brandstiftung – un ich kann un kann denn nich bei die Herrschaft bleiben, so weh mich das tut, aber ich bin allmeindag ein ehrliches Mädchen gewesen – –« sie schluchzte herzbrechend.
»Minna,« versetzte ich empört, »wie können Sie bloß solchen Unsinn schwatzen, das ist doch keine Brandstiftung?«
»Achott, Achott,« wimmerte sie, und setzte sich auf unser Plüschsofa, »ich hab' bei'n Gefangenaufseher gedient, und da hab' ich 'ne Brandstiftersche gesehn, die hatte auch man bloß een brennendes Licht in een Heuschober gesteckt, und kriegte zwei Jahr – – ach, unser armer Herr!« Liebste Mutter, ich war ganz außer mir über diese verdrehte Auffassung; aber Minna ließ sich nicht davon abbringen und schließlich bekam ich's auch mit der Angst und heulte mit Minna um die Wette. Zuletzt siegte bei ihr das Mitleid und sie tröstete mich auf ihre Weise. »Ich bleib' beim Herrn und seh' nach dem Rechten,« sagte sie, »und wenn de Pollezei Sie holen kommt, man bloß ruhig mitgehen, sonst kriegen Se Handschellen!«
Ich war ganz krank und elend, als Hans wiederkam, und er schalt uns beide tüchtig aus. In der folgenden Nacht habe ich natürlich nur von Feuer geträumt: ich lag in einem Flammenmeer und schrie so, daß Hans beinahe zum Arzt geschickt hätte. Minna sah andern Tages gleich in ihrem Traumbuch nach, was »Feuer« für mich bedeute, aber da kam natürlich nur Unsinn heraus, den die Minna nun auf sich bezieht:
»Siehst du nächtlich ein Feuermeer, Sehnt sich ein Mann nach dir sehr Und die Hochzeit kommt gegangen, Dich liebend zu umfangen.«
Sonst ist aber das Traumbuch wirklich ganz nett, Minna schwört darauf. Neulich träumte Hans, er hätte sich in den Finger geschnitten, gleich sahen Minna und ich nach, da stand:
»So viel Tropfen Blut du mußt lassen, So viel Taler fließen in deine Kassen,«
Und richtig, am Ersten bekam Hans hundert Mark Zulage. Er lachte natürlich und behauptete, die hätte er auch ohne seinen Traum bekommen, weil er ›dran‹ war; aber Hans ist entschieden freigeistig.
*
Geliebte Mutter!
Es ist so unendlich lieb und gut von Dir, daß Du uns die ›Stütze‹ besorgt hast und obendrein das Taschengeld von Fräulein Berta selbst bestreiten willst. Ich könnte mir auch sonst die Hilfe gar nicht leisten, doch wird sie mir recht wohl tun, da mir der Arzt etwas Ruhe und Schonung anempfohlen hat. Ängstige Dich aber nicht. Dein Lisel ist ja kerngesund, nur hat mich die Influenza etwas heruntergebracht und dann – Du weißt ja – ach Mutterchen, – ich kann mir noch gar nicht das Glück, das namenlos süße kommende Glück recht vorstellen. Um dieses Glückes willen nehme ich ja gern alle Leiden und kleinen Unbequemlichkeiten ruhig hin, zumal mein Hans so himmlisch gut mit mir ist, noch ›guter‹ als je zuvor. Nur eins tut mir so leid, nämlich seine tiefe Abneigung gegen ›Stützen‹. Ach, und ich habe solches Mitleid mit diesen armen Mädeln, denen ein hartes Geschick den eigenen, trauten Herd vorenthielt, und die nun mit Anspannung aller ihrer Kräfte einer vielleicht harten, ungerechten, oft gar ungebildeten Herrin dienen müssen, die sich einleben müssen in fremdes Leid und fremde Freude unter Verleugnung ihrer eigenen Leiden und Freuden. Hans sagt, meine Phantasie sei viel zu lebhaft und ich sähe in Fräulein Berta bereits die Erzengelin Gabriele; aber dem ist gar nicht so, ich habe mir nur fest vorgenommen, daß ich ihr keine strenge Herrin, sondern eine gute, muntere Freundin werden will. Denke Dir, sie ist aus ›bester Familie‹, wie die Mutter selbst schreibt und durch ›Schicksalstücke‹ verarmt. Das muß schrecklich sein! »Hüten Sie mir meine Berta, sehr geehrte Dame,« schreibt Frau Aurelia Strengel, »sie weiß noch von nichts Bösem, seien Sie ihr eine zweite Mutter!«
Das kann ich nun zwar nicht, denn Fräulein Berta ist zwei Jahre älter als ich; aber ich habe mir schon einen reizenden Plan ausgedacht, nach dem wir unser Zusammenleben einrichten wollen, – – – – – – – – – – – – – – – –