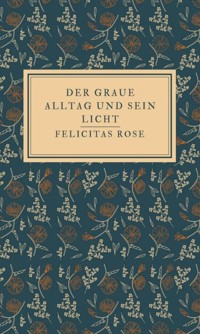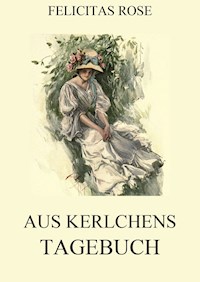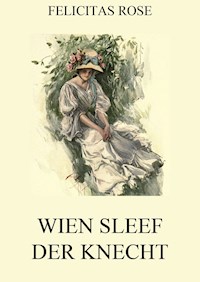0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie es in der Familie weitergeht ... ... Kerlchen spielte mit der silbernen Gabel und ließ sie auf der Hand wippen. Master Franz nahm sie ihr sacht aus der Hand und zeigte auf den Stiel und die großen Buchstaben darin mit der Krone darüber. »Was heißt das, Kerlchen?« »R. v. R.-R!« »Rose von Rumohr-Rotbach.« »Ich weiß. Was soll's. So hieß meine Muusch.« »Und so - - Rumohr-Rotbach heißen alle deine Angehörigen.« »Ich habe keine Angehörigen, ich hab nur dich.« »Kerlchen!« »Doch! Muusch hat es gesagt.« Es zuckte mächtig im Angesicht des Mannes. ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kerlchens Ebenbild
Kerlchens EbenbildKerlchens EbenbildImpressumKerlchens Ebenbild
Aus der Romanreihe "Kerlchen" – Band 10
Felicitas Rose
Kerlchens Ebenbild
Hallo, Cassim – he, sei brav, hoppla, oho – T . . . . . noch mal, meinetwegen go on!«
Und dahinsauste das herrliche Tier, und das schwarze, koboldartige Geschöpf auf seinem Rücken feuerte es mit Schnalzen und kurzen Rufen zu immer rasenderem Laufe an.
Es war ein harter Kampf zwischen Mensch und Tier gewesen, jeden Augenblick hatte man gefürchtet, das Menschenkind kopfüber hinunterfliegen zu sehen, aber es war wie festgewachsen mit dem herrlichen Araber, und jetzt sah man beide nur noch als kleinen fliegenden Punkt weitab vom Schauplatz des Kampfes.
»Man« waren die beiden Zuschauer: ein Weib, in ärmlicher Dienertracht, barfuß und barhaupt, und ein Mann Mitte oder Ende der Dreißiger, beinahe schwarz gebrannt von der indischen Sonne, mit düsteren, schwarzen Augen zwischen starken Brauen.
Er saß auf dem Stumpf eines abgehauenen Teakbaumes und hatte die Arme über der Brust gekreuzt, während das Weib wild mit den Händen in der Luft herumfocht.
»Jesus, Jesus, Master Franz, es kommt nicht wieder, es bricht den Hals, ich hab's gesagt.«
»Rede doch nicht solchen Unsinn, Maria, es kommt schon wieder, gestern war's gerade so.«
»Ja, und morgen wird es ebenso sein und so jeden Tag, und ich schlafe nicht mehr und ängstige mich tot um das Kind.«
Maria schlug die Hände vor das braune Gesicht, ließ sie aber ebensoschnell wieder sinken und setzte beinahe triumphierend hinzu:
»O, Master Franz ist auch voll Angst, ich bin nicht so dumm, Master Franz war ganz weiß vorhin –«
Eine Blutwelle schoß in das Gesicht des Mannes, um ebenso rasch einer tiefen Blässe zu weichen. Schwerfällig erhob er sich und schritt durch die kleine Allee nach dem steinernen Haus hin, das sich so mitten im Dschungel gar seltsam ausnahm, und wie er sich so mühsam an den Peepul- und Tamarindenbäumen festhielt, welche den Pfad einsäumten, sah man, daß der Mann wohl eben erst aus schwerer Krankheit erstanden war. Die alte Magd lief auch sofort ihm nach und reichte ihm den braunen, sehnigen Arm zur Stütze.
Auf der Veranda des »Bungalow« angelangt, ließ sich der Mann schwer in einen Rohrsessel fallen.
»O, das Fieber,« stöhnte er, »dies verd . . . Fieber! Es muß fort, es muß fort!«
»Es wird fortgehen, Master Franz, ich presse Limonen aus, gleich bin ich wieder da!«
Master Franz hob matt abwehrend die Rechte und sah der Davoneilenden düster nach.
Er hatte unter dem »es« etwas anderes gemeint. Das erfrischende Getränk kam unglaublich rasch, und Master Franz trank es mit durstigen Zügen, dann fiel das Glas aus seiner Hand, denn eben kam Cassim wieder angeflogen, aber der Kobold auf seinem Rücken war unbestrittener Sieger; das Tier stand plötzlich lammfromm vor dem Bungalow, schweißbedeckt und mit bebenden Flanken.
Mit einem kühnen Schwung sprang das schwarze Geschöpfchen herunter.
Es war ein Bub mit dunklem Lockenkopf, einem blassen, leicht gebräunten Gesicht, einem klassischen Näschen und nicht allzu kleinen Mund, der zwei Reihen blitzender Zähne sehen ließ, da er jetzt zu den beiden auf der Veranda hinüberlachte.
»Da bin ich!« rief er.
Es klang etwas gezwungen, weil die beiden sich gar so stumm verhielten, und die Hand des schönen Jungen hielt die weite schwarze Pluderhose verlegen zusammen, sie hing am Knie zerfetzt herunter.
»Einmal hat mich Cassim doch runtergeholt, mein Schädel brummt wie toll,« fing er wieder an, bekam aber keine Antwort.
Jetzt warf der Bursche den Kopf zurück, stampfte etwas mit dem Fuß auf und begann dann das Pferd sorgfältig abzureiben; den wollenen Lappen dazu holte er aus einer Satteltasche.
Lange hielt es die alte Maria nicht aus. Mit wenigen Schritten stand sie neben dem Knaben.
»Herzenskind, schreckliches!«
Das »schreckliche Herzenskind« warf einen verstohlenen Blick auf Master Franz, die feingezeichneten Brauen über den blauen Augen zogen sich dicht zusammen, einen Augenblick zögerte es noch, dann sprang es mit wildem Satz auf die Veranda und hing im nächsten Augenblicke am Halse des ernsten Mannes.
»Du sollst nicht blaß aussehen, ich will es nicht!« rief er trotzig.
Master Franz löste mit raschem Ruck die ihn umklammernden Hände.
»Du wirst es nicht wieder tun,« sagte er ernst.
»Nein.«
»Es ist gut. Und nun wirst du Hunger haben.«
»Schrecklichen. Ich führe jetzt Cassim auf und ab, und Maria backt mir ›Chupattie‹, willst du, Maria?«
»Alles, Herzenskind, alles!«
Marias Gesicht strahlte, und sie verschwand schleunigst im Hause.
Master Franz versank wieder in düstere Gedanken, der Bub führte Cassim langsam die Allee auf und ab und band ihn dann an eine der Korkeichen, die vor dem Stallgebäude standen, dann holte er eine ungefüg zurecht gezimmerte Krippe, in die er Futter einschüttete, der Eimer mit Wasser wurde noch beiseite gestellt, nachdem Cassim liebevoll bedeutet war, daß er gegenwärtig noch zu heiß für dieses Labsal sei. Dann war der Bub wieder mit kühnem Satz auf der Veranda, holte aus dem Kasten, der auf dem Seitentischchen stand, ein Knäuel groben, schwarzen Zwirns und eine Nadel, die für Lederzeug bestimmt schien, und begann die zerrissene Hose in großen, überwendlichen Stichen zu flicken.
Niemand sprach, endlich erfolgte ein scharfes Knirschen der weißen Zähne, der Faden war durchgebissen.
»Fertig, und das Beste daran, man sieht nichts,« rief der kleine Schneider strahlend aus. Er sah befriedigt auf die sehr mangelhafte Arbeit seiner Hände und dann auf Master Franz, dessen düstere Stirn sich durchaus nicht aufhellen wollte.
»Nein, man sieht nichts,« wiederholte der Mann, »man merkt leider, leider an keinem Anzeichen, daß du ein erwachsenes Mädchen bist, Felicitas Christiani.«
Die so Angeredete warf ungestüm den Kopf in den Nacken und schüttelte so die kleine Lockentolle von der Stirn.
»Warum nennst du mich so?« fragte sie heftig.
»Weil – weil – –«
Er verstummte.
Das Mädchen verfärbte sich, die Lippen preßten sich fest aufeinander, Tränen traten in die Blauaugen.
»Muusch!« sagte es tonlos. »Wenn Muusch da wäre!«
Der Mann trat erschüttert zu dem Kinde hin, dessen Körper jetzt in Schluchzen bebte. Wie hilflos es plötzlich aussah.
»Still,« raunte er, und strich mit scheuer Liebkosung über den Lockenkopf, »ich – ich wollte dir nicht weh tun – Kerlchen.«
Da versiegten die Tränen, und mit einer ungestümen Bewegung sprang das Mädchen die Verandastufen hinunter, um Cassim in den Stall zu führen.
Maria trat wieder auf die Veranda, deckte den Tisch, legte zwei silberne Bestecke auf und setzte den Teller mit »Chupattie«, einem einfachen Pfannkuchen aus Wasser, Mehl und Salz, hin.
»Wo ist Kerlchen?«
»Im Stall.«
»Es wollte doch essen? Der Chupattie ist knusprig.«
»Es wird schon kommen.«
Master Franz erhob sich plötzlich und stützte sich im Stehen auf den Rohrsessel.
»Maria,« raunte er mit seltsam klangloser Stimme, »das Kerlchen muß fort.«
»Jesus, – wohin denn?«
»Fort! Heim! Nach Deutschland.«
»Jesus, das Fieber kommt bei Euch wieder, Master Franz, setzt Euch, ich hole frische Limonen – –«
»Bleib, Maria. Laß vernünftig mit dir reden. Es geht nicht länger so, – ich verwundere mich so schon über die Maßen, daß noch niemand in all den langen Monaten von der Station hergekommen ist.«
»Die Seuche, Master Franz –«
»Natürlich, die ist's ja; die schreckt alles ab, und sie wissen nicht, daß das Kind lebt.«
»War auch ein Wunder Gottes, Master Franz.«
Der Mann nickte matt.
»Jesus, ich seh es noch, wie Ihr das Kind aus den Flammen trugt, selber fieberkrank, o die schreckliche Feuersbrunst, die Luft riecht noch heute danach.«
»Das soll's wohl.«
»Und wohin wollt Ihr das Kind bringen?«
»Frag nicht so töricht, – in seine Heimat.«
»Wo ist sie?«
»Hab dir's tausendmal gesagt, – fern, in Deutschland, in Thüringen.«
»Ich kann den Namen nicht behalten. Können wir nicht hier bleiben, Master Franz, kann nicht alles so weiter gehen?«
Der Mann atmete schwer.
»Nein, ich muß einen Bericht schicken, und – das Kind muß fort. Als der Herr Pfarrer starb und – die Frau, – Frau Rose – da lebten die Großeltern noch, – ich muß das Kind hinbringen, hier verkommt es.«
»Master Franz, es ist frisch und gesund und schlank und biegsam wie ein Tamarindenbäumchen.«
»So mein ich's nicht, – es gehört nicht hierher, nicht zu dir, nicht zu mir.«
»Aber Master Franz wird sterben, wenn er das Kind nicht mehr hat.«
»Schweig. Ich bringe das Kerlchen heim und komme wieder, – du bleibst bei mir.«
»Jesus, soll ich mit in das ferne Land?«
»Was solltest du dort wohl anfangen, alte gute, dumme Maria? Du bleibst so lange hier beim Ältesten des Dorfes, und unsern Bungalow verrammeln wir.«
»Warum sind wir nicht in Australien geblieben,« jammerte Maria. »In Indien fing unser Unglück an, warum ließ es der Herr Jesus zu? Aber der ›Malgoozar‹ ist ein guter Mann, ich werde zu ihm gehen und auf Euch warten.«
Master Franz schaute stumm und mitleidig – verächtlich auf die alte Magd, die so heftig jammern konnte und so rasch wieder getröstet war.
Und jetzt kam Kerlchen wieder herangestürmt, hatte sich im Nu der Speise bemächtigt und aß sie nicht allzu anmutig herunter.
»Er ist kalt, der Chupattie,« lachte es vergnügt, »ich habe mich zu lange aufgehalten. Aber ich habe gleich noch meine Flinte gereinigt und das junge Büffelkalb besehen – was habt ihr beide? Ihr seht mich so an.«
Kerlchen spielte mit der silbernen Gabel und ließ sie auf der Hand wippen.
Master Franz nahm sie ihr sacht aus der Hand und zeigte auf den Stiel und die großen Buchstaben darin mit der Krone darüber.
»Was heißt das, Kerlchen?«
»R. v. R.-R!«
»Rose von Rumohr-Rotbach.«
»Ich weiß. Was soll's. So hieß meine Muusch.«
»Und so – – ›Rumohr-Rotbach‹ heißen alle deine Angehörigen.«
»Ich habe keine Angehörigen, ich hab nur dich.«
»Kerlchen!«
»Doch! Muusch hat es gesagt.«
Es zuckte mächtig im Angesicht des Mannes.
»Das ist nicht wahr,« sagte er endlich streng. » So hat sie es nicht gesagt. Sie hat nur nicht gewollt, daß ich als – Diener gelten sollte. sondern als Angehöriger, aber – – sie hat mir immer gesagt – in schöner, glücklicher Zeit: Franz, wenn uns etwas zustoßen sollte, mir und meinem Mann, – das Kerlchen gelt das Kerlchen bringst du heim – zur Großmuusch. Und ich gab ihr mein Wort und hab's nicht gehalten.«
»Ich will ja gar nicht fort!« rief Kerlchen mit blitzenden Augen. »Ich war ja einmal dort, ich weiß es noch, wenn es auch schon dreizehn oder vierzehn Jahre her ist, es waren viele Knaben da und viele Leute, die mich besahen und anfaßten und küßten und redeten und schrecklich waren. Sie haben auch alle meine Muusch nicht verstanden, daß sie wieder hierher zurück ging, das hat sie mir oft erzählt und sie weinte dabei. Und mein Väterchen haben sie auch nicht verstanden.«
Master Franz nickte ernst vor sich hin.
»Wie sollten sie ihn wohl verstehen, die Kurzsichtigen – den Seher. Er war ein herrlicher Mann, dein Vater, Kerlchen.«
»Das weiß ich,« bestätigte das Mädchen stolz, »die Muusch erzählte mir, er müsse meinem Urgroßvater gleichen, das war ein Oberst Schlieden, – warum sterben alle guten Menschen zuerst, Franz?«
»Tun sie das? Der beste Mensch ist wohl deine Großmutter, Kerlchen, und die lebt ja auch noch gottlob!«
»Warum seufzst du so tief, Franz? Ich kann mich gar nicht mehr auf die Großmutter besinnen.«
»Sie war damals krank, Kerlchen, schwerkrank, – man fürchtete für ihr Leben, da kamen deine Eltern und legten ihr dich in den Arm, das erste Enkelchen, und von Stund' an wurde sie gesund.«
Franz, der wortkarge, ernste Master Franz sprach mit leuchtenden Augen. Kerlchen sah ihn verwundert an.
»Du mußt hin, Kerlchen, du mußt zu ihr, – mach' mir meine Pflicht nicht schwer,« brach er jetzt leidenschaftlich aus. »Du bist das Vermächtnis deiner Mutter, – ich hab's ihr heilig versprochen, dich hinzugeben.«
Kerlchen sprang auf. Die leuchtenden Blauaugen erschienen fast schwarz von innerer Erregung. Ohne ein Wort zu erwidern, stürmte es die Verandastufen hinunter, dem Stallgebäude zu, und wenige Minuten später hatten die alte Magd und der ernste Mann dasselbe Schauspiel wie schon einmal vor kurzer Zeit. – Cassim jagte in toller Flucht die Landstraße entlang, und auf seinem Rücken lag wie zusammengewachsen mit ihm das schwarze Bündelchen, – sausend fuhr die Reitpeitsche durch die Luft.
»Es ist höchste Zeit,« murmelte Franz Körbs.
»Und das war vor siebzehn Jahren?« fragte der alte Herr Pfarrer Bauer, der erst seit einem Tage in Rotbach weilte, den alten Kantor Rensefeld, der schon sämtliche Pfarrherren »durchgemacht« hatte und eine Art Chronik von Rotbach war.
Pfarrer Truling war in die Residenzstadt gekommen, die hohen Herren am grünen Tische hatten gefunden, daß ein so vorzüglicher Kanzelredner für die Bauern zu schade sei, und wie er und seine Gemeinde auch gebeten hatten, ihn in seinem Dörfchen zu lassen, es half ihnen nichts.
So führte nun der alte Organist den neuen Herrn Seelsorger in die Geheimnisse von Rotbach ein.
»Genau heute vor siebzehn Jahren!« bestätigte er, »der Herr Pfarrer braucht nur im Kirchenbuch nachzusehen. Sie war noch das richtige Kind, die Rose von Rumohr, und wie ein Kind stand sie neben dem jungen Herrn Pfarrer, dem Dr. Christiani, trotz aller Ernsthaftigkeit in dem zarten Gesichtchen. Aber ich konnte gar nicht so viel auf das Brautpaar gucken, ich mußte immer unsere liebe, gnädige Frau von Rumohr ansehen, Herr du meines Lebens, wie war sie blaß. Jeden Augenblick konnt' sie hinschlagen, und sehen Sie, Herr Pfarrer, das Kirchentreppenfegen und Kirchhofbegießen und Glockenläuten und Ohnmächtige 'raustragen, das gehört zu den Funktionen eines ordentlichen Organisten.«
Es klang rührend, mit welcher Wichtigkeit der alte Mann das sagte.
»Und fand sich die Frau Baronin nicht in das Geschick, ihre Tochter weggeben zu müssen, das sie doch mit vielen Müttern teilt?«
»Aber freilich, Herr Pfarrer, freilich. Unsere Baronin, das ist beileib keine gewöhnliche Frau. Die ist tapfer wie ein Mann, – ach, ich mein', – noch viel tapferer. Da weiß unser Dorf in allen Nöten ein Lied davon zu singen. Nur die Augen, die schauten ernsthafter drein, – ach, und die konnten sonst lachen, Herr Pfarrer, ganz warm wurde so 'nem alten Knackstiebel ums Herz, wenn sie einen ansah. Dann kam die Rose Christiani mit Mann und Kind nach vier Jahren wieder, und obwohl unsere Baronin damals den Typhus hatte, weil sie in der schrecklichen Seuche im Dorfe gepflegt hatte, – sie wurde gesund, als sie das Enkelchen sah – von Stund' an gesund und war doch so matt wie 'ne Fliege.«
»Erzählt nur weiter,« bat Pfarrer Bauer, als der Alte eine Pause machte. »So komme ich am besten in die Herzen meiner Pfarrkinder.«
»Nun, damals meinten meine Frau und ich, es könnt' nichts Glücklicheres geben auf der Welt als unser Schloß und die Menschen darin. Förmlich geleuchtet haben alle vor Frohsinn, und selbst das kleine Scheusälchen konnt' dran nichts ändern, – das Enkelkind. Wie ein Zigeuner sah's aus, das justemente Gegenteil von seinem schönen Mütterchen, ich hab' alleweil gedacht, die greuliche schwarze Amme, die sie mitbrachten, nährte es auch mit schwarzer Milch.«
»Aber Rensefeld!«
»Nichts für ungut, Herr Pfarrer, ich kenne mich da drüben nicht so aus in der Naturgeschichte. Na, ich bin der Kleinen nie zu nahe gekommen, sie brüllte ja immer wie am Spieße.«
»Und dann ging Dr. Christiani wieder hinaus, nach Indien? Ich weiß es noch, es war ein einsamer, schwerer Posten, in allen Missionsversammlungen war davon die Rede, aber der Mann hatte sich selbst dazu gemeldet.«
»Und Frau Rose ging wieder mit ihm. Herr du meines Lebens, wie setzten sie ihr zu, hier zu bleiben mit dem Kinde. – Ich war ja einmal selbst dabei, es war am Geburtstage der Frau Baronin, und wir waren alle eingeladen. Ich vergesse es mein Lebtag nicht, wie der Herr Pfarrer Truling schließlich selbst zum Hierbleiben sprach, und wie die junge Frau ihn mit den klaren Augen ansah und so ernst bat: ›Ach, sagen Sie mir meinen Hochzeitsspruch doch noch einmal.‹ Da drückte er ihr nur stumm die Hand, denn der Spruch hieß: ›Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, dein Gott ist mein Gott‹.«
»Nun und dann?«
»Dann kam eine sehr stille Zeit für Rotbach. Von den lieben acht Kegeln zog eins nach dem andern fort, nur in den Ferien hörte man noch helles Lachen und Singen. Von Indien kamen nur spärliche Nachrichten, war aber eine da, dann lief auch unsere Baronin hinüber ins Pfarrhaus und zu mir, und wir nahmen teil an ihrer jubelnden Freude. Sie konnte so lachen, die Frau Kerlchen, ach Gott, was konnte sie lachen!«
»Und dann kam das Unglück?«
»Ja, Herr Pfarrer. – Herrgott, ich sehe immer noch, wie sie die Fahne am Herrenhaus hochzogen – halbmast. Und ganz Rotbach stand unter Wasser, die wilde Gera brauste und gurgelte, und der Herr Pfarrer Truling und ich und der Inspektor, wir fuhren im Kahn vors Herrenhaus, um unsern gnädigen Herrn aufzubahren.«
»Drei Menschenleben hatte er aus Wassersnot gerettet,« schaltete der Pfarrer bewegt ein, »ob alle drei so viel wert waren, als das seine?«
»Sicher nicht, Herr Pfarrer, sicher nicht. Seit der Zeit sind wir alle ernsthafte Leute hier geworden, wir können's halt nicht verwinden. Ich war eigentlich von Geburt 'n humoristischer Mann, und die Leute wollten immer lustige Geschichten von mir hören, – o du liebe Zeit– und das Leben ist doch so bitter ernst. Damals glaubt ich, die Frau Baronin würde den Herrn nicht überleben, – aber sie sah ihre Kinder an, – die Kegel – und dann richtete sie sich auf und schloß sich ein in ihr Zimmer. Als sie wieder herauskam, da sahen wir sie weinend an, – mitten durch ihre dunkelblonden Locken zog sich ein silberweißer Streifen, wie ihn der Herr Oberst hat auf dem großen Ölbild, der Herr Vater selig.«
»Und dann?«
»Dann nahm sie die Bewirtschaftung des großen Gutes allein in die Hände, und gute Freunde und getreue Nachbarn standen ihr bei, der Herr von Reymerstal und der junge Herr von Eulried, dem das Mustergut gehört. Der ist wie ihr Sohn und sollte es wohl auch werden, ehe der Doktor Christiani kam.«
»So so, hm.«
»So haben wir die Jahre miteinander verbracht, Herr Pfarrer, und alleweile haben wir den Hut vor unserer Frau Baronin abgezogen.«
»Wie trug sie den zweiten Schlag ?«
»Herr Pfarrer, ein Fremder merkt's vielleicht gar nicht, daß die gnädige Frau verändert ist, aber wir Alten, wir wissen's, es ist etwas entzwei gegangen in ihr, – sie kann nicht mehr lachen. Und das ist zum Weinen, Herr Pfarrer, für den, der das Kerlchen gekannt hat, als Braut und als junge Frau, so ein Sonnenscheinchen, wie sie alleweile war. Herrgott, so ein Unglück kommt ja auch nicht alle Tage, es war was extra Ausgesuchtes vom Herrgott, damit er sah, wie tapfer die Frau ist.
Und die Herren vom hohen Konsistorium kamen alle Nasenlang und wühlten den Schmerz wieder auf, unnützerweise, denn die späteren Nachrichten bestätigten ja nur die vorhergegangenen: ›Beide, Dr. Christiani und Frau, am gelben Fieber gestorben, und das Mädchen, die kleine Felicitas, im Feuer umgekommen mitsamt dem Franz Körbs.‹ Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, so was hat man erlebt, und dann soll man humoristisch erzählen, und die Leute wollen lustige Geschichten hören.«
»Arme, schwergeprüfte Frau, – gleich morgen gehe ich zu ihr,« sagte der alte Seelsorger schmerzlich bewegt.
»Das tun Sie nur, Herr Pfarrer, aber denken Sie beileibe nicht, daß sie Ihnen was vorklagt. Sie zeigt ihr Inneres nicht, unsere Frau Baronin, sie läßt sich nicht unterkriegen, sie ist von Stahl. Aber eine Herzensfreude könnt sie brauchen, Himmel, Herrgott, eine Herzensfreude, – ich gäbe die paar Jahre drum, die ich noch zu leben habe.«
Kantor Rensefeld zog sein rotes Taschentuch hervor und schneuzte sich laut und umständlich.
Aus Kerlchen seniors Tagebuch
Wenn das alles, was ich so erlebt und niedergeschrieben habe, einmal veröffentlicht würde, – zehn stattliche Bände dürfte es geben – was würden wohl die Leute darüber sagen? Ich glaube, sie würden leicht über alles hinweggehen und lachen: »Es ist ja nur Geflunkertes!«
So viele Menschen lesen aber lieber Geflunkertes, weil die Wahrheit gewöhnlich ein gar ernstes Gesicht macht.
Nun, meine Büchlein sind wahr, Heiteres und Trübes hab' ich getreulich gebucht, sie könnten getrost als Familienchronik in die Welt ziehen.
Und doch – die ganze volle Wahrheit darf auch ich nicht schreiben, sonst müßte sich jeder die Augen rot weinen, der in diesem Buch blättert, und schließlich würde noch einmal eine Urenkelin von mir zu meiner Ururenkelin sagen: »Ach, laß das weinerliche Buch, so alte Leute, wie die Ururgroßmutter wühlen gern in ihrem Schmerz, wein' dir die schönen Augen nicht rot, sterben müssen wir alle.«
Ja, sterben müssen wir alle!
Aber warum der eine vor dem andern?
Warum so früh der beste, der herzgeliebteste Mensch – – – –, still, o still! –
Du liebes Tagebuch, – gleich will ich es hier niederlegen, es gibt eine Stelle im Innersten meines Herzens, über die kann ich nie mehr sprechen, nie mehr schreiben, – über meinen Fritz, meinen Friedel, mein alles, mein totes Glück!
Wachse, Efeu, grüne und blühe, und verhülle das liebste Stellchen. – – –
Gut sein will ich und will glücklich machen, Will verwandeln Leid in Dank und Lachen, Laß mich Sonnenschein vielen Menschen sein, Daß ein Segen walte, wo ich geh und schalte.
Dieses Lied, einst zur Einsegnung unserer herzlieben Rose gesungen, soll mein Leitstern, mein Wahlspruch, mein Gebet sein.
Aber wie schwer ist's, Leid in »Dank und Lachen« zu verwandeln!
Bis jetzt hab' ich nur die Hände zum Dank falten gelernt, zum Lachen ist, so mein' ich, gar keine Veranlassung mehr in Rumohr. –
Daß uns der Erni, mein guter, biederer Ältester, solch ein Schwiegerkind bringen würde, wie diese Agnete.
»Agnete, Freiin von Terlan-Olzen aus dem Hause Krien.«
Ausgerechnet diese mußte es sein.
Durch den hochtönenden Namenkrimskrams hat sich der Jung' nicht blenden lassen, das liegt ihm weltenfern, und Terlan-Olzen samt dem Hause Krien sind ja auch ins schlichte Rumohr-Rotbach übergegangen, als das »Ja« vor fünf Jahren gesprochen wurde. – Er hat sie lieb, – das ist die einfache Geschichte seiner Heirat.
Der selige Kapitän Liskow pflegte früher immer ein uraltes Liedchen zu trillern, wenn er von einer Verlobung hörte, und dieses Liedchen hieß:
Oha, s' ist zum Verwundern auch, Wenn man verliebet ist, Die Lieb' fällt auf'n Rosenstrauch, Die Lieb' fällt auf'n Mist.
Wie würde er wohl geträllert haben bis zum lautesten Forte, wenn er meine älteste Schwiegertochter kännte!
Beileibe nicht – daß ich dieses drastische Wort im Liedchen auf Agnete anwenden will (für eine Gutsbesitzersfrau ist es außerdem nicht drastisch, sondern ein liebes, gutes, schönes Wort).
Nein, nein! Es würde auch gar nicht passen, denn Agnete ist nicht im mindesten nützlich.
O jeh! Was habe ich da geschrieben!
Klingt's nicht, als sei ich eine nörgelnde, – eine böse Schwiegermutter, eine, die in die »Fliegenden« gehört?
Gott bewahre mich davor! Da wäre es ja die höchste Zeit, daß ich mich zur »Muusch« zurückentwickelte.
Wir haben an einer Spezies »Schwiegermutter« schon genug.
Erni hat nämlich nicht Agnete allein geheiratet, ich fürchte, er hat beim Standesamt seine Schwiegermutter, die Frau Baronin Terlan-Olzen aus dem Hause Krien mit unterschreiben lassen und lebt wie der selige Graf von Gleichen, nur mit dem Unterschiede, daß er die »zweite Frau« als wenig beglückendes Anhängsel betrachtet.
Es ist die Stiefmutter von Agnete.
Sie macht die Pointe sämtlicher Märchenbücher zu schanden, in denen die Stiefmutter als etwas Peinigendes für die Stiefkinder empfunden wird, diese verzieht ihre Agnete in jeder Weise, erfüllt ihre verrücktesten Wünsche und macht dadurch meinem lieben Ältesten das Leben nicht gerade zur Rosenlaube.
Ernst und Agnete wohnen in Rumohr, aber einige Wochen habe ich sie immer hier in Rotbach mit Kind und Kegel, und Weihnachten verleben wir stets zusammen in Rotbach. Der ganze Trubel, der dann hier wohnt, bringt mich auch am besten über das Fest hinweg, – obgleich ich gern einmal stille Einkehr hielte in diesen Tagen.
Weihnachten!
Wenn ich an die Zeiten denke, da ich glückseliges Kind in Schwarzhausen war, oder glückselige Frau hier in Rotbach, – wie Tannenduft, Kuchen und Wachslichtchen riecht es plötzlich, – – aber dann ist's mir, als läge diese süße Erinnerung Jahrhunderte weit zurück, als erzählte Frau Sage mir ein wunderschönes, altes Märchen.
Meine Kegel haben alle ihre Bahn gefunden, sind tüchtige Kerle geworden und geblieben; ich sehe sie nicht viel, aber wir haben so Gedenktage, da kommen sie zu mir, in verschiedenster Jahreszeit, wie es jedem paßt, das sind dann köstliche Zeiten. Und so zeigt mein Buch rot angestrichene Feiertage, die sonst in keinem Kalender als Feste stehen.
Vom 1. Januar bis 19. Dezember, lauter Gedenktage! Und für mich ganz allein hebt sich besonders leuchtend der 29. Juni ab, ein Tag, an dem alle Arbeit ruht, ein Tag, an dem ich nur Rückschau halte auf das sonnige, glückliche »Einst«.
Von allen Kegeln am meisten und längsten in der Heimat ist »Pate«, unser Willusch, der, wie sein alter Gönner und Freund Reymerstal sich neckend ausdrückt, ein »von Sachkenntnis ungetrübter Jurist« geworden ist.
Willy ist Assessor am Landgericht I in Berlin und hat uns schon seit Jahren die Paragraphen des »Neuen Bürgerlichen« dermaßen eingepaukt, daß ich mich jeden Tag als Rechtsanwalt niederlassen könnte.
Ich beschränke mich aber darauf, meinen Bauern und Tagelöhnern vom Prozessieren – abzuraten.