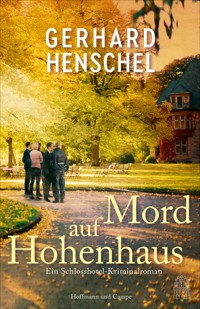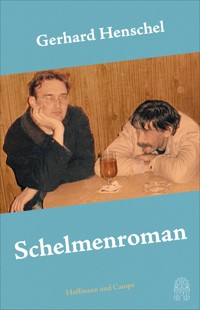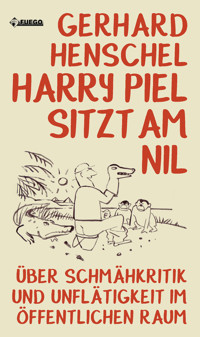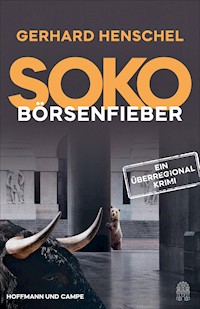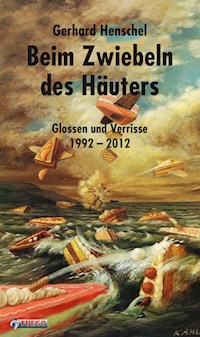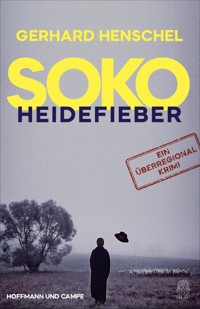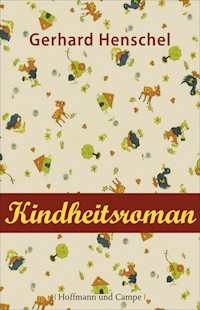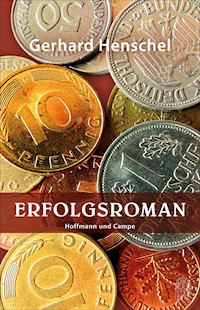14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1983. Helmut Kohl regiert, die Grünen ziehen in den Bundestag ein, der Stern veröffentlicht "Hitlers Tagebücher" und Martin Schlosser wird Student in Bielefeld. Er entscheidet sich für ein Studium der klassischen Taxifahrerfächer Germanistik, Soziologie und Philosophie. Doch das Studentenleben hat er sich lustiger vorgestellt. Er verbringt mehr Zeit in der Uni-Cafeteria als in Vorlesungen, lässt sich treiben und verliebt sich unglücklich. Schließlich zieht er ins vom Leben umtoste Berlin um und stürzt sich kopfüber in eine Affäre, die sein Leben für immer verändern wird. Mit "Bildungsroman" liegt der fünfte Band der Martin-Schlosser-Chronik vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 744
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gerhard Henschel
Bildungsroman
Hoffmann und Campe
Bildungsroman
Bielefeld im Februar: Es grenzte ans Unverschämte, was sich da so als Himmel ausgab. Eine miese Graupensuppe war das. Ein Eintopfgericht aus der Nachkriegszeit. Eine schleimige, verwaschene, von einem niederträchtigen oder durchgeknallten Wettergott zusammengerührte Lauge aus den billigsten und primitivsten Wolkenmaterialien. Dutzendware vom Grabbeltisch.
Unter normalen Umständen hätte mich dieser Anblick fertiggemacht, so wie mich sonst auch das Klaviergeklimper meines WG-Mitbewohners Eberhard fertigmachte oder das mürrische Wesen meiner WG-Mitbewohnerin Edith oder das Gitarrengeschrammel der Vermietertöchter oder die Beziehungsdiskussionen mit Heike, die sich irgendwann verselbständigt hatten, so daß es fast nur noch die Diskussionen gab und nicht mehr viel von der dazugehörigen Beziehung, doch Anfang Februar 1983 lagen die Dinge anders. Ich war auf dem Sprung.
Kurz zuvor hatte ich noch in der Klemme gesteckt. Zivildienst beendet und keine Lust zum Studieren, obwohl einem die Eltern alles bezahlen wollten: Was machte man da? Das Studentenvolk, das ich in der Bielefelder Uni gesehen hatte, gefiel mir nicht, die Uni selbst gefiel mir nicht, die Mensa gefiel mir nicht, der Weg zur Uni gefiel mir nicht, der Teutoburger Wald gefiel mir nicht, ganz Bielefeld gefiel mir nicht, und am allerwenigsten gefiel mir die Aussicht auf das weitere Vegetieren in Bielefeld.
Jetzt aber hatte ich die Chance, etwas Neues anzufangen und mich in Bochum an einem Programmkinoprojekt zu beteiligen. Nicht länger lavieren, sondern loslegen. Mit was Richtigem. Ich wartete bloß noch auf die Nachricht, wo und zu welcher Uhrzeit die Gründungsversammlung stattfinden solle. Mein Erscheinen hatte ich der Crew da schon angekündigt.
Drei Tage vor dem Treffen kam ein Kärtchen aus Bochum.
lieber martin, nach einer sitzung heute morgen haben wir uns entschieden, das projekt nicht durchzuführen. wir steigen aus. solltest du interesse haben, allein was zu machen, kannst du mich kontakten, daß ich dir mehr erzähle, denn das kino ist ja da, aber der termin am samstag ist gestorben. sorry!
Diese Flaschen. Erst inserierten sie groß in der taz und warfen einen Köder in der Größe Neufundlands aus, und wenn man anbeißen wollte, rannten sie weg!
Und was ein Quatsch von wegen »allein was zu machen« – wie hätte ich das denn wohl tun sollen? Ohne Kapital und Know-how? In dem Kino hätte ich Karten verkauft und Eiskonfekt dazu, ich hätte zuspätkommende Zuschauer mit der Taschenlampe zu ihren Sitzen geleitet, Plakate aufgehängt, die Teppiche gesaugt, die Klos geschrubbt, die gesamte Pressearbeit übernommen und an der Programmplanung mitgewirkt, aber wo man die Filme herkriegte und einlegte und so weiter, das hätte ich natürlich erst lernen müssen …
Unterschrieben hatte die Karte ein Hans-Joachim, den ich aber nicht mehr zu »kontakten« wünschte. Sollte der doch verfaulen in seinem Bochumer Pferdemist. In Bochum gab’s ja ohnehin eine hohe Selbstmordrate, wie ich mir hatte sagen lassen.
Im Bielefelder Stadtblatt stand dann was über eine 270 Mark teure Tour mit einem »Freak-Bus«. Start am 19. März mit Ziel Piräus, Wiederkehr am 9. April. In Heikes WG war ein gnubbeliger Typ zu Gast, der dafür warb: »Ey, wennde ankommst in Piräus, fährste mitter Fähre rüber auf ’ne Insel, da sind ja massenhaft diese Inseln, kannste baden und unheimlich viele Leute treffen, die da abhängen. Kannste dir ’n Zimmer mieten, kost’ nur sieben Mark die Woche, aber alles drin. Is’ auch schon warm da um die Zeit, kannste am Abend am Strand liegen und inner Taverne Retsina trinken, da is’ immer was los!«
Ich hatte keine hohe Meinung von Griechenland, aber in Bielefeld konnte ich auch nicht mehr stillsitzen. Weshalb dann nicht in einen Freak-Bus einsteigen? Vielleicht wäre das ja ein Trip wie in dem Comic »The Fabulous Furry Freak Brothers In The 29.95 Dollar SF To NYC Nonstop Whiteline Cannonball Express«, dachte ich mir, und ich versuchte, meinen alten, in Göttingen in den Sachzwängen seines VWL-Studiums steckenden Freund Hermann als Reisegefährten zu gewinnen.
Das mit den Sachzwängen, schrieb er mir zurück, treffe teilweise zu.
Zum Beispiel was die Tour nach Hellas betrifft. Am 19. März und in den Wochen danach bin ich am Moneymaken. Cash! Im übrigen finde ich das Angebot nicht so wahnsinnig günstig. Für ein paar Mark mehr kann man sich auch ein Interrail-Ticket holen.
So. Nun eine interessante Neuigkeit: 500 m von meiner Wohnung entfernt befindet sich Göttingens Dope-Depot. Da wird gedealt wie am Damplats, wenn auch wohl nicht mit gepreßtem Mais oder Henna. Als ich letztens im Podium war (so heißt der betreffende Schuppen), quatschte mich ein Typ von der Seite an: Ey, wo gibt’s denn hier Dope? Ich darauf (cool und fachmännisch): Frag doch mal den an der Kasse, der weiß bestimmt, wer hier was verkauft. Oder vor der Tür, da stehen ein paar Typen, da schwör ich drauf, daß die was verkaufen. Und sag Bescheid, wenn’s geklappt hat! Es ist aber nichts draus geworden.
Am Samstag schreibe ich eine Klausur, aber so ungefähr ab ein Uhr mittags hab ich Zeit. Bis dann!
Wenn man von Bielefeld nach Göttingen trampen wollte, mußte man entweder über die Dörfer juckeln oder einen irren Umweg über Hannover einlegen. Ich probierte es mal querfeldein und kam erst kurz nach zehn Uhr abends an, nachdem ich so sympathische Orte wie Hövelhof, Paderborn, Bad Driburg, Beverungen, Karlshafen, Bursfelde und Dransfeld passiert hatte. In seiner neuen Bruchbude in der Göttinger Leinestraße war Hermann da schon beim dritten Bier angelangt.
Die Wohnungsführung dauerte nur anderthalb Minuten. Es gab ein mittelgroßes Zimmer, ein davon abgeteiltes Schlafkabuff und auf dem Flur eine Toilette mit Dachschräge. Zum Kochen benutzte Hermann ein elektrisches Teil mit zwei Heizplatten, und als Maître de cuisine servierte er mir Reis mit Dosenheringen in Senfsoße und dazu lauwarmes Hannen-Alt.
»Hier wohnst du jetzt also.«
»Ja«, sagte Hermann. »Klein, aber mein.«
Schräg gegenüber befand sich eine Kneipe namens Schluckspecht, aus der es laut herausschallte, ohne daß man vorher hätte hineinrufen müssen.
»Und wer verkehrt da so? Die Hautevolée von Göttingen?«
»Au contraire!«
Wir sprachen dann über seine Freundin Astrid, die in Freiburg Medizin studierte, und er sagte, daß es in der Beziehung krisele. »Und wie sieht’s bei dir aus?«
Ich hätte ihm gern was Netteres erzählt, doch die Wahrheit war, daß Heike und ich uns auseinandergelebt hatten. Wir waren kein Paar mehr. Sie machte ihr Diplompädagogik-Ding und bereitete sich irgendwie auf etwas Berufsmäßiges in der »feministischen Mädchenarbeit« vor, während ich so vor mich hinwurschtelte.
»Ich weiß ja nicht«, sagte Hermann. »Feministische Mädchenarbeit … das kann doch nur heißen, daß da unschuldige kleine Mädchen gegen uns Männer aufgehetzt werden!«
Das Lustigste an dem Abend war Hermanns Bericht von einem Besäufnis der VWLer, bei dem einer der größten Hornochsen unentwegt den Ex-Kanzler Kurt-Georg Kiesinger zitiert habe: »Ich sage nur: China, China, China!« Damit habe dieser Trottel sämtliche Gespräche torpediert. »China, China, China!« Immer wieder. Ohne Erbarmen.
Wir streiften auch die Weltpolitik. Was von den Reagonomics zu halten sei und wohin das sowjetische Weltreich drifte.
»Stell dir mal vor, du wärst der Chef der Roten Flotte«, sagte Hermann. »Was würdest du dann deinen Vorgesetzten im Kreml empfehlen?«
Der Chef der Roten Flotte sei doch nur ein kleines Licht, erwiderte ich, und Hermann brauste auf: »Was sagst du da? Der Chef der Roten Flotte soll ein kleines Licht sein? Und was bist dagegen du?«
Ratzen mußte ich in Hermanns Schlafsack auf dem Fußboden. Ich las noch ein bißchen in einem Buch von Woody Allen, das dort herumflog.
Ob ich W. heirate? Nicht, wenn sie mir nicht auch die anderen Buchstaben ihres Namens sagt …
Da mußte ich schmunzeln. Aber war das Schmunzeln nicht eine der niedersten menschlichen Regungen?
Als Hermann mir anderntags die Dealer zeigen wollte, waren sie alle verschwunden, bis auf einen, der dann noch irgendwo herausgekrochen kam und uns eine große Tüte Gras verkaufte.
Von Göttingen trampte ich über Kassel nach Hofgeismar zu einer Evangelischen Tagungsstätte, wo ein Seminar über die Filme von Pier Paolo Pasolini stattfand. »Accattone«, »Edipo Re«, »Uccellacci e Uccellini«, »Teorema«, »Medea« …
Es wurde über die theologischen Bezüge in diesen Filmen gesabbelt, sogar bei den Mahlzeiten, und ohne mein Gras wäre ich verloren gewesen. Bei so einer Tagung, hatte ich gedacht, müßte man doch auf Gesinnungsgenossen treffen und auch auf schöne Frauen, mit denen man vielleicht was hätte losmachen können, aber die einzigen beiden dafür in Frage kommenden Frauen hingen permanent um einen superekligen Faselhans herum. Ich setzte mich einmal mit an dessen Tisch, weil kein anderer mehr frei war, und da wurde ich ausgequetscht. Wer ich sei, was ich machte und wo ich wohnte. In Bielefeld? Wieso nicht in Berlin?
Ich sagte, das sei ja doch ’n bißchen weit vom Schuß.
»Von welchem Schuß? Vom Schuß der Eltern?« fragte Mister Faselmann zurück, und die beiden Prinzessinnen kicherten.
Ich verarbeitete diese Negativerfahrung bei einem langen Spaziergang und zog auf einem Hochsitz einen durch.
Mit einem anderen Tagungsteilnehmer stritt ich mich über die Frage, ob es gut sei, daß auf das Kinozeitalter jetzt das Videozeitalter folge. Auf Video, sagte ich, sehe doch alles viel dürftiger aus als auf der Kinoleinwand. Beispielsweise eine Wiese – von deren Pracht würde man auf Video kaum noch was erkennen. Sein Gegenargument lautete, daß es gut sei, wenn es einen signifikanten Unterschied zwischen einer echten Wiese und einer gefilmten Wiese gebe, denn sonst würden sich die Menschen ja die echte Wiese nicht mehr ansehen wollen …
Das waren so die Highlights in Hofgeismar.
In Bielefeld kam ich so früh an, daß ich in Sennestadt noch kurz Station bei Tante Gertrud und Onkel Edgar machen konnte. Das Dachgeschoß bekam man da schon gar nicht mehr gezeigt, weil der Ausbau stagnierte.
Tante Gertrud fragte mich nach Mamas Befinden, aber ich wußte nur, daß bei ihr der Verdacht auf Lymphdrüsenkrebs bestand.
Gutartige und bösartige Tumoren. Ich hätte auch keinen gutartigen haben wollen.
Auf einen Sprung besuchte ich auch Oma Schlosser in ihrem klotzigen Altersheim. Wenn ich mal mehr Zeit mitbrächte, sagte sie, dann könne ich ihr vielleicht beim Sortieren ihrer Briefpost zur Hand gehen. »Es wird ja irgendwann ein Ende mit mir haben, und je mehr ich vorher noch in Ordnung bringen kann, desto besser …«
Alte Briefe und Karten von Onkel Rudi, Tante Gertrud, Tante Doro, Papa, Mama, Onkel Dietrich und Onkel Walter. Und auch Enkelkinderpost in Erstkläßlerschrift. Wahre Schätze, sicherlich, aber auch ’ne Last.
Ich durfte mir ein Buch aussuchen und wählte eins mit Bildern von Paul Klee, auch wenn mich die nicht vom Hocker rissen. Gut war allerdings eine Radierung mit dem Titel »Zwei Männer, einander in höherer Stellung vermutend, begegnen sich«. Wie hündisch die voreinander dienerten! Aber der Rest … alles so krakelig und verdruckst und wartezimmertapetenartig, daß ich dachte: Diesen Zeichner hätte ich nicht persönlich kennenlernen wollen.
In den 690 Mark, die Mama und Papa mir monatlich überwiesen, waren dreißig Mark für meine Heimfahrten enthalten. Mir tat’s um jeden Pfennig leid, weil ich ja auch hätte trampen können, doch das wäre den edlen Spendern gegen den Strich gegangen.
Also mit dem Zug nach Meppen. Papa wollte das Dach isolieren, und ich sollte dabei helfen.
Wie meistens stieg ich zuhause erst in die Wanne, bevor ich mich der Familie stellte. Dann stürzte nicht gleich alles so auf einen ein. Man nehme ein heißes Vollbad, eine Kappe Badezusatz (Fichtennadel oder Sandelholz), zwei Flaschen Bier à 0,5 Liter und ein wenig Lektüre zur Erheiterung – Zeit, Stern, Meppener Tagespost –, und die Landung in der Realität wird angenehm abgefedert.
Mama hatte eine Odyssee durch die Kliniken hinter sich: Operation im Meppener Krankenhaus Ludmillenstift, Nachbehandlung durch die Hausärztin, Mitte Februar nochmals vier Untersuchungstage im Ludmillenstift und in der Woche darauf eine Untersuchung im »Tumorzentrum« der Medizinischen Hochschule Hannover. Da müsse sie bald wieder hin, sagte Mama, und dann werde man weitersehen. Die Heilkunst habe ja bedeutende Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten. »Meine Oma Gesine, also die Mutter von Oma Jever, die hat genau die gleiche Krankheit gehabt und ist 1941 daran gestorben …«
Und zwar schon mit 57 Jahren. Das sei aber heutigentages kein unabwendbares Schicksal mehr. »Und was immer man von der Apparatemedizin halten mag – ich bin froh, daß es die gibt! Das kann ich euch aber flüstern!«
Auf dem Couchtisch lag ein dickes blaues Lehrbuch der inneren Medizin, das Papa gekauft hatte. Morbus Brill-Symmers und die Non-Hodgkin-Lymphome.
Obwohl in den meisten Fällen keine Ursache erkennbar ist, müssen Strahleneinwirkungen und Störungen des Immunsystems als ätiologische Faktoren genannt werden. Eine Häufung von lymphozytären Lymphomen und Morbus Hodgkin wurde unter den Überlebenden der Atombombenexplosionen in Japan beobachtet …
Papa sagte, er halte es nicht für ausgeschlossen, daß Mama sich das bei der Weltreise ’81 weggeholt habe. Vielleicht im Flugzeug über dem Stillen Ozean. Wer wisse schon, was die Atommächte da alles verballert hätten!
Und wie ging’s den andern so? Renate, bei der ja bereits Nummer zwei unterwegs war, stand nach ihrem zweiten Staatsexamen als Lehrerin mal wieder auf der Straße, unser Maschinenbauer Volker studierte in Hannover vor sich hin, Wiebke schlug sich durch ihr elftes Schuljahr, und mein alter Lieblingsvetter Gustav logierte nun wieder bei Oma Jever und wartete auf den Termin für seine mündliche Assessorprüfung, die er als Jurist bestehen mußte. Und er war in die SPD eingetreten. »Wenn ich noch daran denke, was der früher für rechte Sprüche geklopft hat!« sagte Mama. »Man sollt’s nicht glauben.«
Von Onkel Rudi hieß es, daß er nicht mehr gewillt sei, sich in Scheidungsfällen das Geheule verlassener Weiber anzuhören. Der war jetzt Anwalt beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Da ich keine bessere Idee hatte, würde dann eben auch ich studieren. Hauptfach Germanistik; Nebenfächer Soziologie und Philosophie. In Bielefeld hieß die Fakultät für Germanistik albernerweise »LiLi«, was die Abkürzung für Linguistik und Literaturwissenschaft war.
»Klüger wär’s ja, du würdest Jura studieren«, sagte Papa.
Da war ich platt. Wo der sonst immer so auf die Juristen schimpfte!
Er meinte, als Jurist hätte ich erstens größere Chancen auf eine Anstellung als die Absolventen der geisteswissenschaftlichen Laberfächer, und zweitens könnten mir die anderen Juristen nicht so leicht an den Karren fahren, wenn ich selber einer wäre. »Es gibt längst keinen Berufszweig mehr, in dem die nicht das Sagen haben! Die drängen sich überall rein! Den Ingenieuren machen sie Vorschriften, den Physikern machen sie Vorschriften, den Lehrern, den Ärzten, den Politikern – allen! Du kannst heute kein Schräubchen mehr verstellen, ohne daß irgendwelche Paragraphenhengste angeschissen kommen und mit ihren Verordnungen wedeln …«
»Richard, bitte«, sagte Mama. »Nicht diese Ausdrucksweise.«
Irgendwie paradox: Juristen hassen und dem eigenen Sohn zum Jurastudium raten.
Aber: Dr. jur. Martin Schlosser? Niemals!
Papa zermalmte eine seiner furchtbaren Gewürzgurken und sagte dann: »Martin braucht sowieso nicht zu studieren. Der weiß ja schon alles.«
Wie oft er mir das wohl noch aufs Butterbrot streichen wollte? Ein einziges Mal hatte ich mein aufwallendes Desinteresse am Studieren in die unglücklich gewählten Worte gekleidet, daß ich schon alles wisse, und seither wurde mir dieser Ausrutscher immer und immer wieder vorgehalten.
Solange ich studierte, würden Mama und Papa weiterhin Kindergeld für mich beziehen. Das war immerhin ein kleiner Vorteil an der Sache.
Wenn man Papas Abneigung gegen die Juristen verstehen wollte, genügte ein Blick in seinen Briefwechsel mit dem Wehrbereichsgebührnisamt.
Bei Überprüfung Ihrer Besoldungsakte wurde festgestellt, daß Ihr mit Bescheid vom 27. 11. 1974 auf den 01. 06. 1950 festgesetztes BDA insoweit fehlerhaft war, als dort bei den absetzbaren Zeiten nach § 28 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Bundesbesoldungsgesetz (BbesG) Ihr Studium mit 6 Jahren und 6 Monaten, anstatt richtig mit nur 5 Jahren und 10 Monaten – also 8 Monate zuviel – berücksichtigt wurde …
Ich hätte solche Post sofort verbrannt, doch das durfte man natürlich nicht, wenn man eine Familie versorgen mußte. Noch ein Grund, sich keine zuzulegen.
Damit das Dach isoliert werden konnte, sollte ich da oben schon mal Platz schaffen, während Papa im Büro war.
Kartons voller Treibgut. Wasserhähne, Kurvenstücke der alten Carrera-Bahn, aussortierte Klamotten, Renates rostige Springschuhe und alte Bücher.
Der redliche Ostpreuße: Ein Hauskalender für 1951
Mit Bauernregeln:
Leuchten in der Fastnacht viel Sterne,
legen die Hennen viel und gerne.
Dazu Reimereien von Hermann Sudermann:
Helden mag man and’re heißen,
wir sind Pflichtvolk, wir sind Preußen,
das ist uns genug an Wert!
Gebt uns wieder Haus und Hof und Herd!
Schlagt uns Balken, brennt uns Steine!
Wir begehren nur das eine:
Heimat!
Wenn sie sonst nichts begehrten, hätten sie doch einfach daheimbleiben können, die redlichen Ostpreußen. Dann hätten sie Polen und Rußland nicht zu überfallen brauchen und später nicht über den Verlust der Heimat jammern müssen.
Lose flog ein von Wiebke in prähistorischen Zeiten gefaltetes und beschriftetes Zeichenblockblatt herum.
Liebe Mama! Wen du Diesess Heft auf schleksst Siesst du etwas Schönes.
Auf den Innenseiten Filzstiftblümchen.
In einem Karton lagen vergilbte Ausgaben der Schülerzeitschrift Mücke. Vermutlich auch aus Wiebkes Besitz.
Das bunte »Gib acht«-Heft für die Grundschule.
Was da für ein Murks drinstand!
Wir basteln Röhrentiere …
Ein Gedicht hieß »Wer leben will, muß arbeiten« und ging so:
Ameisen schleppen Halme her
Zum Bau. (Das ist besonders schwer!)
Sie schuften immerzu. –
Und was, mein Freund, tust du?
Das hätte man mal die 2,5 Millionen Arbeitslosen in Deutschland fragen sollen. Beziehungsweise in der Bundesrepublik, denn in der DDR gab es ja keine Arbeitslosen. Oder nur eine »kaschierte Arbeitslosigkeit«, wie immer gesagt wurde, ohne daß einem mal einer erklärt hätte, wie das gehen sollte: Arbeitslosigkeit kaschieren.
Eine Broschüre, die Oma Schlosser Papa zum 27. Geburtstag gewidmet hatte, trug den Titel: »Goldene Worte – Samenkörner für Zeit und Ewigkeit«. Eines der goldenen Worte stammte von einem gewissen Hermann Bezzel.
Wenn wir beten können: Nimm mir alles und laß mich dabei nicht weinen: das ist Frömmigkeit.
Das ist Masochismus, hätte ich ja eher gesagt. Wie fromm wohl die Mütter gewesen waren, die ihre im Krieg gefallenen Söhne nicht einmal beweint hatten! Ekelhaft, diese Leidensverherrlichung. Was hätte Hermann Bezzel gesagt, wenn ihm im Schützengraben die Eier weggeschossen worden wären? Danke, lieber Gott? Könntest du mir nicht auch noch den Schwanz abschneiden? Und dabei meine Tränen ersticken? Um meine Frömmigkeit zu testen?
Opium für das Volk. Flick und Krupp, die Großindustriellen, hätten weder im Krieg noch im Frieden das Bittgebet gen Himmel geschickt: Nimm mir alles und laß mich dabei nicht weinen! Dafür hatten sie ja seit jeher die Proleten, die ihnen als Kanonenfutter dienten.
Dann ein Sonderdruck aus Medizinische Klinik, Wochenschrift für Klinik und Praxis, erschienen im Oktober 1947:
Eine vereinfachte Berechnung der Blutkörperzählung.
Von Sanitätsrat Dr. med. Eduard Grote.
Das war Oma Schlossers Vater. Der prominenteste unserer direkten Vorfahren.
Oder hier – eins von Mamas Arbeitszeugnissen aus den frühen Fünfzigern. Gesamtbeurteilung:
Fräulein Lüttjes ist eine flotte Dolmetscherin und Übersetzerin.
Wie herablassend das klang. Ein flottes Fräulein! Sowas konnten auch nur Herren absondern, die von Women’s Lib noch nichts läuten gehört hatten.
Ich entdeckte auch ein Büchlein über die Entstehungsgeschichte des Neubaugebiets Horchheimer Höhe, wo wir von 1967 bis 1970 gewohnt hatten. Die Fotos darin zeigten diesen Vorort eines Vororts an der nach Westen geneigten Talseite des Rheins bei Koblenz in aller wahrheitsgetreuen Schlichtheit. Das Ladenzentrum, wo ich als Grundschüler mit meiner Bande Spielzeugpistolen gestohlen hatte, und der Sandkasten vor dem Hochhaus, wo wir die Pistolen eingebuddelt hatten und wo ich sie nachher heimlich wieder ausgebuddelt hatte …
Wären wir da man geblieben! Statt in Vallendar ein Haus zu bauen und dann nach Meppen zu ziehen! Wenn man die Horchheimer Höhe hinter sich gelassen hatte, konnte man nicht wieder zurück und so tun, als ob man dort noch verwurzelt wäre. Die sah ja inzwischen auch etwas anders aus. Aber auf den Fotos von 1967 hatte sie noch ihr einstiges Gesicht, und wenn ich den passenden Zauberspruch gewußt hätte, wäre ich in den Sandkasten auf der Horchheimer Höhe zurückgesprungen.
Zwischen den Dachbalken mußten dicke Bahnen aus einem gelben Stoff eingepaßt werden, der sich wie Glaswolle anfühlte. An der Unterseite klebte eine Art Silberfolie, die links und rechts überstand, so daß sie mit einem elektrischen Klammeraffen ans Holz getackert werden konnte, und darüber kam dann noch eine grüne Plastikfolie, die man ebenfalls antackern mußte.
Bis wir das erste Stück der ersten Stoffbahn zu Papas Zufriedenheit befestigt hatten, vergingen Tage. Zunächst mußten die ganzen schweren Stoffrollen auf den Dachboden gewuchtet und jede Menge Verlängerungskabel zusammengesucht werden. Dann brauchte Papa oben was zum Sitzen. Dafür nahm er eine ausgeleerte Zeichnungsrollentonne, und weil die wackelte, mußte ich einen Stuhl organisieren. Dann mußte ein Aschenbecher her. Und Bier. Und dann fehlten noch alle möglichen Utensilien: Schraubenzieher, Teppichmesser, Zollstock, Schere, Hammer, Nägel, Bleistift, Spitzer, Winkeleisen, Bohrmaschine, Bohrfutterschlüssel, Handbohrer, Holzbohrer, Reißbrettstifte, Klebeband, Kneifzange, Besen, Wasserwaage …
Ich eierte die Treppen rauf und runter, und fast jedesmal, wenn ich was apportiert hatte, schickte Papa mich wieder los.
»Hol mir mal ’ne Lupe!«
»Hol jetzt mal Millimeterpapier rauf!«
»Bring mir mal ’n Anspitzer hoch!«
»Hol mal Handfeger und Schippe! Und bring ’nen Abfalleimer mit!«
»Und wo liegt jetzt wieder dieser gottverdammte Zollstock?«
Zwischen den Arbeitsgängen mußte Papa sich ausruhen und rauchen. Dann ruhte auch ich mich aus und rauchte, und wir tranken Bier.
Genaugenommen, sagte Papa, sei er ein Grüner. »Aber wählen tu ich die nicht! Von denen sind mir die meisten nicht gar genug gebacken …«
Ich achtete darauf, ob sich Glutstücke in den Aschekrümeln befanden, die auf den Boden fielen.
Wenn Wiebke geahnt hätte, was für Spinnen bei uns auf dem Boden wohnten, hätte sie Asyl auf einem der Jupitermonde beantragt. Oschis mit haselnußgroßem Körper und pelzigen Beinen. Die Biester hatten die Ruhe weg, doch sobald man sie mit dem Handfegerstiel berührte, spurteten sie los wie Goldmedaillenaspiranten in der 4 × 100-m-Staffel.
Ich sollte dann, während Papa im Büro war, die Isolierstoffbahnen und die Plastikfolienstreifen zuschneiden, aber ich trug erst einmal den Plattenspieler hoch und gab ihm Saft.
Somewhere, my love, there will be songs to sing
Although the snow covers the hope of spring …
So sang’s ein russophiler Neger auf einer der raren LPs aus Papas Besitz (»An American in Moscow«). In einem anderen Lied wurde die Trauer über das Gehenmüssen der Geliebten thematisiert:
When morning comes
I wonder why
You have to go
So sad am I …
Oder dann der Song, wo der Mann die Frau dazu aufforderte, ihm nur das Äußerste und nicht das Unmögliche abzuverlangen.
Ask me for a rose in the snow
Ask me for my heart
And always to be true
But don’t ask me to go away from you …
Ich legte dann eine alte Single von Renate auf.
Song sung blue
Weeping like a willow …
Da beklagte sich Neil Diamond darüber, daß er sich als gebürtiger New Yorker in Los Angeles fremd fühle, aber auch zu New York keinen Draht mehr habe.
Was ich selbst so an Platten besaß, war beschämend. »Harlekin« von Danyel Gérard, mit meinem Absenderstempel vorn auf der Hülle und auf der Rückseite mit Werbung für eine Langspielplatte:
Neue Lieder in deutscher Sprache: Nur wer wagt, gewinnt – Sie war nicht schön – Halleluja – Jesus Christ – Meine Stadt (Von Japan nach Amerika) – Du bist da – Einsamer Clown – Teddybär – Marie-Jezabel – Harlekin – Carolyn – Butterfly (CBS S 64834, MusiCassette CBS40–64834)
Dann schon lieber Melanie Safka:
There’s no time to lose, I heard her say
Catch your dreams before they slip away …
Oder Cat Stevens:
My Lady d’Arbanville,
Why do you sleep so still?
Wenn man das hörte, kam man sich vor, als wäre man wieder fünfzehn und müßte nachher noch Mathe büffeln.
In der Fernsehwerbung für Jever Pilsener wurde Jever falsch ausgesprochen, nämlich »Jewer« statt »Jefer«.
Das machte Mama jedesmal wieder wütend. Man sage doch auch nicht »Hannower«! Daß die Jeveraner nichts dagegen unternähmen, sei eigentlich sonderbar. »Oder die Geschäftsführer der Brauerei. Die müßten das doch wissen! Schließlich sitzen die in Jever!«
Am Wahlsonntag gaben wir unsere Stimmen in der Kardinal-von-Galen-Schule ab. Von mir hatte die SPD nichts mehr zu erwarten. I gave my vote: Erst- und Zweitstimme für die Grünen. Die Erststimme war natürlich verschenkt. Im Emsland hatte die CDU die Erststimmenmehrheit gepachtet. Und die Zweitstimmenmehrheit desgleichen.
Mit Freuden hätte ich zugesehen, wie Genscher nach dem Aus für die FDP mit gramzerfurchter Stirn vor die Kameras tritt und nach Worten ringt, doch dazu kam es leider nicht. Die FDP verlor zwar 3,6%, schaffte es aber mit 7% relativ locker über die Fünfprozenthürde, und die CDU sahnte fette 48,8% ab, während es die SPD nur auf lumpige 38,2% brachte (minus 4,7). Dafür zogen aber jetzt die Grünen mit 5,6% in den Bundestag ein.
Was mochte Papa wohl gewählt haben? Wahrscheinlich SPD. Obwohl ihm an den Sozis auch nicht alles paßte. Helmut Schmidt hatte in einer Bundestagsrede mal verkündet, das Herz des deutschen Arbeiters schlage immer noch links, und da hatte Papa gesagt, es sei Quatsch, so etwas überhaupt in die Debatte einzuführen.
Mama mußte wieder nach Hannover zur Krebsuntersuchung. Solange Wiebke in der Schule war und Papa im Büro, hatte ich das ganze Haus für mich allein.
Mamas Bücher. »Dicke Lilli, gutes Kind«, »Der Zauberberg«, »So zärtlich war Suleyken« und »Der Geist der Mirabelle« …
Alte Fotoalben. Opa Jever als Schüler. Der Uropa mit Mittelscheitel, und die vielen Kinder fast alle am Schielen. Aber Opas Mutter war eine erstaunlich schöne Frau gewesen.
Im Keller welche von Papas Akten.
Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat …
Stets zu Ihren Diensten zeichnen wir hochachtungsvoll …
Ihrer gefälligen Rückäußerung sehen wir mit Interesse entgegen …
Ging’s nicht noch affektierter?
Aus einem Brief der Kreissparkasse Koblenz:
Vorbezeichnetes Konto wird seit dem 9. 12. 1970 umsatzlos geführt und weist einen Schuldsaldo von DM22,95 aus. Wir bitten Sie, diesen Betrag bis spätestens 30. 5. 1971 auszugleichen.
Es mußten einem doch die Zähne ausfallen, wenn man hauptberuflich solche Wische aufzusetzen hatte.
Stempelaufdruck auf einem Behördenbrief:
Dieses Schreiben wurde von einem Blinden gefertigt.
Kriegte man das mitgeteilt, damit man diesem Blinden Achtung zollte? Oder der Behörde, die so freundlich war, ihn einzustellen? Oder damit man verständnisinnig nickte, wenn einem etwaige Tippfehler auffielen?
Renate war mit ihrer Family irgendwo im Hochsauerland im Rodelurlaub, und Ronald Reagan hatte die Sowjetunion als »Reich des Bösen« klassifiziert.
Sonst noch irgendwas Neues?
Nach dem Therapieplan eines hannöverschen Medizinprofessors mußte Mama Chemikalien schlucken. Vincristin, Decortilen und Endoxan.
Ich versenkte mich in den »Zauberberg«. Einer der größten Romane des 20. Jahrhunderts. Und ich hielt gut fünfhundert Seiten lang durch, bevor ich das Ding in die Ecke feuerte. Was sollte bloß dran sein an diesem Gewäsch über todlangweilige Kurgäste und deren sterbensöden Alltag?
Die Wärmedämmungsmaßnahmen auf dem Dachboden gingen nur langsam voran. Immer erst den ganzen Prüll zur Seite schaffen und dann wieder auf Papa warten, der im Keller nach bestimmten Schrauben oder Schraubenmuttern suchte.
Über Hannover, wo die nächste Untersuchung vorgenommen wurde, fuhren Mama und Papa nach Hildesheim-Itzum zur Feier von Onkel Immos fünfzigstem Geburtstag, und ich ging aus.
Im Pub sah ich jedoch keine bekannten Gesichter, im Bauhaus lärmten radiergummibärtige Pimpfe, und im Fernsehen lief dann auch nur Kacke.
Wer hat gesagt, daß sowas Leben ist?
Die Chemotherapie schlage an, sagte Mama, als sie zurück war. »Aber ich bin derart groggy – so hab ich mich seit Jahren nicht gefühlt …«
In Meppen dauerte jede einzelne Stunde länger als die mittlere Altsteinzeit, doch die Wochen flogen nur so dahin.
Zu Ostern kam die Familie Blum dreieinhalb Mann hoch zu Besuch: Renate, Olaf, Lisa und das Baby, mit dem Renate schwanger ging. Wenn das eine Ahnung davon gehabt hätte, was seiner harrte! Das große Einmaleins, die binomischen Formeln, der Satz des Pythagoras und eventuell ein Auftritt vor dem Prüfungsausschuß für Kriegsdienstverweigerer. Und in Bonn regierte die schwarzgelbe Koalition und verfinsterte die Zukunftsperspektiven.
Lisa mit ihrem Puppenwägelchen. Renate nähte einen neuen Bezug dafür und strickte Babysachen.
Wie ein kleiner Rauschgoldengel sah Lisa aus.
Ich hatte zuviel Weißwein gesüffelt. Mit verheerenden Folgen: Als ich vormittags nach unten ging, fragte Mama mich, was ich denn da am Kinn kleben hätte. Da trat ich einen taktischen Rückzug an und stellte vor dem Badezimmerspiegel fest, daß ich mich im Schlaf erbrochen haben mußte. Und daß das Zeugs dann angetrocknet war.
Aussehen tat’s wie eine Applikation aus gehäckselten Haferflocken.
Erkenne dich selbst!
Bei der Ostereiersuche hatte Lisa mehr Berater, als sie brauchen konnte.
»Hier, Lisa! Hier bei den Sträuchern!«
»Dreh dich mal um, Lisa! Dreh dich mal um!«
»Falsche Richtung, Lisa!«
»Kalt, ganz kalt!«
»Kuck mal da vorn! Beim Beet!«
»Warm … wärmer … immer wärmer … heiß!«
»Zu weit links!«
»Sieh doch mal, was da im Gras liegt! Was da so rosa schimmert!«
Seit Ostersonntag hielt sich auch Heike in Meppen auf, und wir hatten es ganz schön in ihrem alten Jugendzimmerchen. Und trotzdem gab es für unsere Fusion kein Morgen mehr.
Nach dem Sommersemester wollte Heike weg von Bielefeld und nach Oldenburg ziehen, wo es ihr besser gefiel.
Als die Blums am Ostermontagmittag mit ihrer vollgepackten Karre wieder abreisten, ließen sie das Haus so leer zurück, wie es mit Mama, Papa, Wiebke und mir als Besatzung nun einmal wirkte.
Im Bauhaus traf ich Hermann. Er sagte, er fühle sich um Jahre gealtert, seit er studiere. Im Gegenzug beichtete ich ihm mein Haferflockenmalheur, und weil er darüber gar zu hämisch lachte, heckte ich einen Streich aus, bei dem mir unsere alten Mitschüler Ralle und Bohnekamp behilflich sein sollten, die mir auf der Herrentoilette entgegengekommen waren und meinen Instruktionen willig folgten. Sie sollten jeder für sich, mit ein paar Minuten Pause dazwischen, zu Hermann gehen, ein erschrockenes Gesicht machen und sinngemäß sagen: »Mann, was siehst du alt aus! Is’ irgendwas mit dir?« Oder: »Bist du krank?«
Der Effekt war beachtlich. Als Ralle ankam und seinen Vers aufsagte, verdrehte Hermann nur die Augen, aber als Bohnekamp nachsetzte und ihm Salz in die frische Wunde rieb, erlebte man so etwas wie den nervlichen Zusammenbruch eines Cheruskerfürsten.
»Nenn dich doch Hermann Sachzwang statt Hermann Gerdes«, schlug ich ihm vor. »Dann weiß man gleich, warum du so aussiehst, wie du aussiehst …«
Fand er nicht so witzig.
Nach knapp zwei Dritteln der Isolierarbeiten ging Papa auf Dienstreise, und da kratzte auch ich die Kurve. Schließlich mußte ich mich ja mal auf mein Studium vorbereiten.
Fürs erste fuhr ich mit Hermann nach Göttingen. Er kannte einen Autobesitzer aus Haren, der nach Kassel wollte, und der nahm uns mit.
Ermüdend, so ’ne lange Autofahrt! Am Steuer lösten wir einander ab. Auf der Autobahn hinter Hannover überholte ich eine LKW-Kolonne und kriegte fast einen Herzschlag, als von einer Sekunde auf die andere ein Rennwagengeschoß den Rückspiegel ausfüllte und Lichthupensignale abgab, um uns zu verjagen. Porsche oder sowas. Wieder einscheren konnte ich aber erst nach Abschluß meines Überholmanövers. Der Fahrer hinter uns fuhr immer dichter auf. Man sah seine Fresse und daß er schrie und auf sein Lenkrad drosch. Er wartete dann auch nicht ab, bis wir vollständig auf die rechte Spur gewechselt waren, sondern rauschte, links blinkend, in die im Entstehen begriffene Lücke zwischen uns und der Mittelleitplanke hinein, wobei er uns fast gerammt hätte, und ich zeigte ihm spontan den Mittelfinger: Fuck you! Eine Geste, die ich vorher noch nie ausgeführt und von der ich nicht einmal geahnt hatte, daß sie zum Repertoire meiner Reflexhandlungen zählte.
Der Fahrer sah genau zur rechten Zeit herüber. Gutes Timing.
Statt nun aber abzuzischen, setzte dieser Blödmann sich mit seinem Porsche unmittelbar vor uns und bremste plötzlich scharf ab.
Und wir wären ihm draufgefahren, wenn mein rechter Fuß nicht blitzgeschwind das Bremspedal gefunden hätte.
»Arschloch!« schrie Hermann, der hinten saß, und neben mir entrang sich dem Eigentümer des von mir gesteuerten Gefährts ein Seufzer.
Der Porschefahrer, scheint’s befriedigt, zog auf und davon. Wie schnell der wohl fuhr? 220?
»Den hättest du nicht reizen sollen«, sagte Hermann. »Das zahlt sich nicht aus.«
In der Tat: Der Typ hatte unser aller Leben riskiert. Bloß um mir einen Dämpfer zu verpassen. Aus Rache. Und in der Gewißheit, daß bei Auffahrunfällen immer der Aufgefahrene die Schuld trug.
Auf dem nächsten Parkplatz ließ ich mich ablösen.
Krieg auf Deutschlands Autobahnen!
Am Ortseingang von Göttingen holte ich meine Super-8-Kamera raus und schwenkte sie, obwohl ich gar keinen Film eingelegt hatte, von der roten Ampel vor uns zum rechten Bürgersteig. Das fiel einem Neger auf, der dort entlangspazierte, und schon dräute die nächste Konfliktsituation, denn der Neger tickte aus und rannte schimpfend auf uns los, offenbar in der Absicht, mir das Filmen von Passanten zu verleiden, weil er mich wohl für einen Zivilbullen oder einen Verfassungsschützer oder einen ausländischen Geheimagenten oder etwas Derartiges hielt, doch kurz bevor er auf die Kühlerhaube springen oder das Seitenfenster einschlagen konnte, bekamen wir Grün.
Der Neger brüllte fäusteschwingend hinter uns her.
Hermann lachte und sagte: »Wenn der keinen Dreck am Stecken hat, dann weiß ich’s nicht!«
Vielleicht war es ja auch ein politischer Flüchtling, der schlechte Erfahrungen mit Kameramännern gemacht hatte.
Wir asteten eine Kiste Bier in Hermanns Studentenbude und erörterten die politische Lage. »Ich find’s lachhaft«, sagte Hermann, »wie die schwarzgelben Koalitionäre da in Bonn ihren Kurs zur geistig-moralischen Wende hochsterilisieren …«
»Du meinst hochstilisieren.«
»Wieso, was hab ich denn gesagt?«
»Du hast hochsterilisieren gesagt.«
»Hochstilisieren … hochsterilisieren … das Ergebnis bleibt sich gleich: Daumenschrauben für die Arbeitnehmer und Geschenke für die Industrie!«
Einig waren wir uns darin, daß es auch die Regierung Kohl nicht wagen werde, den Wählern ein Tempolimit zuzumuten, ungeachtet aller Folgen für die Unfallstatistik, den Energieverbrauch und die Umwelt. Hermann wandte hier allerdings ein, daß ich auf der Autobahn fast durchgängig 140 gefahren sei, obwohl wir es doch gar nicht eilig gehabt hätten. Wer für Tempo 100 eintrete, der müsse sich auch ohne allgemeinverbindliche Regeln daran halten. »Kant. Kategorischer Imperativ. Schon mal davon gehört?«
Soweit ich wußte, war Immanuel Kant in der praktischen Führerscheinprüfung dreimal durchgefallen.
Zur Ruine der Plesseburg, die man angeblich mal gesehen haben sollte, mußten wir acht Kilometer weit petten, weil Hermann kein zweites Fahrrad besaß. Und man konnte nicht behaupten, daß sich die Strapazen gelohnt hätten. Was sollte man schon tun in so ’ner Ruine? Außer rauchen und dann umkehren?
Beim Trampen nach Bielefeld ging das leidige Frage-Antwort-Spiel wieder los.
»Und was machste da so?«
»Studieren.«
»Was ’n so?«
»Germanistik, Soziologie und Philosophie.«
»Auf Lehramt?«
»Nee. Magister.«
»Ah. Verstehe. Und was willste damit machen später?«
»Is’ noch offen.«
»Was gibt’s ’n da so für Möglichkeiten?«
»Och, ganz verschiedene …«
»Zum Beispiel?«
»Kulturjournalismus.«
»Sagt mir nix. Was meinst ’n damit genau?«
»Na, über Bücher schreiben oder über Filme oder Kunst …«
»Is’ das ’n Beruf? Hätt’ ich nich’ gedacht …«
Pause.
»Und was verdient man da so?«
Nach langem Geblätter fand ich in meiner Brecht-Ausgabe die auf Thomas Mann gemünzten Verse wieder, an die ich mich nur dunkel erinnert hatte:
Der Dichter gibt uns seinen Zauberberg zu lesen.
Was er (für Geld) da spricht, ist gut gesprochen!
Darüber konnte man geteilter Meinung sein.
Was er (umsonst) verschweigt: die Wahrheit wär’s gewesen.
Ich sag: Der Mann ist blind und nicht bestochen.
Vielleicht galt Thomas Mann ja nur deshalb als großer Schriftsteller, weil er sich so aufgeplustert hatte, wie die Leute glaubten, daß große Schriftsteller sich aufplustern müßten.
Bielefeld: regnerisch. Wohngemeinschaft: leblos. Küche: Abwasch. Mülleimer: voll. Gott: tot. Brot: hart. Klopapier: alle. Badewanne: Schmutzrand. Fingernägel: ungeschnitten.
»Catch your dreams«, so hieß auch ein dokumentarischer Spielfilm über ein paar junge Leute, die es miteinander trieben, kreuz und quer, in einem Schloß.
Heike las mir angewidert was darüber vor und faßte den Inhalt zusammen: »Die rammeln da und lassen sich dabei filmen, damit andere, die’s nötig haben, sich daran aufgeilen können …«
Hätte mich interessiert, aber ohne Heike wollte ich nicht reingehen.
Richtig herzig fand sie dafür den neuen Landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle von der CSU. »Der sieht wie so’n kleiner dicker Junge aus, der noch zu seiner Mama laufen muß, damit sie ihm die Nase putzt …«
Fast dreißig Mark hatte ich in die zweibändige Taschenbuchausgabe von Klaus Theweleits »Männerphantasien« investiert. Ein monumentales Werk. Hatte sich vorher überhaupt schon einmal jemand die Mühe gemacht, die Literatur der Faschisten zu lesen? Also in diesem Fall die Romane, Erlebnisberichte und Tagebücher der Freikorpssoldaten, die nach dem Ersten Weltkrieg die Revolution niedergeschlagen hatten?
Die meisten waren an der Front gewesen und nicht ins Zivilleben zurückgekehrt. Sich selbst hatten sie als gepanzerte »Stahlgestalten« beschrieben, aber wie Theweleit nachwies, hatte hinter der Fassade eine scheißende Angst gelauert – vor dem Leben, vor den Frauen, vor dem Sex, vor dem eigenen Körper und dessen Lüsten und Säften, vor der Entgrenzung, vor dem Verlust der angedrillten Männlichkeit, vor der wimmelnden, die militärische Ordnung und die Monarchie über den Haufen werfenden Masse, vor der »roten Flut« und der Syphilis und dem Untergang des Abendlandes durch den Sexualbolschewismus. Wenn diese Krieger jemals liebevoll einen Körper beschrieben hatten, dann war es der eines Reitpferds. Selbst die Ehefrauen kamen nur unter ferner liefen vor:
Am 5. März fand die Trauung, wie vorgesehen, um 11 Uhr am Bett meines Vaters statt, der mit EK I von 1870 aufrecht saß, neben ihm, im Rollstuhl, meine Mutter.
So hatte der General Paul von Lettow-Vorbeck seine Verehelichung geschildert, und Theweleit schrieb dazu:
Das Opfer dieser preußischen Gruselhochzeit ist die Frau.
Und genau aus dieser Soldateska hatten die Nazis ihre Truppen rekrutiert. Für dogmatische Marxisten erklärte sich der Aufstieg des Dritten Reichs allein aus dem Kalkül des Großkapitals, doch das Volk war nicht unschuldig.
Einige Generationen junger deutscher Männer, geboren etwa zwischen 1870 und 1920, fanden es leichter, die halbe Welt in die Luft zu sprengen und einige Millionen Menschen zu töten, als den Ansprüchen ihrer verschiedenen ›Erzieher‹ wirklichen Widerstand entgegenzusetzen.
Darüber hätte ich mich gern mit Opa Jever unterhalten, wenn er nicht schon tot gewesen wäre.
In einem j.w.d. gelegenen alternativen Filmclub lief der Klassiker »Iwan der Schreckliche« von Sergej Eisenstein. Man mußte über Fabrikhöfe laufen, verstaubte Treppen erklimmen und steinerne Korridore durchmessen, um zum Vorführraum zu gelangen, der mit Sperrmüllsofas und Sperrmüllsesseln und einer Holztheke möbliert war, an der man Flaschenbier kaufen konnte.
Außer mir interessierten sich noch elf, zwölf andere Bielefelder für Eisensteins Spätwerk. Dem Proletariat, für das er es geschaffen hatte, schien aber keiner von ihnen anzugehören. Allenfalls dem akademischen Proletariat. Wer sonst hätte spätabends unter der Woche Zeit für einen dreistündigen Historienfilm gehabt? Obwohl – fürs Fernsehkucken nahmen sich manche bundesdeutschen Proletarier abends unter Umständen sogar mehr als drei Stunden Zeit.
Den Weg zu der etwas löchrigen Leinwand mußten sich die bewegten Bilder durch Schwaden von Zigarettenqualm bahnen, zu denen auch ich mein Teil beisteuerte – anfangs aus Gewohnheit, aber dann auch, um mich wachzuhalten, denn je länger sich das Drama hinzog, desto schwerer wurden mir die Lider. Das war nicht fair gegenüber einem berühmten Regisseur, der dieses Epos laut rororo-Filmlexikon unter schwierigsten Bedingungen im stalinistischen Rußland gedreht und montiert hatte, und vielleicht hätte ich kein Bier trinken sollen, aber wie auch immer: Ich mußte wohl eingenickt sein. Denn irgendwann schrak ich auf und merkte, daß ich geschlafen hatte. Und daß alle Leute lachten und zu mir herübersahen.
Hatte ich geschnarcht?
Ich machte mich so klein wie möglich in meinem Sessel, drehte mir ein Zigarettchen und sah Iwan den Schrecklichen agieren, bis ich abermals aufschrak, nachdem ich abermals geratzt hatte.
Eisenstein in allen Ehren, aber ich war bettreif.
Als ich aufstand, wurde nicht nur gelacht, sondern auch Beifall geklatscht.
Unten suchte ich nach meinem Rad. Ich hatte es an einen Gitterzaun gekettet, doch nun waren weder Rad noch Gitter wieder aufzufinden. Oder hatte ich mich in der Hausnummer geirrt?
Nein. Sowohl das Gitter als auch mein Fahrrad waren verschwunden. Aber wohin?
Mein Blick irrte umher, und da sah ich die Bescherung: Der vermeintliche Zaun war ein Tor, das man hochfahren konnte, so daß es sich oben zusammenrollte. Und mein schönes Fahrrad war mit eingerollt worden!
Ich kombinierte: Jemand hatte hier hindurch gewollt oder gemußt und sich über den Idioten geärgert, der sein Rad ans Tor geschlossen hatte. Wer so dämlich sei, der verdiene einen Denkzettel, hatte der Unbekannte gedacht und den Einrollmechanismus in Betrieb gesetzt …
Den rechten Torbogen zierten speckige Schalter. Es regte sich aber nichts, als ich die betätigte. Dafür brauchte man wohl einen Schlüssel oder eine besondere Ausbildung.
Infolgedessen mußte ich zurück zum Filmclub dackeln und den Menschen anhauen, der das Bier verkaufte. Um nicht erkannt zu werden, ging ich hinten um die Sofas rum. Auf Kommentare zu meinem Comeback war ich nicht versessen.
»Da mußte morgen wiederkommen«, sagte der Biermensch. »So ab zehn oder elf. Und nach dem Schwanni fragen.«
»Schwanni?«
»Der macht hier so die Hausmeistersachen.«
»Und der heißt Schwanni?«
»Ja.«
»Und wo kann ich den finden?«
»Frag einfach ma’ rum. Der wird dann schon irgendwo sein.«
Für den Heimweg brauchte ich mehr als anderthalb Stunden und am nächsten Tag genauso lange für den Rückweg zum Unglücksgitter. An der mißlichen Lage meines Fahrrads hatte sich noch nichts geändert.
Nun war es meine Aufgabe, den Hausmeister aufzutreiben. Die vereinzelt über das Gelände geisternden Leute sahen nicht so aus, als ob sie gesiezt werden wollten. Aber Fremde duzen und sie dann auch noch nach einem »Schwanni« fragen – das hätte ich nicht gebracht.
Ich wählte einen Mittelweg. »Entschuldigung, ich suche jemanden, der Schwanni heißt …«
Die besten Antworten: »Bin selber nich’ von hier.« – »Wie war der Name?« – »Schwanni … Schwanni … nö. Da klingelt bei mir nix.« – »Kann schon sein, daß ich den kenne, aber ich hab echt ’n schlechtes Namensgedächtnis …« – »Da fragste mich zuviel. Verrat mir mal lieber, wo hier die Toiletten sind!« – »Schwanni? Wie soll ’n der aussehn?«
Einer der Befragten schickte mich ins zweite Stockwerk, rechts den Gang lang, durch die Stahltür, dann gleich links und auf das verglaste Büro zu: Dort solle ich »den Stefan« fragen. Der könne mir vielleicht weiterhelfen.
In dem Büro waren irgendwelche Spontis am Konferieren.
Ich öffnete die Tür und sagte: »Entschuldigung, ich suche einen Stefan …«
»Später wiederkommen!« wurde mir zugerufen.
»Wieviel später denn?«
»Frühestens in zwei Stunden!«
Klasse. Und was sollte ich solange tun?
Durch die Gegend wandern. Was sonst? Die Ecken von Bielefeld, die ich dabei erblickte, waren mir zwar neu, aber ich hätte keine davon wiedersehen wollen. Häßliche Haustüren, häßliche Gardinen, häßliche Markisen, häßliche Autos, häßliche Menschen.
Black cloud crossed my mind.
Blue mist round my soul …
So viel war sicher: Die Leute, deren Hilfe ich brauchte, um mein Rad wieder freizubekommen, würden mich nicht als ihren Blutsbruder begrüßen. Ich mußte sie beschwichtigen. Als ich einen Supermarkt sah, ging ich rein und kaufte einen Bottich Eis in den Geschmacksrichtungen Erdbeer, Schokolade und Vanille.
»Ach, du bist dieser Pedalritter«, sagte »der Stefan«, nachdem ich ihn zu fassen gekriegt hatte. »Wir haben uns schon gefragt, wer sich da wohl schuldig bekennen wird. War ja echt clever von dir!«
Den Pott mit dem inzwischen halb geschmolzenen Eis stellte er auf einem verschrammten Stahlregal ab, und dann schritten wir in Richtung Rollgitter. Ob nun Schwanni oder Stefan – ich wollte einfach nur mein Fahrrad wiederhaben und mich anschließend so sorgfältig in Luft auflösen, daß mein Fauxpas irgendwann dem Vergessen anheimfallen mußte. Selbst wenn es eine sechzehnteilige Eisenstein-Retrospektive gäbe: Ich würde nie an den Tatort zurückkehren.
Das Gitter klemmte, weil sich der Fahrradständer, beide Pedale und der eine Lenkergriff darin verhakt hatten, und eine Leiter mußte her. Dann ging ein irres Gefrickel und Gezerre los. Bequemer wäre es gewesen, das gesamte Rolltor auszubauen und es mitsamt dem Fahrrad auf der nächsten Documenta auszustellen. Gab es nicht so ähnliche Kunstobjekte von Marcel Duchamp? Oder von Jean Tinguely?
Nach über einer Stunde zäher Arbeit konnte ich den Kadaver meines Drahtesels vom Gitter pflücken. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst: Felgen verbogen, Speichen rausgesprungen, Lenker krumm, Sattelpolster geborsten, Gepäckträger eierig, Kettenschutzblech lose, Lampen zersplittert, Reifen platt und vorderes Zahnrad eingedellt. Das Gitter hingegen hatte so gut wie gar nichts abgekriegt.
Um drei Straßenecken trug ich mein Fahrrad noch herum, bevor ich es absetzte und stehenließ. Sollte sich das doch irgendwer krallen. Die Reparaturkosten hätten mich in den Konkurs getrieben, und ich würde mich auch als Fußgänger zurechtfinden. Wohin hätte ich in dieser Stadt denn überhaupt noch fahren sollen?
Heike meinte, daß man beim Fundbüro abgegebene Fahrräder preiswert bekommen könne. »Frag doch mal nach, wann die da wieder Fundsachen versteigern …«
Ich? Die Nummer vom Fundbüro raussuchen? Und da anrufen? Und zu so ’ner Auktion laufen und da mitbieten? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten?
Ich trampte lieber zu meinem alten Kumpel Georg Krause, der in Düsseldorf einen Studienplatz in Musik an Land gezogen hatte. In Trompete, um genau zu sein. Er bewohnte ein Huck unterm Dach und lebte von der Hand in den Mund. Wer in Düsseldorf ein Bier kippen wollte, der war gut beraten, wenn er vorher eine Bank überfiel. Auf den Einkaufsstraßen flanierten Damen in Nerzmänteln, und jedes zweite Geschäft war eine Edelboutique.
Tags darauf fuhren wir mit dem Zug in Georgs Heimatstadt Erkelenz. Ich kriegte ein kleines Gästezimmer im Reihenhäuschen seiner Mutter und fühlte mich beim Kneipenbummel sehr viel wohler als im Düsseldorfer Schickimicki-Ambiente. Was nützte einem schon der Glanz der Großstadt, wenn man nicht das entsprechende Einkommen hatte?
Georgs Stammlokal hieß Saftladen. Dort berichtete er mir von seiner Jazzband – »Das is’ echt ’ne Chaotentruppe« –, und ich lernte ein paar seiner Freunde kennen: den schlaksigen Kontrabassisten Wolfgang 1, den strubbelhaarigen Pianisten Wolfgang 2, den Posaunisten Ralf, den Trommler und Kesselpauker Hartmut und die Fagottistin Gudrun, die ein »freiwilliges soziales Jahr« in einem Altersheim ableistete und danach studieren wollte. »Auf alle Fälle irgendwas mit Musik. Vielleicht Musiktherapie oder so …«
Diese Gudrun mochte ich wohl leiden. Sie war die Freundlichkeit in Person und auch leicht zum Lachen zu bringen. Außerdem fragte sie gezielt nach den Anfängen meiner Bekanntschaft mit Georg.
»Wir waren in derselben Kompanie.«
»Wie? Du warst bei der Bundeswehr?«
Bei dieser Frage traf mich ein entgeisterter Blick aus Gudruns herrlichen kastanienbraunen Augen. Ein klein wenig ähnelte sie der jungen Jeanne Moreau.
»Zwei Monate nur. Dann hab ich Zivildienst gemacht.«
»Ach so. Du siehst nämlich gar nicht so aus wie die Typen, die am Wochenende in die Sonderzüge kotzen.«
»Vielen Dank auch.«
»Da nich’ für.«
Sie orderte ihr zweites Bier. Zwar nur ein kleines, aber immerhin. Wenn sie eine von den Frauen gewesen wäre, die ausschließlich Kräutertee tranken, hätte ich sie nicht nach ihrer Adresse gefragt.
In Bielefeld komponierte ich einen Brief an Gudrun. Got to get her into my life. Sie schien keinen festen Freund zu haben, jedenfalls hatte sie keinen erwähnt, und ich bespielte die gesamte Klaviatur. Allegro ma non troppo. Andantino. Largo. Maestoso. Presto. Ritardando. Sospirando. Andante con brio. Allegro molto appassionato! Allegretto scherzando! Vivacissimo!
Und wer schrieb mir? Am Montag keiner, am Dienstag keiner und am Mittwoch Hermann.
Ich hoffe, die letzte Zeit ist Dir nicht zu lang geworden. Mir jedenfalls nicht. Mitte letzter Woche bin ich nämlich nach Freiburg getrampt und hab es mir dort gutgehen lassen. Übrigens haben mich nach dahin einige verrückte Leute mitgenommen: ein prahlerischer Rumäne mit seinem Diplomatenschlitten und ein französischer Großkapitalist, der immer nur »Merde« und »Swienerie« sagte. Als ich ihm von den weltmännischen Heldentaten des Rumänen erzählte, rief er: »C’est la vie sportive!«
Nächste Woche läuft hier das Göttinger Filmfest. Ich schicke Dir mal das Programm mit. Falls es Dich anspricht, kannst Du ja vorbeikommen.
Nächste Woche? Fing da nicht schon das Semester an?
Weil Heike nicht mitwollte, mußte ich allein ins Kino. Herbert Achternbusch: »Das Gespenst«. In diesem Film stieg der Heiland vom Kreuz und marschierte durch Bayern.
Abends konnte man den Irren zusehen, die in einer hell erleuchteten Innenstadthochhausetage einer aus Amerika stammenden Gymnastikmode gehorchten: Aerobic. Turnübungen zu schlechter Popmusik.
Daß diese Leute sich nicht schämten!
Er lerne jetzt Spanisch, sagte Hermann, als ich mich von meiner Bude bis zu seiner durchgeschlagen hatte, aber was er mir als erstes vorlas, waren Verse seines neuen Lieblingsdichters Allen Ginsberg:
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked,
dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix,
angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night …
»Und wo bleibt die Simultanübersetzung?«
Hermann gab sich alle Mühe: »Ich sah die besten … äh … Gehirne … oder Geister … oder Bewußtseinsträger … meiner Generation … zerstört durch Wahnsinn, hungrig, hysterisch, nackt … dragging themselves … durch die Negerviertel ziehen, in der Dämmerung, auf der Suche nach einem … einem … zornigen oder ruppigen Schuß, womit wohl Heroin gemeint sein dürfte … engelsköpfige Hipster … brennend … oder entflammt … für die uralte Himmelsverbindung zum sternenhaften Dynamo in der Maschinerie der Nacht … o Junge, gut, daß ich kein Übersetzer bin!«
Der Rauch des roten Libanesen gab uns neue Namen ein. Hermann nannte sich »General Livingstone« und ich mich »Mister President Nebukadnezar der Zwölfte«. Zudem dachte Hermann sich einen räudigen Hund aus und taufte ihn auf den Namen »Mierli the Schmierli«. Außenstehende hätten sich vielleicht gewundert, aber wir amüsierten uns ganz vortrefflich, auch wenn Baudelaire und Konsorten originellere Haschischvisionen gehabt haben mochten.
Auf dem Höhepunkt der Lustbarkeiten schoß Hermann diverse Fotos von mir und per Selbstauslöser auch welche von uns beiden. Die durften aber nicht in die falschen Hände geraten.
Am Samstag spazierten wir durch die Wallanlagen und kamen an einem Türmchen vorbei, in dem Bismarck als Student gewohnt haben sollte. Das Thema Wohnen erinnerte Hermann an einen Artikel, den er mal gelesen hatte, über sogenannte Entmieter, die sich von der Häuserspekulantenmafia engagieren ließen: »Die vertreiben mit Gewalt und Psychoterror Mieter aus ihren Wohnungen. Das geht bis hin zu Einbrüchen, bei denen alles kleingeholzt wird, und manche Mieter werden auch aus den Betten geholt und zusammengeschlagen …«
Dagegen mußte man einschreiten. Radikal. Nicht durch fromme Sprüche, sondern durch subversive Aktionen. Wir faßten den Plan, diese Mafia zu infiltrieren, indem wir ihr per Kleinanzeige in einem der Fachmagazine für Immobilienhaie unsere Dienste anboten.
Renitente Mieter?
Das als Überschrift. Im Fettdruck. Und untendrunter:
Wir lösen Ihre Probleme diskret und unkonventionell.
Chiffre.
Dann würde man ja sehen.
Mit den Drogen – Bier und Shit und dann in einer der Studentenkneipen wieder Bier – hatten wir es abends etwas übertrieben. Als wir heimwärts schwankten, sackte Hermann zusammen. Ihm sei schwindlig, sagte er und suchte Halt an einem Mäuerchen. Er keuchte wie ein ausgepowerter Ochse. Ich dachte schon, ich müsse einen Krankenwagen rufen. Nach einem etwa zehnminütigen Interregnum rappelte Hermann sich aber wieder auf. Und schwor dem Alkohol ab. Sowie überhaupt allem außer Wasser und Brot.
Die Rückfahrt ließ sich gut an. Göttingen-Grone, Seesen, Hannover, Bad Nenndorf, das ging wie der Wind. Vor der letzten Etappe war ich so am Schmöken und am Tagträumen, als ich den Verstand zu verlieren schien. Das Grün des Grünstreifens hinter der Leitplanke verschwamm zu einem Brei, und mir war, als ob ich auf Watte stünde.
Das mußte ein Flashback sein. Heike hatte mir mal davon erzählt: Man hat am Vortag ein bißchen was geraucht und ahnt nichts Arges, und auf einmal ist man breiter denn je.
Gegenüber dem Fahrer, der mich bis Bielefeld mitnahm, ließ ich mir aber nichts anmerken. Das war ja sowieso das Eigentümliche, daß man total bekifft sein konnte, ohne groß aufzufallen.
Sonderveranstaltungen für neue Studenten gab es nur im Wintersemester. Wer im Sommersemester anfing, der hatte selber schuld.
Professor Jörg Drews hielt eine Vorlesung zur Einführung in die Literaturwissenschaft. Da ging ich hin, und es war klasse. Wir sollten nicht in zu viele Seminare rennen und nicht zuviel Zeit in der Uni verbringen, sondern besser in der eigenen Wohnung der Lektüre obliegen, sagte Drews. »Da hat man doch auch seinen Kaffeekocher und was man sonst so alles braucht …«
Wir sollten uns auch nicht von der Sorge erdrücken lassen, daß wir Tag und Nacht lesen müßten, um uns den gesamten Kanon anzueignen. Auch die Professoren hätten ihre Blindstellen. »Ich zum Beispiel habe es bis heute nicht geschafft, mich so eingehend mit Hölderlin zu befassen, wie er es sicherlich verdient hätte. Den ›Hyperion‹ habe ich nie gelesen. Und ich rate Ihnen: Nehmen Sie sich drei Autoren vor, aus verschiedenen Jahrhunderten und möglichst auch aus verschiedenen Ländern oder besser noch Kontinenten. Lesen Sie sich da ein, und wenn Sie sich durch das alles hindurchgearbeitet haben, dann verfügen Sie über ein Grundwissen, das Ihnen durch Ihr ganzes Leben helfen wird. Egal, ob Sie sich nun der Universität verschreiben oder einen anderen Berufsweg wählen …«
Drews, der auch Literaturkritiker war, hatte ein Buch über Herbert Achternbusch herausgegeben. Das bestellte ich mir.
Gudrun hatte mir geschrieben. Sie benutzte graues Umweltschutzpapier mit aufgedruckten Baumwurzeln und Wiesenpflanzen, einem lächelnden Igel und einem im Mondschein tirilierenden Vögelchen, was ich schon etwas problematisch fand.
Oben rechts in der Ecke standen die Worte:
Leben ist für mich wie ein Kerzenlicht, faszinierend, wenn man sich darauf konzentriert, aber gefährlich, wenn man nicht damit umzugehen weiß.
Sollte das eine Warnung sein?
Lieber Martin!
Nun war ich aber mal neugierig.
Ach, tut das gut – endlich wieder draußen im Garten, Sonne, schöne Luft und nicht mehr -zig Pullover und der ganze Wintermief. Nächste Woche fahre ich zu einem Musiktherapievorbereitungsseminar nach Heidelberg und bin total gespannt darauf, weil ich noch ziemlich wenig Konkretes darüber weiß. Was dann aus meinem Berufswunsch wird, das steht noch in den Sternen. Mich macht das manchmal so kribbelig, daß ich nicht weiß, wo ich in fünf Monaten landen werde: Dieses geht wegen Numerus clausus nicht, jenes aus irgendwelchen anderen Gründen nicht …
Das ist doch echt schlimm. Und ich habe keine Lust, was anzufangen, was ich nicht auch wirklich vertreten kann und wo ich nicht hinterstehe. Ganz sicher weiß ich eigentlich nur, daß ich nach meiner praktischen Arbeit jetzt auch unbedingt was lernen möchte (das hätte ich nach dem Abi niemals gekonnt). Die Zeit wird’s zeigen! Und ich finde, das ist kein Grund, eine No-Future-Einstellung oder sowas zu kriegen!
Hatte ich was anderes behauptet?
Das Leben ist ein Fest, bei dem auch mal ein Glas kaputtgeht.
Wie war das nun wieder zu verstehen?
Herzliche Grüße – Gudrun
PS: Was studierst Du eigentlich? Ich habe überhaupt keinen Plan, was Du so machst!
Sofort zurückschreiben? Oder lieber ein bißchen warten, damit sie mich nicht für zu stürmisch hielt?
Lesen sollten wir »Des Luftschiffers Gianozzo Seebuch« von Jean Paul und den Roman »Aus dem Leben eines Fauns« von Arno Schmidt sowie Sigmund Freuds Aufsatz »Der Dichter und das Phantasieren«. Darin wärmte Freud noch einmal seine These auf, daß alle Träume Wunscherfüllungen seien. Aber die meisten Träume vergaß man doch, und in der Erinnerung blieben nur ein paar unscharfe Sequenzen hängen. Wie konnte sich dann jemand hinstellen und behaupten, er habe irgendwas wissenschaftlich Hieb- und Stichfestes über ausnahmslos alle Träume herausgefunden?
In einem Seminar über Theorien und Wirklichkeit sozialer Systeme schwang ein geschleckter Studiosus große Reden. Er wirkte wie ein Doppelgänger des schlaubergerischen Römers Technokratus aus »Obelix GmbH & Co. KG« und flocht ständig Zitate von Autoritäten ein, die außer ihm und dem Professor Vaclav Lamser keiner kannte: Talcott Parsons, Anthony Giddens, John Rawls …
Oder war ich der einzige, der da nicht mitkam?
Was ich noch weniger begriff, war das Prinzip, nach dem die Mensa funktionierte. Wenn Gott gewollt hätte, daß ich mich mit einem Eßtablett in eine Schlange einreihte, dann hätte er mich irgendwie anders ausstatten müssen.
In dem Buch über Achternbusch standen gute Zitate von ihm.
Früher hat man einen Bachlauf nicht verstanden, heut wird er begradigt, das versteht ein jeder. Ein Bach, der so schlängelt. Karl Valentin: Das machen sie gern, die Bäch.
Und:
Im Kino will ich nicht denken, sondern sehen. Im Kino will ich mich spüren. Auf ein Kino, in dem ich mich nicht wieder meiner Gefühlswelt vergewissern kann, pfeife ich. Vom Kino verlange ich ein Rechtsempfinden zurück. Zur Erhaltung meines Lebens war immer das Kino nötig.
Aus Protest hatte Achternbusch einmal einen Zwanzigtausend-Mark-Scheck des Illustriertenverlegers Hubert Burda verbrannt. Ein Mann nach meinem Herzen!
»Orientierst du dich jetzt erstmal?« fragte Heike. »Oder machst du auch schon Scheine?«
Scheine machen? Ich wußte nicht, wovon sie redete.
»Bringen die euch das da nicht bei, wie man Scheine macht?«
Daß man eine bestimmte Anzahl von »Scheinen« brauche, die man durch Referate oder »Thesenpapiere« erwarb, erfuhr ich erst von Heike. Das hatte man davon, wenn man mit dem Studieren nicht im Wintersemester anfing.
Zum Geburtstag schickten Oma Schlosser und Oma Jever mir je zwanzig Mark. Von Hermann war eine geblümte Klappkarte gekommen.
Zum 75. Geburtstag die besten Glückwünsche!
Innendrin klebte ein Foto von mir, wo ich mit erschlaffter Miene im Sessel hing, und vorn ragten zwei Bierflaschenhälse ins Bild.
»O Shit«, denkt sich der Abgebildete, »fühl ich mich alt.« Dabei ist er gerade 21 (nach Jahren gezählt). But life is hard. (Wie wird er wohl mit 75 aussehen?) Alles Gute und viele geglückte Aktionen wünscht Dir Dein Freund Hermann!
Abends rief Tante Dagmar an und sagte, sie habe mir ein Baumwollhemd gekauft. »Das gebe ich deiner Frau Mutter mit, wenn sie hier das nächste Mal absteigt. Gut, mein Lieber! Vermoog di wat!«
Das war Plattdeutsch und bedeutete soviel wie: Gönn dir was Schönes.
Dann war es wieder an der Zeit für einen Trip nach Meppen. Im Zug las ich Schmidt. Der Roman spielte in der Nazizeit, und der Erzähler war ein kleiner, äußerlich angepaßter Angestellter, der die Nazis verabscheute. Sein Leben, erklärte er, sei kein Kontinuum:
(nicht bloß durch Tag und Nacht in weiß und schwarze Stücke zerbrochen ! Denn auch am Tage ist bei mir der ein Anderer, der zur Bahn geht; im Amt sitzt; büchert; durch Haine stelzt; begattet; schwatzt; schreibt; Tausendsdenker; auseinanderfallender Fächer; der rennt; raucht; kotet; radiohört; ›Herr Landrat‹ sagt : that’sme !) : ein Tablett voll glitzernder snapshots.
Im Büro umschleimte dann ein Kollege namens Schönert eine Sekretärin:
»In Ihrer Haut möcht ich stecken.« Sie sah ihn mißtrauisch aus den langen Augenwinkeln an (hat ja wohl auch ihre Sorgen). – »Dochdoch«, beteuerte er fromm, »Und wenns son Stück wär : –« zeigte : etwa 20 Zentimeter. – Ihr Mund, zuerst verblüfft plissiert, löste sich auf, in eddies and dimples, dann prustete sie semig (selbst ich griente würdig und abteilungsleitern : der Schönert, das Schwein. Ja, der war unverheiratet !) …
Für die Deutschen hatte der Erzähler nur Verachtung übrig.
Was sich dort braun gebärdet, Märsche töfft, und begeistert Groschenworte tauscht, ist nicht mein Volk ! Ist das Volk Adolf Hitlers !
Und dann die damalige Schlagerbrühe:
»Jadas Kliemaa : von Liemaa : ist priemaa« ? ! Was müssen das für gefühllose Automaten sein, die sowas
1. texten und musiken,
2. singen und platt schallen,
3. kaufen womöglich,
4. im Rundfunk bringen,
5. sich ruhig (oder gar angeregt) anhören!
( : Wer das Alles macht ? ! : der berühmte ›Deutsche Mensch‹ ! Von der Christlich-Abendländischen Kultur GmbH !)
Mein Gott, war das gut! Weshalb hatte man von diesem Autor in der Schule nichts gehört? Man war mit Böll und Grass und Frisch und Dürrenmatt und Enzensberger abgefüttert worden, den größten Langweilern des Erdenrunds, aber um auf Arno Schmidt zu kommen, mußte man in eine Universitätsstadt ziehen, sich in »LiLi« einschreiben und einem Geheimtip folgen!
Auf dem Klavier rotteten die Osterfotos. Lisa mit Lätzchen und Lisa am Schaukeln. Auf einem der Fotos saßen Papa, Wiebke und ich an verschiedenen Stellen in der Hocke auf dem Rasen und schauten Lisalein beim Eiersuchen zu.
»Das sieht aus, als säßen wir da alle auf ’m Klo«, sagte Papa.
Mama hatte sich inzwischen wieder in Hannover untersuchen lassen müssen und in Hildesheim an der Konfirmation von Tante Luises und Onkel Immos Stammhalter teilgenommen. Der war nicht verwöhnt worden vom Schicksal. Zwei ältere Schwestern und eine Kindheit in den Hildesheimer Suburbs. Und dann so eine aseptische Konfirmationsfeier mit Kaffee und Kuchen und quarrender Verwandtschaft …
Badewanne. Arno Schmidt gegen das Christentum:
Oh, die Schweine Alle !! In die wehrlosen, zart-unwissenden Wesen solche Wortjauchen zu pumpen ! Oder das gleich sinnlose Geleier von »Christi Blut« ! : bis zu 17/18 Jahren müßten Kinder in vollkommener geistiger Neutralität aufwachsen, und dann ein paar tüchtige Lehrgänge ! Könnt ihnen ja dann abwechselnd die Wunderwippchen von der ›Heiligen Dreieinigkeit‹ und den Lieben Männern in Berlin vorlegen, und zum Vergleich Filosofie und Naturwissenschaften : da würdet Ihr Dunkelmänner Euch ganz schön umsehen!
Der Erzähler ging dann mit seiner ungeliebten Frau ins Kino.
Man walzte dekorativ (»Nein, diese ent-zücken-den Kleider, Heinrich !«); Willi dalberte um Lilian; und Hans Moser, der liebe kleine Schelm : Kinderkinder, wenn auf Totschlag bloß nicht immer gleich so hohe Strafen stünden !
Mordgelüste hatte Hans Moser auch in mir schon wachgekitzelt. Jetzt war ich scharf auf alle anderen Bücher von Arno Schmidt.
Im Wohnzimmer erschien Wiebke abends mit verkehrtrum angezogenem Pullover. Der Vau-Ausschnitt saß hinten. Papa wies sie zurecht und bekam die Auskunft, daß das jetzt Mode sei.
»Was? Daß man sich die Klamotten falschrum anzieht?«
»Nur die Oberteile.«
Da stellte Papa sein Weinglas ab und schlug sich mit der Hand an die Stirn.
Ich konnt’s ihm nicht verdenken. Aber wo blieb der Spruch mit den blaugekloppten Fingernägeln?
»Wenn es in Mode kommt, daß man sich mit dem Hammer die Fingernägel blaukloppt, dann machst du das bestimmt auch noch mit«, sagte Papa, woraufhin Wiebke verdrossen zur Decke blickte. Und so hatte alles seine Ordnung: Vater pikiert über die modischen Verirrungen der Jugend und das pubertierende Töchterlein genervt von Vaters Spießertum.
Auf Mamas Schreibtisch lag der Durchschlag eines Briefs an die Kulturredaktion der Zeit.