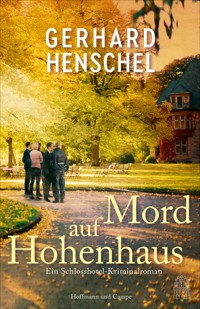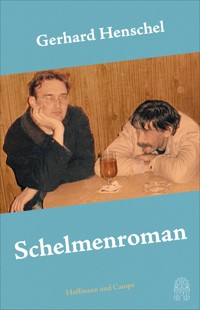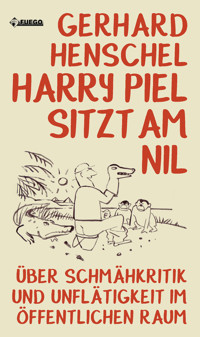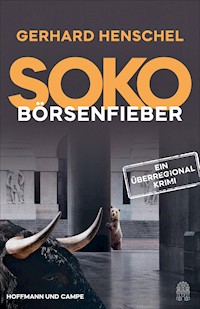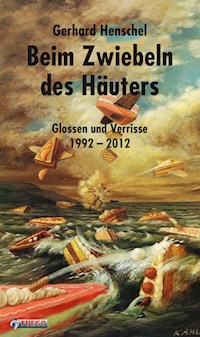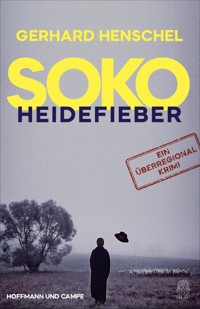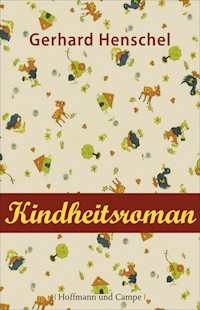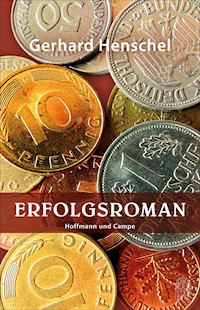14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Schlosser
- Sprache: Deutsch
Verrückt vor Liebe "Es fließt im Buch die Zeit von damals vorbei, als wäre sie nur einen Wimpernschlag entfernt. Großes Ding!" So urteilte das Bonner Stadtblatt Schnüss über den Jugendroman. Im Liebesroman wächst der Erzähler Martin Schlosser nun über sich hinaus und sorgt damit für einen Höhepunkt in der ihm gewidmeten Chronik. Der Liebesroman ist das dritte Buch über die Erlebnisse des jungen Martin Schlosser: Er beginnt am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien 1978 mit einem kühnen Plan zur Eroberung des Herzens einer heißgeliebten Mitschülerin und führt die Leser durch zwei Jahre voller Schikanen, Herzensnöte und wachsender Zweifel am Sinn des Lebens in der emsländischen Kleinstadt Meppen und an der Gerechtigkeit einer Oberstufe, in der man Mathe nicht abwählen kann. Martin Schlosser lässt die Leser an all seinen Abenteuern teilhaben, von der Reinigung der Hamsterkäfige über die schreckliche Goldene-Hochzeit-Feier der Großeltern und die noch viel böser endende Silberhochzeitsfeier der Eltern bis hin zu der berechtigten Vorfreude auf eine Zukunft, in der sich alles, alles ändern wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 860
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gerhard Henschel
Liebesroman
Hoffmann und Campe
Liebesroman
Über die Schlüsselblumenwiese kam Michaela Vogt auf mich zugelaufen, mit weit ausgebreiteten Armen, und sie strahlte vor Glück, so daß ich schon dachte: Das kann nur ein Traum sein.
Tja. Da wollte man nun ein neues Leben anfangen, gleich am ersten Schultag nach den Winterferien, aber dann hockte Wiebke morgens so lange auf dem oberen Klo, daß man sich fast in die Schlafanzughose strullte. Auf dem unteren thronte Papa, und das Badezimmer wurde von Volker blockiert. Der drückte sich da schon seit Stunden seine Eiterpickel aus und verbat sich jede Störung.
Wiebke wollte auch noch duschen, und weil sich die Dusche oben in demselben Raum wie das WC befand und Wiebke kein Erbarmen kannte, durfte ich natürlich nicht mal eben zwischendurch schiffen gehen, obwohl ich ihr meine akute Notlage eindringlich dargelegt hatte, mit Worten und auch mit Fußtritten gegen die Klotür.
»Schluß mit dem Spektakel!« rief Mama von unten hoch. »Ihr seid wohl verrückt geworden!«
Mit einem Herzen voller Liebe zu Michaela Vogt einzuschlummern, das war das eine, und das andere war das Erwachen mit einer vollen Blase, die man nicht entleeren konnte, weil die eigene kleine Schwester einen beim Spurt zur Toilette abgehängt hatte.
Wiebke, die alte Wutz. Und der hatte ich mal ein Eis ausgegeben!
Ich bollerte mit der Faust an die Tür. »Wenn du nicht bald aufmachst, piß ich dir in deinen Ranzen!«
Vor Michaela Vogt hätte ich keine Geheimnisse haben wollen, aber es war gut, daß sie mich in diesem Augenblick nicht live erlebte.
Als Wiebke das Schlachtfeld endlich geräumt hatte, riß ich erst einmal das Klofenster auf, denn die Luft war zum Schneiden. Die Ausdünstungen einer Sextanerin, gepaart mit ätzendem Wasserdampf: Darauf konnten sich jetzt die Meppener Meisen freuen, die noch nicht an den Autoabgasen von der Georg-Wesener-Straße krepiert waren.
Beim Duschen flog mir wieder wie von selbst der miese Duschvorhang ans Hinterteil, und als ich mir dann einmal probehalber Volkers Naßrasierer trocken übers Kinn zog, schlitzte ich’s mir auf, und so begann der große Tag, an dem ich Michaela meine Liebe gestehen wollte.
»Kommst du denn nun bald mal runter, du alte Schlafmütze?« rief Mama.
Ein Pflaster auf die Wunde kleben? Oder mit einer blutroten Klinke im Gesicht herumlaufen?
Am Frühstückstisch befühlte Mama meine Hände. »Zeig mal her! Das darf doch wohl nicht wahr sein, was du wieder für steinharte Papierflossen hast! Die mußt du dir mal eincremen! Und was hast du eigentlich mit deinem Kinn gemacht?«
Das sei eine »contradictio in adjecto«, sagte Papa. »Steinharte Papierflossen!«
Volker und Wiebke gackerten, und ich stärkte mich mit zwei dickbeschmierten Nutellabrötchen für den schwersten Gang meines Lebens.
In der Penne war von Michaela vor Beginn der ersten Stunde nichts zu sehen. Mir tropfte die Nase, als ich den Klassenraum betrat, und in dem Scheißneonröhrenlicht sah alles anders aus als nachts in meinen Träumen.
Kreidestücke flogen durch die Gegend, und dann wurde die Sitzordnung geändert, weil wir als Neuzugang in der Klasse eine Gestalt namens Dürrkopp erhalten hatten, einen muskulösen Typen mit Kartoffelnase und einem Kinn wie ’ne Schneeschaufel, und der pflanzte sich dann natürlich genau neben Ralle und mich.
Gegenüber, am anderen Ende der Bestuhlung, hatte mittlerweile auch Michaela Vogt ihren Platz eingenommen. Sie sah so melancholisch aus wie eh und je und würdigte weder mich noch sonst jemanden eines Blickes.
Ungefähr zehn Minuten vor Ende der ersten Stunde sagte der Dürrkopp, nachdem er sich die ganze Zeit über sehr ruhig verhalten hatte: »Heute ist Stichtag.« Und dann stach er Ralle mit der Zirkelspitze durchs Hemd in den Unterarm.
Meinen Vorsatz, bei der erstbesten Gelegenheit frontal auf Michaela zuzugehen und ihr mein Herz auszuschütten, ließ ich fallen. Wie hätte ich mich da denn ausdrücken sollen? »Hallo, Michaela! Darf ich dir mal was sagen? Ich bin total verliebt in dich. Willst du meine Freundin werden?«
Würg.
In der großen Pause schlenderte sie vor dem Mofaparkplatz auf und ab, ganz allein, die Schultern hochgezogen, einen bunten Schal um den Hals, und sie aß einen Apfel dabei.
Jetzt. Geh einfach hin, Martin Schlosser! Geh hin zu ihr, verwickle sie in ein Gespräch, und laß deinen Charme spielen! Das kann doch wohl nicht so schwer sein!
Und was soll ich ihr sagen?
Das fällt dir dann schon ein!
Von wegen. Ich würde mich sofort verhaspeln. Stottern würde ich, so wie der verknallte Obelix vor Falballa: »Wkrstksft!« Und weil ich diesen peinlichen Blackout nie wieder ungeschehen machen könnte, müßte ich mich anschließend im Dortmund-Ems-Kanal ersäufen.
Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase!
Vom Casanova zur Wasserleiche.
Es hatte alles keinen Sinn.
Weil ich den neuen Physiksaal nicht gleich gefunden hatte, mußte ich mich neben irgendeinen Eierkopf setzen, auf den letzten freien Platz, direkt vorm Pult. Michaela saß total weit hinten irgendwo.
Der Pöttering schleppte einen riesigen Projektor an und stellte den genau vor meiner Nase ab. An der Hinterseite hatte das Ding ein fettes Gebläse, aus dem ein warmer, staubiger, muffiger Luftstrahl kam. Den kriegte ich die ganze Stunde über mitten ins Gesicht.
Am Ende dieses Schultags eierte ich unbeweibt nachhause, so wie immer, und in der Diele empfing mich der übliche Mittagsgestank.
Grünkohl mit Pinkel.
Nach dem Scheißen, vor dem Essen: Händewaschen nicht vergessen.
Alles wäre anders gewesen, wenn Michaela sich dazu entschlossen hätte, in die Redaktion der Schülerzeitung einzutreten, so wie Hermann Gerdes und ich. Da hätte man sich näherkommen können als im Klassenzimmer, denn in dem SV-Raum (»SV« wie »Schülervertretung«) achtete niemand auf halbwüchsige Vertreter der Mittelstufe wie Hermann und mich. Wir hielten uns zurück. Bei der ersten Redaktionssitzung nach den Ferien verzog ich mich nach ganz hinten auf das zerschlissene Sofa, das da herumstand, und eine vollbusige Oberstufenschülerin, die im Schneidersitz neben mir Platz nahm, dachte sich offensichtlich nichts dabei, als ihr Knie in den engen Jeans meinen linken Oberschenkel berührte. Die sah mich jedenfalls nicht an, im Gegensatz zu Hermann, der sich zwischen zwei langhaarigen Typen auf der Fensterbank niedergelassen hatte. Er warf mir aufmunternde Blicke zu, kniepäugelnd, aber dann zog diese Tante da ihr Knie auf einmal weg von mir, sprang auf und fragte in die Runde: »Wo issen hier das Klo?«
Auf dem freien Platz neben mir ließ sich dann einer der beiden Chefredakteure nieder. Peter Nossig. Das war ein blonder, vollbärtiger Schlaks, der an jedem Finger zehn Weiber hatte. Der andere Chefredakteur, Gregor Hellermann, trug einen dunkelbraunen Backenbart zur Schau und wirkte viel ernster als sein Kompagnon.
Er habe hier was für uns, sagte Peter Nossig, »nämlich den ersten und bis heute einzigen Leserbrief, der uns zugedacht worden ist! Alle mal herhören! Ruhe! Oder ich lasse den Saal räumen!«
Der Brief war maschinegeschrieben. Als Absender firmierte ein Mensch aus Esterfeld. Peter Nossig räusperte sich.
Lieben Schöler!
»Was ist denn das für ’ne bekloppte Anrede?« fragte Hermann, aber Gregor Hellermann legte seinen einen Zeigefinger an die Lippen, und Peter Nossig las ungerührt weiter vor.
Als ich die Nr. 1 Eurer neuen Schülerzeitung in die Griffel bekam, ging ich schon bald hoch wie ’ne Silvesterrakete. »Nun also auch hier! Nun also auch hier dies penetrant linkslastige Gedöns, diese pseudo-intellektuellen Weiheformeln sozialistischen Gesundbetertums und seiner Organe (im doppelten Wortsinn!), diese Aufstöhner eines fehlgeleiteten Idealismus«, dachte ich und wollte zuerst einen geharnischten Sammelbrief an den OKD, die Schulaufsichtsbehörde, die Schulleitung, die SMV, den Schulelternrat etc. etc. schicken und dringend darum ersuchen, die geistigen Väter der Schöler Schlosser, Nossig, Gerdes etc. feststellen zu lassen.
»Hohoho«, rief ein Mädchen dazwischen, das schon in die elfte oder zwölfte Klasse ging.
Denn so viel linkslastiges Blech ist bei der sonst so klaren Emslandluft ja wohl kaum von selbst in sechzehn-, siebzehnjährigen Gehirnen gewachsen. Dann aber meinte ich, es sei fairer, zunächst »das Gespräch« mit den Verfassern der Stürmer-und-Dränger-Artikel und den Verfechtern marxophiler Theoreme »zu suchen« (warum sind Stockkonservativlinge wie ich eigentlich meist um Fairneß bemüht, statt ebenfalls linke Touren zu reiten?!?).
Danach hackte der Absender auf einzelnen Beiträgen herum, vor allem auf Hermanns Artikel über Günter Wallraff:
O weh, o ach, wer Gelehrtes – Herr Hermann Gerdes! Wer wie Sie Wallraffens »Werke« als »sehr zu empfehlen« erachtet, der ist an den falschen Deutsch- und Soziologielehrer geraten! Mei-o-mei-o-mei-o-mei! Der von Karolus Marxus gezeugte, im Jahre des Unheils 1942 geborene, von Iljitsch Lenin gesäugte, unter Pontius Conradus gelittene, unter Willyboldus Brandtus mißratene hehre Geist, diese einsame Größe rheinischer Zunge und Schreibe ist wirklich das Letzte, was man in diesem Leben noch lesen, verehren, erreichen kann. Phouogh!
(»Na, der hat’s nötig, sich über den Schreibstil anderer Leute aufzuregen«, warf Gregor Hellermann ein.)
Mein Himmel, Teutates, du fällst mir auf denselben! Karl Murx kann nur bei Halbgebildeten durchgehen – deshalb hat er in unserer Zeit so viele Jünger!
Zu denen gehörte offensichtlich auch ich:
Knabe Schlosser – auch wenn Du schon Referendar sein solltest –, nun hast Du Erich Frieds Schmarrn von »Gedicht« also auch den Meppenses zur Kenntnis gebracht. Der MfS-Abteilungsleiter, der solches zuwege bringt, ohne daß Schreiber und Leser merken, wie so etwas gemacht wird, verdient wirklich vaterländische Verdienstorden! »Fein«, schreibt die Grundschullehrerin an den Heftrand, nach solcher Leistung. Fin – fin – fin de siècle?!
Ob der sie noch alle hatte? »Der Typ war wahrscheinlich besoffen«, sagte Peter Nossig, »aber dafür hat er uns mit einer Geldspende entschädigt …« Zum Beweis hielt er einen Zwanzigmarkschein hoch.
Anlage: 20 Mark zur Finanzierung weiterer Druckerschwärze bei Abdruck des Leserbriefs bzw. bei Nichtabdruck zur Ermutigung zum Weitermachen – wenn’s geht mit mehr Spoerl und weniger Adorno.
Erst wollte er die Schulaufsichtsbehörde alarmieren, dann entlarvte er uns als DDR-Agenten, und zum Schluß ermutigte er uns zum Weitermachen. Schade, daß ich nicht einfach zu Michaela Vogt gehen konnte, um ihr diesen kuriosen Brief zu zeigen. Referendar Martin Schlosser!
Hermann borgte mir ein Taschenbuch über die Diktatur der Kartelle: Wie die multinationalen Konzerne die Weltmärkte unter sich aufteilten, Wechselkurse manipulierten, Minister bestachen, Gutachter erpreßten, Untersuchungsberichte stahlen, Regierungen stürzten, ganze Regionen destabilisierten und unabhängige Konkurrenten mit organisiertem Dumping, Sabotage, Rufmord und Terror in den Konkurs trieben, das konnte einem schon Sorgen bereiten. Die Machenschaften der Giganten: Kodak, Siemens, Mannesmann, AEG, BASF, IBM, ITT, Standard Oil, Coca-Cola, Westinghouse und General Electric. So nach fünfzig, sechzig Seiten hatte ich allerdings noch immer nicht begriffen, wie die Tricks mit künstlich aufgewerteten Währungen und umgetauschten Eurodollarkrediten im einzelnen funktionierten.
In dieses Buch habe sie selbst schon reingesehen, sagte Tante Dagmar abends am Telefon. »Und ich finde das auch gut. Aber das ist ja direkt kommunistisch!«
Weil der Spiegel das Manifest anonymer SED-Abweichler veröffentlicht hatte, mußte er sein Büro in Ostberlin dichtmachen. So hatte es das Außenministerium der DDR beschlossen, wegen »fortgesetzter böswilliger Verleumdungen der DDR und ihrer Bürger« durch die Spiegel-Redaktion.
In Hermanns Augen war das eine Bankrotterklärung. Diese Parteibonzen könnten nicht das kleinste bißchen Kritik vertragen. »Und wieso ist das ’ne böswillige Verleumdung, wenn man schreibt, daß es da Leute gibt, die anderer Meinung sind als die Obrigkeit? Das ist doch wohl das Selbstverständlichste von der Welt!« Bei uns im freien Westen würde ja sicherlich auch so manches im argen liegen, aber darüber dürfe man wenigstens sprechen, ohne eingebuchtet oder ausgebürgert zu werden. »Hier sind die Übelstände ja sogar Schulstoff! In Englisch nehmen wir durch, wie Martin Luther King ermordet worden ist, in Deutsch ist die Manipulation der Verbraucher durch Reklame dran, und in Sozialkunde steht die ungerechte Einkommens- und Vermögensverteilung auf dem Lehrplan …«
Daß man darüber reden durfte, änderte natürlich nichts an der schreienden Ungerechtigkeit der Besitzverhältnisse, aber in der DDR hätte ich trotzdem nicht wohnen wollen.
In der großen Pause quasselte der Albers auf Michaela Vogt ein, und sie ließ sich das gefallen. Kurz darauf galoppierte er in der Klasse auf allen vieren über die Tische und warf Ralle den nassen Tafelschwamm in die Fresse.
An Michaelas Stelle hätte ich den Albers danach mit dem Arsch nicht mehr angekuckt, aber der konnte sich anscheinend alles erlauben, ohne seinen guten Ruf als Klassenkasper zu verspielen.
Das hätte ich mal machen sollen, mit Schwämmen um mich schmeißen, aber dann wären die Weiber trotzdem nicht bei mir angekrochen gekommen, und wenn doch, dann hätte ich ihnen mitteilen müssen, daß es unter meiner Würde sei, Huldigungen von Persönchen entgegenzunehmen, die es witzig finden, wenn einer seine Mitschüler piesackt.
»Ich werd hier noch wahnsinnig«, sagte Ralle und trocknete sich das Gesicht am Pulloverärmel ab.
Im neuesten Asterix-Band kurbelten die Römer das Hinkelsteingeschäft künstlich an, um die Gallier zu korrumpieren, aber das ging schief, weil die Kosten Julius Cäsars Staatskasse ruinierten, und am Ende wurden doch wieder die Römer vermöbelt.
Dieses Heft las sich auch Papa durch. Der wollte schließlich auch mal was zu lachen haben und nicht immer nur die Spülmaschine reparieren und Steuererklärungen abgeben.
Der SPD-Fraktionschef Herbert Wehner hielt nicht viel von dem Manifest, das der Spiegel abgedruckt hatte. In einem Interview beschimpfte er die Verfasser: »Diejenigen, die diese Provokation gemixt haben, den Explosivstoff gemixt haben, können sich heute nicht nur die Hände, sondern auch noch ganz andere Körperteile reiben, weil es ihnen gelungen ist, die ganze Pseudo-Debatte hier zu beherrschen …«
Wenn das heißen sollte, daß hier irgendwelche dunklen Mächte die Finger im Spiel hatten, wußte Wehner mehr als ich.
»Dir würde sofort der Kopf platzen, wenn du alles wüßtest, was Herbert Wehner weiß«, sagte Hermann.
Im Stern stand eine Reportage über einen indischen Guru, dessen Jünger sich sexuell austoben und nackt miteinander raufen sollten, um sich von ihren Verkrampfungen zu befreien. »Wenn du dein Sexproblem gelöst hast, hast du alle deine Probleme gelöst«, hatte dieser Guru verkündet.
Ich wäre schon happy gewesen, wenn mir Michaela einmal zugezwinkert hätte.
Michelle, ma belle …
Was war das Leben ohne Michaela? Kalter Bohnensalat mit Zwiebeln und Essigtunke. Ein verlorenes Auswärtsspiel.
Beim TSV1860 hätte Gladbach gut und gern zwei Punkte holen können, wenn die Abwehr vier Minuten vor dem Schlußpfiff nicht gepennt und den Ausgleichstreffer zum 1:1 kassiert hätte.
Dafür hatte Deutschland Glück bei der Auslosung der WM-Gruppengegner: Polen, Tunesien und Mexiko. Das mußte zu schaffen sein. Auch ohne Franz Beckenbauer.
Bis nach Mitternacht aufbleiben, nur um sich einen Science-fiction-Film mit Überlänge anzutun, der dann ungefähr so spannend war wie ’ne Doppelstunde Chemie: Mit solchen Aktionen verbrachte man nun seine Freizeit, während andere Leute sich in Liebesabenteuer stürzten.
Onkel Dietrich rief an und wollte wissen, wann denn mal endlich die versprochenen Abzüge der Fotos von Papas Fünfzigstem in Umlauf kämen. »Mittlerweile sind zwei Monate ins Land gegangen, ohne daß sich in dieser Affäre irgendwas getan hat! Dreht ihr da den ganzen Tag Däumchen in Meppen? Oder muß mal wieder die gesamte Bude renoviert werden?«
Meistens ging ich jetzt mit Hermann in der großen Pause in die Stadt, obwohl’s verboten war. Das machten alle so. Gewohnheitsrecht. Erdnüsse kaufen bei Aldi, Platten bekucken bei Ceka oder Bücher bei Meyer, dagegen konnte ja wohl niemand was haben, und normalerweise handelte man sich keinen Ärger damit ein, aber eines Tages eben doch: Als die Pause zuendeging, schob der Wolfert am Haupteingangstor Wache und kontrollierte jeden Schüler, der aus der Stadt kam, und weiter hinten, in der Einfahrt für die Autos, hatten sich zwei andere Pauker postiert. Weil auch das Schlupfloch im Jesuitengang der Überwachung unterlag, wetzten Hermann und ich über den Domhof in Richtung Ludmillenstift und pirschten uns dann von hinten an die Schule heran. Das versuchten außer uns auch Niebold, Dralle, Bohnekamp und noch ein paar andere Nestflüchter, und kurz vor der Aula gingen wir allesamt der Wuttke in die Falle und wurden aufgeschrieben, Mann für Mann.
»Die reinste Rasterfahndung«, sagte Hermann, als die Wuttke hinterher außer Hörweite war.
Und natürlich würde diese Sache noch ein Nachspiel haben.
In Italien war der Christdemokrat Giulio Andreotti mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Die wievielte Regierung hatten die jetzt eigentlich seit 1945? Bei denen ging’s ununterbrochen drunter und drüber. Inflation, Regierungskrisen, Erdbeben und Mafiamorde. Im Vergleich mit den Itakern schnitten wir Deutsche gut ab, wenn man mal absah von Juventus Turin.
Als in Emden der letzte VW-Käfer vom Fließband gerollt war, sagte Mama, daß sie’s nicht begreife. Für Otto Normalverbraucher sei das doch immer ein praktisches Auto gewesen: »Versteh ich nicht, weshalb sie dieses Modell jetzt einmotten wollen. Den Leutchen geht’s wohl zu gut!« Anders könne sie sich das nicht erklären.
In einem Schwarzweißfilm stellte Frank Sinatra einen heroinsüchtigen Pokerspieler dar, dessen blöde Geliebte um keinen Preis verlassen werden wollte und deshalb so tat, als ob sie gelähmt im Rollstuhl hocken müsse, und das alles in einem elenden Milieu aus Zockern, Säufern, Animiermädchen und zynischen Drogendealern. Chicago 1956.
Dagegen ging’s in Meppen 1978 ja noch relativ zivil zu.
Man sah auch, in was für ein tobendes und röchelndes Warzenschwein der Entzug einen Süchtigen verwandelte. Heroin wollte ich niemals ausprobieren, schon wegen der pieksenden Spritzen nicht. Oder frühestens an meinem achtzigsten Geburtstag, wenn sowieso alles egal wäre.
Es wurde dann eine Klassenwanderung nach Schwefingen anberaumt, und ich hoffte, Michaela Vogt dabei näherkommen zu können als bei der Klassenfahrt nach Hermeskeil, aber es ergab sich nur ein ödes Gelatsche in Gruppen am Straßenrand. Michaela eilte mir weit voraus, und als wir wieder in Meppen anlangten, schmiß mir der Dürrkopp von hinten einen Schneeball an den Kopf, und zwar mit solcher Wucht, daß mir die Mütze runterflog, und darüber hörte ich welche von den Weibern lachen.
Sehr, sehr lustig. Hahaha.
Den Dürrkopp hätten mal Gehirnchirurgen untersuchen müssen.
Nach dem 2:0-Sieg über Frankfurt stand Gladbach wieder auf dem zweiten Platz, vier Punkte hinter Köln. Das wäre ja ein Witz, wenn Weisweilers alte Mannschaft dem Meistermacher jetzt auf den letzten Drücker doch noch in die Quere käme …
In dem sowjetischen Revolutionsfilm »Panzerkreuzer Potemkin« konnte man sehen, wie die zaristischen Offiziere den Matrosen madenverseuchte Nahrung zu fressen gaben. Wenn das der Wahrheit entsprach, wäre ich da auch Bolschewist geworden!
Abends lief im Ersten dann noch ein Film von Ingmar Bergman, mit Liv Ullmann als Psychiaterin, die von einer Nervenkrise in die andere taumelte, an Depressionen litt und mit Selbstmordgedanken spielte, und mittendrin schlief Papa wieder einmal ein und schnarchte, und Mama flippte plötzlich aus, weil er beim Einschlafen mit seiner Zigarettenglut den Sofastoff in seinem Nacken angekokelt hatte.
»Herregott«, maulte Papa, als Mama ihm die Zigarette aus den Fingern riß und mich losjagte, einen nassen Lappen holen. »Was soll denn diese dämliche Anstellerei?«
Das Polster mit dem Brandloch wurde von Mama danach auf einen der seltener benutzten Sitzplätze im Wohnzimmer verbannt.
Der Spiegel erschien mit einer Titelgeschichte über eine neue, aus England stammende Jugendmode namens Punk. Wenn man dazugehören wollte, mußte man sich Sicherheitsnadeln durch die Backe stechen, Hundehalsbänder tragen und mit Hakenkreuzen geschmückte Klamotten anziehen. Danke bestens!
In derselben Nummer stand auch ein Artikel über einen skandalösen japanischen Spielfilm mit einer mannstollen Geisha, die ihren Liebhaber erwürgt und ihm dann den Schwanz abschneidet, und in den Personalien ging’s um eine Pannenserie am Bundeskabinettstisch: Der Justizminister Hans-Jochen Vogel hatte versehentlich die Kaffeetasse des Landwirtschaftsministers Josef Ertl umgestoßen und sich mit den Worten zu entschuldigen versucht: »Ach du lieber Gott, schon wieder! Das wird ja langsam zur Routine!« In der Kabinettssitzung davor hatte Vogel nämlich schon zwei Kaffeekannen umgeworfen, und er war von Helmut Schmidt verwarnt worden: »Das ist ein Justizskandal!«
Mama wedelte mittags mit einem Brief vom Kreisgymnasium, unterschrieben von Direktor Berthold. Unerlaubte Entfernung vom Schulgelände, Verstoß gegen die Hausordnung, im Wiederholungsfall schwerer wiegende disziplinarische Maßnahmen: »Wenn dir da irgendwas passiert, zahlt die Versicherung keinen Pfennig!«
Anders als solche Mahnschreiben wurden die Zeugnisse jetzt maschinell erstellt, von einem Computer des Kommunalen Datenverarbeitungszentrums Osnabrück. Dieses Verfahren, so stand es da, diene der Entlastung des Sekretariats, und seit neuestem hätten Lehrer auch die Möglichkeit, den Noten Bemerkungen hinzuzufügen.
Von dieser Möglichkeit hatte der Wolfert in meinem Fall Gebrauch gemacht und meine Zwei in Deutsch mit der maschinell erstellten Bemerkung versehen:
DIEMÜNDLICHENLEISTUNGENSINDSCHWÄCHERALSESINDERNOTEZUMAUSDRUCKKOMMT.
Du Arsch, dachte ich, aber ich fand es auch ganz passend, daß dieses Gemecker über meine mündlichen Leistungen in Deutsch einen Kommafehler enthielt.
Zweien hatte ich auch in Reli, Sozi und Englisch und im übrigen leider nur Vieren in Mathe, Bio, Kunst und Franz. Volker schnitt bedauerlicherweise etwas besser ab, und Wiebke hatte eine Vier in Mathe, aber in allen anderen Fächern nur Zweien und Dreien, zum Beispiel in »Welt- und Umweltkunde«. Was war denn das wieder für ’n neumodisches Quatschfach? Sonstige Bemerkungen:
Sie hat an folgenden Arbeitsgemeinschaften teilgenommen: Volkstänze.
Kneifzangen wie Wiebke ausgestorbene Volkstänze beibringen zu müssen, das war ja wohl das letzte vom Hinterletzten.
Dann kam gleich der nächste irre Schrieb von Wiebkes Schule:
Die Trendkonferenz der Klasse 6 kam zu dem Ergebnis, daß sich Ihre Tochter Wiebke nach den bisher gezeigten Leistungen und unseren Beobachtungen für folgende weiterführende Schulart eignet: Realschule, jedoch in einigen Fächern gymnasialfähig.
»Trendkonferenz« – so ein Wort hätte ich als Erwachsener nicht in den Mund nehmen wollen. (»Gehen wir heute abend ins Kino, Schnuckelchen?« – »Nee, tut mir leid, muß zur Trendkonferenz.«)
Dieser Ihnen mitgeteilte Trend ist ein vorläufiger Bescheid und hat keine Verbindlichkeit in Bezug auf das zum Ende des Schuljahres zu erstellende Gutachten zur Schullaufbahnempfehlung …
»Noch gestelzter hätten die sich wohl nicht ausdrücken können«, sagte Mama.
Der Kampf um die Meisterschale war noch lange nicht entschieden. Auf dem Betzenberg unterlag Kaiserslautern Gladbach mit 0:3, und das freute mich, aber nicht so doll, wie es mich in der vorigen oder in der vorvorigen Saison gefreut hätte, sondern nur noch so ein bißchen, aus Gewohnheit.
In Berlin fand ein »Tunix-Kongreß« statt. Darüber kam was im Fernsehen. Saublöder ging’s ja wohl nicht mehr. Sich treffen, um nix zu tun? Mit diesem schwachsinnigen Vorsatz hätten sich die Kongreßteilnehmer auch am Unterricht im Kreisgymnasium beteiligen können, um sich über die Geschwindigkeit der Wanderung von Ionen in Elektrolyten belehren zu lassen.
So ab und zu erfuhr man in der Schule dann aber doch mal was Interessantes: Der Hungergürtel der Erde reichte von Mittelamerika über Afrika bis nach Indien und China, und jedes Jahr starben zehn bis fünfzehn Millionen Menschen an Unterernährung. 1973 hatten die Mitteleuropäer pro Tag und Kopf durchschnittlich mehr als 12000 Joule verbraucht und die Inder weniger als 8500 (Joule war eine Einheit der Energie, benannt nach ihrem Entdecker, dem englischen Physiker James Joule). Und in Ostasien erblindeten jährlich ungefähr einhunderttausend Kinder mangels Vitamin A, während unsereiner alles in sich reinfressen konnte, was man zum Leben brauchte.
Zum Klavierspielen hatte ich absolut keine Lust mehr. Am schönsten war jedesmal der Moment, wenn mich der Radowski in der Musikschule vom Klavierschemel vertrieb, um mir zu zeigen, wie man den alten Kackmist von Bach und Bartók und Czerny richtig spielte. Dann hatte ich das Schlimmste überstanden, für eine Woche.
Das Sonderbare an Cary Grant war, daß er selbst einen zynischen, gewissenlosen, abgefeimten, selbstgefälligen und kaltschnäuzigen Zeitungsfritzen so spielen konnte, daß man ihn leiden mochte. Das Talent, einen ausgewachsenen Mistkerl sympathisch darzustellen, besaß auch Walter Matthau. Der spielte allerdings immer nur Grobiane.
In Nicaragua tobte ein Bürgerkrieg, und man mußte auch in Meppen mal was machen, fand ich, wenn man sich von der breiten Masse abheben wollte, die sich alles gefallen ließ.
In der Innenstadt gab’s ein Spielzeuggeschäft, Wöbker, wo Flugzeugmodelle mit Hakenkreuz-Aufklebern verscherbelt wurden. Ich erzählte Hermann davon, und er sagte, der Handel mit verfassungsfeindlichen Symbolen sei gesetzlich verboten. In der nächsten großen Pause latschten wir also in den Laden hinein und breiteten da einen Bausatz der Firma Revell auf dem Tresen aus. Modell Focke Wulf 190 D.
»Sie bieten hier Flugzeugmodelle mit verfassungsfeindlichen Symbolen zum Kauf an«, sagte Hermann zu dem bulligen Typen, der zu unserer Bedienung herbeigeeilt war, und der hatte sofort die Schnauze voll von uns. Da gehe es um die Nachbildungen der Originale und sonst um gar nichts, belferte er und schrappte die Aufkleberstreifen mit den Hakenkreuzen zusammen. Und dann brüllte er uns an: »Raus hier! Raus, raus, raus, aber sofort!«
Ob das der Wöbker persönlich gewesen war? Oder nur einer von dessen Kettenhunden?
Einer meiner Lieblingsregisseure, Roman Polanski, mußte aus den USA nach Europa fliehen, weil er angeblich mit einer amerikanischen Dreizehnjährigen geschlafen hatte. Und ich war schon fast sechzehn und hatte noch immer keine Freundin.
In der Bundesliga ging es rund: Schalke schlug Köln mit 2:0 und Gladbach Stuttgart mit 3:1, so daß Kölns Vorsprung auf zwei Pünktchen zusammenschmolz. Wenn der Trainer Hennes Weisweiler gedacht haben sollte, seine Schäfchen seien im Trockenen, dann hatte er sich zu früh gefreut.
Mit Marilyn Monroe kam ich nicht klar. Was sollte denn an diesem affektierten Weibsstück so toll sein? Etwa die Oberweite?
Papa kam dafür nicht klar mit Didi Hallervorden. Der purzelte in seiner Sendung in Mülltonnen rein und schnitt blöde Grimassen. »Dem fällt auch nichts mehr ein«, sagte Papa.
So halbwegs gut war dann ein schwarzweißer Vampirfilm, obwohl man nicht genau zu sehen kriegte, wie Dracula in seinem Sarg gepfählt wurde.
Mehr als alles andere törnte mich der neue Hit von Paul McCartney ab: »Mull of Kintyre«. Was für ein Scheiß! Da war ja »Ob-la-di, ob-la-da« glatt noch besser! Traurig, traurig. Und diesen Dudelsackmist mußte sich jetzt auch John Lennon anhören! Unter diesen Umständen konnte niemals was aus dem Traum einer Wiedervereinigung der Beatles werden.
Mama regte sich über einen Artikel im Stern auf. Da wurde die geschaßte Entwicklungshilfeministerin Marie Schlei als »Problem-Mädchen« und als »Mariechen« veräppelt, das »von einem Fettnäpfchen ins andere« tanze, und Mama verfaßte einen wütenden Leserbrief. Im Stern, schrieb sie, werde sonst doch auch kein Hans zum »Hänschen« degradiert!
»Diesen Brief drucken die ab«, sagte Mama, als sie die angeleckte Marke auf den Umschlag pappte. »Wollen wir wetten?«
Der alte Nazi Herbert Kappler war gestorben, in Soltau, als freier Mann, ohne vorher die gerechte Strafe für seine Kriegsverbrechen abzubüßen. Diese ganzen alten Nazischeißer, weshalb liefen denn überhaupt noch welche von denen frei herum?
Im oberen Flur stellte ich Wiebke ein Beinchen, weil sie mir die Zunge rausgestreckt hatte, und von unten brüllte Mama rauf: »Müßt ihr euch partout schon wieder in die Wolle kriegen?«
Wiebke flennte sowieso schon und dann noch viel doller, als sie ohne mein Zutun über einen von Papas Hausschuhen gestolpert war und sich die Birne am Flurschrank gestoßen hatte.
Mama kam die Treppe hochgewalzt und schrie: »Schluß jetzt! Das reicht mir für heute!« Und dann kriegte ich was vor den Latz, obwohl ich gar kein Widerwort gegeben hatte.
Kleine Schwestern hätte man zerschroten müssen. Rickeracke!
Von dem Spielfilm »Krieg der Sterne« hatte ich schon nach einer halben Minute Vorschau im Fernsehen genug. Roboter und Affen und Laserschwertkämpfer im Weltall? Dafür hätte ich keine müde Mark geopfert.
Im Garten hatten Wildkaninchen alles kahlgefressen. Von Papas einhundert Porreepflanzen waren bloß noch Stummel übrig, und man konnte ihm anmerken, daß er darunter litt, als er abends im Wohnzimmer seine Stullen zermalmte.
Volkers Jeans waren draußen über Nacht zum Trocknen aufgehängt gewesen und morgens so stocksteif, daß man sie an die Wand lehnen konnte. Mama machte ein Foto davon.
Als Gast beim Tabellenletzten, dem FC St. Pauli, sicherte sich Gladbach durch ein einziges Tor mit Müh und Not zwei Punkte, während Köln den HSV mit 6:1 überrollte. Um Meister zu werden, mußte Gladbach am Ende auf alle Fälle mehr Punkte haben als Köln, weil Kölns Torverhältnis einfach zu gut war.
In die Badewanne legte man sich besser erst, wenn man sein Fahrrad in den Keller bugsiert hatte, denn sonst mußte man unweigerlich nochmal raus in die Kälte, mit nassen Haaren und im Schlafanzug.
»Du holst dir noch den Tod!« rief Mama mir einmal hinterher. »Zieh dir doch wenigstens ’n Bademantel an!«
Mein Bademantel hatte aber keine heile Gürtelschlaufe mehr, und der Gürtel selbst war verschollen.
»… Jahr 2022 … die überleben wollen …« So nannte sich ein öder Film über frustrierte Zukunftsmenschen auf Futtersuche. Über uns hätte mal einer einen Film drehen sollen: Jahr 1978 … die sich nicht langweilen wollen …
Erstes Faradaysches Gesetz. Was hätte der Pöttering einem in Physik eigentlich beibringen können, wenn Archimedes, Galilei, Newton, Faraday und Edison und wie sie alle hießen schon als Kinder abgenippelt wären? Von selbst hätte der Heini doch im Leben nicht herausgefunden, wie viele Chloratome in einer Kupferchloridlösung auf ein Kupferatom kamen. Oder daß die in Elektrolysierzellen abgeschiedenen Gasmengen den hindurchgeflossenen Ladungsmengen proportional waren. Der konnte bloß nachkauen, was andere ihm vorgekaut hatten. Oder gab’s vielleicht ein Pötteringsches Gesetz? Oder eine nach dem Pöttering benannte physikalische Einheit? Na also. Andernfalls wäre der längst mit dem Nobelpreis in der Tasche sonstwohin verduftet.
In den Briefen, die Heinrich von Kleist seiner Geliebten Wilhelmine von Zenge geschrieben hatte, forderte er von ihr die Ausführung von »Denkübungen«: »Was ist besser, gut sein oder gut handeln?«
Mit solchen Methoden wollte er auch sich selbst immer weiter vervollkommnen, um den gesammelten Schatz von Wahrheiten später ins Jenseits mitnehmen zu können. Verzweifelt war Kleist, als er Immanuel Kants »Kritik der reinen Vernunft« gelesen und daraus gelernt hatte, daß man die Wahrheit gar nicht erkennen könne:
Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün – und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr – und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich –
Ach, Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens Dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen andern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und nun habe ich keines mehr –
Seine klassischen Werke hatte Kleist dann aber trotzdem alle noch geschrieben. Ein komischer Vogel.
Meine Nase lief, ich hatte Kopfweh, mir war übel, und weil ich kein Taschentuch mitgenommen hatte, mußte ich den Gubbel regelmäßig hochziehen, damit er mir nicht aufs Französischbuch tropfte.
Zu Michaela Vogt traute ich mich gar nicht mehr hinzusehen.
Um mich aufzuheitern, sagte Hermann in der großen Pause: »Dir ist jetzt schon schlecht, aber stell dir mal vor, wie schlecht dir erst in der sechsten Stunde sein wird …«
Äußerst witzig, das. Ich wartete nach der Pause noch, bis der Wolfert erschien, und dann meldete ich mich vom Unterricht ab.
»Du triefst ja aus allen Knopflöchern«, sagte Mama, als ich zuhause angeeiert kam. »Wenn du die russische Grippe hast, die hier überall umgeht, dann Prost Mahlzeit.«
Fiebermessen, Nasivin, eine Brausetablette mit Vitamin C und danach ab in die Falle.
Der Arzt, der mich am Nachmittag in meinem Zimmer untersuchte, stellte einen grippalen Infekt fest und verordnete mir Novalgin-Zäpfchen und Hustensaft. Codipront: Davon sollte ich morgens und abends einen Eßlöffel voll einnehmen.
Der Flaschendeckel hatte eine Kindersicherung und mußte gleichzeitig gedreht und an zwei Stellen zusammengepreßt werden, sonst ging er nicht auf. Da brach man sich bald die Finger bei ab.
Auf Dauer war es kein Vergnügen, sich mit Schnupfen und erhöhter Temperatur im Bett herumzuwälzen, und abends tapste ich nach unten, Nachrichten kucken.
Wiebke wich im Wohnzimmer vor mir zurück. »Steck mich bloß nicht an!«
Ich überhörte das und ließ mich abseits von den übrigen Familienmitgliedern nieder.
Hans Apel von der SPD sollte das Amt des Verteidigungsministers übernehmen. In einem Interview, das er aus diesem Anlaß gab, saß er ohne Schuhe im Schneidersitz auf einem Sofa.
»Immer noch besser, als wenn er da jetzt im Stechschritt auf und ab marschieren würde«, sagte Mama, während Papa sich kommentarlos sein leberwurstbestrichenes Schwarzbrot hinter die Kiemen schob.
Weshalb Papa Schwarzbrot so schmackhaft fand, hatte ich auch noch nicht begriffen. Mir blieben davon immer lauter Krümel zwischen den Zähnen kleben.
Als alle ratzten, schlich ich mich noch einmal hinunter, um mir den Rest eines Spielfilms über zwei kalifornische Zocker anzusehen. Der eine der beiden demonstrierte zum Schluß, daß er mit seinem Pimmel eine Flöte festhalten konnte, und als ich das gesehen hatte, schlich ich mich wieder hinauf in mein Zimmer und schlief ein.
Nach fünfzehn Runden hatte Muhammad Ali seinen Titel als Weltmeister im Schwergewichtsboxen verloren, im Kampf gegen Leon Spinks. Es hätte mir ja egal sein können, aber ich ärgerte mich darüber. Was sollte man denn anfangen mit einer Welt, in der selbst ein Muhammad Ali den kürzeren zog?
Aus der Stadt brachte Mama mir auf meinen Wunsch und auf meine Kosten ein Taschenbuch mit: »Kritik der reinen Vernunft« von Immanuel Kant. Die Vorreden und die Einleitung übersprang ich, weil ich nicht dahinterstieg, und ich fing gleich mit dem eigentlichen Buch an, aber das war mir dann endgültig zu hoch. Die Sätze, die da standen, konnte ich zehnmal nacheinander lesen, ohne zu kapieren, was Kant damit gemeint hatte. Weil man ja nicht gleich aufgeben soll, las ich trotzdem weiter. Manches würde sich dann vielleicht irgendwie von selbst erklären, dachte ich, aber da hatte ich mich getäuscht. Genausogut hätte ich mir das Kursbuch von Peking vornehmen können. Nach hundert Seiten oder so kam
eine Anmerkung, die ihren Einfluß auf alle nachfolgende Betrachtungen erstreckt, und die man wohl vor Augen haben muß, nämlich: daß nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder möglich sein, transzendental (d.i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben a priori) heißen müsse.
Aha. Wenn man das bei allen nachfolgenden Betrachtungen beachten mußte, um sie zu begreifen, konnte ich mir die Lektüre sparen, weil ich schon diese Anmerkung nicht verstanden hatte, ebensowenig wie die hundert Seiten davor.
Scheißdreck.
Ich schleuderte das Buch an die Wand.
Tja, Herr Schlosser, dazu reicht Ihr Grips offensichtlich nicht aus. Kleist hat das alles verstanden, im Unterschied zu Ihnen. Kleist hat sich davon sogar in seine berühmte Kant-Krise stürzen lassen, während Sie hier in Ihrer Furzkoje liegen und sich ärgern, daß Sie das sinnlos für die »Kritik der reinen Vernunft« verpulverte Geld nicht in zwei oder drei halbe Liter Bier in der Stadtschänke investiert haben …
Ach was, auf Bier war ich nicht wild in meiner persönlichen Kant-Krise, mit der ich nicht in die Geschichtsbücher eingehen würde. Mir lief immer noch die Nase, und ich mußte lange auf Mama einreden, bis sie mir erlaubte, am Nachmittag vorm Fernseher eine Bundestagsdebatte über die geplanten Anti-Terror-Gesetze zu verfolgen, im Liegen, mit einem Federkissen im Nacken und einer Wärmflasche auf dem Bauch.
Als Herbert Wehner sprach, ließ Philipp Jenninger von der CDU wütende Zwischenrufe los, und Wehner blaffte zurück: »Mann, hampeln Sie doch nicht so herum! Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer!«
Der langweiligste Redner war der Freidemokrat Hans-Günther Hoppe. Wenn der den Mund aufmachte, schliefen einem die Füße ein.
In Bonn wurde das Kabinett umgebildet: Auf Ravens, Rohde und Schlei folgten Haack (Wohnungsbau), Schmude (Bildung) und Offergeld (Entwicklungshilfe), auf Leber folgte Apel (bisher Finanzen), auf Apel folgte Matthöfer (bisher Forschung), und auf Matthöfer folgte Hauff. Mein dicker Vetter Gustav, der das Handbuch des Deutschen Bundestags auswendig kannte, hatte dieses Revirement wahrscheinlich mit größter Aufmerksamkeit registriert und sich alle neuen Namen eingeprägt.
In der blöden Bettdecke rutschten die Federn nachts immer alle ans Fußende, so daß ich unten einen dicken Wumpelhaufen hatte und oben nur so ’n dünnen Lappen.
Wenn man den Spiegel abonnierte, kriegte man ein Reprint der allerersten Ausgabe von 1947 geschenkt, aber Mama wollte kein Abonnement. Sie schrieb lieber einen Bettelbrief: Wären Sie vielleicht so freundlich, meinem Sohn, der Ihr Magazin sehr gern liest, das Reprint zu schenken? In diesem Stil. Und siehe da, eines Tages, als ich noch grippal infiziert im Bett lag, präsentierte Mama mir dieses Heft: »Na, was hab ich gesagt?«
Es war dann leider nicht besonders interessant. Die meisten Prominenten von damals kannte man gar nicht mehr, und die politischen Probleme der frühen Nachkriegszeit, naja. Landesregierungsbildung in Bayern, Wandel in der dänischen Haltung zur »Südschleswig-Frage«, eine Geliebte des Duce vor Gericht und Unruhen in Indochina. Da hatte sich wohl irgendwie schon der Vietnamkrieg angebahnt.
Weiter hinten gab’s Reklame für Gesichtspuder, Reinigungscreme und Wimperntusche, mit einem Hinweis auf den Schatten unserer schicksalsschweren Zeit: Gerade darum sei es wichtig, durch eine sorgfältig abgestimmte Körperpflege das Lebensgefühl zu steigern.
Da griff ich doch lieber wieder zu meinen Büchern.
1811 hatte Kleist Selbstmord begangen, irgendwo am Kleinen Wannsee in Berlin, zusammen mit irgendeiner Frau, und zwar »zufrieden und heiter«, wie es in dem Abschiedsbrief an seine Schwester hieß – »die Wahrheit ist, daß mir auf Erden nicht zu helfen war. Und nun lebe wohl; möge Dir der Himmel einen Tod schenken nur halb an Freude und unaussprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herrlichste und innigste Wunsch, den ich für Dich aufzubringen weiß.« Was die wohl gedacht hatte, die Schwester, mit so einem Brief in den Händen. Der Bruder will sich das Leben nehmen und wünscht ihr vorher noch einen schönen Tod …
Und wie hatte Kleist das gemacht – erst die Frau und dann sich selbst erschossen? Dann hätte er sein Leben als Mörder und als Selbstmörder beendet. Auch nicht schön. Und was sollte das alles bloß?
In Rückspiel gegen Fortuna Düsseldorf lag Gladbach zur Halbzeitpause mit 0:1 hinten und kurz danach sogar mit 0:2, und dabei blieb’s, während die Zeit verging und man sich fragte, ob das jetzt eigentlich noch echter Nervenkitzel war oder ob Gladbach sowieso keine Chance mehr hatte, Meister zu werden.
In der 74. Minute gelang Kulik der Anschlußtreffer, und fünf Minuten später erzielte Bonhof den Ausgleich. Das Blatt schien sich noch einmal wenden zu wollen, und tatsächlich ging Gladbach in der 83. Minute durch ein Tor von Heynckes in Führung. Und abermals erhob sich Gladbach am Ende eines längst verloren geglaubten Spiels wie Phönix aus der Asche!
In Dortmund hatte Köln zwar zwei Punkte geholt, aber Gladbach blieb dran. In einer Woche würde das Gipfeltreffen der beiden Spitzenmannschaften steigen. Und dann wollten wir doch mal sehen, wer den längeren Atem hatte.
Hunde, wollt ihr ewig leben?
In Franz ließ ein Referendar Fotos von französischen Kulturstätten herumgehen. Schlösser, Denkmäler und Parkanlagen.
Mich kotzte das alles an. »Was issen das für ’n Ghetto?« sagte ich, als mir eine dieser Aufnahmen vor die Augen kam, und der Bohnekamp grinste.
Was ging es mich denn an, wie die Franzosen ihre Gärten pflegten?
Und dann noch Klavier üben. Eigentlich fühlte ich mich noch nicht wieder so ganz auf der Höhe, und Mama meinte, wenn ich den Musikschulunterricht sowieso nur widerwillig besuchte, dann könne sie mich auch abmelden. Das gehe aber nicht von heut’ auf morgen. »Bis Ende März müssen wir noch bezahlen, und so lange marschierst du da gefälligst hin!«
»Dann sind doch aber schon Osterferien.«
»Dann eben bis zu den Osterferien!«
Dem Radowski verriet ich nichts davon. Der würde es schon merken, wenn ich nach den Ferien nicht mehr wiederkäme. Dieser alte Eumel mit seinen öden Etüden. Der hätte mir beibringen können, wie man Partygäste als Pianist bezirzt, und gelernt hatte ich bei dem nur lauter ollen Quörks.
Kurz vor knapp erzielte Rainer Bonhof in einem Länderspiel gegen England den Siegtreffer per Freistoß, aber das Spiel hatte es nicht gebracht. Wegen mir hätten auch die Engländer gewinnen können. Das wäre mir total egal gewesen, obwohl ich mir früher den Arsch abgefreut hätte. Zwischen mir und der deutschen Nationalmannschaft war irgendwie die Luft raus, seit Gerd Müller und Franz Beckenbauer da nicht mehr mitspielten.
Wenn Uwe Seeler oder Günter Netzer noch einmal aufgelaufen wären, ja dann!
»Dazu haben wir’s nun immerhin gebracht«, sagte Mama beim Frühstück, und sie zeigte uns ein Foto von Papa in der Meppener Tagespost, auf dem er zwischen irgendwelchen Staatssekretären herumstand, die die Meppener Erprobungsstelle besucht hatten.
Die knappe Führung durch ein Tor von Allan Simonsen rettete Gladbach im Müngersdorfer Stadion bis in die Halbzeit. Danach liefen die Kölner Sturm, aber Wolfgang Kleff machte das Spiel seines Lebens und hielt einfach alles. Darauf waren sie nicht gefaßt, die feisten Geißböcke, daß ihnen Gladbach im Duell der Giganten die Schau stehlen könnte. Hähä!
Die beiden Auswärtspunkte hätte Gladbach im Titelrennen gut gebrauchen können, aber vier Minuten vor Schluß schoß Heinz Flohe das 1:1. Das war doch zum Überschnappen! So ein elendes Pech!
Am Sonntagmittag gab’s Cevapcici. Das waren heiße Hackfleischröllchen, und die spuckte Papa wieder aus, und er ging die Küche, um sich ein Brot zu schmieren.
»Was der Bauer nicht kennt, das frißt er nicht«, sagte Mama.
Im Ersten lief die erste Folge einer Serie über einen afrikanischen Negerjungen, Kunta Kinte, der von Sklavenhändlern nach Amerika verschleppt wurde, und am Montagabend kam spätnachts ein Krimi mit Humphrey Bogart, und mitten zwischen diesen beiden Fernsehterminen mußte ich ein letztes Mal der Visage des Radowksi standhalten. Dem war es nicht verborgen geblieben, daß Mama mich von der Musikschule abgemeldet hatte. Er sah mich doof an, so von oben herab irgendwie, und ich dachte nur: Du Arsch, jetzt kannst du dich alleine mit dem Schrott vergnügen, den du mir so gern noch aufgebrummt hättest.
Aus der Scheißmusikschule wäre ich danach am liebsten hinausgetanzt, und zuhause schmierte ich mir ein fettes Marmeladenbrot, zur Belohnung für alle Strapazen, die ich als Klavierschüler auf mich genommen hatte.
In Papas Arbeitszimmer schrieb ich auf Mamas elektrischer Schreibmaschine einen Artikel über den Etüdenkomponisten Czerny. Von Musik habe dieser Typ soviel verstanden wie eine Kuh vom Klavierspielen, wollte ich schreiben, aber weil ich beim Antippen der Tasten nicht vorsichtig genug gewesen war, stand auf dem Blatt »Kih viom Klvrrrspleen«. Für solche Fälle gab es Tipp-Ex. Das waren kleine schmale Streifen, die man in die Schreibmaschine einspannen mußte, zwischen Farbband und Papier. Wenn man den falschen Buchstaben dann noch einmal tippte, war er weg, das heißt, er war mit einem weißen Korrekturmehl zugepudert, und man konnte den richtigen Buchstaben obendrübertippen. Wenn einem dabei allerdings ein weiterer Tippfehler unterlief, war auch mit Tipp-Ex nicht mehr viel zu machen. Dann sah die korrigierte Stelle aus wie Sau.
Es gingen viele Tipp-Ex-Streifen drauf, bis ich das Wort »Klvrrrspleen« in das Wort »Klavierspielen« verwandelt hatte, denn manchmal flutschte das verfluchte Tipp-Ex-Dings auch weg, bevor man den falschen Buchstaben anschlug. Dann prangte er umso fetter auf dem Papier, und man durfte den Tipp-Ex-Streifen mit ’ner Pinzette irgendwo aus den Innereien der Maschine herausangeln. Nach einer knappen halben Stunde war ich halb wahnsinnig vor Wut auf die Kackschreibmaschine, und da platzte Mama rein und rief: »Was sind denn das für Ausdrücke? Beherrsch dich gefälligst! Und nimm die Pfoten weg von meiner Schreibmaschine! Wer hat dir überhaupt erlaubt, dich hier breitzumachen? Raus hier, aber dalli! Zackzack!«
Das Blatt mit meinem Artikel durfte ich noch mitnehmen, und das knüllte ich in meinem Zimmer zusammen und ballerte es in den Papierkorb.
Czerny, dieser Dreckskerl! Und das schmadderige Leben in Meppen!
Mit was für einem Dreck sich Papa als Hausbesitzer und Vermieter abplagen mußte, ging aus einem Brief hervor, den der Mieter unseres Hauses auf dem Mallendarer Berg geschrieben hatte.
Heute möchte ich Ihnen von einem soeben behobenen Defekt an der Heizungsanlage berichten. Vor einiger Zeit haben wir völlig unerwartet den Plastikhebel, der das Mischventil steuert, zerbrochen vorgefunden. Gleichzeitig war die Heizung dauernd gestört. Wir zogen deshalb die Firma Metzler zu, ließen die Störung beseitigen und das Ersatzteil besorgen. Die Beschaffung dauerte geraume Weile. Mittlerweile konnte ich feststellen, daß vom Schalthebel des Mischventils ein Widerstand ausging. Der Heizungsmonteur erklärte uns, daß der Widerstand im Zusammenhang mit dem Anschweißen der im vergangenen Jahr erneuerten Umwälzpumpe entstanden sei. Angeblich sei das eine hin und wieder vorkommende Begleiterscheinung. Heute ist endlich die ganze Sache im Rahmen einer Inspektion behoben worden. Dabei ist auch das Ersatzteil (jetzt übrigens Metall) für die Steuerung des Mischventils eingebaut und der Widerstand durch Ausfeilen beseitigt worden. Ich hoffe, daß dieser Ablauf in Ihrem Sinne liegt, und vor allem, daß uns das Mischventil länger erhalten bleiben wird.
Und das war es dann, bis auf die Abschiedsformalitäten:
Wir bitten um eine Empfehlung an ihre verehrte Gattin und verbleiben mit besten Grüßen …
Die Querelen wegen des Mischventils und der Umwälzpumpe wirkten sich nicht gerade förderlich auf Papas Stimmung aus.
In den Osterferien hätte Michael Gerlach ja mal nach Meppen kommen können, dachte ich mir, und weil Mama nichts dagegen hatte, durfte ich in Vallendar bei Gerlachs anrufen.
Die Idee sei gut, sagte Michael, aber da müsse er erst einmal seine Alten fragen.
Der Dollar war jetzt weniger als zwei Mark wert, und es gab Finanzexperten, die sich deswegen Sorgen um die Stabilität der Weltwirtschaft machten. Wenn der Dollar in den Wechselkursen um einen Pfennig absank, hätte ja sogar ich den Amis aushelfen können, denn was war schon ein Pfennig?
Hermann schüttelte den Kopf, als ich ihm meine Pläne zur Rettung des internationalen Währungssystems unterbreitete. »Mit deinen Groschen kommst du da nicht weit …«
Ach nee?
Im Viertelfinale des Europapokals haute Wacker Innsbruck Borussia Mönchengladbach im Hinspiel mit 3:1 vom Platz, und ich war sauer. Ja, mir langte es allmählich. Ewig nur verlieren, auf dem Fußballplatz, im Leben, in der Schule, überall, wer sollte das aushalten? Das letzte scheue Augenzwinkern von Michaela Vogt, wie lange war das her? Und wie dämlich mußte man sein, um sich einzubilden, daß das irgendwas zu bedeuten gehabt hätte?
Scheiß Borussia Mönchengladbach, Scheiß alles andere, Scheiße! Wenn wenigstens Günter Netzer noch für Gladbach gespielt hätte, aber nein! Was sollte ich mit meinem kotzigen Leben in Meppen anfangen, wenn Netzer in Madrid spielte und Beckenbauer in New York?
Mamas Leserbrief erschien im Stern, aber gekürzt und verstümmelt. Geschrieben hatte sie den Redakteuren, daß deren taktlose und überhebliche Berichterstattung über die Frauen in der Bundesregierung »doch Ihrem Magazin-Stil nicht angemessen« sei, und im Stern stand, die Berichterstattung sei »doch Ihrem Magazin-Stil angemessen«. Ohne »nicht«.
Mama regte sich über die Idioten auf, die ihren Leserbrief verhunzt hatten, aber Tante Dagmar, die ihr telefonisch gratulierte, fand es prima, daß die Heinis Mamas »nicht« verschlampt hatten: Es sei dem Stil dieser Illustrierten durchaus angemessen, neunmalklug über weibliche Minister herzuziehen.
Als das Gespräch mit Tante Dagmar beendet war, klingelte das Telefon abermals, und diesmal war Michael dran: Er müsse sich kurz fassen, sagte er, aber soviel sei sicher, daß er in den Osterferien kommen könne. Wann genau und für wie lange, das sei noch offen.
Prima. Doch was sollte ich ihm hier bieten? Die Karnickel konnte ich ihm zeigen, die sich abends auf den Grünflächen vor der Einfahrt zur E-Stelle versammelten, okay, und wir könnten einmal an der Hase entlang bis nach Bokeloh stiebeln und zurück, aber sonst?
Na, egal. Da würde uns schon was einfallen, und ich war gespannt darauf, was Michael von meinen Platten hielt. Er selbst besaß ja keine, weil seine Eltern zu arm dafür waren, sich einen Plattenspieler zuzulegen.
Im Deutschunterricht las ich heimlich unter der Bank einen Roman von Heinrich Böll, »Billard um halbzehn«, und als der Wolfert mich dabei erwischte, sagte er: »Oh, das ist aber anspruchsvoll!« Und dann mußte ich dieses Taschenbuch natürlich wegpacken.
Was der so unter »anspruchsvoll« verstand. Ich fand’s langweilig. Man las und las den Kram, ohne jemals dahinterzusteigen, worum es da überhaupt ging. Da kämpfte eine Familie von Architekten ums Überleben, aber alle ödeten sich gegenseitig an, und nach zweihundert Seiten hatte ich genug von dem ganzen Gewürge.
Gegen Hertha BSC kam Köln über ein lahmes 1:1 nicht hinaus, während Gladbach Werder Bremen mit 4:0 in Klump schoß. Damit rückte Gladbach an der Tabellenspitze bis auf einen Punkt an Köln heran, und ich hatte es jetzt förmlich im Urin, daß die Meisterschale für die Fohlenelf zum Greifen nahe war, zum viertenmal nacheinander.
Lauterns Stürmer Klaus Toppmöller hatte innerhalb von zehn Minuten einen Hattrick hingelegt. In der Nationalmannschaft hatte Toppmöller zuletzt vor zwei Jahren gespielt. Hoffentlich merkten sich die Idioten beim DFB jetzt dessen Namen. Wenn Toppmöller nicht in die Auswahl für die WM in Argentinien berufen werden sollte, konnte man davon ausgehen, daß Helmut Schön nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte.
Schön und Neuberger hätten sowieso schon längst auf Knien vor Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Günter Netzer herumrutschen müssen, um sie untertänigst um ihre Rückkehr in die Nationalelf anzuflehen, und wenn ich Müller, Beckenbauer oder Netzer gewesen wäre, hätte ich mich selbst dann nicht so leicht herumkriegen lassen.
Bei Anruf Mord.
Im Spiegel stand ein Artikel über Sex in Japan, mit Aufnahmen aus japanischen Pornofilmen. Wozu brauchte man den Playboy, wenn man den Spiegel hatte?
Was außerdem noch drinstand, war der erste Teil einer Reportage über Armut in Amerika, von Jacob Holdt, der sich das ganze Land von unten angesehen hatte, aus der Froschperspektive. Auf einem Foto sah man die Slums von schwarzen Zuckerrohrarbeitern in Louisiana, einem Bundesstaat mit 257000 Analphabeten. Und in Chicago würden jährlich Hunderte von Kindern an Rattenbissen sterben.
Was ich nicht gut abkonnte in der Badewanne, war der Schaum im Nacken. Wenn es da so knisterte beim Anlehnen. Dagegen gab es ein gutes Mittel: Hände einseifen und die Wassertropfen von den Fingern auf die Schauminseln regnen lassen. Da sackten die Blasen in sich zusammen.
Ba-ba-ba-bamm!
Humphrey Bogart hätte man sein müssen: Dann wären einem die Weiber nur so nachgelaufen, und man hätte sie abwimmeln müssen. Aber ständig mit ’ner scharf geladenen Pistole herumtigern? Und in jeder Bude befürchten müssen, daß irgendein Trollo mit gezückter Waffe hinter der Tür lauert?
Die Gewonk steigerte sich in Englisch auf hundertachtzig, weil keiner seine Hausaufgaben gemacht hatte. Egal, wen sie aufrief: Alle mußten passen. Der einzige, der etwas vorzuweisen hatte, war Hermann. Ich selbst hätte leider auch nichts zu bieten gehabt, wenn ich drangenommen worden wäre.
Wurde ich aber nicht.
Die Gewonk vibrierte. »Wenn hier noch irgendeiner sitzt, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann soll er aufzeigen! Jetzt!«
Hermann stieß mich mit dem Knie an und flüsterte mir zu: »Du mußt gestehen!«
Währenddessen ließ die Gewonk ihren Adlerblick über die Klasse schweifen.
Der Harms meldete sich: Es tue ihm sehr leid, aber er müsse zugeben, daß auch er vergessen habe, sein Hausaufgabenheft mitzunehmen …
Der Arsch. Der war fein raus.
»Sonst noch jemand?« keifte die Gewonk, und alles schwieg.
Wenn ich mich jetzt gemeldet hätte, wäre ich bestimmt nicht mehr so gnädig abgefertigt worden wie der Harms, und alle hätten gedacht: Martin Schlosser, der Feigling! Traut sich erst im allerletzten Moment damit raus, daß er zu faul gewesen ist, seine Hausaufgaben zu machen!
»Gib’s zu«, flüsterte Hermann. »Gib’s zu, du Idiot … noch hast du ’ne Chance …«
Aber mit jeder Sekunde, die verstrich, vergrößerte sich auch die Chance, ungeschoren davonzukommen. Wenn Hermanns Armbanduhr richtig ging, dauerte die Englischstunde bloß noch sechs Minuten.
Die Gewonk knallte ihr Buch aufs Pult und blickte stumm und forschend um sich.
»Melde dich«, flüsterte Hermann. »Die dreht dir sonst den Hals um, wenn sie dich erwischt …«
Aufgerufen wurde dann aber der Holzmüller. Der hatte leider auch nichts vorzuweisen, und die Gewonk rastete aus und schrie, sie sei es leid, sich von Pappnasen wie uns an der Nase herumführen zu lassen.
Ein Riesendonnerwetter prasselte auf den Holzmüller hinab, und als es vorbei war, blieben immer noch vier Minuten übrig. Eine verdammt lange Zeit. Die Gewonk blickte jetzt um sich wie Frau Mahlzahn in der Drachenschule. Der nächste, den sie aufrief, war der Bohnekamp, aber der hatte seine Hausaufgaben nun zufällig gemacht, der alte Schisser, und das war sein Glück.
Drei Minuten noch.
Sie habe die Nase voll für heute, sagte die Gewonk. Eine widerspenstigere Klasse als unsere sei ihr noch nicht untergekommen. »Albers!«
Der Albers legte der Gewonk sein Hausaufgabenheft vor, und sie fand darin nichts zu beanstanden.
Noch neunzig Sekunden.
»O Herr, laß diesen Kelch an mir vorübergehen«, murmelte Ralle.
Noch achtzig.
Der Bohnekamp gnitterte vergnügt in sich hinein und verbarg sein Gesicht hinter den haarigen Krallen, die ihm genetisch vererbt worden waren, von den Torfstechern im Stammbaum seiner Familie.
Mir wäre wohler ums Herz gewesen, wenn ich rechtzeitig zugegeben hätte, daß auch ich gefaulenzt hatte, aber jetzt wuchs meine Hoffnung aufs Davonkommen von Sekunde zu Sekunde, und dann traf der Blitzstrahl Michaela Vogt: Die hatte ihre Hausaufgaben ebenfalls nicht gemacht.
Da schnappte die Gewonk über, und Michaela kriegte schwer einen aufs Dach von ihr, bis das Gekreisch im Pausenklingeln unterging.
In der Pause sah ich mich nach Michaela um, aber die hatte sich wer weiß wohin verkrümelt. Und ich hätte sie so gern getröstet!
She must be hurt very badly
Tell me what’s making you sadly …
Bei mir hätte sie sich ausweinen können, aber an Michaela war einfach nicht ranzukommen.
In Erdkunde konnte ich ihr wieder in den Nacken sehen, zwei Reihen vor mir, wo sie den Unterrichtsstoff still und ungerührt aufnahm. Wie die Schwarzen in südafrikanischen Goldminen schuften müßten: Nach ein paar Jahren seien die Arbeiter da so kaputt, daß man sie rausschmeiße. Das einzige, worum es den Unternehmern in Südafrika gehe, sei die Profitmaximierung.
Die gehörten ins Gefängnis, sagte Hermann. Wenn in Südafrika eine Revolution ausbrechen sollte, wäre er dafür. Er wolle niemanden am Galgen baumeln sehen, aber die rassistischen Kapitalisten in Südafrika müßten sich nicht wundern, wenn sie eines Tages alles heimgezahlt kriegten, was sie den Schwarzen angetan hätten.
Nach Schulschluß blätterte ich bei Meyer in einem rororo-aktuell-Band, der da schon seit sieben Jahren herumgammelte (»Klassenkämpfe in Westeuropa«).
Zwei Forderungen von unmittelbarem Interesse für den größten Teil der Arbeiterklasse sorgten 1968 für die Vereinheitlichung der Streikbewegung: Die Rentenerhöhung zusammen mit einer grundlegenden Reform des Rentensystems und die Beseitigung der Lohnzonen …
Ich stellte das Buch ins Regal zurück. Für Diskussionen über das Rentensystem war mir mein Fensterputzgeld zu schade.
Für Oma und Opa Jever tippte Mama auf ihrer neuen elektrischen Schreibmaschine eine Familienchronik.
Lebenslauf und Ehejahre uns’rer beiden Jubilare.
Dafür hatte Mama Opa Jevers Geburtsanzeige kopiert, aus einem Nachrichtenblättchen fürs Harlingerland, von anno dunnemals:
Heute wurde uns ein kräftiger Knabe geboren.
Altfunnixsiel, den 4. April 1896
Lübbo Lüttjes und Frau
In derselben vergilbten Zeitungsausgabe von 1896 standen Annoncen von Opa Jevers Vater, der als Kolonialwarenhändler Gemüse-Sämereien, prima Weißkalk und prima Cement anpries.
Der von Mama fertiggestellten Chronik konnte man entnehmen, daß die Familie 1905 nach Rüstringen umgezogen war. 1914 hatte Opa Jever eine »Notreifeprüfung« abgelegt, und 1915 war er als Infanterist an der Westfront eingesetzt worden, in der Schlacht an der Somme und in Flandern. Als Leutnant der Reserve war er dann Ende 1918 in Altona aus dem Militärdienst entlassen worden.
Eine Jugend unter der Pickelhaube. Armer Opa!
Im März 1919 habe er seine erste richtige Lehrerstelle angetreten, in einer zweiklassigen Schule in Altenesch an der Weser, und 1923 sei er dann nach Jever gekommen, den Ort seines späteren Wirkens, wo er Lehrer an einer Mädchenschule geworden sei und sich als sangesfreudiger Mensch sogleich beim Singverein angemeldet habe. Dank seines klangvollen Organs sei er schon bald zur Stimmstütze im Baß geworden …
Und in diesem Chor lernte er seine spätere Frau kennen, Oma Jever: Eine der hellsten Sopranstimmen habe damals einer gewissen Emma Thoben gehört, und sie und ihre Freundinnen hätten den neuen Sänger sehr wohl bemerkt. Es sei ihnen auch nicht entgangen, daß er in seiner Sangesbegeisterung jedes Fortissimo mit lebhaftem Kopfwackeln begleitet und damit den Anlaß zu allerlei spöttischen Bemerkungen geliefert habe.
Emma sei zwar ein Kind oldenburgischer Eltern gewesen, aber in der Fußartilleriekaserne in Breisach im Breisgau zur Welt gekommen, als Tochter des Feldwebels Friedrich Thoben und seiner Ehefrau Gesine, geborene Rickels.
Überliefert ist die Anekdote, daß Emma im Alter von zwei Jahren gern die große weite Welt kennenlernen wollte, sich vor dem Wachhabenden aufbaute und treuherzig sagte: »Halbes Pfund gestreiften Peck!« Und der Mann ließ sie passieren, in der Annahme, sie solle eine Besorgung für ihre Mutter machen. Glücklicherweise fand sie sich wohlbehalten wieder ein.
Und wie dann nach der Hochzeit vor fünfzig Jahren das Fünfmädelhaus der Familie Lüttjes in die jeverländische Geschichte eingegangen sei und so weiter.
Von der Anstrengung, die es Mama gekostet hatte, diesen ganzen Kram zu tippen, war sie so erledigt, daß wir uns das Abendbrot selber schmieren mußten.
Im Radio lief ein Song, der mir unter die Haut ging.
And you know that she will trust you
For you’ve touched her perfect body with your mind …
Leonard Cohen hieß der Sänger.
Im Mai wollten Renate und Olaf in Meppen ihre Verlobung feiern, in großer Runde, mit Ringtausch und Ringelpiez, und Mama war damit einverstanden, aber wenn ich ihren Gesichtsausdruck richtig deutete, sah sie doch so ein bißchen dagegen aus.
Bald gehe hier auch die viele Gartenarbeit wieder los, sagte sie. Das sei ihr allerdings immer noch lieber als die gottverflixte Kälte.
»Was wirst du denn eigentlich nach der Schule machen?« fragte Hermann mich. »Zum Bund gehen? Oder verweigern?«
Das war eine gute Frage. Zivildienst? Pißpötte ausleeren und alte Opas schleppen? Oder lieber mit ’ner Knarre im Matsch herumrobben?
Er werde verweigern, sagte Hermann. Sich von einem Hauptmann anschreien zu lassen und im Kriegsfall womöglich zu einer standrechtlichen Erschießung abkommandiert zu werden, das sei nichts für ihn. »Da leere ich lieber Pißpötte aus.«
Von Hermann erfuhr ich dann auch, daß es in einer Parallelklasse jemanden gebe, der zwei Platten von Cohen besitze. Kurt Wilkens hieß dieser Knabe, und er war so freundlich, mir die Platten zu leihen.
In den Songs kamen Betten aus Schnee und endlose Flüsse vor, Schwestern der Gnade, Kinder der Dämmerung, im Regen gewaschene Augenlider, Engel, Gefangene, Schlachthöfe, Gräber, Lorbeerkränze, Wartezimmer, Feigheit, Verzweiflung und befriedigende One-Night-Stands. Eine Strophe handelte von einer Frau, die ihr Haar in einem Webstuhl aus Rauch und Gold und Atemzügen hergestellt habe. Man wurde nicht schlau daraus, aber das machte nicht viel, solange einem die Stimme zu Herzen ging.
Let me see your beauty broken down
like you would do for one you love …
Leonard Cohen hatte schon eine Menge Frauen verschlissen: Suzanne und Marianne und all die anderen namentlich nicht genannten Freundinnen, die ihm so zugelaufen waren.
Trav’ling lady, stay awhile
until the night is over.
Janis Joplin nicht zu vergessen, die er laut Kurt Wilkens auch einmal besungen hatte:
I remember you
Well in the Chelsea Hotel
You were talking so brave and so sweet,
giving me head on the unmade bed,
while the limousines wait in the street …
»To give head«, das bedeute »Schwanzlutschen«, hatte Kurt Wilkens gesagt, und ich wäre fast hintenübergekippt. Da kamen die deutschen Schlagersänger nicht mit! Von denen sah auch keiner so gut aus wie Cohen. Der konnte es sich sogar leisten, seine Geliebten mit anderen Männern zu teilen, ohne vor Eifersucht überzuschnappen:
And you won’t make me jealous if I hear that they sweetened your night:
We weren’t lovers like that and besides it would still be all right.
Kanadier hätte man sein müssen, so wie Cohen.
Der erste Auswärtssieg über Bayern München wäre für Gladbach zu schön gewesen, um wahr zu werden. Die Bayern gingen in der 36. Minute durch ein Tor von Gerd Müller in Führung, und Gladbach rannte dem Rückstand hinterher, bis zur 87. Minute, in der Kalle Del’Haye als eingewechselter Joker nach einem großartigen Sturmlauf über vierzig Meter wenigstens noch den Gleichstand herstellte. Köln hatte zur gleichen Zeit Duisburg mit 5:2 naßgemacht und besaß wieder zwei Punkte Vorsprung.
Hölle, Pech und Hagelschlag!
Auf der Plantage seines neuen Besitzers sollte Kunta Kinte in der Fernsehserie den Namen Toby tragen, wollte aber nicht und wurde ausgepeitscht.
»Wie heißt du?«
»Kunta Kinte.«
Klatsch, der nächste Peitschenhieb, und so ging es weiter, bis Kunta Kinte klein beigeben mußte.
»Wie heißt du?«
»Toby, Massa.«
Der Dürrkopp machte es in der Schule nach und piesackte Ralle mit der Zirkelspitze, bis der auf die Frage nach seinem Namen erwiderte: »Ja, ich heiße Toby, Massa!«
In Geo hatte ich an nichts Böses gedacht, als ich plötzlich die Frage beantworten sollte, wie man das Ruhrgebiet nach Westen abgrenzen könne.
Puh. Mal scharf nachdenken. Was lag denn wohl westlich vom Ruhrgebiet?
»Vielleicht durch die Grenze zu Frankreich?«
Wie ich zuhause feststellte, war das so ungefähr die dümmste Antwort, die ich hatte geben können, denn die französische Grenze fing erst viel weiter unten an, südlich von Trier. O Gott! Da hatte Michaela Vogt ja mal wieder einen schönen Eindruck von meiner Weltläufigkeit gewonnen.
Im SV