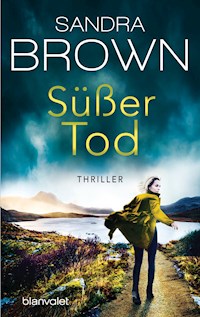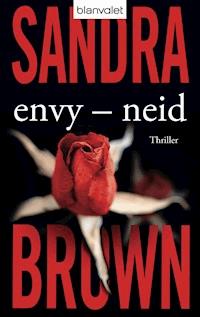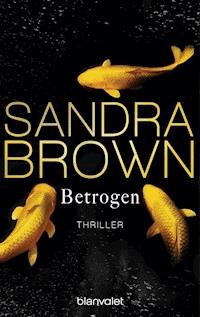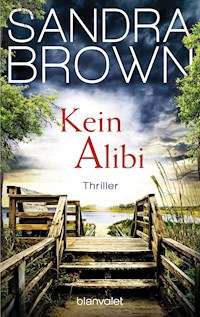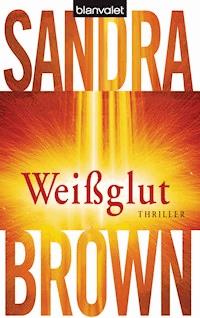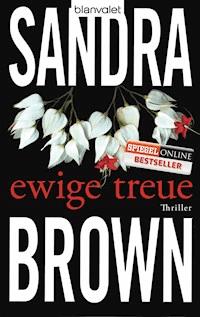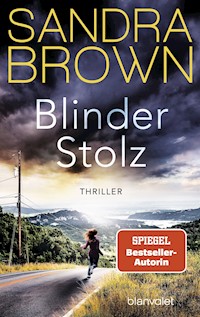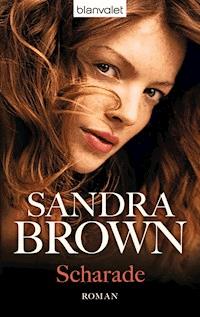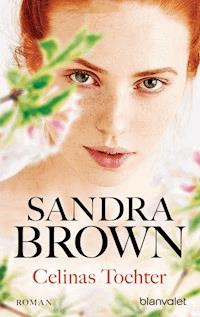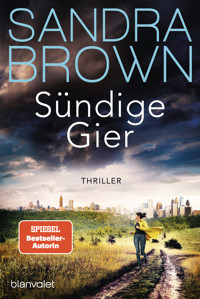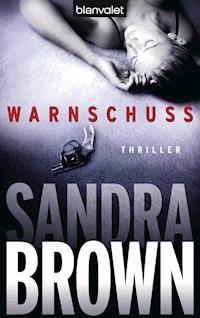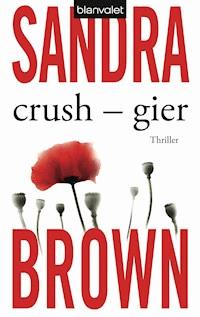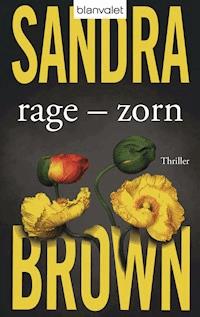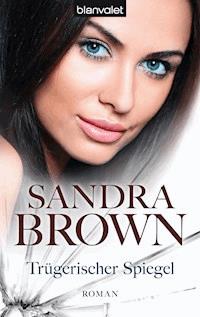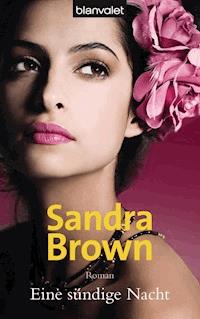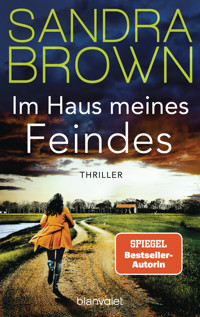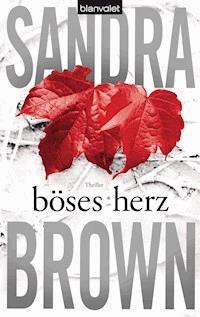
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wem kannst du vertrauen, wenn nichts ist, wie es scheint?
Vor zwei Jahren verlor Honor Gillette ihren geliebten Ehemann Eddie bei einem tragischen Unfall – das glaubte sie jedenfalls, als plötzlich ein fremder Mann blutüberströmt in ihrem Vorgarten auftaucht. Honor ahnt nicht, dass es sich um Lee Coburn handelt, der wegen Mordes an sieben Menschen gesucht wird – bis er sie und ihre kleine Tochter als Geiseln nimmt und behauptet, Eddies Tod sei kein Unfall gewesen und Honor selbst sei in großer Gefahr. Honor hat keine andere Wahl: Um sich und ihre Tochter zu schützen, muss sie Coburn vertrauen und tun was er verlangt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sandra Brown
Böses Herz
Thriller
Deutsch von Christoph Göhler
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Lethal« bei Grand Central Publishing, New York.
1. AuflageCopyright © der Originalausgabe 2011 by Sandra Brown Management, Ltd.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-10155-8www.blanvalet.de
1
Mommy?«
»Hm?«
»Mommy?«
»Hm?«
»Da ist ein Mann im Garten.«
»Was ist los?«
Die Vierjährige blieb an der Ecke des Küchentischs stehen und blickte sehnsüchtig auf die Schokoladenglasur, mit der ihre Mutter den Cupcake verzierte. »Krieg ich was davon, Mommy?«
»Darf ich etwas davon haben. Du kannst die Schüssel ausschlecken, wenn ich fertig bin.«
»Du hast Schoko gemacht.«
»Weil du am liebsten Schoko isst und weil ich dich von allen Mädchen am liebsten habe«, sagte sie und zwinkerte dem Kind zu. »Und«, fuhr sie betont langsam fort, »ich habe noch Streusel, die wir obendrauf streuen können.«
Emily strahlte, doch dann verzog sie bekümmert das Gesicht. »Er ist krank.«
»Wer ist krank?«
»Der Mann.«
»Welcher Mann?«
»Der Mann im Garten.«
Endlich drangen Emilys Worte zu Honor durch, und sie registrierte, dass es sich nicht nur um unwichtiges Geplapper handelte. »Da ist wirklich ein Mann im Garten?« Honor legte den verzierten Cupcake auf der Kuchenplatte ab, versenkte den Spatel in der Kuvertüre und wischte sich gedankenverloren die Hände an einem Handtuch ab, während sie sich an ihrer Tochter vorbeischob.
»Er ist so krank, dass er sich hinlegen muss.«
Emily folgte ihrer Mutter von der Küche ins Wohnzimmer. Honor trat an das große Fenster und ließ den Blick von links nach rechts schweifen, aber sie sah nur den unverwüstlichen Südstaatenrasen, der sich dezent zum Bootssteg hin absenkte.
Hinter den verwitterten Holzplanken des Stegs schwappte träge das Wasser des Bayou. Eine Libelle schwebte so knapp über dem Wasser, dass sich hin und wieder die Oberfläche kräuselte. Der streunende Kater, der Honor jedes Mal mit Missachtung strafte, wenn sie ihm erklärte, dass er hier nicht wohne, pirschte sich in ihrem Beet grellbunter Zinnien an eine unsichtbare Beute an.
»Em, da ist kein …«
»Bei dem weißen Busch«, unterbrach Emily sie eigensinnig. »Ich habe ihn von meinem Zimmer aus gesehen.«
Honor ging zur Tür, drehte den Riegel zurück, hängte die Kette aus, trat auf die Veranda und schaute in die Richtung des weißen Eibischstrauches.
Und tatsächlich, da lag er, mit dem Gesicht zum Boden, halb auf der linken Seite, das Gesicht von ihr abgewandt, den Arm über den Kopf gestreckt. Er rührte sich nicht. Honor konnte nicht einmal feststellen, ob sich sein Brustkorb hob und senkte.
Schnell drehte sie sich um und schob Emily sanft ins Haus zurück. »Schätzchen, lauf in Mommys Schlafzimmer. Das Telefon liegt auf dem Nachttisch. Bring es mir bitte.« Um ihrer Tochter keine Angst einzujagen, sprach sie so ruhig wie möglich, bevor sie die Verandastufen hinunterlief und über den Rasen auf die liegende Gestalt zurannte.
Im Näherkommen sah sie, dass die Kleidung des Mannes verdreckt, zerrissen und voller Blutflecken war. Auch sein nackter, ausgestreckter Arm und die Hand waren blutverschmiert. Geronnenes Blut verklebte außerdem den dunklen Schopf auf seinem Scheitel.
Honor ging neben ihm in die Hocke und legte die Hand auf seine Schulter. Als er aufstöhnte, atmete sie erleichtert aus. »Sir? Können Sie mich hören? Sie sind verletzt. Ich hole Hilfe.«
Sein Arm schnellte so unvermittelt hoch, dass sie nicht einmal Zeit hatte zurückzuweichen, geschweige denn sich irgendwie zu wehren. Blitzschnell und mit einem Höchstmaß an Präzision hatte er sie überwältigt. Seine linke Hand schoss vor und packte ihren Nacken, während seine Rechte den kurzen, stumpfen Lauf einer Pistole in die Vertiefung unter ihren Rippen presste. Er zielte leicht nach oben und links, genau auf ihr Herz, das vor Angst zu platzen drohte.
»Wer ist sonst noch hier?«
Ihre Stimmbänder waren vor Angst wie eingefroren, sie brachte keinen Ton heraus.
Er drückte ihren Nacken fester zusammen und wiederholte düster und mit Nachdruck: »Wer ist sonst noch hier?«
Sie brauchte mehrere Anläufe, bevor sie stammelte: »Meine … meine Toch…«
»Noch jemand außer dem Kind?«
Sie schüttelte den Kopf. Oder versuchte es wenigstens. Er hielt ihren Nacken so gnadenlos umklammert, dass sie jeden einzelnen Finger spüren konnte.
Seine blauen Augen durchbohrten sie wie Laser. »Wenn Sie mich anlügen …«
Noch bevor er die Drohung ausgesprochen hatte, begann sie zu wimmern. »Ich lüge nicht. Ehrenwort. Wir sind allein. Tun Sie uns nichts. Meine Tochter … Sie ist erst vier. Tun Sie ihr nichts. Ich tue alles, was Sie sagen, aber tun Sie …«
»Mommy?«
Honors Herz krampfte sich zusammen, und sie gab ein leises Quieken von sich, wie ein gefangenes, hilfloses Tier. Da sie den Kopf immer noch nicht drehen konnte, sah sie aus den Augenwinkeln nach Emily. Sie stand ein paar Schritte von ihnen entfernt mit niedlich eingeknickten X-Beinchen, das süße Gesicht von blonden Locken umrahmt, und unter den rosa Seidenblüten auf ihren Sandalen leuchteten die kleinen Knubbelzehen hervor. Mit weit aufgerissenen Augen hielt sie Honors Handy in beiden Händen.
Honor spürte, wie eine Woge von Mutterliebe sie überschwemmte. Sie fragte sich, ob sie Emily vielleicht nie wieder so gesund und unschuldig und unberührt sehen würde. Die Vorstellung war so schrecklich, dass ihr sofort Tränen in die Augen stiegen, die sie, um ihrer Tochter willen, hastig wieder wegblinzelte.
Erst als sie zu sprechen versuchte, merkte sie, wie ihre Zähne klapperten. Sie brachte ein »Schon okay, Süße« heraus. Ihr Blick richtete sich wieder auf den Mann, der nur einen Fingerdruck davon entfernt war, ihr Herz in Fetzen zu schießen. Dann würde Emily ganz allein zurückbleiben, in Todesangst und seiner Gnade ausgeliefert.
Bitte, beschwor Honor den Fremden mit einem wortlosen Blick. Dann flüsterte sie: »Ich flehe Sie an.«
Die harten, kalten Augen hielten ihre fest wie ein Magnet, während er ganz langsam die Pistole zurückzog. Er senkte die Waffe und verbarg sie hinter seinem Oberschenkel, sodass Emily sie nicht sehen konnte. Aber die unausgesprochene Drohung blieb.
Schließlich löste er den Griff um Honors Nacken und sah Emily an. »Hi.«
Er sagte es, ohne zu lächeln. Eine Klammer von feinen Fältchen rahmte seine Mundwinkel ein, aber Honor glaubte nicht, dass es Lachfalten waren.
Emily sah ihn schüchtern an und bohrte die große Zehe in das dichte Gras. »Hallo.«
Er streckte die Hand aus. »Gib mir das Handy.«
Sie rührte sich nicht. Als er ungeduldig mit dem Finger schnippte, erklärte sie ihm ernst: »Du hast nicht ›bitte‹ gesagt.«
Das Wort bitte schien er noch nie gehört zu haben. Trotzdem fügte er nach kurzem Zögern hinzu: »Bitte.«
Emily trat einen Schritt vor, blieb dann wieder stehen und sah Honor an, als wartete sie auf deren Erlaubnis. Obwohl Honors Lippen unkontrollierbar zitterten, brachte sie so etwas wie ein Lächeln zustande. »Schon okay, Herzchen. Gib ihm das Handy.«
Schüchtern legte Emily die letzten Schritte zurück. Sobald sie nah genug war, beugte sie sich so weit vor wie möglich und legte das Handy in seine Hand.
Seine blutverschmierten Finger schlossen sich darum. »Danke.«
»Bitte. Willst du Grandpa anrufen?«
Er sah Honor an. »Grandpa?«
»Er kommt uns heute Abend besuchen«, verkündete Emily fröhlich.
Ohne den Blick von Honor zu wenden, fragte der Mann langsam: »Stimmt das?«
»Magst du Pizza?«
»Pizza?« Er sah wieder Emily an. »Klar. Sicher.«
»Mommy hat gesagt, ich kriege heute Abend Pizza, weil wir heute eine Party feiern.«
»Hm.« Er schob Honors Handy in die Vordertasche seiner schmutzigen Jeans, schloss dann die freie Hand um ihren Oberarm und zog Honor im Aufstehen mit hoch. »So wie es aussieht, bin ich gerade rechtzeitig gekommen. Gehen wir ins Haus. Dann kannst du mir alles über eure Feier erzählen.« Ohne Honors Arm loszulassen, schob er sie zum Haus. Honors Beine schlotterten so, dass sie bei den ersten unsicheren Schritten einzuknicken drohten. Im nächsten Moment hatte Emily den Kater entdeckt und alles andere vergessen. Sie rannte los und rief laut: »Hierher, Kätzchen«, woraufhin das Tier eilig in der Hecke am anderen Ende des Gartens verschwand.
Sobald Emily außer Hörweite war, sagte Honor: »Ich habe Geld im Haus. Nicht viel, vielleicht ein paar Hundert Dollar. Und ein bisschen Schmuck. Sie können alles haben. Hauptsache, Sie tun meiner Tochter nichts.«
Während sie auf ihn einredete, suchte sie mit Blicken hektisch den Garten nach irgendeiner Art von Waffe ab. Der aufgerollte Wasserschlauch auf dem Halter am Rand der Veranda? Der Geranientopf unten an den Stufen? Einer der halb vergrabenen Ziegelsteine, mit denen das Blumenbeet eingefasst war?
Sie wäre auf keinen Fall schnell genug, selbst wenn sie sich aus seinem Griff winden konnte, was, so wie sie seine Kräfte einschätzte, schwierig bis unmöglich war. Und falls sie sich gegen ihn zu wehren versuchte, würde er sie einfach erschießen. Dann konnte er mit Emily tun, was immer ihm einfallen mochte. Bei dem Gedanken schoss ihr die Magensäure in den Mund.
»Wo ist Ihr Boot?«
Sie drehte sich zu ihm um und sah ihn verständnislos an.
Ungeduldig nickte er zu dem leeren Steg hin. »Wer ist mit dem Boot unterwegs?«
»Ich habe kein Boot.«
»Erzählen Sie keinen Müll.«
»Ich habe das Boot verkauft, nachdem … Vor ein paar Jahren.«
Er schien abzuwägen, ob sie ihn belog, und fragte dann: »Und wo steht Ihr Wagen?«
»Vor dem Haus.«
»Steckt der Schlüssel?«
Erst zögerte sie, doch als er seinen Griff verstärkte, schüttelte sie den Kopf. »Der ist im Haus. An einem Haken neben der Küchentür.«
Er schubste sie vorwärts und folgte ihr die Stufen zur Veranda hinauf. Bei jedem Schritt spürte sie die Pistole in ihrem Rücken. Sie drehte sich um und wollte Emily rufen, aber er sagte: »Lassen Sie sie.«
»Was wollen Sie von mir?«
»Also, erst einmal …«, sagte er, während er die Tür aufzog und Honor ins Haus stieß, »werde ich nachsehen, ob Sie mich angelogen haben oder ob wirklich niemand im Haus ist. Und dann … werden wir sehen.«
Sie spürte, wie angespannt er war, während er sie vor sich her durch das leere Wohnzimmer und dann durch den kurzen Flur zu den Schlafzimmern schob. »Hier sind nur Emily und ich.«
Er stieß die Tür zu Emilys Zimmer mit dem Pistolenlauf auf. Die Tür öffnete sich zu einem Mädchentraum in Rosa. Hier lag niemand auf der Lauer. Immer noch misstrauisch durchquerte er mit zwei langen Schritten das Zimmer und riss die Schranktüren auf. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass sich auch dort niemand versteckt hielt, zog er Honor in den Flur zurück und auf das zweite Schlafzimmer zu.
Während sie darauf zugingen, knurrte er ihr ins Ohr: »Falls da drin jemand ist, dann erschieße ich Sie zuerst. Klar?« Er blieb kurz stehen, als wollte er ihr Gelegenheit geben, ihre Behauptung, sie sei mit ihrer Tochter allein, zu widerrufen. Als sie nichts sagte, trat er so fest mit der Schuhspitze gegen die Tür, dass sie gegen die Wand knallte.
Ihr Schlafzimmer strahlte eine unpassende, fast höhnische Heiterkeit aus. Die durch die Jalousien fallenden Sonnenstrahlen warfen helle Streifen auf das Parkett, die weiße Tagesdecke und die hellgrauen Wände. Der Deckenventilator ließ Staubkörner in den schrägen Lichtstrahlen tanzen.
Er zerrte sie zum Schrank und befahl ihr, die Tür zu öffnen. Nachdem er einen Blick in das anschließende Bad geworfen und festgestellt hatte, dass sich auch dort niemand versteckt hielt, entspannte er sich ein wenig.
Er baute sich vor ihr auf. »Wo haben Sie Ihre Waffe?«
»Waffe?«
»Sie haben garantiert irgendwo eine.«
»Nein.«
Seine Augen wurden schmal.
»Ehrenwort«, beteuerte sie.
»Auf welcher Bettseite schlafen Sie?«
»Wie bitte? Wieso?«
Er wiederholte die Frage nicht, sondern starrte sie wortlos an, bis sie schließlich den Arm hob. »Auf der rechten.«
Er trat rückwärts an das Nachtkästchen auf der rechten Seite des Bettes und zog die Schublade auf. Darin lagen eine Taschenlampe und ein Taschenbuch, aber keine tödliche Waffe. Dann zerrte er unter ihrem entsetzten Blick die Matratze mitsamt dem Bezug so weit vom Bett, dass er darunter nachsehen konnte, ohne dabei allerdings mehr zu entdecken als den Deckel des Bettkastens.
Mit einem Kopfnicken bedeutete er ihr, ihm voran aus dem Zimmer zu gehen. Beide kehrten ins Wohnzimmer zurück und gingen von dort aus weiter in die Küche, die er akribisch mit den Augen absuchte. Schließlich blieb sein Blick an dem Haken mit ihren Autoschlüsseln hängen.
Als sie seinem Blick folgte, sagte sie: »Nehmen Sie den Wagen. Fahren Sie einfach.«
Ohne darauf einzugehen, fragte er: »Was ist dahinter?«
»Die Waschküche.«
Er ging zu der Tür und zog sie auf. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner. Das Bügelbrett zusammengeklappt in einer Aussparung an der Wand. Ein Wäscheständer zum Trocknen der Unterwäsche, die zum Teil noch dort hing. Ein breites Sortiment an pastellfarbener Spitze. Ein einziger schwarzer BH.
Er drehte sich um, und diese nordischen Augen tasteten sie in einer Intensität ab, bei der ihr das Blut ins Gesicht schoss und gleichzeitig klammer Angstschweiß ihren Rücken überzog.
Er machte einen Schritt auf sie zu, woraufhin sie einen Schritt zurücktrat – eine natürliche Reaktion angesichts der tödlichen Gefahr, die er für sie darstellte. Sie gab sich nicht der Illusion hin, dass es anders sein könnte.
Seine ganze Erscheinung wirkte bedrohlich, angefangen bei den eisigen Augen und den ausgeprägten Gesichtszügen. Er war groß und schlank, aber die Muskeln, die sich unter der glatten Haut an seinen Armen abzeichneten, waren straff wie Peitschenschnüre. Über die Handrücken zogen sich dicke Adern. In seinen Kleidern und Haaren hatten sich Zweige, Moosfasern und kleine Blätter verfangen. Er schien das ebenso wenig zu bemerken wie den verkrusteten Schlamm an seinen Stiefeln und seiner Jeans. Er roch nach Sumpf, nach Schweiß und Gefahr.
Im Haus war es so still, dass sie ihn atmen hörte. Und sie hörte ihr Herz schlagen. Er konzentrierte sich ganz und gar auf sie, und das machte ihr höllische Angst.
Ihn zu überwältigen war ein Ding der Unmöglichkeit, vor allem da er nur einen Finger zu krümmen brauchte, um ihr eine Kugel ins Herz zu jagen. Außerdem stand er zwischen ihr und der Schublade, in der sie die Küchenmesser aufbewahrte. Auf der Theke stand die Kaffeekanne, noch halb gefüllt mit ihrem morgendlichen Kaffee, der heiß genug war, um ihn zu verbrühen. Aber um zu der Kanne oder zu den Messern zu gelangen, musste sie an ihm vorbei, und sie wusste nicht, wie sie das anstellen sollte. Sie glaubte nicht, dass sie ihm davonlaufen konnte, aber selbst wenn sie es durch die Tür schaffen und entkommen sollte, konnte sie Emily unmöglich zurücklassen.
Sie musste auf die Macht der Vernunft oder ihre Überredungskünste setzen.
»Ich habe Sie nicht angelogen, oder?«, fragte sie leise und mit bebender Stimme. »Sie können mein Geld haben und meine Wertsachen …«
»Ihr Geld interessiert mich nicht.«
Sie deutete auf die blutenden Schürfwunden an seinen Armen. »Sie sind verletzt. Sie haben eine Kopfwunde. Ich … ich kann Ihnen helfen.«
»Mich verbinden?« Er schnaubte abfällig. »Das wird nicht passieren.«
»Aber was … was wollen Sie dann?«
»Ihre Hilfe.«
»Wobei?«
»Legen Sie die Hände auf den Rücken.«
»Warum?«
Er kam Schritt für Schritt auf sie zu.
Sie wich zurück. »Hören Sie.« Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Das können Sie nicht machen.«
»Legen Sie die Hände auf den Rücken«, wiederholte er leise, aber mit Nachdruck.
»Bitte.« Sie schluchzte. »Mein kleines Mädchen …«
»Ich werde Sie nicht noch mal darum bitten.« Wieder machte er einen Schritt auf sie zu.
Sie wich wieder zurück und stand im nächsten Moment mit dem Rücken an der Wand.
Mit einem letzten Schritt stand er vor ihr. »Los.«
Instinktiv wollte sie sich wehren, ihn kratzen, schlagen und treten, um das scheinbar Unausweichliche zu verhindern oder wenigstens hinauszuzögern. Aber die Angst um Emily machte sie gefügig, und so schob sie gehorsam die Hände zwischen ihren Rücken und die Wand und faltete sie.
Er beugte sich über sie. Als sie den Kopf zur Seite drehte, legte er eine Hand unter ihr Kinn und zwang sie so, ihn anzusehen.
Dann flüsterte er: »Sehen Sie, wie leicht ich Ihnen wehtun könnte?«
Sie sah ihm in die Augen und nickte stumpf.
»Okay, ich werde Ihnen nicht wehtun. Und ich verspreche Ihnen, dass ich Ihrem Kind nichts tun werde. Aber Sie müssen alles tun, was ich sage. Okay? Haben Sie das verstanden?«
Vielleicht hätte sie aus seinem Versprechen etwas Trost schöpfen können, selbst wenn sie ihm nicht glaubte. Aber plötzlich begriff sie, wer da vor ihr stand, und erstarrte vor Angst.
Atemlos krächzte sie: »Sie sind … Sie sind der Kerl, der gestern Abend dieses Blutbad angerichtet hat.«
2
Coburn. C-o-b-u-r-n. Vorname Lee, zweiter Vorname unbekannt.«
Sergeant Fred Hawkins vom Tambour Police Department setzte die Polizeimütze ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Schon jetzt war sein Gesicht mit einem fettigen Schweißfilm überzogen, dabei war es noch nicht einmal neun Uhr. Im Geist verfluchte er das Klima hier im Süden von Louisiana. Obwohl er nie woanders gelebt hatte, hatte er sich nie an die schwüle Hitze gewöhnen können, und je älter er wurde, desto mehr machte sie ihm zu schaffen.
Im Moment sprach er über Handy mit dem Sheriff des Nachbarbezirks Terrebonne und setzte ihn über den mehrfachen Mord der letzten Nacht ins Bild. »Gut möglich, dass es ein Deckname ist, aber so steht es auf seinem Angestelltenvertrag, und mehr haben wir bis jetzt nicht. Wir haben Fingerabdrücke von seinem Wagen abgenommen … Ja, das ist wirklich kaum zu glauben. Man sollte meinen, er wäre schleunigst vom Tatort verschwunden, aber sein Wagen steht immer noch auf dem Angestelltenparkplatz. Vielleicht hatte er Angst, dass er damit sofort erwischt würde. Andererseits schätze ich, dass jemand, der eben mal kaltblütig sieben Leute erschießt, nicht unbedingt logisch denkt. Jedenfalls ist er, soweit wir das einschätzen können, zu Fuß geflohen.«
Fred holte tief Luft. »Wir lassen die Fingerabdrücke schon landesweit abgleichen. Ich wette, dass wir fündig werden. Bei einem Typen wie dem liegt garantiert schon was vor. Natürlich geben wir alles weiter, was wir über ihn rausfinden, aber ich warte nicht ab, bis ich mehr Informationen bekomme, und Sie sollten das auch nicht tun. Am besten fangen Sie sofort an, nach ihm zu suchen. Haben Sie mein Fax bekommen? … Gut. Dann kopieren Sie es und lassen Sie es von Ihren Deputys verteilen.«
Während der Sheriff Fred versicherte, dass sein Department imstande sei, fast jeden Flüchtigen aufzuspüren, nickte Fred grüßend seinem Zwillingsbruder Doral zu, der sich eben neben ihm an den Streifenwagen lehnte.
Der Streifenwagen stand am Rand einer zweispurigen Landstraße im schmalen Schatten einer Reklametafel, die für einen Nachtklub am Flughafen von New Orleans warb. Fünfundsechzig Meilen von hier. Die kältesten Drinks. Die heißesten Mädchen. Komplett nackt.
Für Fred klang das durchaus verlockend, aber so wie er die Sache sah, hatte er für solche Vergnügungen vorerst keine Zeit. Nicht, bis Lee Coburn gefasst war.
»Sie haben richtig gehört, Sheriff. Noch nie musste ich an einem so blutigen Tatort ermitteln. Das war eine regelrechte Hinrichtung. Sam Marset wurde aus nächster Nähe durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet.«
Der Sheriff drückte seinen Abscheu über ein so brutales Verbrechen aus und verabschiedete sich dann mit dem Versprechen, sofort anzurufen, sobald der irre Mörder in seinem Bezirk entdeckt wurde.
»Dieser Windbeutel könnte einer Ziege die Hörner abschwatzen«, beklagte sich Fred bei seinem Bruder, sobald er die Verbindung getrennt hatte.
Doral reichte ihm einen Styroporbecher. »Du siehst aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen.«
»Keine Zeit.«
»Nimm sie dir.«
Ungeduldig zog Fred den Deckel vom Becher und nahm einen kleinen Schluck. Überrascht zuckte er zurück.
Doral lachte. »Ich dachte, du könntest etwas Aufmunterung brauchen.«
»Wir sind nicht umsonst Zwillinge. Danke.«
Während Fred seinen steifen Kaffee trank, ließ er den Blick über die Reihe von am Straßenrand geparkten Streifenwagen wandern. Dutzende uniformierter Polizisten der verschiedensten Polizeibehörden standen in Grüppchen herum, zum Teil telefonierend, zum Teil über große Karten gebeugt, aber durchwegs ratlos und eingeschüchtert angesichts der vor ihnen liegenden Aufgabe.
»Was für ein Dreck«, meinte Doral halblaut.
»Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß.«
»Ich bin als Vertreter der Stadtverwaltung hier und soll dir nur ausrichten, dass wir dir jede Unterstützung geben werden, die ich oder die Stadt anbieten können.«
»Als Chefermittler in diesem Fall bedanke ich mich für die Hilfe der Stadt«, erwiderte Fred ironisch. »Und nachdem wir damit den offiziellen Kack hinter uns gebracht haben, kannst du mir jetzt erklären, wohin er deiner Meinung nach getürmt ist.«
»Du bist der Bulle.«
»Aber du bist der beste Spurenleser weit und breit.«
»Vielleicht seit Eddie gestorben ist.«
»Also, Eddie ist nicht mehr da, und damit bist du es. Du bist ein halber Bluthund. Du könntest einen Floh auf einem Penner finden.«
»Ja, aber kein Floh ist so aalglatt wie dieser Typ.«
So wie Doral gekleidet war, war er nicht als städtischer Angestellter, sondern als Jäger gekommen, weil er fest damit gerechnet hatte, dass sein Bruder ihn dazu verdonnern würde, bei der Menschenjagd mitzumachen. Er setzte seine Baseballkappe ab und fächelte sich damit Luft zu, während sein Blick an den Waldrand ging, wo sich inzwischen alle versammelten, die bei der Suche mitmachen würden.
»Dass er so aalglatt ist, macht mir Sorgen.« Das hätte Fred niemandem außer seinem Bruder gestanden. »Wir müssen diesen Hurensohn kriegen, Doral.«
»Und zwar so schnell wie möglich, verfluchte Scheiße.«
Fred kippte den Rest seines whiskygetränkten Kaffees hinunter und warf den leeren Becher auf den Fahrersitz seines Wagens. »Bist du so weit?«
»Falls du auf mich gewartet hast, hättest du schon längst losgehen können.«
Die beiden stießen zum restlichen Suchtrupp. Da Fred die Fahndung leitete, gab er das Suchkommando. Die Polizisten schwärmten aus und durchkämmten das hohe Gras in Richtung der Bäume, bei denen der fast undurchdringliche Wald begann. Die Hundeführer ließen ihre Tiere von der Leine.
Sie starteten die Suche an dieser Stelle, weil ein Autofahrer, der gestern Nacht hier am Straßenrand einen Reifen gewechselt hatte, gesehen hatte, wie ein Mann in den Wald gelaufen war. Er hatte sich nichts weiter dabei gedacht, bis er heute Morgen im Radio die Meldung von dem Blutbad in der Lagerhalle der Royale Trucking Company gehört hatte. Die Schießerei hatte sich kurz vor dem Zeitpunkt ereignet, an dem er beobachtet hatte, wie ein Individuum – das er nicht beschreiben konnte, weil es zu weit weg gewesen war – zu Fuß eilig im Wald verschwunden war. Daraufhin hatte er das Tambour Police Department angerufen.
Es war keine besonders vielversprechende Spur, aber nachdem Fred und die anderen nichts anderes in der Hand hatten, waren sie hier zusammengekommen, um die Fährte aufzunehmen, die sie hoffentlich zu dem mutmaßlichen Mehrfachmörder, einem gewissen Lee Coburn, führen würde.
Doral hielt den Kopf gesenkt und studierte den Boden. »Kennt sich Coburn in der Gegend aus?«
»Keine Ahnung. Vielleicht kennt er sie wie seine Westentasche, vielleicht hat er auch noch nie einen Sumpf gesehen.«
»Hoffen wir das Beste.«
»In seinen Bewerbungsunterlagen stand, dass er in Orange, Texas, gewohnt hat, bevor er nach Tambour kam. Allerdings habe ich die Adresse überprüfen lassen. Es gibt sie nicht.«
»Also weiß niemand mit Sicherheit, woher er kam.«
»Niemand, den wir fragen könnten«, bestätigte Fred trocken. »Seine Kollegen auf der Laderampe sind alle tot.«
»Aber er hat seit dreizehn Monaten in Tambour gewohnt. Irgendwer muss ihn doch kennen.«
»Bis jetzt hat sich niemand gemeldet.«
»Aber es würde sich auch niemand melden, oder?«
»Wahrscheinlich nicht. Nach der Sache gestern Nacht möchte bestimmt niemand zugeben, dass er mit ihm befreundet war.«
»Ein Barkeeper? Eine Kellnerin? Jemand, bei dem er eingekauft hat?«
»Die Kollegen hören sich schon um. Eine Kassiererin bei Rouse’s, die ab und zu seine Einkäufe abkassiert hat, meinte, er sei ein angenehmer Kunde gewesen, aber nicht übermäßig freundlich. Er hätte ausschließlich bar bezahlt. Wir haben seine Sozialversicherungsnummer abgefragt. Keine Kreditkarte, keine Schulden. Kein Konto bei irgendeiner Bank im Ort. Mit seinen Lohnschecks ist er zu einer dieser Agenturen gegangen, die gegen Gebühr Schecks einlösen.«
»Der Mann wollte keine Spuren hinterlassen.«
»Und hat es auch geschafft.«
Doral wollte wissen, ob Coburns Nachbarn befragt worden seien.
»Von mir persönlich«, antwortete Fred. »Jeder in seinem Wohnblock kannte ihn vom Sehen. Die Frauen fanden ihn ganz attraktiv, jedenfalls in dieser gewissen Weise.«
»Und in welcher Weise?«
»Alle wären gern mit ihm in die Kiste gesprungen, aber alle hatten das Gefühl, dass das übel ausgehen würde.«
»Und das ist ›eine gewisse Weise‹?«
»Aber sicher doch.«
»Wer hat dir das gesagt?«
»Ich weiß es eben.« Er stupste seinen Bruder in die Rippen. »Natürlich verstehe ich mehr von Frauen als du.«
»Piss mir nicht ans Bein.«
Beide lachten kurz, dann wurde Fred wieder ernst. »Die Männer, mit denen ich geredet habe, meinten, er sei keiner, mit dem man sich anlegen sollte.«
»Hatte er eine Geliebte?«
»Nicht, soweit wir wissen.«
»Einen Geliebten?«
»Nicht, soweit wir wissen.«
»Die Wohnung habt ihr durchsucht?«
»Gründlich. Er wohnt in einem Ein-Zimmer-Apartment im Osten der Stadt, und nichts darin hat uns irgendwie weitergebracht. Arbeitsklamotten im Schrank. Hühnerpastete im Kühlschrank. Der Mann lebte wie ein Mönch. Eine zerfledderte Ausgabe der Sports Illustrated auf dem Couchtisch. Fernseher, aber kein Kabelanschluss. In der ganzen verfluchten Wohnung war nichts Persönliches zu finden. Kein Notizblock, kein Kalender, kein Adressbuch. Null Komma nichts.«
»Computer?«
»Fehlanzeige.«
»Was ist mit seinem Handy?«
Fred hatte am Tatort ein Handy gefunden und ermittelt, dass es keinem der hingerichteten Männer gehörte. »In letzter Zeit gab es nur einen ausgehenden Anruf bei dem miesen Chinesen, der sein Essen in der ganzen Stadt ausliefert, und einen eingegangenen Anruf von einem Telefonwerber.«
»Das ist alles? Zwei Anrufe?«
»In sechsunddreißig Stunden.«
»Verflucht.« Doral schlug nach einer Pferdebremse.
»Wir sind noch dabei, die früheren Anrufe zu überprüfen. Mal sehen, wem die Nummern gehören. Aber im Moment wissen wir nichts über Lee Coburn, außer dass er irgendwo da draußen ist und dass uns die Scheiße um die Ohren fliegen wird, wenn wir ihn nicht bald finden.« Fred senkte die Stimme. »Und mir ist es egal, ob wir ihn in Handschellen oder im Leichensack heimbringen. Weißt du, was für uns am praktischsten wäre? Wenn wir ihn tot aus irgendeinem Bayou fischen würden.«
»In der Stadt würde sich jedenfalls niemand beschweren. Die Leute hielten große Stücke auf Marset. Er war praktisch der Prinz von Tambour.«
Sam Marset war der Besitzer der Royale Trucking Company gewesen, dazu Präsident des Rotarierclubs, Kirchenvorstand der katholischen Gemeinde, ehemaliger Pfadfinder und Freimaurer. Er hatte im Vorstand mehrerer Vereine gesessen und mehr als einmal die Mardi-Gras-Parade im Ort angeführt. Er war ein Grundpfeiler der Gemeinde gewesen, und die Leute hatten ihn bewundert und gemocht.
Jetzt war er nur noch ein Leichnam mit einem Einschussloch im Kopf und einer zweiten Kugel in der Brust, als hätte die erste nicht ausgereicht, um ihn umzubringen. Die sechs weiteren Mordopfer würden wahrscheinlich nicht so schmerzlich vermisst, aber nach dem Mord an Marset hatte man noch an diesem Morgen eine Live-Pressekonferenz geben müssen. Sie war von zahllosen Lokalzeitungen aus dem Küstengebiet Louisianas verfolgt und von allen größeren Fernsehsendern rund um New Orleans aufgezeichnet worden.
Flankiert von Vertretern der Stadtverwaltung, darunter sein Zwillingsbruder, hatte Fred der Presse Rede und Antwort gestanden. Die Polizei von New Orleans hatte einen Porträtzeichner nach Tambour geschickt, der anhand der Beschreibungen von Coburns Nachbarn ein Phantombild angefertigt hatte: Es zeigte einen männlichen Weißen, etwa ein Meter neunzig groß, mittelschwer, athletisch gebaut, mit schwarzem Haar und blauen Augen, der seinen Arbeitsunterlagen zufolge vierunddreißig Jahre alt war.
Zum Abschluss der Pressekonferenz hatte Fred die Zeichnung in die Kameras gehalten und die örtliche Bevölkerung gewarnt, dass Coburn sich vermutlich noch in der Gegend aufhalte und höchstwahrscheinlich bewaffnet und gefährlich sei.
»Du hast ganz schön dick aufgetragen«, kommentierte Doral jetzt Freds abschließende Bemerkung. »Ganz egal, wie aalglatt Lee Coburn ist, inzwischen will ihm jeder ans Leder. Ich glaube nicht, dass er auch nur den Hauch einer Chance hat, von hier wegzukommen.«
Fred sah seinen Bruder an und zog eine Braue hoch. »Meinst du das ernst, oder ist das nur Wunschdenken?«
Ehe Doral darauf antworten konnte, läutete Freds Handy. Er warf einen Blick aufs Display und grinste seinen Bruder an. »Tom VanAllen. Das FBI eilt uns zu Hilfe.«
3
Coburn trat einen Schritt zurück, aber trotzdem konnte er die Angst der jungen Frau spüren. Gut. Es war besser, wenn sie sich fürchtete. Solange sie sich fürchtete, würde sie kooperieren. »Die suchen nach Ihnen«, stellte sie fest.
»Hinter jedem Baum.«
»Die Polizei, die Leute des Sheriffs, Freiwillige. Hunde.«
»Heute Morgen konnte ich sie bellen hören.«
»Sie werden Sie kriegen.«
»Noch haben sie mich nicht.«
»Sie sollten fliehen.«
»Das würde Ihnen gefallen, nicht wahr, Mrs. Gillette?«
Das erschrockene Aufleuchten in ihren Augen verriet, dass ihr bewusst war, was es bedeutete, dass er ihren Namen kannte. Er hatte sich nicht auf gut Glück in ihr Haus geflüchtet. Er hatte von Anfang an dorthin – zu ihr – gewollt.
»Mommy, das Kätzchen hat sich unter dem Busch versteckt und will nicht mehr rauskommen.«
Obwohl Coburn mit dem Rücken zur Tür stand, hatte er gehört, wie das Mädchen ins Haus gekommen war, wie ihre Sandalensohlen bei jedem Schritt in Richtung Küche auf den Holzboden klatschten. Trotzdem drehte er sich nicht um. Sein Blick lag weiter fest auf der Mutter des Kindes.
Deren Gesicht war kalkweiß. Die Lippen waren praktisch blutleer, und ihr Blick wechselte in panischer Angst zwischen ihm und dem Mädchen hin und her. Trotzdem musste Coburn ihr zugutehalten, dass sie es schaffte, fröhlich und unbeschwert zu klingen. »Das machen alle Kätzchen so, Em. Sie verstecken sich.«
»Warum denn?«
»Es hat Angst vor dir, schließlich kennt es dich nicht.«
»Das ist doch blöd.«
»Ja, das ist es. Richtig blöd.« Sie richtete den Blick wieder auf Coburn und ergänzte vielsagend: »Es sollte doch wissen, dass du ihm nichts tun würdest.«
Okay, er war nicht auf den Kopf gefallen. Er hatte verstanden. »Aber wenn ihm jemand was tut«, ergänzte er scheinbar freundlich, »dann kratzt es, und das tut scheußlich weh.« Während er in ihre vor Angst geweiteten Augen blickte, schob er die Pistole unauffällig in den Bund seiner Jeans, zog das T-Shirt darüber und drehte sich um. Die Kleine sah ihn mit unverhohlener Neugier an.
»Tut dein Aua weh?«
»Mein was?«
Sie zeigte auf seinen Kopf. Er hob die Hand und ertastete verklebtes Blut. »Nein, das tut nicht mehr weh.«
Dann ging er an ihr vorbei zum Tisch. Seit er in die Küche gekommen war, machte ihm der Duft von frischgebackenem Kuchen den Mund wässrig. Er zog die Papierhülle von einem Cupcake, biss die Hälfte ab und stopfte sich dann in einem Anfall von rasendem Hunger den Rest in den Mund, um sofort nach einem zweiten Küchlein zu greifen. Seit gestern Mittag hatte er nichts mehr gegessen, und er war die ganze Nacht durch den Sumpf gewatet. Er war am Verhungern.
»Du hast dir nicht die Hände gewaschen«, stellte das Kind empört fest.
Er schluckte den Kuchen in seinem Mund praktisch auf einen Sitz hinunter. »Was ist?«
»Du musst dir die Hände waschen, bevor du was isst.«
»Ach ja?« Er schälte das Papier von seinem zweiten Cupcake und biss herzhaft zu.
Das Kind nickte ernst. »Das muss jeder machen.«
Er warf der Frau, die sich inzwischen hinter ihre Tochter gestellt hatte und ihr schützend die Hände auf die Schultern legte, einen kurzen Blick zu. »Ich tue nicht immer das, was jeder macht«, sagte er. Ohne die beiden aus den Augen zu lassen, ging er zum Kühlschrank, öffnete ihn und holte die Milch heraus. Er drehte mit dem Daumen den Deckel ab, setzte die Plastikflasche an den Mund und trank in großen Schlucken.
»Mommy, jetzt trinkt er aus …«
»Ich weiß, Schatz. Aber das ist eine Ausnahme. Weil er so durstig ist.«
Das Kind beobachtete fasziniert, wie er fast einen Liter Milch trank, bevor er absetzte und Luft holte. Dann wischte er sich mit dem Handrücken über den Mund und stellte die Flasche in den Kühlschrank zurück.
Die Kleine rümpfte die Nase. »Deine Sachen sind ganz schmutzig, und du stinkst.«
»Ich bin ins Wasser gefallen.«
Sie sah ihn mit großen Augen an. »Aus Versehen?«
»Irgendwie schon.«
»Hattest du Flügel an?«
»Flügel?«
»Kannst du toter Mann machen?«
Verständnislos sah er die Mutter an. Sie erklärte: »Sie hat im Schwimmunterricht gelernt, wie man toter Mann macht.«
»Ich muss immer noch meine Flügel anziehen«, eröffnete ihm die Kleine. »Aber ich hab schon einen goldenen Stern auf mein Fertizikat gekriegt.«
Nervös drehte die Mutter das Kind um und schob es auf die Tür zum Wohnzimmer zu. »Ich glaube, jetzt kommt gleich deine Sendung. Willst du nicht ein bisschen fernsehen, während ich mit … mit unserem Besuch rede?«
Das Mädchen stemmte sich gegen den Griff der Mutter. »Du hast gesagt, ich darf die Schüssel auslecken.«
Nach kurzem Zögern nahm die Mutter den Gummispatel aus der Glasurschüssel und reichte ihn ihrer Tochter. Die nahm ihn glückselig entgegen und ermahnte ihn dann: »Noch mehr Cupcakes darfst du aber nicht essen. Die sind nämlich für die Geburtstagsfeier.« Dann hüpfte sie aus dem Raum.
Die Frau drehte sich zu ihm um, blieb aber stumm, bis Stimmen aus dem Fernseher zu hören waren. Dann fragte sie ihn: »Woher wissen Sie, wie ich heiße?«
»Sie sind doch Eddie Gillettes Witwe, richtig?« Sie starrte ihn nur an. »Das ist doch nicht so schwer zu beantworten. Ja oder nein?«
»Ja.«
»Wenn Sie also nicht wieder geheiratet haben …«
Sie schüttelte den Kopf.
»Dann ist davon auszugehen, dass Sie immer noch Mrs. Gillette heißen. Wie heißen Sie mit Vornamen?«
»Honor.«
Ehre? Er hatte noch nie jemanden getroffen, der so hieß. Aber andererseits war er hier in Louisiana. Hier hatten die Menschen die merkwürdigsten Namen, Vor- wie Nachnamen. »Also, Honor, mich brauche ich wohl nicht vorzustellen, oder?«
»In den Nachrichten haben sie gesagt, Sie heißen Lee Collier.«
»Coburn. Sehr erfreut. Bitte setzen Sie sich.« Er deutete auf den Stuhl am Küchentisch.
Sie zögerte, zog dann den Stuhl unter dem Tisch hervor und ließ sich langsam darauf sinken.
Er zerrte ein Handy aus der Vordertasche seiner Jeans, tippte eine Nummer ein, angelte sich dann mit der Stiefelspitze einen zweiten Stuhl und setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. Während er dem Läuten am anderen Ende der Leitung lauschte, ließ er sie nicht aus den Augen.
Sie rutschte auf ihrem Sitz herum. Erst rang sie die Hände im Schoß und wandte das Gesicht ab, kurz darauf richtete sie fast trotzig den Blick auf ihn und starrte zurück. Sie stand Todesängste aus, wollte das aber auf keinen Fall zeigen. Die Lady hatte Rückgrat, aber damit konnte er umgehen. Ihm war eine kleine Kämpferin lieber als eine jammernde Heulsuse.
Als sich am anderen Ende eine Automatenstimme meldete, fluchte er leise, wartete das Piepsen ab und sagte: »Du weißt, wer dran ist. Hier ist die Hölle los.«
Sobald er aufgelegt hatte, fragte sie: »Sie haben einen Komplizen?«
»Könnte man so sagen.«
»War er auch bei … der Schießerei?«
Er sah sie nur an.
Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und zog die Unterlippe zwischen die Zähne. »In den Nachrichten hieß es, dass dabei sieben Menschen getötet wurden.«
»So viele habe ich auch gezählt.«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und umklammerte ihre Ellbogen. »Warum haben Sie die Leute umgebracht?«
»Was sagen sie denn im Fernsehen dazu?«
»Dass Sie ein Angestellter seien und einen Groll gegen Ihren Arbeitgeber gehegt hätten.«
Er zuckte mit den Achseln. »Das mit dem Groll könnte passen.«
»Sie konnten die Firma nicht leiden?«
»Nein. Und den Boss schon gar nicht.«
»Sam Marset. Aber die anderen waren doch nur Schichtarbeiter, genau wie Sie. War es wirklich nötig, sie zu erschießen?«
»Ja.«
»Warum?«
»Weil sie Zeugen waren.«
Seine barschen Antworten schienen sie gleichermaßen zu verblüffen und zu schockieren. Er sah, wie ein Schaudern durch ihren Körper lief. Eine Weile blieb sie still sitzen und starrte nur auf die Tischplatte.
Dann hob sie langsam den Kopf und sah ihn an. »Woher kannten Sie meinen Mann?«
»Ehrlich gesagt, hatte ich nie das Vergnügen. Aber ich habe von ihm gehört.«
»Über wen?«
»Bei Royale Trucking wird oft über ihn gesprochen.«
»Er wurde in Tambour geboren und ist hier aufgewachsen. Jeder kannte Eddie, und jeder mochte ihn.«
»Sind Sie sich da ganz sicher?«
Sie sah ihn empört an. »Aber ja.«
»Unter anderem war er Polizist, nicht wahr?«
»Was meinen Sie mit ›unter anderem‹?«
»Ihr Mann, der verstorbene, verehrte Polizist Eddie, war im Besitz von etwas sehr Wertvollem. Ich bin hergekommen, um es zu holen.«
Bevor sie antworten konnte, begann das Telefon in seiner Tasche, ihr Telefon, zu läuten und unterbrach ihr Gespräch. Coburn zog es wieder aus der Tasche. »Wer ist Stanley?«
»Mein Schwiegervater.«
»Grandpa«, wiederholte er, was die Kleine draußen im Garten gesagt hatte.
»Wenn ich nicht drangehe …«
»Vergessen Sie’s.« Er wartete, bis das Telefon aufgehört hatte zu läuten, und nickte dann zu den Cupcakes hin. »Wer hat eigentlich Geburtstag?«
»Stan. Er kommt zum Abendessen, um mit uns zu feiern.«
»Um welche Uhrzeit? Und ich rate Ihnen, mich nicht anzulügen.«
»Um halb sechs.«
Er sah auf die Wanduhr. Das war in knapp acht Stunden. Bis dahin hatte er hoffentlich gefunden, was er suchte, und war längst über alle Berge. Allerdings hing viel davon ab, wie Eddie Gillettes Witwe reagierte und wie viel sie tatsächlich über die Nebentätigkeiten ihres verstorbenen Mannes wusste.
Er sah ihr an, dass ihre Angst nicht gespielt war. Aber fürchten konnte sie sich aus den verschiedensten Gründen, und einer davon war möglicherweise, dass sie das bewahren wollte, was sie besaß, und Angst hatte, dass er es ihr wegnehmen könnte.
Oder aber sie war vollkommen unschuldig und fürchtete einfach um ihr Leben und das ihres Kindes.
So wie es aussah, lebten die beiden allein hier draußen in der Wildnis. Nichts im Haus deutete darauf hin, dass hier ein Mann wohnte. Natürlich musste die einsame Witwe Todesängste ausstehen, wenn plötzlich ein blutverschmierter Fremder auftauchte und sie mit einer Waffe bedrohte.
Obwohl die Tatsache, dass sie allein lebte, nicht automatisch ein Beweis für Tugendhaftigkeit war, dachte Coburn. Schließlich lebte auch er allein.
Auch das Äußere konnte täuschen. Natürlich sah sie unschuldig aus, vor allem in diesen Sachen. Das weiße T-Shirt, die kurzen Bluejeans und die weißen Retro-Turnschuhe wirkten so bodenständig wie selbst gebackene Cupcakes. Die blonden Haare hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz zusammengefasst. Ihre Augen waren grün. Sie sah aus wie das typisch amerikanische, adrette Mädchen von nebenan, nur dass Coburn noch nie neben jemandem gewohnt hatte, der so gut ausgesehen hatte wie sie.
Als er die knappen Höschen auf dem Wäscheständer in der Waschküche gesehen hatte, war ihm wieder bewusst geworden, wie lange er mit keiner Frau mehr zusammen gewesen war. Und beim Anblick der weichen Hügel unter Honor Gillettes T-Shirt und ihrer langen glatten Beine spürte er nur zu deutlich, wie gern er seine lange Abstinenzphase beenden würde.
Offenbar ahnte sie, wohin seine Gedanken abgeschweift waren, denn als er den Blick wieder von ihren Brüsten hob und ihr in die Augen sah, beobachtete sie ihn ängstlich. Schnell meinte sie: »Sie sitzen bis zum Hals in der Tinte, und hier vergeuden Sie nur Zeit. Ich kann Ihnen nicht helfen. Eddie besaß bestimmt nichts wirklich Wertvolles.« Sie hob die Hände. »Sie sehen doch selbst, wie einfach wir leben. Als Eddie starb, musste ich sein Angelboot verkaufen, sonst wäre ich nicht über die Runden gekommen, bis ich wieder unterrichten konnte.«
»Unterrichten.«
»In der Grundschule. Zweite Klasse. Eddie hat mir nichts hinterlassen als eine kleine Lebensversicherung, die kaum die Beerdigungskosten abdeckte. Nachdem er nur acht Jahre bei der Polizei war, bekomme ich nur eine winzige Witwenrente. Und die wandert direkt in Emilys Collegefonds. Wir leben ausschließlich von meinem Gehalt, und davon bleibt so gut wie nichts übrig.«
Sie holte tief Luft. »Man hat Sie falsch informiert, Mr. Coburn. Oder Sie sind einem Gerücht aufgesessen und haben die falschen Schlüsse gezogen. Eddie hat nichts Wertvolles besessen, und ich besitze auch nichts Wertvolles. Falls ich etwas hätte, würde ich es Ihnen liebend gern überlassen, um Emily zu schützen. Ihr Leben ist kostbarer als alles, was ich je besitzen könnte.«
Er sah sie nachdenklich an und erwiderte nach einigen Sekunden: »Schön gesprochen, aber das überzeugt mich nicht.« Er stand auf, beugte sich vor, packte sie wieder am Oberarm und zog sie aus ihrem Stuhl. »Als Erstes nehmen wir uns das Schlafzimmer vor.«
4
Auf der Straße nannten sie ihn Diego.
Anders hatte man ihn noch nie genannt, und soweit ihm bekannt war, hatte er auch keinen anderen Namen. Seine frühesten Erinnerungen drehten sich um eine dürre schwarze Frau, die ihm befahl, ihr die Zigaretten oder eine Spritze zu bringen, und die ihn beschimpfte, wenn er nicht sofort gehorchte.
Ob sie seine Mutter war, wusste er nicht. Sie hatte das nie behauptet, aber sie hatte es auch nicht abgestritten, als er sie ein einziges Mal danach gefragt hatte. Er war nicht schwarz, jedenfalls nicht richtig. Sein Name klang spanisch, aber das sagte nichts über seine Herkunft aus. Sogar in New Orleans, wo sich die Rassen schon immer gemischt hatten, war er nicht mehr als ein Straßenköter.
Die Frau in seinen Erinnerungen hatte davon gelebt, Zopffrisuren zu flechten. Ihren Salon hatte sie nur geöffnet, wenn sie Lust hatte zu arbeiten, was selten genug vorgekommen war. Wenn sie schnell Geld gebraucht hatte, hatte sie im Hinterzimmer den männlichen Kunden andere Dienste geleistet. Sobald Diego alt genug gewesen war, hatte sie ihn losgeschickt, um auf der Straße Werbung zu machen. Die Frauen hatte er mit dem Versprechen angelockt, sie würden die festesten Rastazöpfe von ganz New Orleans bekommen. Männern hatte er die anderen Vergnügungen angedeutet, die hinter dem Glasperlenvorhang in der Tür zur Straße zu finden waren.
Eines Tages war er nach Hause gekommen, nachdem er auf der Straße nach etwas Essbarem gesucht hatte, und hatte sie tot auf dem verdreckten Badezimmerboden gefunden. Er hatte bei ihr ausgeharrt, bis selbst er den Gestank nicht mehr ertragen hatte, und war dann getürmt. Sollte sich doch jemand anderer um den aufgedunsenen Leichnam kümmern. Seit jenem Tag war er auf sich allein gestellt. Sein Jagdgebiet war ein Stadtviertel von New Orleans, das selbst die Engel aus Angst mieden.
Inzwischen war er siebzehn und seinen Jahren an Erfahrung weit voraus.
Sein Handy vibrierte, und er sah auf das Display. Unbekannte Nummer. Anders gesagt, er bekam einen neuen Auftrag. Er antwortete mit einem mürrischen »Ja?«.
»Das klingt ziemlich gereizt, Diego.«
Schon eher stinksauer. »Warum hast du nicht mich eingesetzt, um die Sache mit Marset zu klären? Aber du wolltest ja nicht. Und jetzt sieh dir an, was passiert ist.«
»Du hast von dem Lagerhaus und Lee Coburn gehört?«
»Ich habe einen Fernseher. Flatscreen.«
»Den du von meinem Geld gekauft hast.«
Diego ließ das unkommentiert. Sein Gesprächspartner brauchte nicht zu wissen, dass Diego auch andere Geldquellen hatte. Gelegentlich arbeitete er auch für andere Kunden.
»Schusswaffen«, meinte er verächtlich. »Was für ein Krach. Warum mussten sie alles in Fetzen schießen? Ich hätte Marset still und leise erledigt, und allen wäre der Zirkus erspart geblieben, der jetzt in Tambour einzieht.«
»Ich wollte etwas klarstellen.«
Legt euch nicht mit mir an. Das hatte klargestellt werden sollen. Diego vermutete, dass jeder, der in diesem Geschäft tätig war und von der Schießerei gehört hatte, heute Morgen besonders vorsichtig war. Obwohl Marsets Exekution so stümperhaft durchgeführt worden war, hatte sie ihre Wirkung nicht verfehlt.
»Lee Coburn ist immer noch auf freiem Fuß«, meinte Diego fast stichelnd.
»Stimmt. Ich lasse mich über die Suche auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass er schon tot ist, wenn sie ihn finden, aber falls nicht, muss er zum Schweigen gebracht werden. Genau wie jeder, mit dem er gesprochen hat, seit er aus diesem Lagerhaus verschwunden ist.«
»Darum rufst du also an.«
»Es ist ziemlich knifflig, an jemanden im Polizeigewahrsam heranzukommen.«
»Knifflig ist meine Spezialität. Ich komme schon an ihn ran. So wie noch jedes Mal.«
»Darum bist du mein Mann für diesen Job, sollte er nötig werden. Bei Marset hätte ich dein Talent verschwendet. Ich brauchte jemanden, der Krach schlägt und eine Menge Blut hinterlässt. Aber nachdem das jetzt erledigt ist, will ich keine losen Enden zurücklassen.«
Keine losen Enden. Keine Gnade. Das Mantra, nach dem hier gearbeitet wurde. Wer sich vor der Drecksarbeit zu drücken versuchte, war gewöhnlich das nächste Opfer.
Ein paar Wochen zuvor war ein mexikanischer Junge von einem überladenen Lkw entkommen, auf dem er in die Staaten geschmuggelt worden war. Er und eine Handvoll anderer Jungen waren für irgendwelche Sklavendienste bestimmt gewesen. Offenbar hatte der Junge geahnt, was die Zukunft für ihn bereithielt. Bei einem Tankstopp war er getürmt, während der Fahrer den Sprit bezahlt hatte.
Zum Glück hatte ein State Trooper, der ebenfalls auf der Gehaltsliste stand, ihn dabei erwischt, wie er auf dem Freeway in Richtung Westen trampen wollte. Der Highway-Polizist hatte den Jungen versteckt und den Befehl bekommen, das Problem zu lösen. Leider hatte er in letzter Minute den Schwanz eingezogen.
Daraufhin hatte Diego den Auftrag bekommen, den Jungen abzuholen und die Schmutzarbeit zu erledigen. Eine Woche nach dem Tod des Jungen war Diego dann ein weiteres Mal losgeschickt worden, um nicht nur den nachlässigen Lastwagenfahrer zu beseitigen, dem der Junge entwischt war, sondern auch den Trooper, der sich nicht nur als gierig, sondern auch als feige erwiesen hatte.
Keine losen Enden. Keine Gnade. Mit dieser kompromisslosen Haltung machte man die Menschen ängstlich und fügsam.
Nur dass Diego vor niemandem Angst hatte. Darum antwortete er auf die fast mürrisch klingende Frage aus dem Telefon: »Hast du das Mädchen gefunden, das aus dem Puff abgehauen ist?«, fast fröhlich: »Gestern Abend.«
»Sie macht keine Probleme mehr?«
»Höchstens den Engeln. Oder dem Teufel.«
»Der Leichnam?«
»Ich bin kein Idiot.«
»Diego, nur eins ist noch lästiger als ein Idiot – und das ist ein Klugscheißer.«
Diego zeigte dem Handy den Stinkefinger.
»Ich muss Schluss machen, da ruft jemand an. Halte dich bereit.«
Diego schob die Hand in die Hosentasche und spielte mit dem Rasiermesser, das überall gefürchtet war. »Ich bin immer bereit«, versicherte er, doch die Leitung war schon wieder tot.
5
Emily war so vertieft in ihre Sendung, dass sie sich nicht einmal umdrehte, als Honor und Coburn das Wohnzimmer durchquerten.
Sobald sie im Schlafzimmer standen, wand Honor den Arm aus seinem Griff und rieb sich den schmerzenden Muskel. »Ich will nicht erschossen werden, und ich würde ganz bestimmt nicht riskieren, dass Emily etwas passiert, darum würde ich auf keinen Fall weglaufen und sie allein zurücklassen. Sie brauchen also nicht grob zu werden.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!