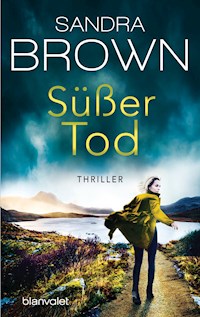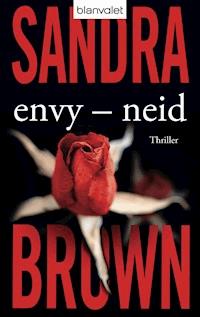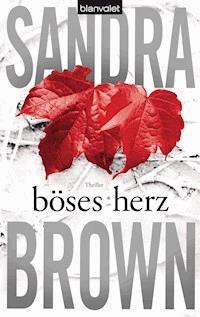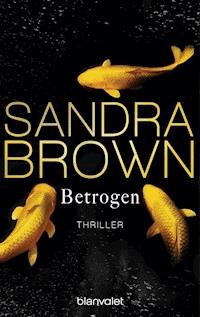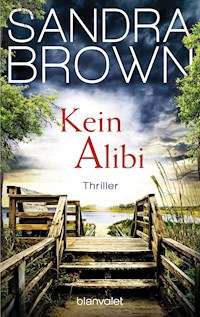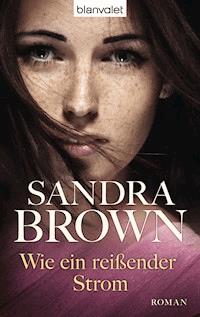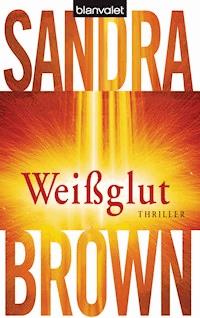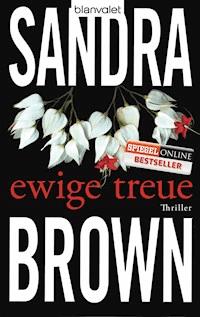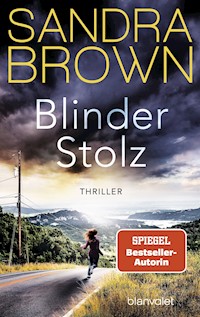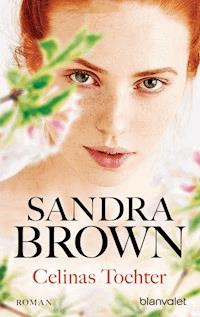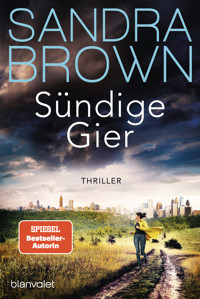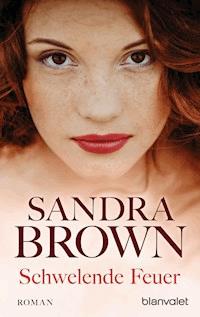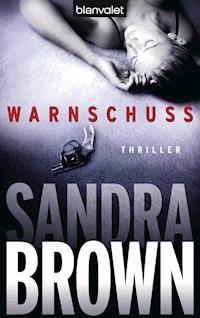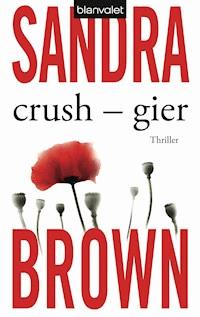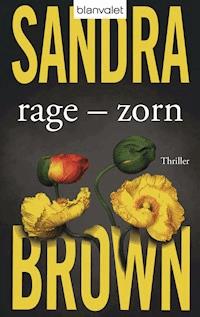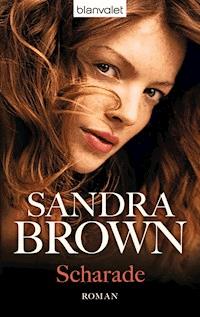
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der erfolgreichen Schauspielerin Cat Delaney stehen in Hollywood buchstäblich alle Türen offen – bis eine Herzoperation das Leben der jungen Frau völlig umkrempelt: Von einem Tag auf den anderen zieht Cat in den kleinen Ort San Antonio, wo sie viel Ruhe und sogar eine neue Liebe findet – den Expolizisten Alex Pierce. Doch dann erfährt sie zufällig von einer Reihe mysteriöser Unfälle, der nur Menschen zum Opfer fallen, die wie sie ein neues Herz bekommen haben! Und plötzlich ist auch Cats Leben in Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Cat Delaney ist eine echte Karrierefrau – dynamisch, zielstrebig und erfolgsorientiert. Ihrem Beruf als Schauspielerin beim Fernsehen ordnet sie alles andere unter. Doch dann stellen die Ärzte Cat eine schreckliche Diagnose, die ihr Leben von Grund auf durcheinander bringt: Sie muss sich so schnell wie möglich einer schweren Herzoperation unterziehen.
Und so beginnt mit der erfolgreich verlaufenen Transplantation für die einst so ehrgeizige Cat ein völlig neuer Lebensabschnitt. Sie verlässt das schillernde Hollywood, um nach San Antonio zu ziehen, wo sie sich für die Probleme von Waisenkindern engagiert. Eines Tages begegnet sie Alex Pierce, einem Expolizisten, der ihr mit der Zeit wieder neues Selbstbewusstsein schenkt. Als Cat dann jedoch zufällig von mysteriösen »Unfällen« erfährt, die all jene ereilen, die etwa gleichzeitig mit ihr ein neues Herz bekommen haben, sieht sie ihre Umgebung plötzlich in einem ganz anderen Licht ...
Autorin
Sandra Brown ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Jeder ihrer Romane erreicht Spitzenplätze in den englischen und amerikanischen Bestellerlisten. Sandra Brown wurde mehrfach mit dem New York Times Award ausgezeichnet, und ihre Bücher werden weltweit in neunundzwanzig Sprachen übersetzt. In Deutschland ist gerade ihr neuer Psychothriller »Rage-Zorn« erschienen. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie in Arlington, Texas.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sandra-brown.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
10. Oktober 1990
»Cat, wach auf! Wir haben ein Herz!«
Nur mühsam gelang es Cat Delaney, aus der von Medikamenten verursachten, klebrigen Benommenheit in die Realität aufzutauchen. Sie schlug die Augen auf und versuchte, den Blick auf Dean zu richten. Nur verschwommen nahm sie ihn wahr, sah aber sein breites, strahlendes und vielversprechendes Lächeln.
»Wir haben ein Herz für dich!« wiederholte er.
»Wirklich?« fragte sie mit heiserer und schwacher Stimme. Als sie in die Klinik eingeliefert worden war, hatte sie die Aussicht gehabt, diese entweder mit einem neuen Herzen wieder zu verlassen – oder im Sarg.
»Das Rettungsteam ist unterwegs und bringt es hierher.«
Dr. Dean Spicer wandte sich zu seinen Kollegen um, die ihn auf die Intensivstation begleitet hatten. Cat vernahm zwar seine Stimme, doch was er sagte, schien keinen Sinn zu ergeben.
Träumte sie? Nein. Dean hatte gerade klar und deutlich gesagt, daß ein Spenderherz unterwegs war. Ein neues Herz – für sie! Leben!
Plötzlich spürte sie einen Energieschub wie schon seit Monaten nicht mehr. Sie setzte sich in ihrem Krankenhausbett auf und plauderte mit den Schwestern und Technikern, die um sie herumschwirrten und sie mit Infusionsnadeln und Kathetern malträtierten.
Diese schmerzhafte Prozedur war schon derart alltäglich für sie geworden, daß sie diese kaum noch wahrnahm. Während der vergangenen Monate war ihr so viel Blut abgezapft worden, daß es für einen Swimmingpool gereicht hätte. Sie hatte erheblich an Gewicht verloren und war – ohnehin von zarter Statur – fast nur noch Haut und Knochen.
»Dean? Wo ist Dean?«
»Ich bin hier.« Der Kardiologe schob sich zwischen den anderen durch zu ihr ans Bett und ergriff ihre Hand. »Habe ich dir nicht immer gesagt, daß wir rechtzeitig ein Spenderherz für dich auftreiben werden?«
»Ihr Ärzte seid doch alle gleich. Rechthaberisch und eingebildet bis zum Gehtnichtmehr. Halbgötter allesamt.«
»Das will ich überhört haben.« Dr. Jeffries, der für die Transplantation verantwortliche Herzchirurg, betrat das Zimmer so lässig, als sei er bei seinem abendlichen Spaziergang – über Wasser. Er entsprach haargenau dem Klischee, auf das sie mit ihrer Bemerkung angespielt hatte. Sie wußte um sein Können, vertraute seinen Fähigkeiten, konnte ihn aber persönlich überhaupt nicht leiden.
»Was machen Sie denn hier?« fragte sie. »Sollten Sie jetzt nicht eigentlich im OP sein und Ihre Instrumente sterilisieren?«
»Schnippisch wie eh und je. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ein Fernsehstar?«
»Haargenau.«
Ungerührt wandte sich der Chirurg der Schwester der Intensivstation zu. »Hat die Patientin Fieber?«
»Nein.«
»Erkältung? Virusinfektionen irgendwelcher Art?«
»Was soll das?« mischte sich Cat verärgert ein. »Wollen Sie etwa einen Rückzieher machen? Schon auf einen freien Abend gefreut? Was Besseres vor?«
»Reiner Routinecheck, ob Sie wohlauf sind.«
»Das bin ich. Nehmen Sie das Herz und tauschen Sie es aus. Meinetwegen auch ohne Narkose.«
Ohne ein Wort wandte er sich um und verließ das Zimmer.
»Arrogantes Arschloch«, murmelte Cat.
»Sag so was nicht«, mahnte Dean sie in heiterem Ton. »Du wirst ihn heute abend noch brauchen.«
»Wann geht es los?« wollte Cat wissen.
»Ein bißchen Geduld wirst du schon noch brauchen.«
Sie drängte auf eine genauere Auskunft, doch erfolglos. Angewiesen, sich auszuruhen, doch innerlich zu aufgeputscht, lag sie hellwach in ihrem Bett und schaute immer wieder auf die Uhr, während die Stunden quälend langsam verstrichen. Sie war mehr aufgeregt als ängstlich.
Die Neuigkeit von der bevorstehenden Transplantation machte rasch die Runde im Krankenhaus. Operationen wie eine Herzverpflanzung zählten zwar längst zur Routine, wurden aber dennoch mit Ehrfurcht betrachtet. Den ganzen Abend über bekam Cat Besuch von Menschen, die ihr Glück wünschten.
Cat erhielt ein Jodbad; eine klebrige und unangenehme Prozedur, die ihre Haut kupfern färbte. Sie schluckte ihre erste Dosis Cyclosporin, das lebenswichtige Medikament gegen Gewebeabstoßung. Die Flüssigkeit war in Kakao eingerührt worden in dem vergeblichen Versuch, den Olivenölgeschmack zu überdecken. Cat beschwerte sich noch darüber, als Dean ins Zimmer gestürmt kam und die ersehnte Nachricht überbrachte.
»Sie sind unterwegs mit dem neuen Herz. Bist du bereit?«
»Ist der Papst katholisch?«
Er beugte sich über sie und küßte sie auf die Stirn. »Ich werde jetzt runtergehen und mich umziehen. Keine Sorge, ich werde die ganze Zeit dabeisein und Jeffries über die Schulter schauen.« Er hielt kurz inne. »Ich werde dich bei jedem Schritt begleiten.«
Sie packte ihn beim Ärmel. »Wenn ich aufwache, will ich sofort wissen, ob ich ein neues Herz habe.«
»Aber sicher.«
Sie hatte schon von anderen Patienten gehört, denen gesagt worden war, daß man ein passendes Spenderherz für sie gefunden habe. Ein Mann, den sie kannte, war sogar schon für die Operation vorbereitet und narkotisiert gewesen. Als das Herz eingetroffen war, hatte Dr. Jeffries es untersucht und für mangelhaft befunden. Die Transplantation hatte nicht stattgefunden. Für den Patienten war dies ein derart schwerer emotionaler Rückschlag gewesen, daß er sich noch immer nicht davon erholt hatte; was der kritischen Verfassung seines Herzens ganz sicher nicht gutgetan hatte.
Nun zog Cat überraschend kräftig am Ärmel von Deans Armani-Jackett. »Ich will es sofort wissen, wenn ich wieder aufwache. Versprich es mir!«
Er legte seine Hand auf ihre und nickte. »Ich gebe dir mein Wort drauf.«
»Dr. Spicer – bitte!« drängelte eine der Schwestern.
»Wir sehen uns im OP, Schatz.«
Nachdem Dean gegangen war, ging alles ungeheuer schnell. Cat hielt sich am Rand der Bahre fest, als man sie den Flur hinunterschob. Als sie durch die Flügeltür in den OP gerollt wurde, wurde sie für einen Moment vom gleißenden Licht geblendet und war verwirrt wegen des maskierten Personals, das sich mit konzentrierten und geschickten Handgriffen auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitete.
Hinter den gleißenden Strahlern über dem Operationstisch konnte sie einige Gesichter hinter der Glasscheibe oben auf der Observationsgalerie ausmachen.
»Wie ich sehe, habe ich Publikum. Haben die da oben alle Eintrittskarten und Programmhefte? Wer sind die überhaupt? Hey, würde mir vielleicht mal jemand antworten? Was macht ihr denn da?«
Jemand mit Atemschutz und Gummihandschuhen stöhnte auf und fragte: »Wo bleibt denn Dr. Ashford?«
»Schon da.« Der Anästhesist kam hereingeeilt.
»Gott sei Dank. Schalten Sie sie endlich ab, damit wir anfangen können.«
»Die kann einem mit ihrer Klappe gehörig auf den Wecker gehen.«
Cat wußte, daß es nicht so gemeint war, und war daher nicht beleidigt. Die Augen über der Maske lächelten ihr zu. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung im OP, und so war es ihr auch lieber.
»Kein Wunder, daß ihr alle Masken tragt, wenn ihr den ganzen Tag eure Patienten beleidigt«, lästerte Cat. »Feiglinge, die ihr alle seid.«
Der Anästhesist trat an ihre Seite. »Mir scheint, daß wir ein wenig hyperaktiv und überdreht sind, Ms. Delaney...«
»Das ist mein großer Auftritt. Ich spiele die Szene so, wie es mir paßt.«
»Sie werden umwerfend sein.«
»Haben Sie mein neues Herz schon gesehen?«
»Nein, das Interessante kriege ich immer nicht mit. Ich sorge nur für süße Träume. Und jetzt entspannen, bitte.« Er tupfte ihren Handrücken zur Vorbereitung für die Injektion ab. »Gleich werden Sie einen klitzekleinen Piekser spüren.«
»Das sagt ihr Männer alle.«
Gelächter ringsum.
Dr. Jeffries traf zusammen mit Dean und Dr. Sholden ein, dem Kardiologen, an den Dean sie überwiesen hatte, nachdem er aus persönlichen Gründen von der Behandlung zurückgetreten war.
»Wie sieht’s aus?« fragte Dr. Jeffries.
»Sie sollten mal Ihr Script überprüfen lassen, Doktor«, sagte Cat mißbilligend. »Eigentlich müßte ich ›Wie sieht’s aus?‹ fragen.«
»Wir haben das Herz untersucht«, antwortete der Arzt ruhig.
Sie hielt erwartungsvoll den Atem an, sah dann stirnrunzelnd zu ihm auf. »Solche Antworten setzten wir bei den Fernsehserien auch immer ein, um die Spannung zu erhöhen. Das ist billig. Sagen Sie schon – was ist mit dem Herz?«
»Es ist wunderschön«, antwortete Dr. Sholden. »Sieht fabelhaft aus. Steht Ihr Name drauf.«
Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Gruppe von OP-Technikern wahr, die über eine Kühltruhe gebeugt hantierten.
»Wenn du aufwachst, wird es in deiner Brust schlagen«, sagte Dean.
»Bereit?« fragte Dr. Jeffries.
War sie bereit?
Natürlich hatte sie, als die Möglichkeit einer Herztransplantation zum erstenmal mit ihr besprochen wurde, Bedenken gehabt. Doch mittlerweile hatte sie diese für komplett ausgeräumt gehalten.
Kurz nachdem Dean ihr Herzproblem erstmalig diagnostizierte, hatte sich ihre Verfassung langsam, aber stetig verschlechtert. Über die tiefe Müdigkeit und den Mangel an Energie halfen kurzfristig Medikamente hinweg, doch gegen die Krankheit selbst gab es laut Dean keine Kur. Doch sogar zu diesem Zeitpunkt hatte sie sich geweigert, den Ernst ihrer Erkrankung anzuerkennen.
Erst als sie sich wirklich krank zu fühlen begann, als schon das Duschen oder Essen zu einer wahren Strapaze und mühseligen Übung für sie wurde, begriff sie, daß ihre Herzschwäche tödlich sein konnte.
»Ich brauche ein neues Herz.«
Bis zu ihrer tapferen und gewagten Ankündigung gegenüber ihren Chefs beim Fernsehsender hatte niemand etwas von ihren gesundheitlichen Problemen geahnt. Ihre Schauspielerkollegen und das Aufnahmeteam der Vormittagsfernsehserie Der Lauf der Dinge hatten, obwohl sie sich jeden Tag bei der Arbeit sahen, nie etwas von der zunehmenden und verräterischen Blässe unter ihrer Schminke bemerkt.
Und so reagierten ihre Kollegen wie ihre Vorgesetzten beim Sender — niemand wollte es wahrhaben. Niemand wollte glaubten, daß Cat Delaney, dreimalige EMMY-Preisträgerin, ihr Star, deren Rolle der Laura Madison unverzichtbar für die Serie war, daß ausgerechnet Cat Delaney ernsthaft krank sein sollte. Und so hatte sie noch eine Weile ihre Arbeit fortgesetzt, unterstützt von ihrem Team und mit Hilfe ihres schauspielerischen Könnens und ihrer robusten Art.
Doch dann war unweigerlich der Punkt gekommen, als sie – ungeachtet ihres großen Ehrgeizes – den strapaziösen Drehplan nicht mehr bewältigen konnte, und so war sie vorübergehend aus der Serie ausgeschieden.
Mit fortwährender Verschlechterung ihres Zustands verlor sie so viel an Gewicht, daß ihre große Fangemeinde sie nicht mehr erkannt hätte. Sie hatte tiefe Ringe unter den Augen, weil sie trotz ihrer völligen Erschöpfung nicht schlafen konnte. Ihre Fingerkuppen und Lippen färbten sich blau.
Die Boulevardpresse dichtete ihr alle möglichen Krankheiten an; angefangen von Windpocken bis hin zu Aids. Normalerweise hätte diese Art häßlicher Ausbeutung durch die Medien sie wütend gemacht und beunruhigt, doch dazu fehlte ihr längst die Energie. Also ignorierte sie derartige Meldungen und konzentrierte sich aufs Überleben.
Ihre Verfassung wurde derart instabil und ihre Depressionen so schlimm, daß sie eines Nachmittags zu Dean sagte: »Ich habe es so satt, schwach und nutzlos zu sein, von mir aus kann bald der Abspann kommen.«
Für gewöhnlich mißbilligte Dean ihre Anspielungen auf den Tod, auch die scherzhaften, doch an diesem Tag spürte er ihr Bedürfnis, sich die plagenden Ängste von der Seele zu reden.
»Sag, was geht dir durch den Kopf?« fragte er.
»Ich führe schon tägliche Gespräche mit dem Tod«, gestand sie leise. »Ich verhandle mit ihm. Morgens sage ich: ›Gönn mir noch diesen einen Tag. Bitte, einen Tag noch.‹ Bei allem, was ich tue, bin ich mir bewußt, daß es vielleicht das letzte Mal ist. Das letzte Mal, daß ich den Regen sehe. Ananas esse, einen Song der Beatles höre.«
Sie hob den Blick und sah Dean an. »Ich habe meinen Frieden mit Gott geschlossen. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich hoffe, daß es nicht schmerzvoll und beängstigend ist. Wie wird es sein, wenn ich mich verabschiede, Dean?«
Er tat ihre Ängste nicht leichtfertig ab, sondern antwortete ihr aufrichtig: »Dein Herz wird ganz einfach aufhören zu schlagen, Cat.«
»Keine Fanfare? Kein Trommelwirbel?«
»Nein. Es wird nicht so traumatisch sein wie ein Herzinfarkt. Kein Kribbeln im Arm. Dein Herz wird einfach –«
»Aufgeben.«
»Richtig.«
Dieses Gespräch war erst einige Tage her. Nun sah ihre Zukunft durch eine Laune des Schicksals völlig anders aus: Leben.
Doch plötzlich wurde ihr bewußt, daß die Ärzte, um ihr ein neues Herz einpflanzen zu können, zuvor ein anderes herausschneiden mußten. Diese Vorstellung ließ sie frösteln. Sosehr sie das nicht mehr funktionstüchtige Organ haßte, das während der vergangenen zwei Jahre ihr Leben völlig bestimmt hatte, so groß war ihre unerklärliche Zuneigung zu ihm. Gewiß, sie wollte ihr krankes Herz endlich loswerden, doch irgendwie kam es ihr obszön vor, wie gutgelaunt diejenigen nun waren, die es ihr gleich entfernen würden.
Natürlich war es jetzt zu spät für Skrupel. Außerdem war der Eingriff – verglichen mit anderen Operationen am offenen Herzen – relativ simpel. Aufschneiden. Rausnehmen. Austauschen. Zunähen.
Während der Zeit des Wartens auf ihr Spenderherz war sie von den Ärzten immer wieder ermuntert worden, Fragen zu stellen. Sie hatte sie in endlose Diskussionen verstrickt und so viele Informationen wie möglich aufgesogen. Bei den Treffen ihrer Selbsthilfegruppe, die aus anderen Patienten bestand, die ebenfalls auf eine Organspende warteten, waren ihre Ängste offen ausgesprochen worden. Diese Sitzungen waren stets äußerst interessant und hilfreich für sie gewesen, weil eine Transplantation ein facettenreiches Thema mit sehr unterschiedlichen und kontroversen Positionen war. Diese waren von Person zu Person verschieden und reichten von allgemeinen Emotionen, religiösen Überzeugungen und moralischen Grundsätzen bis hin zu juristischen Problemen.
Während des monatelangen Wartens hatte Cat all diese Argumente durchdacht und war zu einer Entscheidung gelangt, von der sie zutiefst überzeugt war. Sie war sich der möglichen Risiken vollauf bewußt und vorbereitet auf die Schrecken, die ihr möglicherweise während der Genesung auf der Intensivstation bevorstanden. Sie akzeptierte sogar die Möglichkeit, daß ihr Körper das neue Herz abstieß.
Doch ihre einzige Alternative zu einer Transplantation war der sichere Tod – und zwar bald. Und so blieb ihr im Grunde keine Wahl.
»Ich bin bereit«, sagte sie entschlossen. »O Moment, eines noch. Wenn ich unter Narkose anfange, irgendwelche intimen Geständnisse von mir zu geben: Nichts davon ist wahr.«
Ersticktes Gelächter unter den Masken.
Sekunden später durchströmte die flüssige Mattigkeit der Narkose ihre Adern und ließ sie in seidenweiche Schläfrigkeit sinken. Sie sah zu Dean, lächelte und schloß die Augen – vielleicht zum letztenmal.
Und kurz vor der endgültigen Bewußtlosigkeit schoß ihr ein allerletzter Gedanke durch den Kopf, grell und gleißend wie ein explodierender Stern.
Wessen Herz ist es?
Kapitel 2
10. Oktober 1990
»Wie könnte eine Scheidung die größere Sünde von beiden sein?« fragte er.
Sie lagen in dem Bett, das sie normalerweise mit ihrem Mann teilte, der um diese Zeit Schichtarbeit bei seiner Fleischverpackungsfirma machte. Wegen eines Lecks in der Gasleitung war das Bürogebäude, in dem sie beide arbeiteten, für den Rest des Tages evakuiert worden. Sie hatten diesen unerwartet freien Nachmittag auf ihre Weise genutzt.
Im engen, vollgestopften Schlafzimmer roch es nach verschwitztem Sex. Der Schweiß trocknete auf ihrer Haut, gekühlt vom träge kreisenden Deckenventilator. Die Laken waren feucht und zerknittert. Die Fensterläden sperrten die Nachmittagssonne aus. Die brennenden Duftkerzen auf dem Nachttisch warfen ein flackerndes Licht auf das Kruzifix an der Wand mit der ausgeblichenen Blumenmustertapete.
Doch die schläfrige Atmosphäre täuschte. Sie standen unter Zeitdruck; und sie versuchten verzweifelt, ihr jede Sekunde an Vergnügen abzuringen. Bald würden ihre Töchter von der Schule heimkommen. Sie haßte es, die kostbaren kurzen gemeinsamen Augenblicke durch den ständig wiederkehrenden und schmerzlichen Streit zu vergeuden.
Es war nicht das erste Mal, daß er sie drängte, sich scheiden zu lassen und ihn zu heiraten. Aber sie war katholisch. Eine Scheidung war völlig indiskutabel.
»Ich habe Ehebruch begangen, ja«, sagte sie leise. »Aber meine Sünde betrifft nur uns beide. Wir sind die einzigen, die davon wissen. Außer meinem Beichtvater.«
»Du hast unser Verhältnis gebeichtet?«
»Nur so lange, bis es immer wieder geschah. Jetzt gehe ich nicht mehr zur Beichte. Ich schäme mich zu sehr.«
Sie setzte sich auf und rückte zur Bettkante, das Gesicht von ihm abgewandt. Ihr schweres dunkles Haar klebte ihr feucht im Nacken. Im Standspiegel in der Ecke betrachtete sie ihr Spiegelbild.
Sie kritisierte ihre Figur, hielt ihre Hüften für zu breit und ihre Oberschenkel für zu massig. Doch ihm schien die Üppigkeit ihres Körpers und ihr dunkler Teint zu gefallen. Sie schmecke sogar dunkel, hatte er einmal zu ihr gesagt. Natürlich war das nichts weiter als Bettgeflüster in der Hitze der Leidenschaft und hatte daher nichts zu bedeuten. Trotzdem hatte sie seine Bemerkung gern gehört.
Er strich ihr mit einer Hand über den makellosen Rücken. »Schäm dich nicht für das, was wir tun. Es bricht mir das Herz, dich sagen zu hören, daß du dich wegen unserer Liebe schämst.«
Vor vier Monaten hatte ihr Verhältnis so richtig begonnen. Vorausgegangen waren mehrere qualvolle und zermürbende Monate des Ringens mit Gewissen und Schuldgefühlen. Sie arbeiteten in verschiedenen Stockwerken, waren einander aber häufig im Fahrstuhl des Bürohochhauses begegnet. Das erste Mal hatten sie sich in der kleinen Cafeteria im Erdgeschoß getroffen, wo er versehentlich mit ihr zusammenstieß und sie ihren Kaffee verschüttete. Sie hatten verdrossen gelächelt, während sie sich entschuldigten und sich einander vorstellten.
Schon bald richteten sie es so ein, daß sie gemeinsam die Mittags- und Kaffeepause machten. Sich unten in der Cafeteria zu treffen, das wurde zur Gewohnheit, aus der bald eine Notwendigkeit wurde. Ihr Wohlsein hing davon ab, daß sie sich sahen. Die Wochenenden schienen quälend lang zu sein, Ewigkeiten, die irgendwie überstanden werden mußten, bis es endlich wieder Montag war und sie sich wiedersehen konnten. Sie begannen beide, Überstunden einzulegen, damit sie einige Momente ungestört verbringen konnten, ehe sie sich auf den Heimweg machten.
Als sie eines Abends gemeinsam das Büro verließen, fing es an zu regnen. Er bot ihr an, sie mit seinem Wagen nach Hause zu bringen.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich fahre mit dem Bus, wie immer. Trotzdem danke.«
Mit Blicken voller Bedauern und Sehnsucht wünschten sie sich gegenseitig einen schönen Abend und verabschiedeten sich voneinander. Die Handtasche mit einer Hand an die Brust gepreßt, in der anderen Hand den Regenschirm, eilte sie durch den Wolkenbruch bis zur Bushaltestelle an der Ecke.
Dort stand sie noch immer in ihrem dünnen Mantel, als ein Auto direkt vor ihr am Randstein hielt. Er kurbelte das Seitenfenster herunter.
»Steig ein. Bitte.«
»Der Bus kommt bestimmt gleich.«
»Du wirst doch pitschnaß. Steig ein.«
»Er hat sicher nur ein paar Minuten Verspätung.«
»Bitte...«
Er bat um mehr als nur das Privileg, sie heimfahren zu dürfen, und das war ihnen beiden bewußt. Unfähig, der Versuchung zu widerstehen, stieg sie zu ihm ins Auto, als er die Tür für sie aufhielt. Ohne ein weiteres Wort fuhr er mit ihr zu einer entlegenen Stelle im Stadtpark, nicht weit von Downtown.
Kaum hatte er den Motor abgestellt und sich zu ihr hingedreht, als sie sich auch schon hungrig küßten. Bei der ersten Berührung seiner Lippen hatte sie bereits ihren Ehemann vergessen, ihre Kinder und religiösen Überzeugungen. Sie wurde von animalischer Lust beherrscht, nicht vom Sittenkodex, den sie gelobt hatte, seit sie alt genug war, zwischen falsch und richtig zu unterscheiden.
Ungeduldig hantierten sie mit Knöpfen, Reißverschlüssen und Ösen, bis sie ihre durchnäßte Kleidung gelöst hatten und sich Haut an Haut berührten. Was seine Hände, dann sein Mund mit ihr taten, war ebenso aufregend wie schockierend für sie. Als er in sie eindrang, verstummte ihr Gewissen vollends unter seinen glühenden Liebesbekundungen.
Diese anfängliche Leidenschaft hatte nicht abgenommen. Wenn, dann hatte sie während ihrer folgenden heimlichen Treffen nur noch zugenommen. Nun wandte sie den Kopf zu ihm um und sah ihn über die Schulter hinweg an. Auf ihren üppigen Lippen lag ein schüchternes Lächeln.
»Ich schäme mich nicht genug, um unser Verhältnis zu beenden. Auch wenn ich weiß, daß es eine Sünde ist, würde ich sterben, wenn ich nie wieder mit dir schlafen könnte.«
Mit einem Stöhnen erneuten Verlangens zog er sie wieder an sich. Sie drehte sich, bis sie auf ihm lag, ihre gespreizten Schenkel auf seinen Hüften.
Er stieß tief in sie, hob dann den Kopf, um an ihren Brüsten zu saugen und zu knabbern. Sie preßte ihre große Knospe an seine Lippen. Er liebkoste sie mit der Zunge, dann lutschte er gierig daran.
Diese Position war noch immer eine neue und aufregende Erfahrung für sie. Sie ritt ihn so lange, bis sie einen erneuten heftigen gemeinsamen Höhepunkt hatten, der sie beide erschöpft und außer Atem zurückließ.
»Verlaß ihn«, drängte er keuchend. »Heute. Jetzt gleich. Verbring gar nicht erst noch eine weitere Nacht mit ihm.«
»Ich kann nicht.«
»Doch, du kannst. Der Gedanke, daß du mit ihm zusammen bist, macht mich wahnsinnig. Ich liebe dich. Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch«, sagte sie unter Tränen. »Aber ich kann nicht einfach so von zu Hause fortgehen. Ich kann doch meine Kinder nicht verlassen.«
»Du bist jetzt bei mir zu Hause. Ich verlange doch gar nicht, daß du die Kinder zurückläßt. Bring sie mit. Ich werde ihnen ein Vater sein.«
»Er ist ihr Vater. Sie lieben ihn. Er ist mein Mann. Vor Gott gehöre ich ihm. Ich kann ihn nicht verlassen.«
»Du liebst ihn doch gar nicht.«
»Das stimmt«, gab sie zu. »Nicht so, wie ich dich liebe. Aber er ist ein guter Mann. Er sorgt für mich und die Mädchen.«
»Das ist keine Liebe. Er erfüllt nur seine Pflichten.«
»Für ihn ist das mehr oder weniger dasselbe.« Sie legte den Kopf in seine Schulterbeuge, wollte, daß er verstand. »Wir sind in derselben Nachbarschaft aufgewachsen. Wir waren schon in der Schule ineinander verliebt. Unsere Leben sind miteinander verbunden. Er ist ein Teil von mir, und ich bin ein Teil von ihm. Wenn ich ihn verlasse, würde er das nie verstehen. Es würde ihn zerstören.«
»Es wird mich zerstören, wenn du es nicht tust.«
»Nein«, widersprach sie. »Du bist viel schlauer als er. Selbstsicherer und stärker. Du wirst es überleben. Aber bei ihm bin ich mir nicht sicher.«
»Er liebt dich nicht so wie ich.«
»Er macht nicht so Liebe wie du. Er würde niemals...« Verlegen senkte sie den Kopf.
Über Sex zu reden, fiel ihr nach wie vor schwer. In ihrer Familie war darüber niemals offen gesprochen worden, weder in ihrer Pubertät noch später in ihrer Ehe. Sex wurde im Dunkeln gemacht, ein notwendiges Übel, von Gott toleriert und vergeben, wenn es der Fortpflanzung diente.
»Er schert sich nicht um mein Verlangen«, sagte sie errötend. »Es würde ihn schockieren, wenn er wüßte, daß ich überhaupt Lust verspüre. Du ermutigst mich, dich anzufassen und zu küssen, wie ich es bei ihm niemals wagen würde, weil es ihn beleidigen würde. Er würde deine Sensibilität als Schwäche abtun. Er ist nicht dazu erzogen worden, im Bett zärtlich zu sein.«
»Dieser Machomist«, sagte er bitter. »Willst du dich für den Rest deines Lebens damit zufriedengeben?«
Sie sah ihn traurig an. »Ich liebe dich mehr als mein Leben, aber er ist mein Mann. Wir haben Kinder. Wir haben ein gemeinsames Erbe.«
»Wir könnten auch Kinder bekommen.«
Sie berührte seine Wange, verspürte Zuneigung und Bedauern. Manchmal führte er sich auf wie ein Kind, das stur verlangt, was es nicht haben kann.
»Die Ehe ist ein heiliges Sakrament. Ich habe vor Gott den Schwur geleistet, bei ihm zu bleiben, bis daß der Tod – und der Tod allein — uns trennt.« Tränen traten ihr in die Augen. »Ich habe das Treuegebot für dich gebrochen. Ich werde nicht auch die anderen brechen.«
»Nicht... nicht weinen. Das letzte, was ich will, ist, dich unglücklich zu machen.«
»Halt mich.« Sie schmiegte sich an ihn.
Er strich ihr über das Haar. »Ich weiß, daß es gegen deine religiöse Überzeugung verstößt, wenn du mit mir zusammen bist, aber das vertieft unsere Liebe doch nur, nicht wahr? Dein Gefühl für Moral würde dir nicht erlauben, mit mir zu schlafen, wenn du mich nicht von ganzem Herzen lieben würdest.«
»Das tue ich.«
»Ich weiß.« Er wischte ihr die Tränen von den Wangen. »Bitte, weine nicht, Judy. Wir kriegen das schon hin. Das werden wir. Leg dich nur noch ein bißchen neben mich.«
Sie klammerten sich aneinander; ihr Kummer wegen ihrer Situation war so absolut wie ihre Freude über ihre Liebe; die nackten Körper vereinigten sich vollkommen.
Und genau so fand ihr Ehemann sie Minuten später vor.
Sie war die erste, die ihn in der Tür zum Schlafzimmer stehen sah, zitternd vor Entrüstung. Sie sprang auf, griff nach dem Laken, um sich zu bedecken. Sie versuchte, seinen Namen auszusprechen, doch ihr Mund war trocken vor Furcht und Scham.
Fluchend kam er quer durchs Zimmer auf das Bett zugestürzt und holte mit einem Baseballschläger zum tödlichen Schlag aus.
Später hatten sogar die Männer der Ambulanz, die den Anblick schrecklicher Tatorte gewohnt waren, Schwierigkeiten, ihr Entsetzen zu verbergen. Es war ein Gemisch aus Blut und Gehirn, über die geblümte Tapete hinter dem Bett verteilt.
Nicht als Respektlosigkeit gegenüber dem blutverschmierten Kruzifix an der Wand gemeint, flüsterte einer: »Jesus Christus.«
Sein Partner kniete sich neben das Opfer: »Verdammt, ich fühle noch einen Puls!«
Der andere schaute skeptisch auf die blutige Masse, die aus dem gespaltenen Schädel quoll. »Meinst du wirklich, da besteht ’ne Chance?«
»Nein, aber laß sie uns trotzdem einladen. Könnte sein, daß wir hier eine Organspende haben.«
Kapitel 3
10. Oktober 1990
»Stimmt was nicht mit meinen Pfannkuchen?«
Er schaute auf und sah sie mit leerem Blick an. »Was?«
»Auf der Packung steht, daß der Teig jedesmal superluftig wird. Ich muß was falsch gemacht haben.«
Er hatte seit mehr als fünf Minuten in seinem Frühstück herumgestochert, ohne einen Bissen zu essen. Nun spießte er mit der Gabel den sirupartigen Klumpen auf seinem Teller auf und lächelte entschuldigend. »Nein, nein. Du hast nichts falsch gemacht.«
Er war nur höflich. Amandas Kochkünste waren katastrophal. »Wie schmeckt dir der Kaffee?«
»Toll. Kann ich noch eine Tasse haben?«
Sie warf einen Blick auf die Küchenuhr. »Hast du noch soviel Zeit?«
»Ich nehm sie mir.«
Er erlaubte sich nur höchst selten den Luxus, zu spät zur Arbeit zu kommen. Was auch immer ihn die letzten Tage beschäftigt hatte, es mußte sehr wichtig sein, dachte sie sich.
Nichts Gutes ahnend, stand sie auf und ging zur Kaffeemaschine auf der Anrichte. Sie brachte die Kanne mit an den Tisch und schenkte ihm nach.
»Wir müssen reden.«
»Nichts dagegen.« Sie nahm wieder Platz. »Ich würde schon gern wissen, wo du in letzter Zeit mit deinen Gedanken bist.«
»Ja, du hast recht. Tut mir leid.« Zwischen seinen Brauen formte sich eine Falte, während er in die dampfende Tasse Kaffee starrte, die er eigentlich gar nicht mehr wollte. Er hatte nur Zeit gewinnen wollen.
»Du machst mir angst«, sagte sie leise. »Was immer du auch auf dem Herzen hast – du kannst es mir doch sagen. Was ist es? Eine andere Frau?«
Er warf ihr einen scharfen Blick zu, der ihr deutlich sagte, daß sie es doch besser wissen müßte.
»Ich hab’s!« Sie schlug mit der Handfläche auf die Tischplatte. »Du bist angewidert von mir, weil ich aussehe wie Dumbos Mutter. Meine dicken Fußgelenke und mein Hinterteil törnen dich ab, stimmt’s? Du vermißt meine kleinen, festen Brüste, mit denen du mich immer aufgezogen hast. Ich habe durch die Schwangerschaft all meinen Sexappeal verloren, und jetzt hast du dich in ein süßes, junges, schlankes Ding verguckt und hast Angst, es mir zu beichten. Heiß oder kalt?«
»Du bist verrückt.« Er griff über den kleinen runden Tisch und zog sie hoch. Als sie vor ihm stand, strich er mit beiden Händen über ihren angeschwollenen Bauch. »Ich liebe dich so, wie du bist.«
Er küßte sie durch den dünnen Stoff ihres Nachthemdes auf den Bauchnabel. »Ich liebe das Baby«, sagte er. »Ich liebe dich. Es gibt keine andere Frau in meinem Leben, und die wird es auch nie geben.«
»Unsinn.«
»Tatsache.«
»Und was ist mit Michelle Pfeiffer?«
Er grinste, während er so tat, als würde er darüber nachdenken. »Hm, das ist natürlich schwer zu sagen. Wie sind ihre Pfannkuchen?«
»Wär dir das wichtig?«
Lachend zog er sie auf seinen Schoß und umarmte sie.
»Vorsichtig«, sagte sie. »Ich zerdrücke dir sonst den Familienschmuck.«
»Ich passe schon auf.«
Sie küßten sich innig. Als er sich schließlich von ihr löste, schaute sie in sein besorgtes Gesicht. Obwohl es noch frühmorgens war und er gerade erst geduscht und sich rasiert hatte, sah er so mitgenommen aus, als hätte er bereits einen langen und strapaziösen Tag hinter sich.
»Wenn es nicht meine Kochkünste sind, es keine andere Frau ist und du nicht von meinem aufgeblähten Bauch angewidert bist, was ist es dann?«
»Ich komme einfach nicht damit klar, daß du deinen Beruf aufgegeben hast.«
Sie verspürte eine unendliche Erleichterung, weil sie insgeheim mit etwas viel Schlimmerem gerechnet hatte. »Das hat die ganze Zeit an dir genagt?«
»Es ist unfair«, sagte er stur.
»Für wen?«
»Für dich, natürlich.«
Amanda sah ihn mißtrauisch an. »Oder hast du etwa vor, vorzeitig in Rente zu gehen, den ganzen Tag auf dem Sofa rumzulümmeln und dich von mir aushalten zu lassen?«
»Keine schlechte Idee«, sagte er mit einem schiefen Lächeln. »Aber im Ernst: Ich denke dabei nur an dich. Weil die Biologie die Männer eindeutig bevorzugt –«
»Verdammt richtig«, grummelte sie.
»Mußt du nun alles opfern.«
»Wie oft habe ich dir schon gesagt, daß ich genau das tue, was ich tun will. Ich bekomme ein Kind, unser Kind. Das macht mich sehr glücklich.«
Er hatte die Nachricht von der Schwangerschaft mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zuerst war er schockiert gewesen. Sie hatte die Pille abgesetzt, ohne mit ihm darüber zu reden. Doch nachdem der erste Schreck abgeklungen war und er sich an die Idee, Vater zu werden, gewöhnt hatte, hatte es ihm gefallen.
Nach dem dritten Monat hatte sie die Partner der Anwaltskanzlei, in der sie tätig war, davon informiert, daß sie während der ersten wichtigen Monate nach der Geburt zu Hause bleiben werde. Damals hatte er ihre Entscheidung nicht kritisiert. Daß er nun Bedenken bekam, überraschte sie.
»Du bist erst seit zwei Wochen nicht mehr im Büro und bist schon kribbelig«, sagte er. »Ich erkenne die Anzeichen. Ich sehe doch, wenn du ruhelos wirst.«
Mit einer sanften Geste wischte sie ihm eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. »Mag sein, aber nur weil ich nicht mehr weiß, was ich im Haus noch erledigen soll. Ich habe die Regale abgewischt, die Einmachgläser neu beschriftet und die Schubladen mit den Socken sortiert. Ich habe alles erledigt, was ich vor der Geburt erledigen wollte. Aber wenn das Kind erst mal da ist, werde ich mehr als genug um die Ohren haben.«
Sein zweifelnder Blick blieb. »Während du hier happy Hausfrau spielst, machen dich die anderen in der Kanzlei schlecht.«
»Und wenn schon.« Sie lachte. »Für mich gibt es nichts Wichtigeres, als unser Kind zu kriegen. Und daran glaube ich von ganzem Herzen.«
Sie nahm seine Hand und legte sie auf ihren Bauch. Das Baby bewegte sich. »Fühlst du das? Wie könnte ein Prozeß beeindruckender sein als das? Ich habe mich entschieden und bin sehr zufrieden damit. Und ich möchte, daß du das auch bist.«
»Das ist vielleicht zuviel verlangt.«
Insgeheim pflichtete sie ihm bei. Er würde niemals wirklich damit zufrieden sein. Doch er fand Trost in seiner Liebe zu ihr und im Wissen um die baldige Geburt seines Kindes. Er massierte die Stelle, wo das Baby gerade einen kräftigen Tritt gelandet hatte.
»Ich dachte, es sei euch Männern ganz recht, wenn die kleine Frau brav daheim bleibt und die Kinder kriegt«, neckte sie ihn. »Was ist los mit dir?«
»Ich will nur einfach nicht den Tag erleben, an dem du es bereust, deine Arbeit aufgegeben zu haben.«
Sie beruhigte ihn mit einem Lächeln. »Das wird nie passieren.«
»Und warum habe ich dann dauernd das Gefühl, als würde ein Damoklesschwert über mir hängen?«
»Weil für dich das Glas immer halb leer ist.«
»Und für dich halb voll.«
»Ich sehe es so voll, daß es gleich überläuft.« Sie machte eine Geste mit den Händen, die ihn lächeln ließ, woraufhin sich sein Schnurrbart verbog, wie sie es so sehr mochte.
»Ja, ja, ich bin der ewige Pessimist.«
»Du gibst es also zu?«
»Nein. Es ist nur, daß wir das schon alles einmal hatten.«
»Bis zum Überdruß«, sagte sie.
Sie lächelten einander zu, und er zog sie wieder an sich. »Du hast schon soviel für mich aufgegeben. Ich verdiene dich gar nicht.«
»Denk daran, wenn Michelle Pfeiffer die Finger nach dir ausstreckt.«
Sie lehnte sich in die Beuge seines Armes, als er sie mit wachsender Leidenschaft küßte. Seine Hand glitt unter den Stoff ihres Nachthemdes und fand ihre Brüste. Sie waren prall und schwer, bereit, Milch zu geben. Er liebkoste sie und knetete sanft ihre Brustwarzen.
Dann zog er ihr Nachthemd tiefer und liebkoste ihre Brüste mit Lippen und Zunge. Als er ihre harten Perlen mit seinem Schnurrbart kitzelte, stöhnte sie auf. »Das ist nicht fair.«
»Wie lange müssen wir warten?«
»Mindestens sechs Wochen nach der Geburt.«
Er stöhnte.
»Wir fangen besser gar nicht an, womit wir dann nicht aufhören können.«
»Zu spät«, sagte er wimmernd.
Lachend zog sie ihr Nachthemd hoch und glitt von seinem Schoß. »Du solltest dich jetzt besser auf den Weg machen.«
»Ja, hast recht.« Er stand auf, zog die Jacke an und ging zur Tür. »Wie geht es euch heute?«
Sie hielt ihren großen Bauch mit beiden Händen. »Uns geht es bestens.«
»Du hast unruhig geschlafen.«
»Versuch du mal zu schlafen, wenn jemand mit deinen inneren Organen Fußball spielt.«
An der Tür gaben sie sich einen Abschiedskuß. »Was möchtest du heute abend gern essen?«
»Ich lade dich ein. Wir gehen aus.«
»Zum Chinesen?«
»Aber sicher.«
Meist winkte sie ihm morgens von der Tür aus zu. Heute jedoch gingen sie Arm in Arm bis zum Wagen. Als es Zeit wurde, ihn loszulassen, fiel ihr dies unerklärlich schwer. Es war, als wäre sein Pessimismus ansteckend. Seine düstere Ahnung mußte sich auf sie übertragen haben, weil sie plötzlich das dringende Bedürfnis verspürte, sich an ihm festzuhalten und ihn zu bitten, er solle sich krank melden und heute bei ihr zu Hause bleiben.
Doch um das, was wahrscheinlich nur eine vorübergehende, von der Schwangerschaft hervorgerufene, emotionale Unsicherheit war, zu überspielen, zog sie ihn auf. »Glaub ja nicht, daß ich zur Märtyrerin für die Mutterschaft werde. Wenn unser Schatz erst auf der Welt ist, wirst du auch deinen Anteil an Windeln wechseln.«
»Darauf freue ich mich schon.« Er grinste. Dann wurde er wieder ernst, legte ihr die Hände auf die Schultern und zog sie an sich. »Du machst es mir so leicht, dich zu lieben. Wirst du je wissen, wie sehr ich dich liebe?«
Sie schaute zu ihm auf. »Ich weiß es.« Das Sonnenlicht blendete sie. Vielleicht traten ihr deshalb Tränen in die Augen. »Ich liebe dich auch.«
Ehe er sie küßte, nahm er ihr Gesicht in beide Hände und sah sie lange an. Seine Stimme war belegt, als er sagte: »Ich werde versuchen, heute früher nach Hause zu kommen.« Als er ins Auto stieg, fügte er noch hinzu: »Ruf mich an, wenn du mich brauchst.«
»Mache ich.« Als er um die Ecke bog, winkte sie ihm nach.
Während des Abwaschs machten sich Schmerzen im Rücken bemerkbar. Sie ruhte sich ein wenig aus, bevor sie die Betten machte, doch der dumpfe Schmerz blieb.
Gegen Mittag konnte sie die Krämpfe im Unterleib nicht mehr ignorieren. Sie überlegte einen Moment, ihn anzurufen, tat es aber nicht. Solche Kontraktionen konnten Wochen vor den eigentlichen Wehen eintreten. Das Baby würde erst in zwei Wochen kommen. Es konnte also nur falscher Alarm sein. Seine Arbeit war schwierig und aufreibend, und sie wollte ihn nicht stören, wenn es nicht wirklich etwas Ernstes war.
Kurz nach vier Uhr brach ihre Fruchtblase, und die Wehen setzten ein. Sie rief ihren Hausarzt an. Der versicherte ihr, daß es keinen Grund zu überstürzter Eile gebe, daß die Geburt des ersten Kindes manchmal Stunden dauerte, riet ihr aber dennoch, ins Krankenhaus zu fahren.
Nun mußte sie ihn benachrichtigen. Sie rief bei ihm im Büro an, erhielt aber die Auskunft, er sei gerade nicht zu sprechen. Das war nicht weiter schlimm. Sie mußte noch einiges erledigen, ehe sie ins Krankenhaus fahren würde.
Sie nahm eine Dusche, rasierte sich die Beine, wusch sich die Haare, weil sie nicht wußte, wann sie das nächste Mal Gelegenheit dazu haben würde. Ihr Koffer war bereits gepackt mit Nachthemden, einem neuen Bademantel und Hausschuhen, ferner mit einem Strampelanzug für das Baby auf der Heimfahrt. Sie verstaute noch ihre Kosmetika, dann verschloß sie den Koffer und stellte ihn neben die Haustür.
Die Wehen wurden heftiger und kamen in kürzeren Abständen. Sie rief erneut bei ihm im Büro an. »Er ist unterwegs«, wurde ihr gesagt. »Aber ich kann ihn ausfindig machen für Sie. Handelt es sich um einen Notfall?«
War es ein Notfall? Eigentlich nicht. Frauen bekamen ihre Kinder in allen möglichen Situationen. Sicherlich würde sie die Fahrt ins Krankenhaus auch ohne ihn schaffen. Außerdem würde er dann nicht erst nach Hause und von dort zum Krankenhaus fahren müssen.
Sie wollte nur so gern mit ihm reden. Seine Stimme zu hören hätte ihr Mut gemacht. Doch statt dessen mußte sie sich nun damit zufriedengeben, ihm die Nachricht zu hinterlassen, er solle so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen.
Sie dachte sich, daß dies nicht die Situation war, um tapfer zu sein und selber zu fahren, aber sie konnte keinen ihrer Freunde oder jemand aus ihrer Familie erreichen. Also rief sie die Ambulanz. »Ich habe Wehen und muß schnell ins Krankenhaus.«
Innerhalb von Minuten traf die Ambulanz ein. Der Notarzt checkte sie kurz durch. »Sonderbarer Blutdruck«, sagte er, als er ihr die Manschette vom Oberarm löste. »Wann etwa haben die Wehen eingesetzt?«
»Vor einigen Stunden.«
Die Schmerzen waren nun stark. Die Atem- und Konzentrationsübungen der vorbereitenden Kurse waren weniger wirkungsvoll, wenn man sie allein machte. Sie versuchte es, doch es milderte die Schmerzen nicht.
»Wie weit ist es noch?« fragte sie keuchend.
»Wir sind gleich da. Halten Sie durch. Sie haben es gleich geschafft.«
Doch es sollte anders kommen. Und sie wußte, daß etwas nicht stimmte, als sie das Stirnrunzeln des Arztes nach der Beckenuntersuchung sah. »Das Baby ist in der Steißlage.«
»O Gott«, wimmerte sie.
»Kein Grund zur Aufregung. Das kommt öfter vor. Wir werden versuchen, es zu drehen. Wenn das nicht funktioniert, holen wir es mit Kaiserschnitt.«
»Ich habe die Nummer angerufen, die Sie mir gegeben haben«, sagte die Hebamme, die Amandas Panik spürte. »Er ist unterwegs.«
»Gott sei Dank«, seufzte Amanda und entspannte sich etwas. Nicht mehr lange, und er würde hier sein. »Gott sei Dank.«
»Er ist Ihr Geburtshelfer?«
»Er ist mein ein und alles.«
Die Schwester drückte ihre Hand und begleitete sie plaudernd durch den nächsten dunklen Tunnel des Schmerzes, während der Arzt versuchte, das Baby in die richtige Position zu drehen. Dabei wurde ständig der Herzschlag kontrolliert. Die Schwester maß in immer kürzeren Abständen ihren Blutdruck.
Schließlich sagte der Arzt: »Kaiserschnitt vorbereiten.«
Die nächsten Minuten verstrichen in einem verschwommenen Kaleidoskop von Licht, Geräuschen und Bewegung. Sie wurde in einen Kreißsaal geschoben.
Wo blieb er denn nur? Sie rief mit leiser Stimme nach ihm, biß die Zähne zusammen bei einem Versuch, die Schmerzen zu besiegen, die wie ein Messer in ihren Bauch stachen.
Dann hörte sie, wie eine Schwester zur anderen sagte: »Auf der Autobahn hat es eine schreckliche Massenkarambolage gegeben.«
»Ich weiß. Bin gerade hergekommen. Das ist ein Irrsinn da draußen. Etliche Tote, die meisten mit Kopfverletzungen. Es sind einige Teams wegen Organ- und Gewebespenden unten und reden mit Angehörigen, sobald die eintreffen.«
Amanda spürte, wie ihr eine Nadel in die Hand gestochen wurde. Ihr Bauch wurde mit einer kalten Paste eingestrichen; ihre Beine mit sterilen blauen Laken bedeckt.
Ein Massenunfall auf der Autobahn Richtung Krankenhaus?
Das war doch auch sein Weg...
Er hatte es sicher eilig gehabt, hierherzukommen, ehe sie das Baby zur Welt gebracht hatte.
Zu schnell gefahren.
Risiken eingehend, die er normalerweise nicht eingehen würde.
»Nein!« Sie stöhnte auf.
»Halten Sie durch. Noch ein paar Minuten und Sie haben Ihr Baby im Arm.« Es war eine freundliche Stimme. Aber nicht seine. Nicht die, nach der sie sich so sehr sehnte.
Und plötzlich wußte sie, daß sie seine Stimme nie mehr hören würde. In einem Moment grausam scharfer Klarheit wußte sie, unbegreiflich, aber nicht abstreitbar, daß sie ihn nie mehr wiedersehen würde.
Am Morgen, als ihre Augen gebrannt hatten vor unvergossenen Tränen, hatte sie eine Vorahnung gehabt, daß ihr Abschiedskuß auch ihr letzter Kuß sein würde. Irgendwie hatte sie gewußt, daß sie ihn nie mehr berühren würde.
Deshalb hatte sie ihn auch nicht gehen lassen wollen. Jetzt fiel ihr ein, wie eindringlich er sie angesehen hatte, so als wolle er sich jede Nuance ihres Gesichts einprägen. Hatte er auch gespürt, daß es ein endgültiger Abschied war?
»Nein«, schluchzte sie. »Nein.« Doch ihr Schicksal war besiegelt, und diese Erkenntnis war profund und unmißverständlich. »Ich liebe dich. Ich liebe dich.«
Ihr heiserer Schrei hallte von den gekachelten Wänden des Kreißsaals wider. Doch er war nicht da, um ihn zu hören. Er war fort.
Für immer.
Kapitel 4
10. Oktober 1990
»Zyk is’n potthäßlicher Scheißkerl.« Petey pulte ein Stück öligen Dreck unter seinem Fingernagel hervor, dann wischte er das Taschenmesser an seiner Jeans ab. »Und er ist noch fieser, als er häßlich ist. Ich an deiner Stelle würde sie ihm überlassen. Würdest dir damit ’ne Menge Scherereien ersparen, Sparky.«
»Tja, du bist aber nicht an meiner Stelle.« Er schneuzte sich und spuckte knapp neben die zerschlissenen schwarzen Stiefel seines Kumpans. »Und ich werde Zyklop ’ne Lektion erteilen, wenn er sich hier noch mal blicken läßt.«
»Kismet war zuerst seine Alte, vergiß das nicht. Lange bevor du hier aufgekreuzt bist. Das wird er nicht vergessen.«
»Wie ein Stück Scheiße hat er sie behandelt.«
Petey zuckte philosophisch mit den Schultern.
»Wenn er sie anrührt, ... wenn er sie auch nur so anguckt, als wolle er sie anfassen, dann nagele ich seine Eier an einen Pfeiler.«
»Du bist doch nicht ganz dicht, Mann«, meinte Petey. »Ein prächtiger Arsch is ’ne feine Sache, okay, aber der ist nicht schwer zu kriegen, Menschenskind. Auf keinen Fall lohnt es sich, dafür zu sterben.« Er fuchtelte mit der Spitze seines Messers herum wie mit einem erhobenen Zeigefinger. »Paß auf dich auf, Mann. Zyk kriegt immer, was er will. Deshalb ist er ja auch der Boß.«
Sparky stieß einen leisen Fluch aus. »Boß? Scheiß drauf. Ein gottverdammter Schläger ist er.«
»Ist dasselbe.«
»Ich hab jedenfalls keinen Schiß vor ihm. Von dem laß ich mir nichts bieten, und sie von jetzt an auch nicht mehr.«
Er schaute zu der Gruppe Frauen, die aus einer Kneipe kamen, in der sie sich aufgehalten hatten, während er und Sparky auf der klapprigen Veranda der Raststätte gesessen hatten. Die Spelunke lag am Hang an einer Landstraße, die kaum noch benutzt wurde, seit es die Autobahn in der Nähe gab.
Es war ein abgelegener Ort. Früher hatte er Ganoven aller Art angezogen, Huren, Spieler und Verbrecher auf der Flucht. Nun kamen die Biker hierher, kleinere Fische aus dem Teich der Kriminellen und sonstige finstere Gestalten, die am Rande der Gesellschaft lebten. So ziemlich jeden Abend gab es eine Schlägerei, doch wurden sämtliche Auseinandersetzungen ohne Polizei geregelt, selbst jene, bei denen Blut floß.
Unter den Frauen auf der Veranda ragte Kismet wie ein Juwel aus der Asche heraus. Sie hatte dunkles, dichtes, lockiges Haar, sinnliche Augen und eine üppige Figur, die sie stolz präsentierte in ihrer hautengen Jeans. Um ihre Hüfte schmiegte sich ein breiter schwarzer Ledergürtel mit silbernen Nieten. Heute abend trug sie ein ärmelloses Top mit einem so tiefen Ausschnitt, daß ihre Tätowierung, ein Halbmond, über dem Herzen zu sehen war. Zufrieden bemerkte er, daß sie um den Oberarm das Kupferband trug, das er für sie vor wenigen Wochen aus Mexiko mitgebracht hatte. An ihren Ohren klimperten mehrere glitzernde Ringe und Anhänger.
Sie spürte seinen Blick und erwiderte ihn mit einem herausfordernden Schwung ihres Kopfes. Ihre Lippen öffneten sich verführerisch. Sie lachte über eine Bemerkung einer ihrer Freundinnen, doch ihre dunklen Augen ruhten weiterhin auf ihm.
»Die Pussy hat dich verhext, Mann, ganz klar«, sagte Petey resigniert.
Er ließ Petey diese unverschämte Bemerkung durchgehen. Diese geistige Null war die Energie nicht wert, sich mit ihm zu streiten. Außerdem war sich Sparky nicht sicher, ob er die richtigen Worte finden würde, um auszudrücken, was er für Kismet empfand, aber es war auf jeden Fall mehr und anders als bei jeder anderen Frau bisher.
Er hielt sich bedeckt, was seine Vergangenheit betraf, und gab seinen wahren Namen nicht preis. Die übrigen Biker der Gang hätten sich gewundert, wenn sie gewußt hätten, daß er einen Abschluß in Literaturwissenschaften an einer renommierten Universität abgelegt hatte. Unter ihresgleichen war Intelligenz und Wissen aus Büchern verpönt. Je weniger sie über ihn wußten, desto besser.
Und auch Kismet redete nicht gern über ihre Vergangenheit vor ihrer Zeit mit Zyklop. Sie hatte das Thema von sich aus nie angesprochen, und er hatte nicht danach gefragt.
Wie verwandte Seelen hatten sie einander an der Ruhelosigkeit erkannt, die ihnen beiden gemeinsam und eher eine Flucht als ein Ziel war. Beide liefen sie vor einer Situation weg, die sie nicht länger hinnehmen konnten.
Vielleicht hatten sie, ohne es zu wissen, einander gesucht. Vielleicht war ihre Suche nun beendet. Eine Vorstellung, die ihm sehr gut gefiel, und er hielt sie in seinen Tagträumen aufrecht.
Als er sie das erste Mal sah, hatte sie ein geschwollenes blaues Auge und eine aufgeplatzte Lippe gehabt.
»Was glotzt du denn so?« fragte sie gereizt, als sie seine Blicke bemerkte.
»Hab mich gefragt, wer das getan hat.«
»Was schert’s dich?«
»Na ja, vielleicht willst du ja, daß ich dem Scheißkerl ’nen ordentlichen Denkzettel verpasse.«
Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß und schnaubte verächtlich. »Du?«
»Ich bin zäher, als ich aussehe.«
»Klar, und ich bin die verdammte Königin von Saba. Außerdem kann ich schon allein auf mich aufpassen.«
Doch es hatte den Anschein, als könne sie das nicht. Einige Tage später wiesen ihr Gesicht und Oberkörper erneut Schrammen und Schwellungen auf. Inzwischen hatte er erfahren, daß sie zu Zyklop gehörte, dem Anführer der Biker-Gang, der seinen Spitznamen wegen seines Glasauges hatte.
Doch dieses Handicap minderte seine Bösartigkeit nicht. Sein gesundes Auge war ebenso kalt und leblos wie das aus Glas. Wenn er seinen stechenden Blick auf jemanden richtete, der es sich mit ihm verscherzt hatte, dann fiel sein künstliches Auge, das leicht schielte, kaum auf.
Zyklop wurde hinter seinem Rücken nur der »Mischling« genannt, weil niemand genau wußte, was außer mexikanischem und indianischem Blut noch in seinen Adern floß. Wahrscheinlich wußte Zyklop es selber nicht. Und es war zweifelhaft, ob er sich überhaupt dafür interessierte.
Er war dunkelhäutig, geschmeidig und zäh wie Leder. Seine Waffe war das Messer. Wäre da nicht Kismet gewesen – Sparky wäre ihm tunlichst aus dem Weg gegangen.
Doch unglücklicherweise hatte sich das Schicksal eingemischt. Vom ersten Moment an fühlte er sich magisch angezogen von Kismets üppiger Figur, ihren dunklen Augen, ihrer wilden Lockenmähne. Er hatte instinktiv auf die Furcht und Verletzlichkeit reagiert, die er hinter ihrem trotzigen Blick und ihrer feindseligen Art erkannte. Und auf wundersame Weise fühlte sie sich ebenso zu ihm hingezogen.
Er hatte nie direkt etwas unternommen, noch je die Einladung ausgesprochen, mit ihm zu fahren. Doch sie mußte seine indirekten Signale erkannt haben. Eines Morgens stieg sie einfach hinter ihm auf sein Motorrad und schlang ihre bloßen, schlanken Arme fest um seine Taille.
Ein gespanntes Schweigen breitete sich unter den Mitgliedern der Gang aus, als Zyklop zu seiner Maschine ging. Er sah Kismet hinter Sparky sitzen, kniff drohend sein gesundes Auge zusammen und verzog die schmalen Lippen. Dann trat er die Pedale seiner Maschine durch und röhrte davon.
In dieser Nacht blieb Kismet bei Sparky. Er hatte eigentlich vorgehabt, sie zärtlich zu behandeln wegen der kürzlichen Prügel von Zyklop. Doch dann war überraschenderweise sie die Aktive gewesen, hatte sich mit Zähnen und Klauen über ihn hergemacht und mit einem ungeheuren sexuellen Hunger, den er aber mehr als nur zu befriedigen vermochte.
Seither betrachteten sie sich als festes Paar. Doch jene, die der Gang schon länger angehörten, jene, die Zyklop gut kannten und um seine Rachsucht und Grausamkeit wußten, fürchteten, die im stillen kochende Wut ihres Anführers könne jeden Moment ausbrechen wie ein Vulkan.
Niemand nahm sich ungestraft, was Zyklop gehörte.
Doch Peteys Warnung, auf der Hut zu sein, war gar nicht nötig gewesen. Sparky beobachtete Zyklop längst, weil ihm klar war, daß dessen Gleichgültigkeit darüber, daß Kismet ihm den Laufpaß gegeben hatte, nur der Versuch war, vor der Gang das Gesicht zu wahren. Er traute ihm nicht und war ständig auf einen möglichen Angriff gefaßt.
Deshalb sträubten sich ihm auch die Nackenhaare, als er Zyklop aus der Bar auf die Veranda stolpern sah. Er stützte sich mit einer Hand am Türrahmen ab, um das Gleichgewicht zu halten, in der anderen hielt er eine Flasche Wodka, aus der er einen kräftigen Schluck nahm. Selbst auf die Entfernung sah Sparky, wie Zyklops gesundes Auge nach Kismet suchte.
Zyklop ging zu ihr hin, streckte die Hand aus und wollte ihr den Hals streicheln. Sie stieß seine Pranke weg. Er beugte sich vor und sagte etwas zu ihr. Ihre dreiste Antwort ließ die anderen Frauen lachen.
Zyklop fand das gar nicht lustig. Er ließ die Wodkaflasche fallen und zog sein Messer aus dem schmalen Lederhalfter auf seinem Rücken. Die anderen Frauen wichen erschrokken zurück. Kismet rührte sich nicht von der Stelle, auch dann nicht, als er mit der Messerspitze vor ihrem Gesicht herumfuchtelte. Sie zuckte nicht mal mit der Wimper, erst als er mit einer blitzschnellen Bewegung so tat, als wolle er zustechen, wich sie zurück, und er lachte schallend.
In diesem Augenblick waren für Sparky alle Warnungen vergessen. Er stürmte über die Veranda. Zyklop spürte ihn kommen und nahm eine geduckte Angriffspose ein. Er ließ das Messer von einer Hand in die andere gleiten und musterte Sparky.
»Komm doch...«
Sparky wich blitzschnell mehreren Attacken aus, von der ihn jede einzelne hätte aufschlitzen können. Körperlich war ihm Zyklop überlegen. Aber Sparky machte sich seine Schnelligkeit, Geschicklichkeit und die Tatsache, daß er im Gegensatz zu seinem Gegner nüchtern war, zunutze.
Er wartete auf den günstigsten Moment und trat Zyklop ans Handgelenk. Sein Stiefel krachte gegen den Knochen. Zyklop jaulte auf, und das Messer flog in hohem Bogen zur Seite. Sparky verpaßte ihm einen Kinnhaken, der ihn nach hinten schleuderte. Zyklop krachte gegen die Hauswand und sackte zu einem schmachvollen betrunkenen Häufchen zusammen.
Sparky hob das Messer auf und warf es weit fort. Alle schauten gebannt zu, wie es durch die Luft wirbelte, die Klinge im Licht der Neonreklame der Raststätte aufblitzend, und im Gebüsch landete.
Sparkys Arm ging schwer, doch mit ruhiger Würde reichte er Kismet die Hand. Sie ergriff sie, ohne zu zögern. Zusammen gingen sie zu seiner Maschine und stiegen auf. Er drehte sich nicht um. Sie schon. Zyklop rappelte sich gerade auf und schüttelte benommen den Kopf.
Sie zeigte ihm den Mittelfinger, ehe die Maschine in die hereinbrechende Dunkelheit schoß.
Der heulende Fahrtwind machte jede Unterhaltung unmöglich, also verständigten sie sich mit anderen Mitteln. Sie preßte die Oberschenkel fest an seine Hüften und rieb die Brüste an seinem Rücken, während sie ihn mit gierigen Händen im Schritt liebkoste. Sie biß ihm in die Schulter. Er stöhnte auf vor Lust, Schmerz und Vorfreude.
Nun gehörte sie ihm. Keine Frage. Hätte sie noch irgend etwas für den ausgebooteten Zyklop übrig gehabt, wäre sie bei ihm geblieben. Doch das hatte sie nicht getan. Nun war sie sein Preis. Als Sieger hatte er das Recht auf sie erworben. Noch ein paar Kilometer, und er würde sie ...
»Scheiße, er kommt uns nach, Sparky!«
Einen Sekundenbruchteil, bevor sie aufschrie, hatte er den aufblitzenden Scheinwerfer bemerkt, grell wie das Auge eines einäugigen Monstrums; was er einerseits passend fand, andererseits jedoch beunruhigend.
Der Scheinwerfer wurde im Rückspiegel größer, als Zyklop ihnen in einem Höllentempo folgte. Sparky donnerte die kurvenreiche Strecke bereits selbst in halsbrecherischer Geschwindigkeit entlang, gab aber noch mehr Gas, um Zyklop auf sicherer Distanz zu halten.
Er wußte, daß sein Verfolger durch Wodka und rasende Wut aufgeputscht war, und so konzentrierte er sich ganz auf die wilde Jagd die Haarnadelkurven hinunter Richtung Stadt, wo er hoffte, Zyklop abzuhängen.
Er schrie Kismet zu, sie solle sich gut festhalten, dann legte er sich gefährlich steil in die nächste Kurve. Als sich die Maschine wieder aufrichtete, sah er im Rückspiegel, daß Zyklop ihm noch immer dicht auf den Fersen war.
»Schneller!« rief Kismet. »Er holt uns ein. Wenn er uns kriegt, wird er uns umbringen.«
Er holte das letzte aus seiner Maschine heraus. Die Landschaft verschwamm. Nur jetzt keinen Gegenverkehr. Bisher war ihnen niemand entgegengekommen, doch –
»Paß auf!«
Zyklop war fast auf gleicher Höhe mit ihnen. Sparky schoß auf die Gegenfahrbahn, um den Vorsprung zu halten. Wenn er zuließ, daß Zyklop sie einholte oder gar überholte, waren sie so gut wie tot.
Es ging nun nicht mehr ganz so steil bergab. Es war nicht mehr weit bis zur Stadt. Wenn sie die erreichten, würden sie den wahnsinnigen Bastard schon abhängen.
Er überlegte sich gerade eine Strategie, als es in eine weitere Kurve ging. Nachdem sie aus ihr herausgefahren waren, schien es, als würden sie in eine völlig andere Landschaft geschleudert. Unvermittelt lag die Ebene vor ihnen. Offene Straßen zogen sich wie ein straff gespanntes, silbernes Band dahin, das direkt in die Stadt führte. Hätte das Schicksal es gut mit ihnen gemeint, wäre dies ein willkommener Anblick gewesen.
So aber schrie Kismet auf. Sparky fluchte. Sie rasten geradewegs auf eine breite Kreuzung zu. Von rechts kam ihnen ein Viehtransporter entgegen. Sie fuhren zu schnell, um ausweichen zu können. Zyklop hing ihnen am Auspuffrohr. Der Viehtransporter war zu langsam, um die Kreuzung rechtzeitig freizumachen.
Es blieb keine Zeit, zu überlegen.
Eineinhalb Stunden später eilte ein milchgesichtiger Arzt den Korridor Richtung Warteraum der Notaufnahme entlang, wo eine Schar Motorradfahrer auf Auskunft über den Zustand ihrer Freunde wartete. Selbst der abgebrühteste unter ihnen mußte schlucken, angesichts des vielen Bluts auf dem Kittel des Arztes.
»Tut mir leid«, sagte er zu ihnen. »Wir haben alles versucht. Jetzt müssen wir dringend mit einem Angehörigen sprechen – wegen einer Organspende. Und zwar rasch.«
Kapitel 5
Mai 1991
»Hey, Pierce, nimm gefälligst die Füße runter. Das ist ein öffentliches Gebäude, verdammt noch mal.«
Die Stimme hätte Tote aufwecken können. Auf jeden Fall ließ sie Alex Pierce vor Schreck zusammenfahren. Ein Lächeln trat auf sein ausgemergeltes Gesicht, als er die Gerichtsdienerin auf sich zukommen sah. Reuig und folgsam setzte er sich gerade hin.
»Hallo, Linda.«
»Mehr hast du nicht zu sagen als ›Hallo, Linda‹? Nach allem, was wir einander bedeutet haben?« Sie stemmte die fleischigen Fäuste in die Hüften und starrte ihn an, dann klopfte sie ihm freundschaftlich auf die Schulter. »Wie geht’s meinem Hübschen?«
»Kann nicht klagen. Und du?«
»Dasselbe wie immer.« Sie schaute mit einem Stirnrunzeln zum dicht besetzten Gerichtssaal, wo Hunderte von Geschworenenkandidaten inständig hofften, von der Erfüllung ihrer öffentlichen Pflicht befreit zu werden.
»Hier ändert sich nie was, nur die Gesichter. Immer dieselben lahmen Ausreden, das Zeter und Mordio, nur weil sie als Geschworene bei Gericht berufen wurden.«
Ihr Blick glitt wieder zu ihm. »Wo hast du dich in letzter Zeit rumgetrieben? Hab gehört, du hättest Houston verlassen.«
Vor dem vierten Juli letzten Jahres war er gelegentlich im Harris-County-Gericht gewesen, um als Zeuge bei Verfahren gegen Kriminelle auszusagen, bei deren Verhaftung er selber mitgemischt hatte.
»Ich hab meine Postanschrift noch hier«, antwortete er ausweichend. »War die meiste Zeit auf Achse. Bin eine Weile in Mexiko gewesen. Angeln.«
»Was gefangen?«
»Nicht der Rede wert.«
»Hoffentlich keinen Tripper eingefangen.«
Er grinste trocken. »Heutzutage kann man doch froh sein, wenn es nur ein Tripper ist, was man sich eingefangen hat.«
»Kann man wohl sagen.« Die kernige Gerichtsdienerin schüttelte traurig ihre rote Mähne. »Erst gestern habe ich in der Zeitung gelesen, daß mein Deo Löcher in die Ozonschicht macht. Meine Tampons können bei mir einen toxischen Schock auslösen. Alles, was ich esse, verstopft entweder meine Arterien oder verursacht Dickdarmkrebs. Und jetzt ist es auch vorbei mit dem Spaß beim Rumbumsen.«
Alex lachte. Ihre vulgäre Art beleidigte ihn nicht. Sie kannten einander seit seiner Anfangszeit bei der Polizei von Houston, als er noch Streife gefahren war. Linda kannte jeder hier am Gericht. Man konnte sich darauf verlassen, daß sie den neuesten Klatsch wußte und die dreckigsten Witze, die zur Zeit im Umlauf waren. Ihre rauhe Schale sollte nur den zarten Kern verbergen, den sie bei sehr wenigen Menschen zu erkennen gab. Alex gehörte dazu.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Charade« bei Warner Books, Inc., New York.
4. Auflage Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2006 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Sandra Brown
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1995 by Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Mauritius/nonstock UH · Herstellung: H. Nawrot
eISBN 978-3-641-10339-2
www.blanvalet-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe