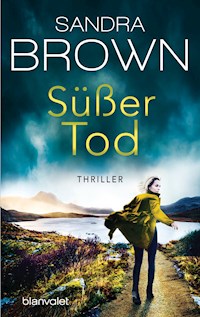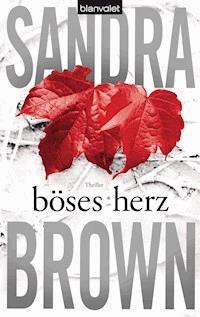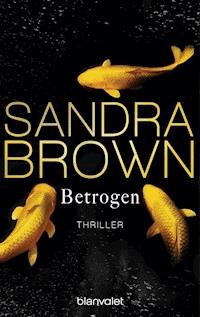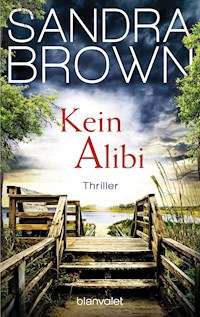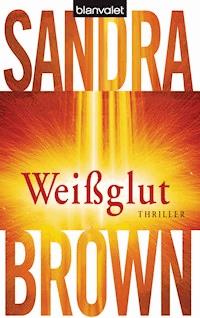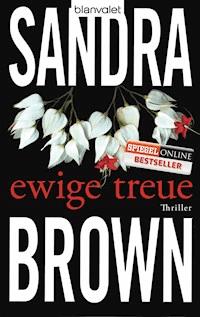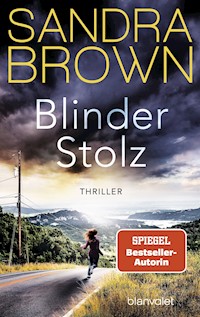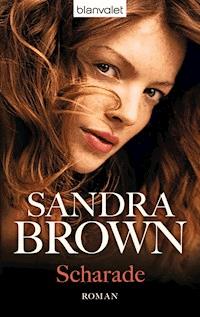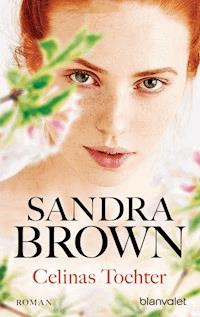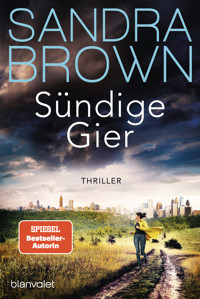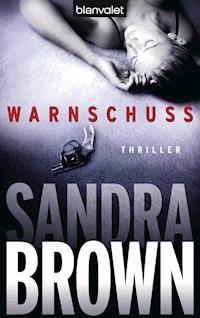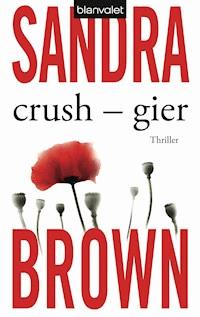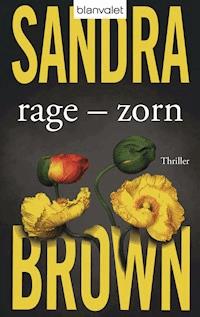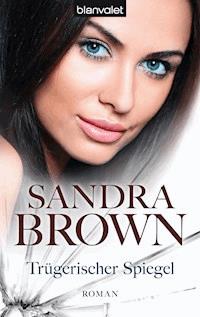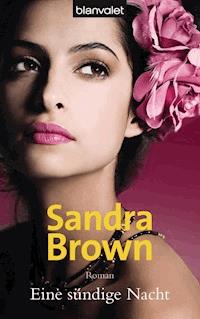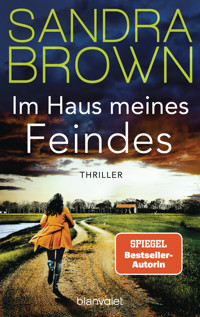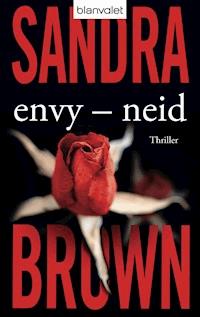
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Neid ist die zweite Todsünde – nach dem Hochmut. Doch im Gegensatz zum Hochmut kann Neid auch tödlich sein ... Der geheimnisumwitterte Autor Parker Evans plant seine Rache gegen einen Mann, der ihn vor Jahren töten wollte. Seine Waffen: sein neues Buch – und seine New Yorker Verlegerin Maris Matherly. Als Maris den teuflischen Plan durchschaut und voll Entsetzen Parkers Gegenspieler ganz in ihrer Nähe ausmacht, steht sie bereits am Rande des Abgrunds. Denn auf einer kleinen Insel vor der Küste Georgias wird bereits das unausweichliche, mörderische Schlusskapitel geschrieben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ENVY – NEID, Prolog
Key West, Florida, 1988
Cracker und Sardinen. Seine Hauptnahrung. Dazu ein Stück einfachen Käse und eine koschere Dillgurke – und schon hatte man die vier wichtigsten Lebensmittel beisammen. Eine bessere Kost gab es einfach nicht.
So die unerschütterliche Meinung von Hatch Walker, dessen sonnengegerbte, windzerfurchte Visage höchstens eine Gorgonenmutter lieben konnte. Während er sein Abendessen malmte, strichen zusammengekniffene Augen, die schon gegen unzählige beißende Sturmböen angeblinzelt hatten, über den Horizont.
Er hielt Ausschau nach zuckenden Blitzen, den Vorboten eines Sturms. Obwohl hier an Land noch nichts darauf hindeutete, war er längst irgendwo dort draußen, tankte Energie und saugte Feuchtigkeit aus dem Meer auf, um sie schwallweise wieder auf die Erde zu peitschen.
Aber erst später. Über dem Hafen hing ein Viertelmond am klaren Himmel. Sterne trotzten dem grellen Neonlicht unten. Aber Hatch ließ sich nicht täuschen. Noch ehe das Barometer fiel, konnte er einen nahenden Wetterwechsel in seinen Knochen spüren. Er konnte einen Sturm sogar riechen, bevor Wolken aufkamen, oder ein Segel die erste starke Windböe einfing. Seine Wettervorhersagen lagen nur selten falsch. Noch vor Morgengrauen würde es regnen.
Geräuschvoll bohrten sich seine nikotingelben Zähne ins eingelegte Gemüse. Die Lake mit Knoblauchgeschmack war ein Genuss, den er mit einem Bissen Käse noch steigerte. Besser ging es nun wirklich nicht. Ihm waren Leute ein Rätsel, die für ein Essen, das nicht einmal einen Fingerhut füllte, freiwillig einen ganzen Wochenlohn bezahlten, wenn man genauso gut – und seiner Ansicht nach sogar verdammt viel besser – für anderthalb Dollar essen konnte. Maximal.
Natürlich zahlten die für mehr als nur die Lebensmittel. Sie finanzierten Parkwächter, gestärkte weiße Tischdecken und Kellner mit Ohrringen und gespreiztem Gang, denen schon die bloße Bitte um eine Extraportion Brot zu viel war. Man bezahlte für den französischen Fantasienamen, den sie einem Fischfilet verpassten, das früher einfach Fang des Tages geheißen hatte. Solche pompösen Lokale hatte er in sämtlichen Häfen der Welt gesehen. Ein paar waren sogar hier in Key West aufgetaucht. Und die verabscheute er am meisten.
An Wochentagen wie diesem war es auf den Straßen relativ ruhig. Die Touristensaison klang langsam ab. Man muss dem lieben Gott auch für Kleinigkeiten danken, dachte Hatch, während er seine Pepsi-Dose leerte. In das Rülpsen mischte sich ein verächtliches Räuspern für Touristen im Allgemeinen, insbesondere für die, die Key West scharenweise überschwemmten.
Zu Tausenden fielen sie alljährlich ein, zugeklatscht mit widerlich stinkendem Sonnenöl und bepackt mit Fotoausrüstungen, quengelnde Blagen im Schlepptau, die eines von Disneys künstlichen Blendwerken oben in Orlando einem der spektakulärsten Sonnenuntergänge des Planeten jederzeit vorgezogen hätten.
Für solche Narren hatte Hatch nur Verachtung übrig. Schufteten fünfzig Wochen im Jahr einen vorzeitigen Herzinfark t herbei, um dann während der restlichen zwei doppelt so hart an ihrem Vergnügen zu arbeiten. Dass sie für dieses Privileg auch noch ihre weichen blassen Hintern zu Markte trugen, verblüffte ihn umso mehr.
Unglücklicherweise hing sein Lebensunterhalt von ihnen ab. Und damit steckte Hatch in einem moralischen Dilemma: Trotz seiner Verachtung hätte er ohne diese Touristeninvasion nicht überleben können.
»Walkers Ausflugsfahrten und Bootsverleih« bekam seinen Teil ab vom Geld der Urlauber, das sie während ihrer lärmenden Besetzung seiner Stadt ausgaben. Er versorgte sie mit Tauch- und Schnorchelausrüstung, lieh ihnen Boote und nahm sie zum Hochseefischen mit, damit sie wieder an Land gehen und ihre sonnenverbrannten Birnen mit einem Edelfisch fotografieren lassen konnten, den ihre blöde Knipserei vermutlich mehr beleidigte als der Fang an sich.
Heute Abend lief das Geschäft nicht gerade glänzend, aber auch das hatte sein Gutes. Ruhig war es, fast schon friedlich. Und das war nicht schlecht. Ganz sicher nicht. Nicht im Vergleich zum Leben auf Handelsschiffen mit ihren lauten und voll gestopften Kajüten, ohne einen Hauch Privatsphäre. Davon hatte er die Schnauze gestrichen voll. Besten Dank. Gebt Hatch Walker seine Einsamkeit und Ruhe, und zwar jederzeit.
Das Wasser im Jachthafen lag ruhig wie ein See da. Fast ungebrochen spiegelten sich die Lichter vom Land auf der Oberfläche. Gelegentlich knarzte auf einem Segelboot ein Mast, oder er hörte auf einer der Jachten ein Telefon klingeln. Mitunter drangen von einem der Nachtclubs an der Promenade ein, zwei Töne oder ein paar Trommelwirbel herüber. Das Rauschen des Verkehrs riss nicht ab. Aber sonst war es still. Und so war es Hatch auch lieber, obwohl das in finanzieller Hinsicht eine magere Woche bedeutete.
Wenn er nicht noch ein Boot draußen gehabt hätte, hätte er heute Abend vielleicht früh zugesperrt und wäre heimgegangen. Er hatte das 25-Fuß-Boot an ein paar Kids vermietet, falls man gut Zwanzigjährige noch als Kids bezeichnen konnte. Im Vergleich zu ihm waren sie es. Zwei Jungs, ein Mädchen. Auf alle Fälle eine brisante Kombination, wie Hatch befand.
Die Kids sahen gut aus, waren braun und schlank und mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das fast an Arroganz grenzte. Vermutlich hatten alle drei zusammen noch keinen Tag ihres Lebens mit ehrlicher Arbeit verbracht. Sie stammten von hier, oder waren wenigstens auf Dauer hierher verpflanzt. Er hatte sie schon des Öfteren gesehen.
Als sie kurz vor Sonnenuntergang an Bord gingen, waren sie schon halb blau. Außerdem schleppten sie mehrere Kühlboxen mit sich, die ein sattes Gewicht haben mussten, so plagten sie sich damit ab. Wetten, dass darin Alkohol steckte? Eine Angelausrüstung hatten sie nicht dabei. Der einzige Grund für ihren Ausflug auf See war ein mehrstündiges Sauf- und Bumsgelage, so wahr er Hatch Walker hieß. Er war unschlüssig gewesen, ob er ihnen das Boot überhaupt vermieten sollte, aber seine fast leere Kasse verlieh seiner Überzeugung Nachdruck, dass sie nicht völlig betrunken waren.
Seine strenge Anweisung, auf seinem Boot während der Fahrt nicht zu trinken, hatten sie mit dem falschen Lächeln von Teppichhändlern quittiert und ihm versichert, derlei käme ihnen nie und nimmer in den Sinn. Einer verbeugte sich tief mit mühsam unterdrücktem Lachen. Die Lektion des alten grauen Sacks musste ihm urkomisch erschienen sein. Der andere meinte mit einem forschen Salut: »Aye, aye, Sir!«
Während Hatch der jungen Frau aufs Boot half, hoffte er inständigst, sie wüsste, was ihr bevorstand. Allerdings wirkte sie durchaus so. Auch sie hatte er schon hier gesehen. Viele Male. Mit jeder Menge Männer. Eine Augenklappe bedeckte mehr Haut als ihr Bikinihöschen. Und Hatch hätte sich nicht mehr einen Kerl nennen dürfen, wenn er nicht bemerkt hätte, dass sie auf das Oberteil ebenso gut hätte verzichten können.
Was sie dann auch bald tat.
Noch ehe sie aus dem Hafenbecken waren, riss ihr einer der Männer das Oberteil weg und schwenkte es wie ein Siegesbanner über dem Kopf. Ihre Versuche, es zurückzubekommen, endeten mit spielerischem Klapsen und Kitzeln.
Kopfschüttelnd hatte Hatch zugeschaut, wie das Boot zum Jachthafen hinaustuckerte, und sich dabei glücklich geschätzt, dass er nie eine Tochter gehabt hatte, deren Jungfernschaft es zu schützen galt.
Schließlich lag nur noch eine Sardine in der Dose. Mit zwei Fingern fischte Hatch sie aus dem Öl, legte sie quer über einen Cracker, packte den letzten Bissen Gurke und ein Eckchen Käse dazu, tränkte alles tüchtig mit Tabasco, stapelte einen weiteren Cracker oben drauf und steckte sich das Ganze in den Mund. Anschließend wischte er sich die Krümel aus dem Bart.
Während er zufrieden kaute, warf er zufällig einen flüchtigen Blick Richtung Hafeneinfahrt. Der Anblick ließ das Sandwich in seinem Hals stecken bleiben. Als er es mit Gewalt hinunterzwang, zerkratzte ihm ein Stück Cracker die Speiseröhre. »Verdammt noch mal, was macht denn der da?«, stieß er hervor.
Kaum hatte Hatch den Gedanken ausgesprochen, warf ihn ein lang gezogenes Tuten des Signalhorns vom Hocker. Das Boot kam immer näher.
Aber er wäre sowieso aufgesprungen. Das unzerkaute Sardinensandwich hatte kaum seinen Magen erreicht, da war Hatch bereits zur Türe des verwitterten Schuppens, der seinen Bootsverleih beherbergte, hinaus und walzte wütend den Kai hinunter. Er ruderte wild mit den Armen und brüllte den Fahrer an, er komme viel zu schnell in den Jachthafen hinein und verursache viel zu viel Kielwasser. Dieser Leichtsinn koste ihn eine Geldstrafe, vielleicht sogar ein paar Nächte im Kittchen. Vermutlich ein Tourist aus einem dieser quadratischen Binnenstaaten, der noch nie eine größere Wasserfläche als die auf einem Viehtrog gesehen hatte.
Erst dann erkannte Hatch das Boot wieder. Es war seines. Seins! Dieser verdammte Volltrottel trieb Schindluder mit seinem Boot, dem schönsten und größten seiner Flotte!
Hatch ließ eine Reihe kräftiger Flüche vom Stapel, üble Reste aus seinen Jahren bei der Handelsmarine. Wenn er diese Kids in die Hände bekäme, würden sie den Tag bedauern, an dem ihre Papis sie gezeugt hatten. Gut, er war alt und hässlich und krumm, hatte graue Koteletten, und hinkte nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem kubanischen Messerstecher ein bisschen. Mit zwei gelackten Beachboys würde er trotzdem fertig werden. »Darauf könnt ihr Gift nehmen, ihr arroganten kleinen Scheißer!«
Auch nach dem Passieren der Bojen verlangsamte das Boot nicht, sondern fuhr in vollem Tempo weiter. Nur um wenige Zentimeter verpasste es eine zweiundvierzig Fuß lange Segeljacht, die heftig ins Schaukeln geriet. Ein Schlauchboot rammte die Seite einer Multimillionendollarjacht, auf deren poliertem Deck die Besitzer an ihrem letzten Drink nippten. Sie stürzten an die Reling und brüllten zu dem unvorsichtigen Seemann hinunter.
Hatch drohte dem jungen Mann am Steuer mit der Faust. Dieser betrunkene Narr steuerte doch tatsächlich im Kamikazestil kerzengerade den Pier an. Plötzlich schaltete er den Motor aus und riss das Steuer scharf nach Backbord. Vom Außenborder schoss ein Gischtschweif hoch.
Hatch blieb kaum eine Sekunde, um zur Seite zu springen, da krachte das Boot auch schon in den Kai. Der junge Mann kletterte die Stufen herunter, kam quer übers Deck, sprang auf den Hauptpier, stolperte über eine Querleiste und kroch dann ein paar Meter auf allen Vieren vorwärts.
Hatch ging auf ihn los, packte ihn an den Schultern und drehte ihn wie einen Fisch beim Ausnehmen herum. Hätte er sein Filetiermesser zur Hand gehabt, hätte er ihn vermutlich tatsächlich, ohne mit der Wimper zu zucken, von den Gonaden bis zur Gurgel aufgeschlitzt. Zum Glück war eine Litanei von Flüchen, Drohungen und Beschuldigungen seine einzige Waffe.
Aber sogar diese stockten und erstarben, noch ehe sie ausgesprochen wurden.
Bis jetzt hatte sich Hatch ausschließlich auf sein Boot konzentriert und auf das waghalsige Tempo, mit dem es in den Jachthafen gerast war. Auf den jungen Mann am Steuer hatte er nicht geachtet.
Jetzt sah er das blutige Gesicht des Jungen. Sein linkes Auge war praktisch zugeschwollen, sein zerfetztes T-Shirt klebte wie ein nasser Lumpen am schlanken Oberkörper.
»Helft mir. O Gott, o Gott.« Er schüttelte Hatchs Hände von den Schultern und kam mühsam auf die Beine. »Sie sind da draußen«, sagte er, wobei er hektisch aufs offene Meer hinaus deutete. »Sie sind auf dem Ozean. Ich konnte sie nicht finden. Sie… sie …«
Einmal hatte Hatch mit eigenen Augen gesehen, wie ein Mann von einem Hai angefallen wurde. Hatch hatte es geschafft, ihn aus dem Wasser zu ziehen, bevor der Hai mehr als nur sein linkes Bein packen konnte. Er hatte überlebt, aber wie: Zu Tode geschockt hatte er sich bepisst und wirres Zeug hervorgestoßen, während er kübelweise Blut im Sand vergoss.
Dieselbe wilde Panik erkannte Hatch in den Augen dieses jungen Mannes. Das war kein Dummer-Jungen-Streich, wie er ursprünglich gedacht hatte, keine Mutprobe, keine Eskapade eines Betrunkenen. Dieser Junge – er hatte ihm vorher salutiert – war vor Verzweiflung fast hysterisch.
»Beruhige dich, Sohnemann.« Hatch packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn sacht. »Was ist da draußen passiert? Wo sind deine Freunde geblieben?«
Der junge Mann legte die Hände übers Gesicht. Hatch bemerkte, dass auch sie blutig und verschrammt waren. Er schluchzte unkontrolliert. »Im Wasser.«
»Über Bord?«
»Ja. O Gott. Himmel.«
»Dieses Rindvieh hat fast meine Jacht versenkt! Wie kommt er dazu, zum Teufel noch mal?«
Ein Mann in Badesandalen kam angeschlappt, die Hände in die Seiten gestemmt. Er stank geradezu nach einem Cologne, das jeder Hure, die etwas auf sich hielt, zu stark gewesen wäre. Unter seinem mit schwarzen Locken bedeckten Hängebauch trug er lediglich einen Tanga. An seinem rechten Handgelenk prangte ein dickes Goldarmband. Er hatte genau jenen näselnden nordöstlichen Akzent, der Hatch stets unweigerlich auf die Palme brachte.
»Der Junge ist verletzt. Sie hatten einen Unfall.«
»Unfall, meine Fresse. Eine Mordsdelle hat er der Dinky Doo verpasst.« Inzwischen hatte sich, in Bikini und hochhackigen Sandalen, die Gefährtin des Mannes dazu gesellt. Ihre Sonnenbräune und Titten waren gekauft. Unter jedem Arm hielt sie einen Zwergpudel. Die Schoßhündchen hatten rosa Bänder um die Ohren und kläfften wütend im Duett.
»Rufen Sie 911 an«, sagte Hatch.
»Ich will wissen, was dieser Scheißkerl vorhat …«
»Ruf 911 an!«
Drinnen in Hatchs »Büro« roch es nach Sardinen, feuchtem Hanf, totem Fisch und Motoröl. Es war ungemütlich warm und stickig, als könnte die Bude drei Männern nicht genug Sauerstoff liefern, weil sie normalerweise nur mit einem besetzt war.
Den an und für sich schon begrenzten Raum am Boden beengten zusätzlich Kisten mit Angel- und Tauchzeug, Seilrollen, Karten und Tabellen, Ersatzteile und Werkzeug, ein uralter metallener Aktenschrank, in den Hatch kaum je eine Akte verfrachtete, und sein Schreibtisch, der aus einem Schiffswrack stammte und den er auf einer Auktion für dreißig Dollar gekauft hatte.
Bereits zweimal hatte sich der Junge, der sein Boot zu Schrott gefahren hatte, auf seiner Toilette übergeben. Hatch witterte hinter dieser Übelkeit eher Nerven und Angst als den Schuss Brandy, den er ihm heimlich zugesteckt hatte, als keiner hinsah.
Natürlich hatte der Junge von dem Brandy eine Menge getrunken, und das war nicht einmal eine Vermutung. So viel hatte er dem Offizier der Küstenwache, der ihn momentan verhörte, bereits gestanden. Zuvor hatte ihn schon die Polizei von Key West zur Havarie im Jachthafen befragt. Anschließend hatte man ihn dem Offizier der Küstenwache übergeben, der wissen wollte, weshalb seine beiden Begleiter schließlich im Atlantik gelandet waren.
Er hatte ihre Namen und ihr Alter angegeben und die örtlichen Adressen. Hatch hatte diese Information an Hand des Leihvertrages überprüft, den die beiden jungen Männer vor dem Einschiffen ausgefüllt hatten. Er bestätigte dem Offizier die Daten.
Obwohl es Hatch gegen den Strich ging, seinen Privatraum mit Fremden teilen zu müssen, war er froh, weil man ihn nicht gebeten hatte, draußen zu warten, während die Polente den Jungen verhörte. Inzwischen wimmelte es im Jachthafen von Zuschauern. Der dramatische Vorfall hatte sie angezogen wie ein Misthaufen die Fliegen. Außerdem konnte man sich nicht rühren, ohne auf einen Uniformierten zu treten.
Dank seiner intimen Kenntnis von Gefängnissen in zahllosen Häfen auf mehreren Kontinenten hatte Hatch eine Abneigung gegen Uniformen und Dienstmarken. Am liebsten wäre er jeder Obrigkeit aus dem Weg gegangen, gleich welcher Art. Welchen Sinn hatte denn das Leben, wenn ein Mensch nicht nach seinen eigenen Regeln und seinem persönlichen Sinn für Gut und Böse leben konnte? Diese Einstellung hatte ihn auf dem ganzen Globus in der grünen Minna landen lassen. Aber das war nun mal seine Philosophie, und dabei blieb er.
Eines musste Hatch trotzdem fairerweise zugeben: Die offiziellen Vertreter der Küstenwache und die Polizisten vor Ort, die den jungen Mann befragt und einen Such- und Rettungstrupp organisiert hatten, hatten sich nicht danebenbenommen.
Dass der Junge kurz vor einem totalen Kollaps stand, war klar. Die Polypen war schlau genug gewesen, einzusehen, dass er zusammenbrechen würde, wenn sie zu viel Druck ausübten. Und wie stünden sie dann da? Um ihn zu beruhigen und Antworten zu bekommen, hatten sie ihn ziemlich sanft behandelt.
Noch immer hatte er eine nasse Badehose und Turnschuhe an, aus denen bei jeder Bewegung Meerwasser auf die rauen Bodenplanken sickerte. Zusätzlich zum Alkohol hatte ihm Hatch eine Decke übergeworfen, die er allerdings zusammen mit seinem zerfetzten T-Shirt abgestreift hatte.
Als man von draußen eilige Schritte und eine aufgeregte Stimme hörte, fuhr der Kopf des Jungen hoch, und er schaute hoffnungsvoll Richtung Tür.
Aber die Schritte rannten vorbei, ohne anzuhalten. Während sich der Offizier aus Hatchs Kaffeekanne bediente, drehte er ihm den Rücken zu. Nun wandte er sich wieder um und deutete die Miene des Jungen richtig. »Sobald wir etwas wissen, erfährst du’s, Sohn.«
»Sie müssen noch am Leben sein.« Seine Stimme klang so heiser, als hätte er lange Zeit gegen einen Sturm angebrüllt. »Wahrscheinlich habe ich sie im Dunkeln einfach nicht finden können. Da draußen war es so verdammt finster.« Seine Augen schossen zwischen Hatch und dem Offizier hin und her. »Aber gehört habe ich sie nicht. Hab gerufen und gerufen, aber… Warum haben sie mir nicht geantwortet? Oder um Hilfe gerufen? Es sei denn…« Er brachte es nicht fertig, die allgemeine Befürchtung laut auszusprechen.
Der Offizier begab sich wieder zu Hatchs Hocker. Er hatte ihn neben den Stuhl gestellt, auf dem der Junge mit zusammengesackten Schultern saß. Mehrere Minuten verstrichen bleischwer. Der Offizier schlürfte lediglich in kleinen Schlucken seinen heißen Kaffee.
Hatch blieb ruhig, obwohl ihn das fast wahnsinnig machte. Das war die Sache der Polizei, nicht seine. Sein Boot war versichert. Es würde zwar Papierkram bis zum Abwinken und Gefeilsche mit einem misstrauischen Sachverständigen im Pepita-Anzug geben, aber auf lange Sicht käme er schon auf seine Kosten. Vielleicht stünde er danach sogar ein bisschen besser da als vorher.
Was diesen Jungen anbetraf, war er weniger optimistisch. Kein noch so hoher Versicherungsbetrag würde ihm nach diesem Vorfall das Leben erleichtern. Und bezüglich der beiden, die über Bord gegangen waren, hatte Hatch nicht viel Hoffnung. Die Chancen standen eindeutig gegen sie.
Er hatte ein paar überlebende Schiffbrüchige gekannt, die später davon berichten konnten, allerdings nicht viele. Wenn man ins Wasser fiel, stellte der Tod durch Ertrinken vermutlich noch die gnädigste Variante dar. Den Elementen ausgesetzt zu sein, dauerte viel länger. Und für die Raubfische war man sowieso nur eine weitere Nahrungsquelle.
Der Offizier der Küstenwache hielt den angeschlagenen Kaffeebecher zwischen den Händen und schwenkte den Inhalt. »Warum hast du denn nicht über Funk Hilfe geholt?«
»Hab ich doch. Ich meine, ich hab’s versucht. Ich hab das Radio nicht angekriegt.«
Der Offizier starrte in seinen Kaffeewirbel. »Ein paar andere Boote haben dein SOS gehört. Haben versucht, dir zu sagen, du sollst bleiben, wo du bist. Hast du nicht gemacht.«
»Ich hab sie nicht gehört. Wahrscheinlich …« Hier schaute er verstohlen zu Hatch hinüber. »Ich hab wohl nicht besonders aufgepasst, als er uns den Umgang mit dem Funkgerät erklärt hat.«
»Teurer Fehler.«
»Ja, Sir.«
»Könnte man sagen, dass du kein erfahrener Seemann bist?«
»Erfahren? Nein, Sir. Trotzdem habe ich diesmal zum ersten Mal Probleme gehabt.«
»Mhmm. Erzähl mir von der Rauferei.«
»Rauferei?«
Diese Rückfrage ließ den Offizier die Stirn runzeln. »Halt mich jetzt nur nicht für dumm, mein Freund. Dein Auge ist völlig zugeschwollen. Du hast eine blutige Nase, aufgeplatzte Lippen und aufgeschürfte, blau geschlagene Fingerknöchel. Ich weiß, wie ein Faustkampf aussieht, ja? Also treib keine Spielchen mit mir.«
Die Schultern des jungen Mannes fingen zu zittern an. Seine Augen liefen über. Trotzdem versuchte er nicht einmal, gegen die Tränen anzukämpfen, oder sich die laufende Nase abzuwischen.
»War es wegen des Mädchens?«, fragte der Offizier etwas rücksichtsvoller. »Mr. Walker hier meint, sie sei ein echter Hingucker gewesen. Ein Partygirl, soweit er das beurteilen konnte. Gehört sie zu einem von euch?«
»Sie meinen, wie eine Freundin? Nein, Sir, sie ist nur eine Bekannte.«
»Und du hast dich mit deinem Kumpel um ihre Gunst geprügelt?«
»Nein, Sir, nicht… nicht direkt. Ich meine damit, dass sie nicht der Grund dafür war.«
»Und was war’s dann?«
Der Junge schniefte, blieb aber stumm.
»Kannst es mir genauso gut jetzt erzählen«, sagte der Offizier, »denn egal, was wir dort draußen finden, wenn wir soweit sind, werden wir dich in die Enge treiben, bis wir die Wahrheit erfahren.«
»Wir waren betrunken.«
»Mhmm.«
»Und … und …« Der Junge hob den Kopf, schaute zu Hatch hinüber und dann wieder zu dem Offizier zurück und sagte: »Er ist mein bester Freund.«
»Schön. Was ist also passiert?«
Er leckte sich die Oberlippe. »Er hat durchgedreht. Wie irre. So habe ich ihn noch nie erlebt.«
»Wie?«
»Verrückt. Gewalttätig. Als wäre ihm der Faden gerissen oder so was.«
»Der Faden.«
»Ja, Sir.«
»Was hast du denn gemacht, dass er die Schnauze voll hatte? Was war der Grund für den Fadenriss?«
»Nichts! In der einen Minute war er noch mit ihr unter Deck. Ich hab sie ein bisschen in Ruhe gelassen. Verstehen Sie?«
»Wegen Sex? Die haben miteinander geschlafen?«
»Jaaa. Ich meine, mal so richtig einen draufmachen und sich amüsieren. In der nächsten Minute war er dann wieder an Deck und ging auf mich los.«
»Ohne jeden Grund? Einfach so?«
Der Kopf des Jungen wackelte auf und ab. »Es sollte eine Sause werden. Etwas zum Feiern. Ich kapier nicht, wieso das so schnell außer Kontrolle geraten ist. Ich schwör bei Gott, dass es so ist.« Er senkte sein zerschundenes Gesicht in die Hände und fing wieder zu schluchzen an.
Der Offizier schaute zu Hatch hinüber, als wollte er ihn um Rat fragen. Hatch starrte zurück. Am liebsten hätte er gefragt, warum er ihn so anschaute. Er war kein Berater, kein Vater. Er war noch nicht einmal ein Offizier der Küstenwache oder ein Bulle, verdammt und zugenäht. Das war einfach nicht mehr sein Problem.
Als er freiwillig nichts von sich gab, wollte der Offizier wissen, ob er der Version des Jungen etwas hinzuzufügen hätte.
»Nein.«
»Haben Sie die Rauferei gesehen oder gehört?«
»Ich habe nur eines gesehen: dass die ihren Spaß hatten.«
Der Offizier wandte sich wieder dem jungen Mann zu. »Gute Freunde raufen nicht grundlos miteinander. Nicht einmal, wenn sie zu viel getrunken haben. Vielleicht setzt es ein paar kräftige Bemerkungen oder ein, zwei Hiebe. Aber dann legt sich das auch wieder und ist vorbei, stimmt’s?«
»Vermutlich«, erwiderte er mürrisch.
»Deshalb will ich, dass du jetzt reinen Tisch mit mir machst. Okay? Hörst du? Was hat diese Rauferei ausgelöst?«
Mühsam schluckte der Junge. »Er ist einfach über mich hergefallen.«
»Wieso?«
»Ich hab mich nur verteidigt. Ehrenwort«, flennte er. »Ich wollte nicht mit ihm raufen. Es war eine Party.«
»Warum ist er über dich hergefallen?«
Er schüttelte den Kopf.
»Also, das ist nicht wahr, oder? Du weißt, warum er über dich hergefallen ist. Also sag’s mir. Warum ist dein bester Freund so durchgedreht, dass er angefangen hat, dich zu verprügeln?«
Nach zwanzig Sekunden Schweigen nuschelte der Junge ein Wort. Ein Einziges.
Hatch war unsicher, ob er richtig gehört hatte. Erstens, weil dabei der erste Donnerschlag des vorhergesagten Gewittersturms das kleine Fenstereck seiner Hütte erbeben ließ, und zweitens, weil ihm die Antwort des Jungen auf diese Frage merkwürdig vorkam.
Der Offizier musste dasselbe gedacht haben. Irritiert schüttelte er den Kopf und beugte sich vor, um besser hören zu können. »Wie bitte? Lauter, mein Junge.«
Der junge Mann hob den Kopf und fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase. Er räusperte sich. Blinzelnd konzentrierte er sich mit seinem guten Auge auf den Offizier.
»Neid«, sagte er barsch. »Darum geht es hier. Um Neid.«
P.M.E. St. Anne Island, Georgia Februar 2002
1
»Aber es muss doch etwas geben.« Ungeduldig trommelte Maris Matherly-Reed mit ihrem Bleistift gegen den Notizblock, auf den sie eine Reihe Dreiecke und eine Kringelkette gekritzelt hatte. Darunter hatte sie die Umrisse eines Buchumschlages skizziert.
»P.M.E., korrekt?«
»Korrekt.«
»Bedauere, Ma’am, aber das steht nicht im Verzeichnis. Ich habe doppelt geprüft.«
Die Idee für den Umschlag – ein autobiografischer Bericht der Autorin über die düstere Beziehung zu ihrer Stiefschwester – war Maris gekommen, während sie darauf wartete, dass die Auskunft die Telefonnummer lokalisierte. Eigentlich hätte der Anruf nur wenige Sekunden dauern dürfen, aber nun waren schon mehrere Minuten vergangen.
»Haben Sie denn unter dieser Vorwahl keinen Eintrag für P.M.E.?«
»Unter gar keiner Vorwahl«, erwiderte der Mann von der Auskunft. »Ich habe im ganzen US-Gebiet gesucht.«
»Vielleicht handelt es sich um ein Geschäft, nicht um eine Privatadresse.«
»Ich habe beides überprüft.«
»Könnte es eine Geheimnummer sein?«
»Auch die würde unter dieser Kennung erscheinen. Ich habe nichts mit diesen Initialen. Punktum. Wenn Sie einen Nachnamen hätten …«
»Habe ich aber nicht.«
»Dann tut es mir Leid.«
»Danke für den Versuch.«
Frustriert betrachtete Maris erneut ihre Skizze, ehe sie darüberkritzelte. Dieses Buch würde sie nie mögen, egal, wie der Umschlag aussah. Die inzestuösen Untertöne bereiteten ihr Bauchschmerzen. Außerdem befürchtete sie, dass eine größere Anzahl Leser ihr ungutes Gefühl teilen würde.
Doch die Lektorin, die das Manuskript bearbeitet hatte, plädierte nachhaltig für einen Kauf. Das Thema garantierte der Autorin Auftritte im Fernsehen und bei Talkshows im Radio, Besprechungen in Zeitschriften und wahrscheinlich eine Option auf den Film der Woche. Und selbst bei schlechten Kritiken böte das Thema noch genügend Anreiz, um große Verkaufszahlen anzustoßen. Da sich die übrigen Entscheidungsträger in der Hardcover-Abteilung von Matherly Press dem Plädoyer der Lektorin für ihr Projekt angeschlossen hatten, hatte sich Maris der Mehrheit gebeugt. Jetzt hatte sie bei ihnen etwas gut.
Das brachte sie wieder auf den Prolog von Neid, den sie heute Nachmittag gelesen hatte. Das Manuskript hatte sie unter einem Stapel unangeforderter Einsendungen entdeckt, die schon seit Monaten ein Regal in ihrem Büro belegten und bis zu einem Tag in weiter Ferne Staub ansammelten, an dem ihr Terminkalender einen flüchtigen Blick darauf gestattete. Anschließend würde sie den bange wartenden Autoren den üblichen Absagebrief schicken. Angesichts der niederschmetternden Enttäuschung, die diese beim Lesen eines unpersönlichen, aber deutlichen Laufpasses überfallen würde, verdiente jeder Autor wenigstens ein paar Minuten ihrer Zeit.
Und außerdem gab es immer diese abwegig nebulöse Chance von eins zu einer Million, die durch jedes Lektorenhirn spukte: dass genau unter diesem Schrotthaufen der nächste Steinbeck, Faulkner oder Hemingway wartete.
Maris wäre schon mit einem neuen Bestseller zufrieden. Diese fünfzehn Prologseiten waren definitiv viel versprechend. Sie hatten Maris mehr als jede andere Lektüre in jüngster Zeit mitgerissen. Und darunter befand sich sogar Material von ihren bereits veröffentlichten Autoren. Ganz gewiss jedoch handelte es sich um eine aufregendere Lektüre als sämtliche Ergüsse von Nachwuchsdichtern.
Sie hatte ihre Neugierde erweckt, wie das ein Prolog oder ein erstes Kapitel tun sollte. Sie war gefesselt, wollte unbedingt mehr wissen und war ganz wild darauf, die restliche Geschichte zu lesen. Doch war die überhaupt schon geschrieben? Sie rätselte. Oder wenigstens in Umrissen skizziert? Handelte es sich um den Erstversuch eines Autors in Sachen Belletristik? Hatte er oder sie Schreiberfahrung in einem anderen Genre? Worin bestanden seine/ihre Referenzen? Hatte er/sie überhaupt welche?
Obwohl nichts auf das Geschlecht des Schriftstellers hindeutete, tippte ihr Instinkt auf männlich. Hatch Walkers Selbstgespräche standen ganz im Einklang mit seinem deftigen Charakter und lasen sich so, wie ein Mann denken würde. Der Erzählton spiegelte die poetische Ader des alten Seebären.
Und doch hatte ein völlig unerfahrener Mensch diese Seiten eingesandt, einer, dem man nie beigebracht hatte, wie man ein Manuskript bei einem zukünftigen Verleger einreicht. Er hatte sämtliche Standardregeln gebrochen: kein adressierter und frankierter Rückumschlag, kein persönliches Anschreiben, weder Telefonnummer noch Adresse, Postfach oder E-Mail-Adresse. Lediglich jene drei Initialen und der Name einer Insel, von der Maris noch nie etwas gehört hatte. Wie konnte der Schriftsteller auf einen Verkauf seines Manuskriptes hoffen, wenn man keinen Kontakt zu ihm aufnehmen konnte?
Ihr fiel auf, dass der Poststempel auf dem Umschlag vier Monate alt war. Sollte der Autor den Prolog bei mehreren Verlegern gleichzeitig eingereicht haben, war das Buch eventuell bereits verkauft. Um so mehr galt es, ihn schnellstmöglich zu lokalisieren. Entweder verschwendete sie ihre Zeit, oder sie war einem potenziellen Erfolg auf der Spur. Eines stand jedenfalls fest: Sie musste sich Gewissheit verschaffen und das eher früher als später.
»Du bist noch nicht fertig?«
Noah tauchte in ihrer offenen Bürotür auf, im Armani-Smoking. Maris sagte: »Meine Güte, siehst du schick aus.« Ein rascher Blick auf ihre Schreibtischuhr bestätigte, dass sie jedes Zeitgefühl verloren hatte und tatsächlich spät dran war. Mit einem kurzen, geringschätzigen Lachen über sich selbst raufte sie sich die Haare. »Während es bei mir wohl größerer Renovierungsarbeiten bedarf.«
Der Mann, der seit zweiundzwanzig Monaten ihr Ehemann war, schloss die Türe hinter sich, ging weiter in ihr Eckbüro und warf eine Branchenzeitschrift auf ihren Schreibtisch. Dann trat er hinter ihren Sessel und begann mit einer Nacken- und Schultermassage. An diesen Stellen stauten sich bei ihr Anspannung und Müdigkeit, das wusste er genau. »Harter Tag?«
»Eigentlich gar nicht so übel. Nur eine Konferenz, am Nachmittag. Heute habe ich hauptsächlich hier drinnen Platz geschaffen.« Sie deutete auf den Stapel abgelehnter Manuskripte, die auf ihre Rücksendung warteten.
»Du hast das Zeug aus deinem Schrotthaufen gelesen? Maris, also wirklich«, schalt er spielerisch. »Warum machst du dir diese Mühe? Einer der Grundsätze bei Matherly Press lautet, nie etwas zu kaufen, was nicht über einen Agenten eingereicht wurde.«
»Das ist die offizielle Richtlinie des Hauses, da ich aber eine Matherly bin, kann ich die Regeln nach Belieben brechen.«
»Ich bin mit einer Anarchistin verheiratet«, scherzte er und bückte sich, um sie auf den Hals zu küssen. »Falls du einen Aufstand planst, könntest du dich dann nicht der Rationalisierung unseres Geschäftes annehmen, anstatt dich Dingen zu widmen, die die kostbare Zeit unserer Verlegerin und Geschäftsführerin verschwenden?«
»Dieser Titel verleidet einem ja wirklich alles«, stellte sie fest und schüttelte sich leicht. »Das klingt ja, als sei ich eine alte Schachtel, die nach Halspastillen riecht und Gesundheitsschuhe trägt.«
Noah lachte. »Einflussreich klingt das, was du ja auch bist. Und schrecklich beschäftigt, und das bist du auch.«
»Du hast schlau und sexy vergessen.«
»Das ist offensichtlich. Hör auf, das Thema wechseln zu wollen. Warum kümmerst du dich um den Schrott, das tun doch nicht einmal unsere Nachwuchslektoren?«
»Weil mir mein Vater beigebracht hat, jeden Schreibversuch ernst zu nehmen. Schon das bloße Bemühen darum verdient eine kleine Anerkennung, selbst wenn das individuelle Talent begrenzt ist.«
»Es läge mir fern, den ehrenwerten Daniel Matherly in Zweifel zu ziehen.«
Trotz Noahs leisem Tadel beabsichtigte Maris, weiterhin wie gewohnt den Manuskriptberg zu durchforsten, auch wenn es sich um eine Zeit raubende und unproduktive Aufgabe handelte. Denn sie gehörte zu jenen Prinzipien, auf denen vor über hundert Jahren ein Matherly dieses Verlagshaus gegründet hatte. Noah mochte sich ruhig über ihre archaischen Traditionen lustig machen. Er war schließlich kein geborener Matherly, sondern ein angeheiratetes Mitglied der Familie. Und dieser wesentliche Unterschied erklärte seine eher lockere Haltung in Sachen Tradition.
Jeder Matherly war in der Wolle gefärbt – mit Tinte. Die Liebe dazu strömte durch die Adern der ganzen Familie. Die Bewunderung und der Respekt ihrer Familie für das geschriebene Wort und für Schriftsteller stellten die Grundlagen ihres Erfolgs und des Überlebens als Verleger dar. Davon war Maris felsenfest überzeugt.
»Ich habe eine Vorabkopie des Artikels bekommen«, sagte Noah.
Sie nahm die Zeitschrift zur Hand, die er mitgebracht hatte. Ein gelber Zettel markierte eine spezielle Seite. Beim Umblättern sagte sie: »Aha, tolles Foto.«
»Guter Fotograf.«
»Guter Kopf.«
»Danke schön.«
»›Noah Reed ist vierzig, geht aber als viel jünger durch‹«, zitierte sie laut. Sie lehnte den Kopf schräg nach hinten und musterte ihn kritisch. »Einverstanden, du siehst keinen Tag älter als neununddreißig aus.«
»Ha-ha.«
»›Tägliches Training im hauseigenen Matherly-Fitnessraum im sechsten Stock – eine von Reeds Innovationen beim Eintritt in die Firma vor drei Jahren – halten den Eins-achtzig-Mann rank und schlank.‹ Na ja, eines steht fest: Die Verfasserin ist von dir entzückt. Hattest du mal etwas mit ihr?«
Er lachte in sich hinein. »Ganz gewiss nicht.«
»Dann ist sie eine rare Ausnahme.«
An ihrem Hochzeitstag hatte ihn Maris mit der Bemerkung geneckt, sie sei überrascht, dass kein Trauerflor die Portale von St. Patrick verhüllte, da so viele Single-Frauen den Verlust eines der begehrtesten Junggesellen der Stadt beklagten. »Bekommt sie denn die Kurve und erwähnt auch den Geschäftsmann und seinen Beitrag zum Erfolg der Firma?«
»Weiter unten.«
»Mal sehen ... ›bekommt allmählich graue Schläfen, was sein distinguiertes Aussehen nur noch steigert‹… Und so weiter und so fort zu deinem überlegenen Auftreten und deinem Charme. Bist du sicher … Oh, hier steht etwas. ›Das Ruder bei Matherly Press teilt er sich mit seinem Schwiegervater, dem legendären Verleger und Vorstandsvorsitzenden Daniel Matherly, und mit seiner Ehefrau Maris Matherly-Reed, deren perfekten Instinkt bei der Auswahl und Betreuung von Büchern er neidlos anerkennt. Für den Ruf des Verlages als Bestsellerschmiede macht er in aller Bescheidenheit sie verantwortlich.‹« Erfreut lächelte sie zu ihm hoch. »Das hast du wirklich gesagt?«
»Und noch mehr, was sie nicht erwähnt hat.«
»Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir.«
»Ich habe lediglich eine mir bekannte Wahrheit geäußert.«
Nachdem Maris den schmeichelhaften Artikel zu Ende gelesen hatte, legte sie die Zeitschrift bei Seite. »Sehr hübsch. Trotzdem hat sie in ihrer Blauäugigkeit zwei wichtige biografische Punkte übersehen.«
»Und die wären?«
»Dass du obendrein ein ausgezeichneter Schriftsteller bist.«
»Vernichtet ist doch kalter Kaffee.«
»Trotzdem sollte man es jedes Mal erwähnen, wenn dein Name gedruckt wird.«
»Und was ist das zweite?«, fragte er in jenem brüsken Ton, den er immer anschlug, sobald sie seinen einzigen publizierten Roman zur Sprache brachte.
»Sie hat kein Wort über deine wunderbaren Massagetechniken verloren.«
»Stets zu Diensten.«
Maris schloss die Augen und legte den Kopf zur Seite. »Ein bisschen tiefer auf der… Mmmh. Genau da.« Er versenkte seinen kräftigen Daumen an eine Stelle zwischen ihren Schulterblättern. Allmählich löste sich die Verkrampfung.
»Du bist ja völlig verspannt«, sagte er. »Die gerechte Strafe, wenn du den ganzen Tag diesen Mist durchstöberst.«
»Vielleicht war’s doch keine reine Zeitverschwendung. Ich habe tatsächlich etwas gefunden, das mein Interesse erweckt hat.«
»Du machst Witze.«
»Nein.«
»Belletristik oder Sachbuch?«
»Belletristik. Nur ein Prolog, aber der hat’s in sich. Es beginnt …«
»Wirklich, mein Schatz, ich möchte alles darüber hören, aber jetzt solltest du wirklich einen Zahn zulegen, wenn wir noch rechtzeitig hinkommen wollen.«
Er gab ihr einen Kuss auf den Scheitel und versuchte dann, sich zurückzuziehen, aber Maris ergriff seine Hände, zog sie über die Schultern und legte sie flach auf ihre Brust. »Ist das heute Abend obligatorisch?«
»Mehr oder weniger.«
»Eine Veranstaltung könnten wir doch versäumen, oder? Pa hat sich für heute Abend entschuldigt.«
»Genau deshalb sollten wir ja dort sein. Matherly Press hat einen Tisch gekauft. Zwei leere Sitze würden auffallen. Einer unserer Autoren bekommt einen Preis.«
»Ihre Agentin und ihre Lektorin nehmen teil. Ohne Applaus wird er also nicht ausgehen.« Sie zog seine Hände auf ihren Busen herunter. »Lass uns sagen, wir seien krank geworden. Dann gehen wir heim und lassen die Welt außen vor, machen eine Flasche Wein auf, je billiger desto besser, klettern in den Whirlpool und füttern uns gegenseitig mit Pizza. Danach schlafen wir miteinander, aber nicht in unserem Schlafzimmer. Vielleicht sogar in zwei anderen Zimmern.«
Lachend drückte er liebevoll ihre Brüste. »Worum ging es in diesem Prolog? Was hast du gesagt?« Er zog seine Hände unter ihren hervor und strebte zur Türe.
Maris stöhnte vor Enttäuschung. »Ich dachte, diesem Angebot könntest du nicht widerstehen.«
»Verlockend, sogar sehr, aber wenn wir nicht bei diesem Dinner sind, wird es Gerede geben.«
»Du hast Recht. Es wäre mir zuwider, wenn die Leute dächten, dass wir uns immer noch wie Frischvermählte benehmen, die ihre Abende unbedingt allein verbringen möchten.«
»Was der Wahrheit entspricht.«
»Aber …?«
»Aber wir tragen auch beruflich Verantwortung, Maris. Was du bestens weißt. Bei Matherly Press sollen Branchenkenner an die Gegenwart denken oder die Zukunft, aber nie an die Vergangenheit.«
»Und deshalb tauchen wir bei fast jedem Verlagsereignis auf, das in New York gefeiert wird«, sagte sie, als sei dieser Satz Bestandteil eines auswendig gelernten Katechismus.
»Ganz genau.«
Beider Kalender füllten Frühstücks- und Mittagstermine, Dinners, Empfänge und Cocktailpartys. Noah war der Überzeugung, es sei extrem wichtig, ja sogar zwingend notwendig, sich bewusst in literarischen Kreisen sehen zu lassen, besonders seit sich ihr Vater nicht mehr im selben Maße engagieren konnte wie früher.
In jüngster Zeit hatte Daniel Matherly kürzer getreten und tauchte nicht mehr bei allen Branchentreffen auf. Auch Verpflichtungen für Vorträge ging er nicht mehr ein, obwohl der Strom von Anfragen nicht abriss. Inzwischen rief das Four Seasons täglich an und erkundigte sich, ob Daniel seinen reservierten Lunchtisch benötigte, oder ob man darüber verfügen und jemand anderen hinsetzen könne.
Über vier Jahrzehnte hatte Daniel unumstritten über Macht und Einfluss verfügt. Unter seiner Ägide hatte Matherly Press Branchenstandards gesetzt, Trends diktiert und die Bestsellerlisten beherrscht. Sein Name war im In- und Ausland zum Synonym für Verlegertum geworden. Er, der Branchenmotor, hatte im Laufe der letzten Monate freiwillig sein Tempo gedrosselt.
Trotzdem bedeutete sein halber Ruhestand nicht eine Schwächung des Verlages, geschweige denn das Ende seiner Existenz. In Noahs Augen war es lebenswichtig, dass die Buchbranche dies auch so verstand. Und falls dazu mehrmals im Monat die Teilnahme an Dinners anlässlich von Preisverleihungen verbunden war, würden sie genau das tun.
Er warf einen prüfenden Blick auf seine Armbanduhr. »Wie viel Zeit brauchst du? Ich sollte den Chauffeur wissen lassen, wann wir unten sein werden.«
Maris seufzte resigniert. »Gib mir zwanzig Minuten.«
»Ich werde großzügig sein. Nimm dir eine halbe Stunde.« Vor dem Weggehen warf er ihr einen Luftkuss zu.
Maris machte sich jedoch nicht sofort an die Generalüberholung, sondern bat stattdessen ihre Assistentin um einen Anruf. Ihr war noch eine Idee gekommen, wie sie den Autor von Neid eventuell aufspüren konnte.
Während sie darauf wartete, durchgestellt zu werden, schaute sie zu ihren beinahe raumhohen Bürofenstern hinaus, die eine Art Erker bildeten und ihr freien Blick nach Südosten gewährten. Das Herz von Manhattan erlebte einen milden Sommerabend. Hinter den Wolkenkratzern war die Sonne untergegangen und tauchte die Straßen unten vorzeitig ins Dämmerlicht. In den Häusern gingen bereits die Lichter an. Es sah aus, als würden die Gebilde aus Ziegel und Granit zwinkern. Durch die Fenster der Nachbargebäude konnte Maris zusehen, wie andere Berufstätige für heute Schluss machten.
Auf den verstopften Avenues lagen die Autos von Büroangestellten und Theaterbesuchern miteinander im Clinch. Taxis wetteiferten zentimeterweise um Platz und zwängten sich in schier unmögliche Lücken zwischen Bussen und Lieferwagen. Offensichtlich todessüchtige Fahrradkuriere veranstalteten ein lebensgefährliches Hase-und-Igel-Rennen mit dem motorisierten Verkehr. Drehtüren spuckten Fußgänger auf die überfüllten Gehsteige, wo sie um Platz fochten und Aktentaschen und Einkaufstüten wie Waffen schwangen.
Auf der anderen Seite der Avenue of the Americas bildete sich bereits eine Schlange vor der Radio City Music Hall, wo heute Abend Tony Bennett auftrat. Obwohl man ihr, Noah und ihrem Vater VIP-Freikarten angeboten hatte, mussten sie wegen dieses Banketts zur Literaturpreisverleihung ablehnen.
Und genau dafür sollte sie sich eigentlich schon umziehen, ermahnte sie sich selbst. In dem Moment klingelte ihr Telefon. »Er ist auf Leitung Eins«, teilte ihre Assistentin mit.
»Danke. Sie müssen nicht warten. Bis morgen.« Maris drückte den blinkenden Knopf. »Hallo?«
»Jaaa. Hier Hilfssheriff Dwight Harris.«
»Hallo, Deputy Harris. Danke, dass Sie meinen Anruf entgegennehmen. Ich heiße Maris Matherly-Reed.«
»Sagen Sie das noch mal?«
Sie tat es.
»Mhm.«
Maris hielt inne und gab ihm Zeit für einen Kommentar oder eine Frage. Da er das nicht tat, kam sie direkt zum Grund ihres Anrufes. »Ich versuche, jemanden zu erreichen, der vermutlich auf der Insel St. Anne lebt.«
»Die liegt in unserem Bezirk.«
»In Georgia, korrekt?«
»Jawohl, Ma’am«, erwiderte er stolz.
»Ist St. Anne tatsächlich eine Insel?«
»Macht nicht viel her. Ich meine, ist klein. Aber eine Insel ist’s, klar. Liegt ein bisschen unter zwei Meilen vor dem Festland. Wen suchen Sie denn?«
»Jemanden mit den Initialen P.M.E.«
»Sagten Sie P.M.E.?«
»Haben Sie je gehört, dass einer diese Initialen verwendet?«
»Könnte ich nicht sagen, Ma’am. Geht’s hier um einen Mann oder eine Frau?«
»Leider weiß ich das nicht.«
»Das wissen Sie nicht. Hm.« Nach ein, zwei Sekunden fragte der Hilfssheriff: »Was wollen Sie denn von dem, wenn Sie nicht mal wissen, ob’s ein Mann oder eine Frau ist?«
»Etwas Geschäftliches.«
»Geschäftlich.«
»Richtig.«
»Hm.«
Sackgasse. Maris versuchte es noch einmal. »Ich dachte, Sie würden vielleicht jemanden kennen oder hätten schon von einem gehört, der …«
»Nöö.«
Das führte zu nichts, außerdem war ihre Zeit knapp. »Jedenfalls bedanke ich mich bei Ihnen, Deputy Harris, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Entschuldigen Sie bitte die Störung.«
»Macht nichts.«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, meinen Namen und die Nummer zu notieren? Sollte Ihnen etwas einfallen oder Ihnen etwas über jemanden mit diesen Initialen zu Ohren kommen, wäre ich Ihnen für eine Mitteilung sehr dankbar.«
Nachdem sie ihm ihre Telefonnummern gegeben hatte, sagte er: »Hören Sie, Ma’am, wenn es sich um unbezahlte Alimente oder einen ausstehenden Haftbefehl oder was Ähnliches handelt, wäre ich Ihnen gern behilflich …«
»Nein, nein, mit dem Gesetz hat das gar nichts zu tun.«
»Rein geschäftlich.«
»Richtig.«
»Nun, dann also«, sagte er spürbar enttäuscht. »Schade, dass ich Ihnen nicht helfen konnte.«
Sie bedankte sich nochmals, versperrte dann ihr Büro und lief durch den Flur zur Damentoilette, wo seit ihrer Ankunft heute am frühen Morgen ihr Cocktailkleid hing. Da sie häufig vor dem Verlassen des Gebäudes ihre Tageskleidung mit einem Abenddress vertauschte, bewahrte sie in einem verschlossenen Fach ein komplettes Sortiment von Kosmetika auf, das jetzt zum Einsatz kam.
Als sie fünfzehn Minuten später vor dem Aufzug auf Noah traf, stieß er einen langen anerkennenden Pfiff aus und küsste sie auf die Wange. »Hübsches Wechselspiel. Eigentlich sogar ein Wunder. Du siehst fantastisch aus.«
Während der Fahrt ins Erdgeschoss taxierte sie in der metallenen Aufzugtüre ihr Spiegelbild. Ihre Bemühungen waren nicht vergebens gewesen. »Fantastisch« war zwar leicht übertrieben, aber in Anbetracht des aufgelösten Anfangszustandes sah sie besser aus, als sie je hätte erwarten dürfen.
Sie hatte sich für ein Etuikleid aus weinroter Seide mit Spaghettiträgern und U-Ausschnitt entschieden. Als Zugeständnis an abendliches Geglitzer trug sie Diamantstecker in den Ohren und eine über und über mit Strass besetzte, schmetterlingsförmige Handtasche von Judith Leiber, ein Weihnachtsgeschenk ihres Vaters. Dazu einen Pashmina, den sie im Anschluss an die Frankfurter Buchmesse während eines Abstechers nach Paris gekauft hatte.
Die schulterlangen Haare hatte sie zu einem glatten, tief sitzenden Pferdeschwanz zusammengebunden, eine Frisur, die – obwohl eine Verlegenheitslösung – schick und elegant aussah. Sie hatte ihr Augen-Make-up erneuert und die Lippen umrandet und mit Gloss betont. Um ihrer Neonlicht-Blässe etwas Farbe zu verleihen, hatte sie auf Wangen, Kinn, Stirn und Dekolleté Bronzepuder aufgetragen. Ihr Wonderbra, ein technisches Wunderwerk, sorgte für ein schmeichelhaftes Grübchen im Ausschnitt.
»Ihre Sonnenbräune und Titten waren künstlich.«
Die Aufzugtüren öffneten sich im Erdgeschoss. Mit einem verwunderten Blick trat Noah beiseite, um sie zuerst aussteigen zu lassen. »Verzeihung?«
Sie lachte leise. »Nichts, nur ein Zitat aus meiner heutigen Lektüre.«
2
Obwohl der Regen schon vor einer halben Stunde aufgehört hatte, war die Luft noch so feucht, dass das Wasser nicht verdunsten konnte, sondern sich in Pfützen sammelte, und Blütenblätter und die flaumige Haut erntereifer Pfirsiche mit Wasserperlen überzog. Die Äste immergrüner Gewächse bogen sich unter dem zusätzlichen Gewicht. Dicke Tropfen fielen von sauber gewaschenen Hartholzblättern auf den aufgeweichten durchnässten Boden.
Der leiseste Hauch hätte das Wasser in kleinen Schauern herabgeschüttelt, aber leider regte sich kaum ein Lüftchen. Die Luft stand träge da und lastete auf einem fast so wie die Stille.
Deputy Dwight Harris kletterte aus dem Golfcart, den er sich an der Anlegestelle von St. Anne geborgt hatte. Ehe er sich auf den Weg hinauf zum Haus machte, nahm er seinen Hut ab und blieb stehen. Er brauche einfach einen Augenblick zur Orientierung, redete er sich ein, obwohl er in Wahrheit nur im Nachhinein seine Entscheidung überprüfte, nach Sonnenuntergang allein hierher zu kommen. Er war unsicher, was ihn erwartete.
Obwohl er noch nie vorher hier gewesen war, wusste er über dieses Haus Bescheid. Klar. Jeder Besucher der Insel St. Anne hatte Geschichten über die Pflanzervilla an der östlichsten Inselspitze gehört. Sie lag auf einer kleinen Landzunge Richtung Afrika. Einiges, was ihm zu Ohren gekommen war, entbehrte jeder Glaubwürdigkeit. Die Beschreibungen des Hauses kamen der Wirklichkeit allerdings verdammt nahe, weiß Gott.
Es handelte sich um eine für das Tiefland von Carolina typische Architektur: Das zweistöckige weiße Holzhaus saß auf einem alten Ziegelunterbau. Sechs breite Stufen führten zur tiefen Veranda hinauf, die sich über die ganze Vorderfront des Hauses und noch links und rechts davon erstreckte. Die Eingangstür sowie sämtliche Fensterläden in beiden Stockwerken waren glänzend schwarz gestrichen. Sechs glatte Säulen trugen den Balkon des zweiten Stocks. Wie Buchstützen klebten Doppelkamine an den Enden des steilen Satteldaches. Das entsprach ziemlich der Erwartung von Deputy Harris.
Mit einem hatte er allerdings nicht gerechnet: dass es so gespenstisch wirkte.
Als ihm unvermutet vom tief hängenden Ast eines Baumes, unter dem er stand, ein Regentropfen ins Genick fiel, zuckte er mit einem leisen Entsetzensschrei zusammen. Während er sich abtrocknete, setzte er seinen Hut wieder auf und sah sich verstohlen um, ob auch ja niemand seine nervöse Reaktion gesehen hatte. Die hereinbrechende Dunkelheit und das unfreundliche Wetter ließen diesen Ort unheimlich wirken. Er verwünschte sein eigenes feiges Verhalten und setzte seine Füße mit Gewalt in Bewegung.
An Pfützen vorbei ging er den Weg aus zerstoßenen Muschelschalen hinauf, den links und rechts je vier Steineichen säumten, von deren Ästen büschelweise Louisiana-Moos herunterhing. Die Wurzeln der uralten Bäume schlängelten sich über den Boden. Manche waren oberschenkeldick.
Alles in allem handelte es sich um eine eindrucksvolle Vorderfront. Majestätisch, könnte man sagen. Von der Rückseite des Hauses überblickte man den Atlantik, das wusste Harris.
Anfänglich war das Haus nicht so grandios gewesen. Die vier ursprünglichen Räume hatte vor über zweihundert Jahren jener Pflanzer gebaut, der die Insel einem Siedler abgekauft hatte. Dieser hatte es vorgezogen, hochbetagt in England zu sterben, statt in der neu gegründeten amerikanischen Nation dem Gelbfieber zu erliegen. Mit dem Erfolg der Plantage – zuerst Indigo, dann Baumwolle – war auch das Haus gewachsen.
Mehrere Pflanzergenerationen später hatte man die ursprünglichen vier Räume in Sklavenquartiere umgewandelt und mit dem Bau des großen Hauses begonnen. Ein Prachtbau war es damals gewesen, zumindest für St. Anne. Baumaterial und das gesamte Mobiliar waren per Schiff angelandet und dann auf Maultierschlitten durch dichte Wälder und fruchtbare Felder zur Baustelle geschleppt worden. Die Fertigstellung der stabilen Konstruktion hatte Jahre gedauert, dafür hatte sie aber auch der Besatzung der Nordstaatenarmee sowie dem Ansturm mehrerer Dutzend Hurrikans standgehalten.
Doch dann fiel sie einem Käfer zum Opfer.
Ungefähr zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ruinierte der Baumwollkapselkäfer mehr als nur die Baumwollernte. Er richtete mehr Schaden an als Unwetter und Krieg, denn dieser Käfer vernichtete das lokale Wirtschaftssystem und zerstörte die bisherige Lebensart auf St. Anne.
Ein Nachkomme des ursprünglichen Plantagenbesitzers hatte sich in weiser Erkenntnis seines drohenden Ruins am Kronleuchter des Esszimmers erhängt. Die restliche Familie verließ unter Hinterlassung von Schulden und unbezahlten Steuern bei Nacht und Nebel auf Nimmerwiedersehen die Insel.
Jahrzehnte verstrichen. Der Wald eroberte Stück für Stück das Land um das Haus zurück, genau wie die früher schneeweißen Baumwollfelder. Gesindel besetzte die ehemaligen Aristokratenzimmer, die sogar den Besuch eines US-Präsidenten erlebt hatten. Wilde Halbstarke wagten sich als Einzige in das verfallene Herrenhaus und riskierten dabei die Begegnung mit Gelegenheitstrinkern, die einen Platz zum Ausschlafen ihres Rausches suchten.
Bis vor knapp einem Jahr blieb es eine Ruine. Dann kaufte es ein Auswärtiger, kein Inselbewohner, und begann mit massiven Renovierungsarbeiten. Harris vermutete in ihm ein Nordlicht, das öfters Vom Winde verweht gesehen hatte und unbedingt auf südlichem Boden einen Herrensitz aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg haben wollte. Ein Yankee mit mehr Geld als Verstand.
Trotzdem hatte der neue Besitzer auf der Insel einen guten Ruf. Er habe den Besitz merklich verbessert, hieß es, obwohl Harris die Ansicht vertrat, dass es noch immer eine Menge zu tun gab, bis der Glanz der besten Zeiten wieder da wäre. Der Deputy beneidete den neuen Besitzer weder um die Sisyphusarbeit, die ein solches Unterfangen erforderte, noch um die Kosten dafür. Auch auf das Pech, das mit diesem Ort Hand in Hand zu gehen schien, war er nicht neidisch.
Man munkelte, der Geist des Erhängten spuke noch immer in dem alten Haus herum, und ohne ersichtlichen Grund schwinge der Kronleuchter im Esszimmer hin und her.
Von Gespenstergeschichten hielt Harris nicht viel. Er hatte Menschen aus Fleisch und Blut viel scheußlichere Sachen begehen sehen, als sich der boshafteste Geist ausdenken konnte. Trotzdem hätte er nichts gegen ein wenig mehr Beleuchtung einzuwenden gehabt, als er die Treppe hinaufstieg, über die Veranda ging und sich dem vorderen Eingang näherte.
Er betätigte den Messingklopfer, zuerst vorsichtig, dann fester. Sekunden verstrichen, schwerfällig wie der Regen, der vom Dachvorsprung tropfte. So spät war es noch gar nicht, aber vielleicht lag der Hausbewohner schon im Bett. Auf dem Land gingen die Leute meistens früher schlafen als die Stadtfräcke, oder?
Harris wollte gerade gehen und zu einer anderen Zeit wiederkommen – am liebsten vor Sonnenuntergang –, hörte dann aber Schritte näherkommen. Sekunden später wurde von drinnen die Tür aufgezogen. Nicht weit.
»Ja?«
Harris spähte in den Spalt. Er hatte sich selbst so aufgeputscht, dass er auf alles gefasst war: vom Geist des Erhängten bis zum Doppellauf einer abgesägten Schrotflinte, die ihm ein verstimmter Hausbesitzer, den er unnötigerweise aus dem Bett geholt hatte, unter die Nase hielt.
Gott sei Dank fiel die Begrüßung ganz anders aus. Der Mann wirkte einigermaßen freundlich. Obwohl ihn Harris nicht gut erkennen konnte, und seine Gesichtszüge im Schatten verschwammen, klang seine Stimme ziemlich angenehm. Wenigstens hatte er ihn nicht wütend beschimpft. Noch nicht.
»Guten Abend, Sir. Ich bin Hilfssheriff Dwight Harris. Vom Sheriffbüro drüben in Savannah.«
Der Mann beugte sich leicht vor und schaute an ihm vorbei zum Golfcart hinüber, der unten am Weg parkte. Um Touristen und unwillkommene Besucher von der Insel fernzuhalten, gab es keine Fähre zwischen dem Festland und St. Anne. Alle Besucher kamen entweder mit dem eigenen oder mit einem Leihboot hierher. Nach der Ankunft bewegten sie sich zu Fuß oder auf einem gemieteten Golfcart über die ungefähr 36 Quadratkilometer große Insel. Nur wer hier seinen Hauptwohnsitz hatte, fuhr mit dem Auto über die schmalen Straßen, von denen man viele absichtlich ungepflastert gelassen hatte.
Leider wirkte der Golfcart nicht so offiziell wie ein Streifenwagen und verringerte dadurch optisch ein wenig seine Amtsautorität. Zur Stärkung seines Selbstvertrauens zog Harris seinen verrutschten Pistolengürtel hoch.
Der Mann hinter der Tür fragte: »Deputy Harris, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Erstens entschuldige ich mich für die Störung. Aber ich bekam heute am frühen Abend einen Anruf. Von einem Mädel oben aus New York.« Wortlos wartete der Mann ab. »Meinte, sie versucht jemanden aufzuspüren, der die Initialen P.M.E. verwendet.«
»Tatsächlich?«
»So hat sie’s gesagt. Ich hab mir nicht anmerken lassen, ob mir der Name bekannt vorkommt.«
»Ist er’s denn?«
»Gemeldet, meinen Sie? Nein, Sir. Könnte ich so nicht sagen.«
»Trotzdem sind Sie hier.«
»Geb’s ja zu, sie hat mich neugierig gemacht. Wissen Sie, hab noch nie einen gekannt, der nur seine Initialen benützt. Machen Sie sich trotzdem keine Gedanken. Hier in der Gegend wird die Privatsphäre respektiert.«
»Eine lobenswerte Sitte.«
»Auf St. Anne ist’s schon Tradition, dass sich Leute aus dem einen oder anderen Grund hier verstecken.«
Kaum hatte Harris diesen Satz ausgesprochen, bedauerte er ihn auch schon zutiefst. Irgendwie hatte es anklagend geklungen. Es folgte langes Schweigen. Bevor er wieder zu sprechen begann, räusperte er sich nervös. »Na, egal, jedenfalls dachte ich, ich sollte dieser Dame einen Gefallen tun. Bin mit der Revierbarkasse rübergekommen. Hab mich am Landungssteg erkundigt und wurde hierher geschickt.«
»Was wollte denn besagte Dame aus New York?«
»Nun, Sir, weiß nicht so recht. Sie sagte, es geht um nichts Gesetzliches oder so was. Nur dass sie geschäftlich mit P.M.E. zu tun hätte. Ich dachte, Sie hätten den Haupttreffer in einer Lotterie gewonnen und würden vielleicht von Ed McMahon oder Dick Clark gesucht.«
»Ich habe nie an einer Lotterie teilgenommen.«
»Schön, schön. Na dann…«
Harris schob seinen Hut nach vorne, um sich am Hinterkopf kratzen zu können. Zum Teufel noch mal, warum hatte ihn der Mann nicht hereingebeten oder wenigstens Licht angemacht? Da ihn das Herumreden um den heißen Brei, weiß Gott, nicht weiter gebracht hatte, fragte er rundheraus: »Sind Sie P.M.E., oder was?«
»Hat sie ihren Namen hinterlassen?«
»Häh? Ach, die Dame? Jaa.« Harris fischte einen Notizzettel aus der Brusttasche seines Uniformhemdes. Als er entdeckte, dass er ihn durchgeschwitzt hatte, wurde er verlegen, aber der Mann nahm den Zettel und las Harris’ Notizen. Offensichtlich fiel es ihm nicht auf, wie feucht er war, oder es war ihm egal.
»Das sind ihre Telefonnummern«, erklärte Harris, »die ganze Reihe. Schätze mal, ihr Geschäft muss ganz schön wichtig sein. Deshalb bin ich auch heute Abend rausgekommen.«
»Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Sheriff Harris.«
»Hilfssheriff.«
»Deputy Harris.«
Dann machte ihm der Mann die Türe vor der Nase zu, ehe Harris auch nur mit der Wimper zucken konnte. »Auch Ihnen noch einen schönen Abend«, nuschelte er, während er sich umdrehte.
Seine Stiefel knirschten über den Muschelweg. Die Dämmerung hatte sich in tiefschwarze Dunkelheit verwandelt. Unter dem Baldachin der Steineichenäste war es sogar noch dunkler. Direkt Angst hatte er nicht. Der Mann hinter der Türe war einigermaßen höflich gewesen. Als feindseliges Verhalten hätte man das nicht bezeichnen können. Vielleicht ungastlich, aber nicht feindselig.
Trotzdem war Harris froh, seinen Auftrag endgültig erledigt zu haben. Falls er das noch einmal tun müsste, würde er sich vermutlich dieser Pflicht entziehen. Was ging es denn ihn an, ob irgendeine Dame aus New York mit ihrem nicht näher erklärten Geschäft Erfolg hatte oder nicht?
Beim Hinsetzen merkte er, dass es auf den Sitz des Golfcarts getropft hatte. Bis er am Landungssteg ankam, wo er das Boot des Sheriffbüros vertäut hatte, war seine Kniehose durchgeweicht.
Misstrauisch beäugte ihn der Mann, von dem er sich den Golfcart geborgt hatte – für Gesetzeshüter kostenlos –, als Harris den Schlüssel zurückbrachte. »Gefunden?«
»Jaja, danke für die Richtung«, erwiderte Harris. »Bekommen Sie den Typen je zu Gesicht?«
»Ab und zu«, meinte der Mann gedehnt.
»Gehört zur komischen Sorte?«
»Merkt man eigentlich nicht.«
»Hat’s mit ihm schon mal Schwierigkeiten hier gegeben?«
»Nöö, der bleibt ziemlich für sich.«
»Können ihn die Insulaner leiden?«
»Brauchen Sie vor der Rückfahrt noch Diesel?«
Das war so gut wie eine direkte Aufforderung, zu gehen und das neugierige Fragen sein zu lassen. Harris hatte gehofft, eine klarere Vorstellung von dem Bewohner des Herrenhauses zu bekommen, der sich hinter Türen versteckte, wenn Besuch kam, aber offensichtlich sollte es anders sein. Für weitere Nachforschungen jenseits seiner Neugierde darüber, warum ein Mann lediglich seine Initialen benützte, und was eine Frau aus New York von ihm wollte, hatte er keinerlei Veranlassung.
Er bedankte sich bei dem Insulaner für den Golfcart.
Der Mann spuckte Tabaksaft in den Schlamm. »Kein Problem.«
3
»Bitte, nur noch ein Foto. Mr. und Mrs. Reed?«
Maris und Noah lächelten für den Fotografen, der für Publishers Weekly über das Bankett berichtete. Während des Cocktails hatte man sie zusammen mit anderen Verlegern, der preisgekrönten Autorin und einem berühmten Showmaster abgelichtet. Die Autorin betrachtete sich als Schriftstellerin, nur weil ein Ghostwriter für sie einen Schlüsselroman über ihre Tage im Profitennis zusammengekritzelt hatte.
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Envy« bei Warner Books, Inc., New York
Der Blanvalet Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House.
1. Auflage
© der Originalausgabe 2001 bySandra Brown Management, Ltd.
© der deutschsprachigen Ausgabe 2004 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-10333-0
www.blanvalet-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe