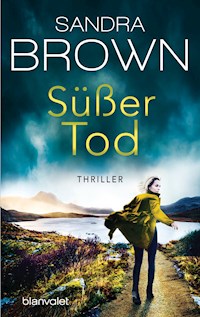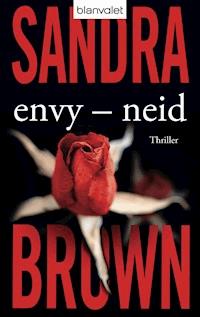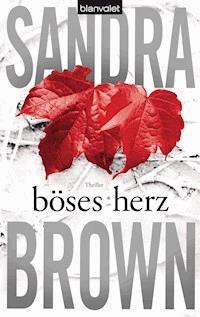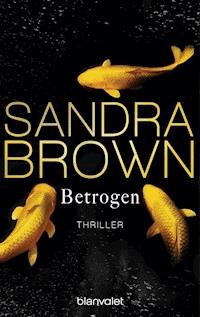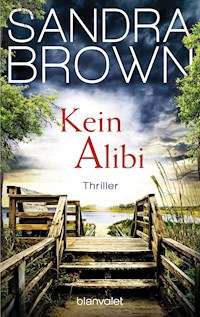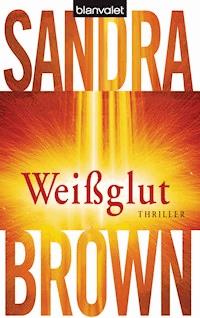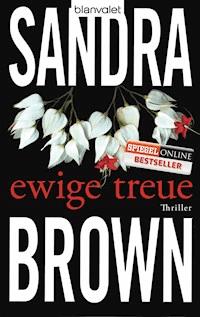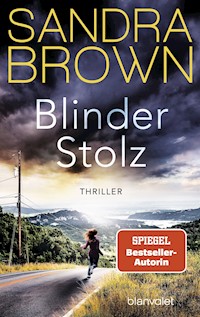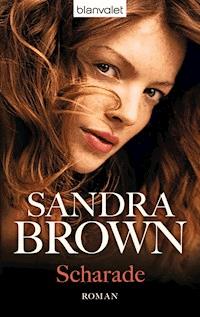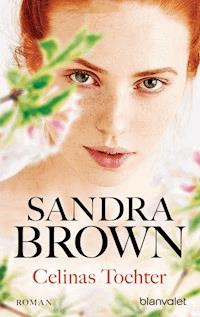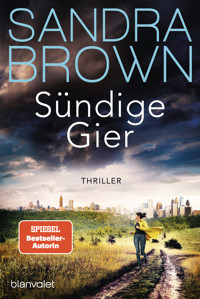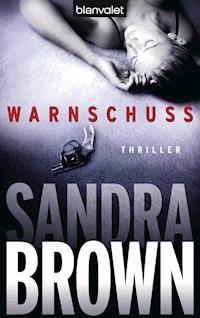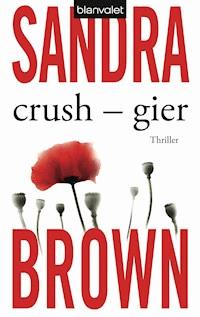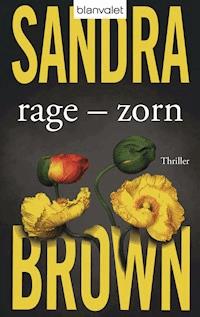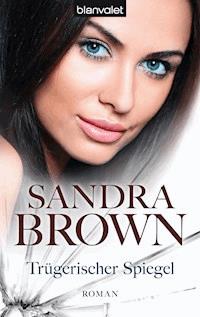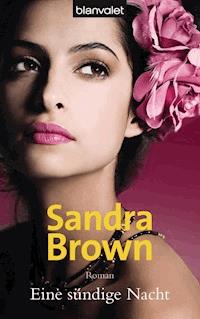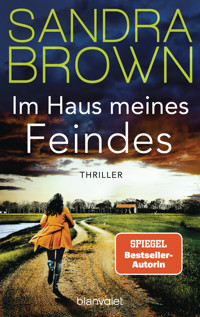
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine verbotene Liebe im heißen Sommer Louisianas – so mitreißend und explosiv schreibt nur Bestsellerqueen Sandra Brown!
Seit Jahren ist Detective Burke Basile dem zwielichtigen Staranwalt Pinkie Duvall auf den Fersen. Als er eines Tages einen Handlanger Duvalls mit einer Pistole in Schach hält, löst sich ein Schuss – und trifft Burkes eigenen Kollegen. Von Schuldgefühlen gequält, quittiert er den Dienst und schmiedet einen verzweifelten Plan: Er entführt Pinkies schöne Frau Remy in die Sümpfe Louisianas. Doch Duvalls vermeintliches Spielzeug entpuppt sich als klug, willensstark und so anziehend, dass Burke schon bald zu vergessen droht, wie gefährlich der Anwalt ist. Ein verhängnisvoller Fehler ...
Lesen Sie auch die spannenden Romane »Vertrau ihm nicht«, »Die Zeugin« oder »Ihr zweiter Tod« von Bestsellerqueen Sandra Brown!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
»Die sprechen ihn frei!« Burke Basile streckte die Finger seiner rechten Hand und ballte sie dann zur Faust. Diese unwillkürliche Streckbewegung hatte er sich in letzter Zeit angewöhnt. »Er wird unter gar keinen Umständen schuldig gesprochen.«
Captain Douglas Patout, der Chef des Drogen- und Sittendezernats des New Orleans Police Departments, seufzte entnervt. »Vielleicht.«
»Nicht ›vielleicht‹. Die sprechen ihn frei«, wiederholte Burke nachdrücklich.
Nach kurzer Pause fragte Patout: »Warum hat Littrell die Anklage in diesem Fall ausgerechnet diesem Staatsanwalt übertragen? Er ist neu hier, lebt erst seit ein paar Monaten im Süden, ist aus dem Norden hierher verpflanzt worden. Aus Wisconsin oder so ähnlich. Er hat die … Nuancen dieses Verfahrens nicht begriffen.«
Burke, der aus seinem Fenster gestarrt hatte, drehte sich wieder um. »Pinkie Duvall hat sie dagegen recht gut begriffen.«
»Dieser aalglatte Wortverdreher! Er tut nichts lieber, als auf die Polizei einzuschlagen und uns alle als unfähig hinzustellen.«
Obwohl es Burke widerstrebte, den Strafverteidiger zu loben, sagte er: »Eins muß man ihm lassen, Doug, sein Schlußplädoyer war brillant. Eindeutig gegen die Polizei, aber ebenso eindeutig für die Gerechtigkeit. Die zwölf Geschworenen haben jedes Wort gierig aufgesogen.« Er sah auf seine Armbanduhr. »Sie beraten seit einer halben Stunde. Ich würde sagen, in zehn Minuten sind sie wieder da.«
»Glaubst du wirklich, daß es so schnell geht?«
»Ja, glaub’ ich.« Burke setzte sich auf einen zerschrammten Stuhl mit hölzernen Armlehnen. »Nüchtern betrachtet, haben wir nie ein Chance gehabt. Welcher Staatsanwalt die Anklage auch vertreten hätte, mit welchen juristischen Tricks beide Seiten auch gearbeitet haben mögen – es steht leider fest, daß Wayne Bardo nicht abgedrückt hat. Er hat die Kugel, die Kevin den Tod brachte, nicht abgefeuert.«
»Ich wollte, ich hätte fünf Cent bekommen für jedes Mal, das Pinkie Duvall das während der Verhandlung gesagt hat«, meinte Patout mißmutig. »›Mein Mandant hat die tödliche Kugel nicht abgefeuert.‹ Das hat er gebetsmühlenhaft wiederholt.«
»Leider ist es die Wahrheit.«
Dieses Thema hatten sie mindestens schon tausendmal diskutiert – grübelnd, Vermutungen anstellend, aber immer wieder auf die eine unangenehme, unbestreitbare, unumkehrbare Tatsache zurückkommend: Der in diesem Verfahren angeklagte Wayne Bardo hatte Detective Sergeant Kevin Stuart faktisch nicht erschossen.
Burke Basile rieb sich müde seine von dunklen Ringen umgebenen Augen, strich sich das zerzauste, lockige Haar aus der Stirn, fuhr sich über den Schnurrbart und rieb dann nervös über seine Oberschenkel. Er streckte die Finger seiner rechten Hand. Zuletzt stützte er die Ellbogen auf die Knie, ließ die Schultern entmutigt nach vorn hängen und starrte blicklos auf den Fußboden.
Patout musterte ihn prüfend. »Du siehst verdammt schlecht aus. Warum gehst du nicht raus und rauchst eine Zigarette?«
Burke schüttelte den Kopf.
»Wie wär’s mit einem Kaffee? Ich hole dir einen, bringe ihn dir, damit die Reporter nicht über dich herfallen können.«
»Nein, vielen Dank.«
Patout setzte sich auf den Stuhl neben Burke. »Wir dürfen den Fall noch nicht abschreiben. Die Geschworenen sind oft unberechenbar. Man glaubt, man hätte so einen Dreckskerl überführt, und er verläßt den Gerichtssaal als freier Mann. Ein andermal rechnet man mit einem sicheren Freispruch, aber sie sprechen ihn schuldig, und der Richter verhängt die Höchststrafe. Im voraus weiß man das nie.«
»Ich schon«, murmelte Burke hartnäckig. »Bardo wird freigesprochen.«
Eine Zeitlang sagte keiner der beiden Männer etwas, um das bedrückende Schweigen zu brechen. Dann meinte Patout: »Heute ist der Jahrestag der mexikanischen Verfassung.«
Burke sah auf. »Wie bitte?«
»Der mexikanischen Verfassung. Sie wurde am fünften Februar angenommen. Das habe ich heute morgen in meinem Terminkalender gelesen.«
»Hmmm.«
»Allerdings hat nicht dringestanden, in welchem Jahr. Vor mindestens hundert Jahren, schätze ich.«
»Hmmm.«
Als dieses Thema erschöpft war, schwiegen sie wieder und hingen ihren eigenen Gedanken nach. Burke überlegte, wie er sich in den ersten Sekunden nach der Urteilsverkündung verhalten sollte.
Daß es zu einer Gerichtsverhandlung kommen würde, hatten sie von Anfang an gewußt. Pinkie Duvall würde nicht im Traum daran denken, einen Deal mit der Anklagebehörde anzustreben, wenn er den Freispruch für seinen Mandanten schon so gut wie in der Tasche zu haben glaubte. Und Burke hatte ebenfalls gewußt, wie dieser Prozeß ausgehen würde. Jetzt, wo der Augenblick der Wahrheit bevorstand – falls seine schlimmen Vorahnungen sich bestätigten –, machte er sich darauf gefaßt, gegen die Wut anzukämpfen, die er empfinden würde, wenn er sah, wie Bardo das Gerichtsgebäude als freier Mann verließ.
Gott behüte ihn davor, diesen Dreckskerl mit bloßen Händen zu erwürgen.
Eine große, brummende Stubenfliege, die nicht in diese Jahreszeit paßte und von Insektiziden high war, hatte sich irgendwie in den kleinen Raum im Gerichtsgebäude des Orleans Parish verirrt, in dem schon unzählige Anklagevertreter und Angeklagte angstvoll geschwitzt hatten, während sie auf den Spruch der Geschworenen gewartet hatten. Bei ihren verzweifelten Fluchtversuchen prallte die Fliege immer wieder mit einem selbstmörderischen kleinen Platsch! gegen die Fensterscheibe. Das arme Fliegenvieh wußte nicht, daß es verloren hatte. Es erkannte nicht, daß es sich mit seinen vergeblichen Versuchen, so tapfer sie auch waren, nur zum Narren machte.
Burke unterdrückte ein selbstkritisches Auflachen. Daß er sich mit dem vergeblichen Bemühen einer Stubenfliege identifizieren konnte, bewies ihm, daß er auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt war.
Als das Klopfen ertönte, wechselten Patout und er zuerst einen Blick, bevor sie zur Tür hinübersahen, die von der Gerichtsdienerin geöffnet wurde. Sie steckte den Kopf herein. »Die Geschworenen sind wieder im Saal.«
Auf dem Weg zur Tür warf Patout einen Blick auf seine Uhr und murmelte: »Verdammt! Genau zehn Minuten.« Er sah zu Burke hinüber. »Wie hast du das erraten?«
Aber Burke hörte nicht zu. Seine Aufmerksamkeit galt der offenen zweiflügeligen Tür des Gerichtssaales am Ende des Korridors. Prozeßbeobachter und Medienvertreter strömten durch das Portal, aufgeregt wie Kolosseumsbesucher im alten Rom bei der Aussicht darauf, daß ein paar Märtyrer von Löwen zerfleischt werden.
Kevin Stuart – Ehemann, Familienvater, verdammt guter Cop und bester Freund – war einen Märtyrertod gestorben. Wie bei vielen Märtyrern im Lauf der Geschichte war sein Tod die Folge eines Verrats. Jemand, dem Kevin vertraut hatte, jemand, der auf seiner Seite hätte stehen und ihn unterstüzten sollen, war zum Verräter geworden. Ein anderer Cop hatte die Bösen gewarnt, daß die Guten unterwegs waren.
Ein heimlicher Anruf von irgend jemandem aus ihrem Dezernat, und Kevin Stuarts Schicksal war besiegelt. Gewiß, er war im Dienst umgekommen, aber das machte ihn nicht weniger tot. Sein Tod war unnötig gewesen. Unnötig und blutig. Mit diesem Verfahren wurde lediglich ein Schlußstrich gezogen. Der Prozeß war nur eine teure und zeitraubende Übung, der eine zivilisierte Gesellschaft sich unterzog, um die Tatsache zu kaschieren, daß sie einen Dreckskerl laufenließ, nachdem er dem Leben eines anständigen Menschen ein Ende gesetzt hatte.
Die Auswahl der Geschworenen hatte zwei Wochen gedauert. Der Staatsanwalt war von Anfang an vom Strafverteidiger, dem glanzvollen Pinkie Duvall, eingeschüchtert und ausgetrickst worden. Ohne auf energische Gegenwehr seitens der Anklagebehörde zu stoßen, hatte Duvall sämtliche Einspruchsmöglichkeiten genutzt, um die Geschworenenbank mit handverlesenen Leuten zu besetzen, die seinen Mandanten vermutlich begünstigen würden.
Der Prozeß selbst hatte nur vier Tage gedauert. Aber seine Kürze stand in umgekehrtem Verhältnis zu dem Interesse der Öffentlichkeit an seinem Ausgang. Voraussagen hatte es reichlich gegeben.
Am Morgen nach dem tödlichen Vorfall wurde der Polizeipräsident mit den Worten zitiert: »Jeder unserer Beamten fühlt diesen Verlust und ist persönlich betroffen. Kevin Stuart war im Kollegenkreis sehr beliebt und geachtet. Wir setzen alle uns zur Vergügung stehenden Mittel ein, um die genauen Umstände der tödlichen Schüsse auf diesen ausgezeichneten Beamten gründlich und vollständig aufzuklären.«
»Das Verfahren müßte sich rasch abschließen lassen«, hatte ein Leitartikler am ersten Prozeßtag in der Times Picayune geschrieben. »Durch einen krassen Fehler der Polizei hat einer ihrer Beamten den Tod gefunden. Tragisch? Bestimmt. Aber eine Rechtfertigung dafür, seinen Tod einem unschuldigen Sündenbock anzulasten? Meiner Ansicht nach nicht.«
»Der Staaatsanwalt vergeudet Steuergelder, indem er einen unschuldigen Bürger dazu zwingt, sich vor Gericht wegen einer erfundenen Anklage zu verantworten, die allein den Zweck hat, das New Orleans Police Department vor der öffentlichen Demütigung zu bewahren, die es wegen dieses Vorfalls verdient hätte. Alle Wähler wären gut beraten, sich an diese Farce zu erinnern, wenn Staatsanwalt Littrell sich zur Wiederwahl stellt.« Dieses Zitat stammte von Pinkie Duvall, dessen »unschuldiger« Mandant Wayne Bardo, geborener Bardeaux, ein Vorstrafenregister hatte, das so lang war wie die Brücke über den Lake Pontchartrain.
Pinkie Duvalls Beteiligung an einem Gerichtsverfahren sorgte immer für reges Medieninteresse. Jeder Wahlbeamte im öffentlichen Dienst wollte an dieser kostenlosen Publicity teilhaben und benützte den Prozeß gegen Bardo als Forum für sein oder ihr Programm, was immer es beinhalten mochte. Ungebetene Meinungen wurden so freigiebig unters Volk gebracht wie Konfetti an Mardi Gras.
Im Gegensatz dazu hatte Lieutenant Burke Basile seit der Nacht, in der Kevin Stuart umgekommen war, hartnäckiges, verächtliches Schweigen bewahrt. Während der Anhörungen vor Prozeßbeginn, während all der Anträge, die beide Seiten bei Gericht stellten, und inmitten der künstlich erzeugten Medienhysterie war dem schweigsamen Drogenfahnder, dessen Partner und bester Freund in jener Nacht, in der die Drogenrazzia schiefgelaufen war, einer Schußverletzung erlegen war, nichts Zitierbares zu entlocken gewesen.
Als er jetzt wieder den Verhandlungssaal betreten wollte, um den Spruch der Geschworenen zu hören, erklärte Burke Basile einem Reporter, der ihm sein Mikrofon unter die Nase hielt und wissen wollte, ob er etwas zu sagen habe, kurz und bündig: »Ja. Verpiß dich!«
Captain Patout, den die Reporter als höheren Polizeibeamten erkannten, wurde aufgehalten, als er Burke in den Saal zu folgen versuchte. Obwohl Patout sich weit diplomatischer ausdrückte als sein Untergebener, stellte er unmißverständlich fest, Wayne Bardo habe Stuarts Tod verschuldet und der Gerechtigkeit werde nur Genüge getan, wenn die Geschworenen auf schuldig erkannt hatten.
Burke saß bereits, als Patout sich wieder zu ihm gesellte. »Für Nanci wird das bestimmt schwierig«, meinte er besorgt, als er Platz nahm.
Kevin Stuarts Witwe saß in derselben Reihe wie sie, aber auf der anderen Seite des Mittelgangs. Rechts und links neben ihr hatten ihre Eltern Platz genommen. Burke beugte sich leicht nach vorn, erwiderte ihren Blick und nickte ihr aufmunternd zu. Aus ihrem schwachen Antwortlächeln sprach mehr Optimismus, als sie tatsächlich empfand.
Patout winkte ihr grüßend zu. »Andererseits ist sie ein tapferer Kerl.«
»Na klar, auf Nanci kann man immer zählen, auch wenn ihr Mann eiskalt umgelegt wird.«
Patout quittierte diese sarkastische Bemerkung mit einem Stirnrunzeln. »Dieser Seitenhieb war unnötig. Du weißt genau, was ich gemeint habe.« Burke äußerte sich nicht dazu. Nach kurzer Pause fragte Patout gespielt nonchalant: »Kommt Barbara noch?«
»Nein.«
»Ich dachte, sie würde vielleicht kommen, um dir moralische Unterstützung zu gewähren, falls die Sache für uns ungünstig ausgeht.«
Burke hatte keine Lust, ihm zu erklären, warum seine Frau es vorzog, der Verhandlung fernzubleiben. Er sagte einfach: »Wir haben vereinbart, daß ich sie anrufe, sobald das Urteil gesprochen ist.«
Aus den Lagern der beiden Prozeßparteien kamen ganz unterschiedliche Signale. Burke teilte Patouts Einschätzung, der Staatsanwalt habe als Vertreter der Anklage versagt. Nachdem er das Verfahren mehr schlecht als recht hinter sich gebracht hatte, saß er jetzt an seinem Tisch und klopfte mit dem Radiergummi an seinem Bleistift auf einen Schreibblock, auf dem er sich keine einzige Notiz gemacht hatte. Er wippte nervös mit dem linken Bein und machte den Eindruck, er wäre am liebsten woanders – notfalls zur Wurzelbehandlung auf einem Zahnarztstuhl.
Dagegen schienen Bardo und Duvall am Verteidigertisch über einen geflüsterten Scherz zu grinsen. Beide schmunzelten hinter vorgehaltener Hand. Burke wäre es schwergefallen, sofort zu sagen, wen er mehr haßte – den Berufsverbrecher oder seinen ebenso kriminellen Verteidiger.
Als Duvall von einem seiner Assistenten angesprochen wurde und sich abwandte, um in einem Schriftsatz zu blättern, lehnte Bardo sich auf seinem Stuhl zurück, hielt die Fingerspitzen seiner aneinandergelegten Hände unters Kinn und sah himmelwärts. Burke konnte sich nicht vorstellen, daß der Dreckskerl tatsächlich betete.
Bardo sah zu ihm hinüber, als spürte er, daß der Lieutenant ihn durchdringend anstarrte. In den kalt glitzernden dunklen Augen, die nun Burkes Blick erwiderten, hatte bestimmt noch niemals ein Anflug von Schuldbewußtsein gestanden. Reptilienschmale Lippen verzogen sich zu einem eisigen Lächeln.
Dann blinzelte Bardo ihm frech zu.
Burke wäre aufgesprungen, um sich auf den Kerl zu stürzen, wenn Patout, der diese unverschämte Geste beobachtet hatte, ihn nicht am Arm gepackt und zurückgehalten hätte.
»Mach keinen Unsinn, verdammt noch mal!« Gereizt fügte er mit gedämpfter Stimme hinzu: »Drehst du jetzt durch, spielst du diesem Dreckskerl doch nur in die Hände. Das wäre der Beweis für alle negativen Behauptungen, die sie während dieses Prozesses über dich aufgestellt haben. Wenn du das willst, dann nur zu!«
Ohne diese Zurechtweisung auch nur mit einer Antwort zu würdigen, riß Burke sich von seinem Vorgesetzten los. Bardo, der weiter selbstgefällig grinste, sah wieder nach vorn. Im nächsten Augenblick rief die Gerichtsdienerin den Saal zur Ordnung, und der Richter nahm seinen Platz wieder ein. Mit einer Stimme, die so honigsüß war wie Geißblattnektar im Sommer, ermahnte er die Zuhörer, sich anständig zu betragen, wenn der Spruch der Geschworenen verkündet werde, und wies dann die Gerichtsdienerin an, die Geschworenen hereinzuholen.
Sieben Männer und fünf Frauen nahmen auf der Geschworenenbank Platz. Sieben Männer und fünf Frauen hatten einstimmig entschieden, Wayne Bardo treffe keine Schuld daran, daß Detective Sergeant Kevin Stuart erschossen worden sei.
Das hatte Burke Basile erwartet, aber es war schwerer zu verkraften, als er es sich vorgestellt hatte, und er hatte sich schon vorgestellt, es würde unmöglich zu verkraften sein.
Trotz der Ermahnungen des Richters beherrschten oder verbargen die Zuhörer ihre Reaktionen nicht. Nanci Stuart stieß eine spitzen Schrei aus, dann sackte sie zusammen. Ihre Eltern schützten sie vor den Kamerascheinwerfern und der gierig herandrängenden Reportermeute.
Der Richter dankte den Geschworenen und entließ sie. Sobald der Richter die Verhandlung mit lauter Stimme offiziell geschlossen hatte, stopfte der unfähige Staatsanwalt seinen unbenützten Schreibblock hastig in seinen neu aussehenden Aktenkoffer und trabte den Mittelgang entlang, als hätte jemand »Feuer!« gerufen. Er wich Burkes und Patouts Blicken aus.
Burke glaubte auf seiner Stirn lesen zu können, was der andere dachte: Es ist nicht meine Schuld. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Wie es auch ausgeht, am Freitag gibt’s den nächsten Gehaltsscheck, also was soll’s.
»Arschloch«, murmelte Burke.
Am Verteidigertisch herrschte wie erwartet Jubel, und der Richter hatte es aufgegeben, ihn unterbinden zu wollen. Pinkie Duvall sprach wortgewandt in die hingehaltenen Mikrofone. Wayne Bardo trat von einem Bally-Slipper auf den andern und wirkte selbstzufrieden und gelangweilt, während er seine Manschetten etwas weiter aus den Jackenärmeln zog. Seine mit Brillanten besetzten Manschettenknöpfe glitzerten im Licht der Fernsehscheinwerfer. Burke sah, daß die Stirn des Mannes mit dem dunklen Teint nicht einmal feucht war. Der Dreckskerl hatte genau gewußt, daß er auch diesmal wieder straffrei davonkommen würde.
Patout, der als Polizeisprecher fungierte, weil der Vorfall sein Dezernat betraf, war damit beschäftigt, Reporter und ihre Fragen abzuwehren. Burke behielt Bardo und Duvall im Visier, während sie sich triumphierend durch die Reportermeute zum Ausgang vorarbeiteten. Sie wichen keiner Kamera und keinem Mikrofon aus. In der Tat pflegte und genoß Duvall jegliche Publicity, deshalb sonnte er sich auch jetzt im Scheinwerferlicht. Im Gegensatz zum Staatsanwalt hatten sie es nicht eilig, den Saal zu verlassen, sondern ließen sich absichtlich Zeit, um den Beifall ihrer Anhänger einzuheimsen.
Sie wichen Burke Basiles Blick auch nicht aus.
Sie gingen im Gegenteil langsamer, als sie an der Reihe vorbeikamen, an deren Ende Burke stand und seine rechte Hand zur Faust ballte und die Finger wieder streckte. Beide starrten Burke ganz bewußt ins Gesicht.
Wayne Bardo beugte sich sogar leicht vor und stellte flüsternd eine Burke verhaßte, aber unwiderlegbare Tatsache fest. »Ich hab’ diesen Cop nicht erschossen, Basile. Sie waren es.«
2. Kapitel
»Remy?«
Sie drehte sich um und strich sich mit dem Rücken ihrer in einem Gummihandschuh steckenden Hand eine Haarsträhne aus der Stirn. »Hallo. Ich habe dich nicht so früh erwartet.«
Pinkie Duvall stolzierte den Mittelgang des Treibhauses entlang, schloß sie in die Arme und küßte sie nachdrücklich. »Ich habe gewonnen.«
Sie erwiderte sein Lächeln. »Das habe ich mir gedacht.«
»Wieder ein Freispruch.«
»Glückwunsch.«
»Danke, aber diesmal war es kaum eine Herausforderung.« Ein breites Grinsen zeigte, daß seine Bescheidenheit nur gespielt war.
»Für einen weniger brillanten Anwalt wäre es eine gewesen.«
Sein Grinsen wurde noch breiter, denn er freute sich über ihr Lob. »Ich fahre ins Büro, um ein paar Anrufe zu erledigen, aber wenn ich zurückkomme, bringe ich die ganze Gesellschaft mit. Roman hat dafür gesorgt, daß alles in Bereitschaft ist. Als ich reingekommen bin, sind schon die ersten Lieferwagen vom Partyservice vorgefahren.«
Ihr Butler Roman und das gesamte Hauspersonal hatten sich seit Prozeßbeginn in Alarmbereitschaft befunden. Die Partys, die Pinkie zur Feier seiner Siege gab, waren so berühmtberüchtigt wie der protzige Brillantring, den er am kleinen Finger der rechten Hand trug und dem er seinen Spitznamen »Pinkie« verdankte.
Seine Siegesfeiern nach einem Prozeß wurden so begierig erwartet wie die Verfahren selbst und von den Medien ausführlich geschildert. Remy hatte den Verdacht, daß manche Geschworenen nur deshalb für einen Freispruch stimmten, um endlich auch einmal eine von Pinkie Duvalls berühmten Feten miterleben zu können.
»Kann ich bei den Vorbereitungen irgendwie helfen?« Natürlich gab es für Remy nichts zu tun, was sie schon im voraus wußte.
»Du brauchst nur zu kommen und so wunderbar wie immer auszusehen«, erklärte er ihr, ließ seine Hände über ihren Rücken gleiten und küßte sie nochmals. Dann ließ er sie los und wischte ihr ein paar Krümel Erde von der Stirn. »Was machst du überhaupt hier? Du weißt doch, daß ich hier drinnen nicht allzuviel Betrieb haben will.«
»Hier war auch kein Betrieb. Ich bin allein hergekommen. Ich habe einen Farn aus dem Haus rübergebracht, weil er nicht gesund aussieht und wahrscheinlich ein bißchen Dünger braucht. Keine Angst, ich habe deine Pflanzen nicht angefaßt.«
Das Treibhaus war Pinkies Reich. Die Orchideenzucht war sein Hobby, aber er nahm es sehr ernst und achtete im Treibhaus ebenso auf Ordnung und Präzision wie in seiner Anwaltskanzlei und allen übrigen Lebensbereichen.
Jetzt nahm er sich einen Augenblick Zeit, um die Reihen der von ihm gezogenen Pflanzen stolz zu betrachten. Nur wenige seiner Freunde und noch weniger seiner Feinde wußten, daß Pinkie Duvall mit Leidenschaft Orchideen züchtete und ein Experte auf diesem Gebiet war.
Extreme Maßnahmen stellten sicher, daß im Treibhaus immer ideale Kulturbedingungen herrschten. Es gab dort sogar einen eigenen Raum für die Meß- und Steuergeräte, die das empfindliche Treibhausklima regelten. Pinkie hatte sich gründlich mit der Orchideenzucht beschäftigt und nahm alle drei Jahre am internationalen Orchideenkongreß teil. Er wußte genau, bei welcher Beleuchtung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur jede einzelne Orchideenart am besten gedieh. Ob Cattleyen, Laelien, Cymbidien oder Oncidien – Pinkie pflegte und hegte sie wie eine Krankenschwester eine Frühgeburt und bot allen den Nährboden, die Belüftung und die Feuchtigkeit, die sie brauchten. Als Gegenleistung erwartete er, daß seine Pflanzen beispielhaft und außergewöhnlich gediehen.
Ganz als wollten sie ihren Gebieter nicht enttäuschen, taten sie das auch.
Im allgemeinen. Aber jetzt runzelte er die Stirn, während er auf eine Gruppe von Pflanzen mit der Bezeichnung Oncidium varicosum zutrat. Ihre Rispen waren dicht mit Blüten besetzt – aber nicht so üppig wie die ihrer Nachbarn. »Diese blöden Dinger habe ich wochenlang aufgepäppelt. Was ist mit ihnen los? Das ist eine verdammt schlechte Leistung.«
»Vielleicht hatten sie noch nicht genug Zeit, sich wirklich …«
»Sie hatten reichlich Zeit.«
»Manchmal dauert’s einfach etwas länger, bis …«
»Es sind minderwertige Pflanzen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.« Pinkie griff gelassen nach einem der Töpfe und ließ ihn zu Boden fallen. Er zerschellte beim Aufprall auf die Bodenfliesen, und ein Häufchen aus Tonscherben, Orchideensubstrat und geknickten Blütenrispen blieb zurück. Wenig später folgte der nächste Topf.
»Nein, Pinkie, nicht!« Remy kauerte sich nieder und barg eine der zarten Pflanzen zwischen ihren Händen.
»Laß sie liegen«, sagte er gleichmütig, indem er bereits den nächsten Topf zerschellen ließ. Er verschonte keinen einzigen. Wenig später lag die ganze Gruppe in Trümmern auf den Fliesen. Er trat auf einen der Rispen und zermalmte die Blüten unter seinem Absatz. »Sie haben das Gesamtbild des Treibhauses ruiniert.«
Remy war über diese Vergeudung empört und fing an, die Pflanzen einzusammeln, aber Pinkie sagte: »Gib dich nicht damit ab. Ich schicke einen der Gärtner her, damit er saubermacht.«
Bevor er ging, hatte sie ihm versprochen, gleich hineinzugehen und sich für die Party umzuziehen, aber sie verließ das Treibhaus nicht sofort, sondern kehrte die zertrümmerten Orchideentöpfe selbst auf. Sie achtete darauf, alle von ihr benützten Gegenstände wegzuräumen und das Treibhaus mustergültig aufgeräumt zurückzulassen.
Der mit Natursteinplatten belegte Weg zum Haus schlängelte sich über den Rasen. Alte, moosbewachsene Eichen beugten sich über sorgfältig gepflegte Blumenbeete. Die Bäume hatten schon hier gestanden, lange bevor das Haus im neunzehnten Jahrhundert erbaut worden war.
Remy betrat es durch einen der Hintereingänge und benützte die rückwärtige Treppe, um nicht an Küche, Anrichteraum und Speisezimmer vorbeigehen zu müssen. Aus dem Speisezimmer war die scharfe Stimme der Chefin eines Partyservices zu hören, die ihrem halben Dutzend Mitarbeitern knappe Anweisungen erteilte. Bis Pinkie und seine Gäste eintrafen, wäre alles fertig und die Versorgung mit Speisen und Getränken würde reibungslos funktionieren.
Remy wußte, daß sie kaum Zeit genug hatte, sich für die Party umzuziehen, aber inzwischen waren schon Vorbereitungen getroffen worden, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Ein Dienstmädchen hatte ihr bereits ihr Bad eingelassen und wartete auf weitere Anweisungen. Sie besprachen gemeinsam, was Remy tragen würde, und nachdem alles herausgelegt war, ließ das Dienstmädchen sie allein, damit sie baden konnte, was sie rasch tat, weil sie wußte, daß sie für Frisur und Make-up einige Zeit brauchen würde. Pinkie erwartete, daß sie bei seinen Partys immer besonders hübsch aussah.
Als sie fünfzig Minuten später an ihrem Toilettentisch saß und noch etwas Rouge auflegte, hörte sie jemanden ins Schlafzimmer kommen. »Bist du’s, Pinkie?«
»Ein anderer hat hier ja hoffentlich nichts zu suchen!«
Sie stand auf, ging aus dem Ankleideraum ins Schlafzimmer hinüber und nickte dankend, als er einen anerkennenden Pfiff ausstieß. »Möchtest du einen Drink?«
»Bitte.« Er begann sich auszuziehen.
Bis sie ihm einen Scotch eingeschenkt hatte, war er schon ganz ausgekleidet. Auch mit fünfundfünfzig war Pinkie noch beeindruckend fit. Er stählte seinen Körper durch tägliches Krafttraining und leistete sich einen eigenen Masseur. Er war stolz darauf, sich seine Schlankheit bewahrt zu haben – trotz seiner Vorliebe für große Weine und die exquisite einheimische Küche mit ihren berühmten Desserts wie Brotpudding mit Whiskeysauce und Sahnepralinen mit Pecannußfüllung.
Er küßte Remy auf die Wange, griff nach dem Highballglas, das sie ihm hinhielt, und nahm einen kleinen Schluck von dem teuren Scotch. »Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht – du hast dich ja gewaltig zurückgehalten. Du hast es nicht erwähnt, obwohl ich weiß, daß du’s gesehen hast.«
»Ich fand, du sollst entscheiden, wann du’s mir geben willst«, sagte sie zurückhaltend. »Woher hätte ich außerdem wissen sollen, daß es für mich ist?«
Er lachte halblaut, als er ihr die als Geschenk verpackte flache Schachtel gab.
»Aus welchem Anlaß?«
»Ich brauche keinen Anlaß, um meiner schönen Frau ein Geschenk zu machen.«
Sie knüpfte das schwarze Satinband auf und zog das Goldpapier vorsichtig ab. Pinkie lachte wieder halblaut.
»Warum lachst du?« fragte sie.
»Die meisten Frauen reißen Geschenkpapier mit unverhohlener Gier auf.«
»Ich genieße ein Geschenk lieber.«
Er streichelte ihre Wange. »Weil du als kleines Mädchen nicht viele bekommen hast.«
»Bis ich dich kennengelernt habe.«
Unter dem Goldpapier kam ein mit schwarzem Samt bezogenes Etui zum Vorschein, in dem auf weißem Satin eine Platinkette lag, an der ein mit länglichen Diamanten eingefaßter Aquamarin im Smaragdschnitt hing.
»Ein wundervolles Stück«, flüsterte Remy.
»Es ist mir aufgefallen, weil dieser Stein genau die Farbe deiner Augen hat.« Pinkie stellte sein Glas auf den Nachttisch, nahm das Kollier aus dem Etui und drehte sich um. »Auf die kannst du einen Abend lang verzichten, glaube ich«, sagte er, indem er ihr die Goldkette mit dem Kreuz abnahm, die sie sonst immer trug. Er ersetzte sie durch das neue Kollier und schob Remy dann auf einen Standspiegel aus dem achtzehnten Jahrhundert zu, der einst das Prunkstück im Pariser Boudoir einer dem Untergang geweihten französischen Adeligen gewesen war.
Über ihre Schulter hinweg musterte er kritisch ihr Spiegelbild. »Hübsch, aber nicht perfekt. Das Kleid paßt irgendwie nicht dazu. Schwarz wäre viel besser. Tief ausgeschnitten, damit der Stein direkt auf deiner Haut liegt.«
Er zog den Reißverschluß des Kleides auf und streifte es von ihren Schultern. Dann hakte er ihren trägerlosen Büstenhalter auf und zog ihn weg. Als sie den Stein am Ansatz ihrer Brüste ruhen sah, wandte Remy den Blick vom Spiegel ab und verschränkte die Arme.
Pinkie drehte sie zu sich um und drückte ihre Arme herunter. Sein Blick wurde dunkel, während er sie prüfend musterte. Sein Atem streifte ihre Haut. »Ich hab’s gewußt«, sagte er heiser. »Nur dort wirkt dieser Stein richtig.«
Er zog sie zum Bett, ohne ihren leisen Protest zu beachten. »Pinkie, ich bin schon zurechtgemacht.«
»Dafür gibt’s Bidets.« Er drückte sie nach hinten in die Kissen und folgte ihr aufs Bett.
Pinkies von Haus aus starker Geschlechtstrieb war nach einer siegreichen Verhandlung noch stärker. An diesem Abend war er besonders ausgeprägt. Nach wenigen Minuten war alles vorbei. Remy trug noch Strümpfe und Pumps, aber Frisur und Make-up hatten unter seinem aggressiven Liebesspiel gelitten. Er wälzte sich zur Seite und griff nach seinem Glas, das er beim Aufstehen leerte. Danach durchquerte er leise pfeifend das Schlafzimmer und verschwand in seinem eigenen Ankleideraum.
Remy drehte sich auf die Seite und legte beide Hände flach unter ihre Wange. Ihr graute davor, sich noch einmal anziehen zu müssen. Hätte sie die Wahl gehabt, wäre sie im Bett geblieben und hätte ganz auf die Party verzichtet. Sie hatte sich schon morgens müde gefühlt, und die Lethargie lag ihr wie Blei in den Gliedern. Aber sie wollte unter allen Umständen verhindern, daß Pinkie diesen Mangel an Energie bemerkte, den sie ihm schon seit Wochen verheimlichte.
Sie zwang sich dazu, endlich aufzustehen. Gerade ließ sie sich ein weiteres Bad ein, als er frisch geduscht und rasiert in einem untadelig geschnittenen schwarzen Anzug aus seinem Ankleideraum trat. Er starrte sie überrascht an. »Ich dachte, du wärst fertig!«
Sie hob hilflos die Hände. »Es ist einfacher, von vorn anzufangen, als zu versuchen, etwas zu reparieren. Außerdem benütze ich nicht gern ein Bidet.«
Er zog sie an sich und küßte sie neckend. »Vielleicht habe ich dich ein Jahr zu lange in dieser Klosterschule gelassen. Du hast dir ein paar schrecklich prüde Gewohnheiten zugelegt.«
»Du hast nichts dagegen, wenn ich etwas später herunterkomme, nicht wahr?«
Er gab sie nach einem Klaps auf den Po wieder frei. »Du bist bestimmt so hinreißend, daß sich das Warten lohnt.« Von der Tür aus fügte er hinzu: »Denk daran, etwas zu tragen, was sexy, schwarz und tief ausgeschnitten ist.«
Remy ließ sich mit ihrem zweiten Bad Zeit. Von unten herauf war zu hören, wie die Musiker ihre Instrumente stimmten. Bald würden die ersten Gäste eintreffen. Bis in die frühen Morgenstunden würden sie sich nun mit Delikatessen und starken Getränken bewirten lassen, und dabei gäbe es Musik, Lachen, Tanz, Flirts und Gerede, Gerede, Gerede.
Allein der Gedanke daran ließ sie müde seufzen. Würde es irgend jemand merken, wenn die Hausherrin beschlösse, in ihrem Zimmer zu bleiben und nicht zur Party zu kommen?
Pinkie würde es merken.
Um seinen Sieg vor Gericht zu feiern, hatte er Remy ein weiteres kostbares Schmuckstück als Ergänzung ihrer schon beschämend umfangreichen Sammlung gekauft. Er wäre beleidigt gewesen, wenn er gewußt hätte, mit welchem Widerstreben sie zu seiner Siegesfeier ging oder wie wenig sein Geschenk ihr bedeutete. Aber es war unmöglich, sich aufrichtig über seine Großzügigkeit zu freuen, weil seine schönen, teuren Geschenke nur ein schwacher Ersatz für alles waren, was er ihr vorenthielt.
Noch in der Wanne liegend, drehte sie ihren Kopf zur Seite und sah zu dem Toilettentisch hinüber, wo ihr neuer Schatz in dem mit Satin ausgeschlagenen Etui lag. Sie hatte keinen Blick für die Schönheit dieses speziellen Steines. Er strahlte keine Wärme aus, sondern wirkte ausgesprochen kalt. Seine Facetten schickten keine Feuerblitze aus, sondern glitzerten in eisigem Licht. Der Aquamarin erinnerte sie an den Winter, nicht an den Sommer. Bei seinem Anblick fühlte sie sich nicht glücklich und erfüllt, sondern hohl und leer.
Pinkie Duvalls Frau begann still zu weinen.
3. Kapitel
Pinkie machte viel Aufhebens um Remy, als sie herunterkam. Er bemächtigte sich ihres Armes und verkündete, mit ihrem Erscheinen könne die Party jetzt offiziell beginnen. Dann führte er sie durch die Menge und stellte ihr alle Gäste vor, die sie nicht kannte – auch die sichtlich beeindruckten Geschworenen aus dem Prozeß gegen Bardo.
Viele der Gäste waren wegen ihrer Verwicklung in Skandale, Verbrechen oder Kombinationen aus beiden berüchtigt. Manchen wurde nachgesagt, sie gehörten der Metropolitan Crime Commission an, aber da die Mitgliedschaft in dieser Elite, für die man sich nicht selbst bewerben konnte, geheim war, wußte das niemand genau. Die unbegrenzten Geldmittel dieser Gruppe wurden nur von ihrer unbegrenzten Macht übertroffen.
Einige der Gäste waren Politiker, die es verstanden, ihre Wähler in eigennützigem Sinn zu beeinflussen. Andere waren neureiche Erfolgsmenschen, während wieder andere aus altehrwürdigen und betuchten Familien stammten, die das hiesige Gesellschaftsleben despotisch beherrschten. Einige wenige hatten Verbindung zum organisierten Verbrechen. Alle waren Freunde, Geschäftspartner und ehemalige Mandanten Pinkies. Alle waren gekommen, um ihm Tribut zu zollen.
Remy ertrug die Schmeicheleien der Gäste ihres Mannes aus demselben Grund, aus dem sie ihr schmeichelten – um weiter in seiner Gunst zu stehen. Das neue Schmuckstück wurde neidvoll bewundert, und das Dekolleté, in dem es ruhte, zog ebenfalls bewundernde Blicke auf sich, was Remy peinlich war. Sie stand nicht gern im Mittelpunkt übertriebener Aufmerksamkeit und haßte es, von gerissenen Männern angegafft zu werden, während die ebenso gerissenen Ehefrauen sie mit kaum verhüllter Mißgunst und Geringschätzung musterten.
Pinkie, der die Unaufrichtigkeit dieser Leute nicht wahrzunehmen schien, stellte sie wie eine lebende Jagdtrophäe zur Schau. Remy spürte, daß seine falsch lächelnden Freunde bei ihr erste Abnutzungserscheinungen suchten und sich fragten: Wer hätte gedacht, daß eine so unwahrscheinliche Ehe derartig lange halten würde?
Irgendwann kam das Gespräch auf den Prozeß, und Remy wurde nach ihrer Meinung über das Urteil gefragt. »Pinkie engagiert sich bei jedem Verfahren hunderprozentig«, antwortete sie. »Mich hat nicht im geringsten überrascht, daß sein Mandant freigesprochen wurde.«
»Aber Sie müssen doch zugeben, meine Liebe, daß der Ausgang diesmal leicht vorauszusagen war.« Diese herablassende Bemerkung machte eine Dame der Hautevolee, an deren dürrem, faltigem Hals Unmengen von Diamanten hingen.
Pinkie antwortete an Remys Statt. »Wie ein Prozeß ausgehen wird, läßt sich nie voraussagen. Dieser hier hätte ebensogut anders enden können. Sobald man einen Polizeibeamten im Zeugenstand hat, muß man verdammt hellwach sein.«
»Bitte, Pinkie«, warf einer der Umstehenden spöttisch ein. »Die Glaubwürdigkeit von Polizeibeamten vor Gericht ist doch seit Mark Fuhrmanns Aussage im Prozeß gegen O. J. Simpson für immer dahin.«
Pinkie schüttelte den Kopf. »Gut, ich gebe zu, daß Fuhrmann der Anklage mehr geschadet als genützt hat. Aber Burke Basile ist ein völlig anderer Typ. Wir haben in seiner Vergangenheit irgendwas gesucht, was ihn diskreditieren würde. Er hat sich nie das Geringste zuschulden kommen lassen.«
»Bis zu der Nacht, in der er den eigenen Partner erschossen hat«, kicherte einer der Gäste. Er schlug Pinkie auf die Schulter. »Sie haben ihm im Zeugenstand wirklich Daumenschrauben angelegt.«
»Nur schade, daß der Richter keine Fernsehübertragung zugelassen hat«, meinte ein anderer Gast. »Sonst hätte die Öffentlichkeit live miterleben können, wie ein Cop auseinandergenommen wird.«
Ein weiterer Gast behauptete: »Mich hätte es nicht gewundert, wenn die Geschworenen den Prozeß während Basiles Aussage unterbrochen und den Antrag gestellt hätten, gleich heimgehen zu dürfen.«
»Wir reden hier über den Tod eines Menschen«, platzte Remy heraus. Sie fand die Scherze und das Lachen der Gäste obszön. »Ganz egal, wie dieses Verfahren ausgegangen ist – Mr. Stuart wäre nicht erschossen worden, wenn Bardo ihn nicht als lebenden Schutzschild benützt hätte. Habe ich nicht recht?«
Das Gelächter verstummte schlagartig. Plötzlich waren alle Augen auf sie gerichtet.
»Rein faktisch, meine Liebe, stimmt das«, antwortete Pinkie. »Wir haben vor Gericht eingeräumt, daß Mr. Bardo hinter dem verletzten Polizeibeamten gestanden hat, als dieser erschossen wurde, aber davon, daß Stuart als Schutzschild benützt worden sei, kann keine Rede sein. Das Ganze war ein bedauerlicher Unfall, was aber nicht rechtfertigt, daß dafür ein Unschuldiger ins Gefängnis geschickt wird.«
Remy war noch nie eingeladen worden, an einer Gerichtsverhandlung teilzunehmen und Pinkie in Aktion zu erleben, aber sie kannte alle Einzelheiten dieses Falles, weil sie die Berichterstattung in den Medien verfolgt hatte. Die Drogenfahnder Stuart und Basile waren als erste ihrer Einheit in einem Lagerhaus eingetroffen, in dem vermutlich Drogen hergestellt und versandfertig gemacht wurden.
Die Männer in dem Lagerhaus waren vor der bevorstehenden Razzia gewarnt worden. Als Stuart und Basile sich dem Gebäude näherten, wurden sie beschossen. Ohne auf Verstärkung zu warten, war Stuart in das Lagerhaus gestürmt, hatte sich einen Schußwechsel mit einem Mann namens Toot Jenkins geliefert und ihn erschossen.
Toot Jenkins lag tot da; Stuart war schwer verwundet. Seine kugelsichere Weste hatte potentiell tödliche Treffer abgelenkt, aber eine Kugel hatte seinen Oberschenkel getroffen und die Schlagader nur knapp verfehlt. Eine zweite Kugel hatte die Elle seines rechten Armes zerschmettert.
»Der Arzt hat vor Gericht ausgesagt, Stuart habe vermutlich unter Schock gestanden, hätte aber trotz dieser Verletzungen überleben können«, sagte Remy. »Sie waren schwer, aber nicht lebensgefährlich.«
»Aber Ihr Mann hat die Glaubwürdigkeit des Arztes erschüttert.«
Pinkie hob abwehrend eine Hand, als wollte er andeuten, er brauche keine Unterstützung, zumal die Herausforderin seine eigene Frau sei. »Versetz dich in Mr. Bardos Lage, Liebling«, sagte er. »Ein Mann liegt tot da, ein zweiter ist verletzt und blutet. Daraus hat Mr. Bardo ganz richtig geschlossen, er sei unabsichtlich in eine sehr gefährliche Situation geraten.
Er hat sich überlegt, die Männer dort draußen seien vielleicht gar keine Polizeibeamten, wie sie behaupteten, sondern in Wirklichkeit Mr. Jenkins’ Konkurrenten, die sich als Polizisten ausgaben. Toot Jenkins hatte Geschäfte mit einer asiatischen Bande gemacht. Diese Bandenmitglieder können äußerst clever sein, weißt du?«
»Stuart war rothaarig und sommersprossig. Mit einem Asiaten hat man ihn kaum verwechseln können.«
»Touché, Pinkie«, versetzte einer der Gäste lachend. »Pech für die Staatsanwaltschaft, daß nicht Remy die Anklage vertreten hat.«
Pinkie lachte mit den anderen über diese kleine Schlappe, aber wahrscheinlich merkte nur Remy, daß sein Lachen gezwungen klang. Er musterte sie von Kopf bis Fuß. »Remy vor Gericht? Das kann ich mir nicht recht vorstellen. Ihre Begabung liegt anderswo.« Während er das sagte, fuhr er mit einer Fingerspitze über ihr tiefes Dekolleté.
Die anderen lachten alle, aber Remy fühlte, wie eine heiße Welle von Demütigung und Zorn ihren Körper durchflutete. »Entschuldigung, ich habe noch nichts gegessen«, murmelte sie und kehrte der Gruppe den Rücken zu.
Remy glaubte zu wissen, was in jener Nacht, in der Stuart umgekommen war, passiert war, aber es wäre nicht klug gewesen, das vor Pinkie und seinen Freunden zu äußern. Sie feierten den Freispruch seines Mandanten, nicht seine Unschuld – was nicht unbedingt ein und dasselbe war. Remy glaubte keine Sekunde lang, Wayne Bardo sei verwirrt gewesen, als plötzlich Schüsse fielen. Er hatte mit voller Überlegung gehandelt, als er den verletzten Polizeibeamten hochgezogen und als Schutzschild benützt hatte, während er durchs offene Tor in die Dunkelheit hinausgetreten war. Ihm war klar gewesen, daß er unter Beschuß geraten würde, wenn ihn draußen Polizeibeamte erwarteten.
Leider verfügte Burke Basile über ausgezeichnete Reflexe und war ein erstklassiger Schütze. Da er glaubte, auf einen Angreifer zu schießen, hatte er auf den Kopf gezielt und ihn auch getroffen. Der Spruch der Geschworenen hatte ihm die Alleinschuld an Stuarts Tod zugeschoben.
Weil Remy behauptet hatte, hungrig zu sein, ging sie ins elegante Speisezimmer. Das Büfett hätte – wie erwartet – jeden Schlemmer entzückt. In randvollen Wärmeschüsseln aus Sterlingsilber dampften Flußkrebsragout, Reis mit roten Bohnen und gegrillte Garnelen in einer so scharfen Sauce, daß allein ihr Duft genügte, um Remy Tränen in die Augen zu treiben.
Rohe Austern in der Halbschale lagen auf Tabletts mit zerstoßenem Eis. Ein Koch mit weißer Mütze säbelte von riesigen Hinterschinken und Rinderbraten Scheiben ab. Es gab scharf gewürzte Eier und Krabben, dazu Salate, Beilagen, Würstchen, verschiedene Brotsorten und Nachspeisen für jeden Geschmack. Der Anblick und die Düfte so vieler Speisen reizten Remy jedoch gar nicht, im Gegenteil, ihr wurde leicht übel.
Sie sah sich um und stellte fest, daß Pinkie sich mit einigen der Geschworenen unterhielt, die Bardo freigesprochen hatten. Sie schienen an seinen Lippen zu hängen, und da Pinkie aufmerksame Zuhörer liebte, würde er seine Frau nicht so bald vermissen.
Sie schlüpfte unbeobachtet durch eine Terrassentür in den stillen, abgeschiedenen Garten hinter dem Haus hinaus. Draußen war es so kühl, daß ihre Atemfeuchtigkeit zu sehen war, aber Remy genoß die belebende Kühle auf ihrer nackten Haut. Sie folgte dem Gartenweg, der zum Pavillon führte. Der reich verzierte schmeideeiserne Rundbau mit zwiebelförmiger Kuppel in der hintersten Ecke des Grundstücks war einer ihrer liebsten Aufenthaltsorte. Empfand sie das verzweifelte Bedürfnis, allein zu sein – oder wenigstens die Illusion der Einsamkeit zu haben –, zog sie sich in den Pavillon zurück.
Sie trat in den Rundbau, lehnte sich an einen der Pfeiler, umarmte ihn beinahe, während sie die Wange an das kalte Metall legte. Was Pinkie vorhin vor seinen Gästen angedeutet hatte, war ihr noch immer peinlich. Solche Bemerkungen unterstrichen nur, was ohnehin schon jeder von ihr glaubte: daß sie ein verwöhntes Luxusweibchen mit beschränkter Intelligenz und belanglosen Meinungen war, dessen einziger Daseinszweck darin bestand, ihrem prominenten Ehemann in der Öffentlichkeit als schmückendes Beiwerk zu dienen und ihn im Bett zu befriedigen. Die Leute schienen auch zu glauben, daß sie keine Gefühle hätte, daß ihre subtilen Beleidigungen spurlos an ihr abprallten. Sie dachten, das behütete Leben, das sie führte, mache sie glücklich, und sie hätte alles, was ihr Herz begehrt.
Aber sie täuschten sich.
Keine Macht der Welt hätte ihn daran hindern können herzukommen.
Burke Basile gestand sich ein, daß es nicht ratsam war, sich hier aufzuhalten. Nicht ratsam? Quatsch, es war regelrecht dämlich von ihm, im Schatten der hohen, dichten Azaleenhecke zu lauern und Pinkie Duvalls Villa im Garden District feindselig anzustarren.
Das Haus war weiß und verziert wie eine Hochzeitstorte – nach Burkes Meinung geschmacklos überladen. Aus hohen Fenstern fiel goldgelbes Licht auf den Rasen, der so perfekt gepflegt war, daß er einem grünen Teppich glich. Musik und Lachen drangen aus den lichtüberfluteten Räumen.
Burke verschränkte seine Arme und umfaßte seine Ellbogen mit den Händen, weil er in der kühlen Abendluft zu frösteln begann. Er hatte nicht einmal daran gedacht, eine warme Jacke anzuziehen. Der Herbst war gekommen und gegangen. Die Feiertage waren buchstäblich unbemerkt verstrichen, der milde Winter von New Orleans war schon fast wieder vorüber. Der Wechsel der Jahreszeiten und der kommende Frühling gehörten zu den Dingen, die Burke am wenigsten beschäftigten.
Kevin Stuarts Tod vor acht Monaten hatte ihn ganz in Anspruch genommen, gelähmt und für seine Umgebung unempfindlich gemacht.
Barbara hatte zuerst gemerkt, wie ausschließlich ihn dieses Thema beschäftigte, aber das war nur natürlich, weil sie mit ihm zusammenlebte. Als seine Trauer sich zur Besessenheit auswuchs, hatte sie eine gerechtfertigte Beschwerde vorgebracht. Und dann noch eine. Und noch eine, bis sie von ihrem Gekeife selbst erschöpft war. In letzter Zeit war ihre Haltung eher gleichgültig gewesen.
Als der Prozeß gegen Wayne Bardo bevorstand, hatten alle Kollegen in seinem Dezernat gemerkt, daß Burke nicht mehr wie früher mit Leib und Seele bei der Arbeit war. Er konnte sich nicht auf neue Fälle konzentrieren, weil er in Gedanken noch bei dem einen war, der Kevin und ihn in dieses Lagerhaus geführt hatte.
Ein Jahr lang, bis zu jener schicksalshaften Nacht hatten sie diesen einen Dealerring stetig verkleinert, indem sie die wichtigsten Dealer nacheinander aus dem Verkehr gezogen hatten. Aber die Bosse im Hintergrund hatten sich nicht fassen lassen und lachten sich vermutlich schief über die unbeholfene und kontraproduktiven Bemühungen der Drogenfahndung.
Wie um das Dezernat noch mehr zu frustrieren, war ihre Erfolgsquote gegen null gesunken. Jede Razzia hatte mit einem Mißerfolg geendet. Selbst bei noch so strengen Sicherheitsmaßnahmen, auch bei sorgfältig geheimgehaltenen Razzien wurden die Verbrecher immer rechtzeitig gewarnt. Drogenlabors waren verlassen, obwohl die Chemikalien noch dampften. Riesige Lagerbestände wurden nur wenige Augenblicke vor dem Eintreffen der Drogenfahnder preisgegeben. Das waren Verluste, die sich die Dealer leisten konnten; sie rechneten solche Verluste einfach zu den Geschäftskosten. Und am nächsten Tag machten sie woanders ein neues Drogenlabor auf.
Die Dreckskerle stoben schneller auseinander als Kakerlaken, wenn das Licht angeht. Die Cops standen wie Idioten da. Nach jeder fehlgeschlagenen Razzia befand sich das Dezernat wieder auf Feld eins und mußte erneut mühsam versuchen, die Lieferanten aufzuspüren.
Burke, der seit vielen Jahren Dorgenfahnder war, war nicht leicht zu erschüttern. Er wußte, daß sie mit Rückschlägen und Verzögerungen rechnen mußten. Er wußte, daß es Monate dauerte, Hinweise zusammenzutragen. Er wußte, daß die verdeckt arbeitenden Kollegen Beziehungen aufbauen mußten, die Zeit und Geduld erforderten. Er wußte, daß die Erfolgschancen minimal waren – und daß auch Erfolge nur wenig Anerkennung brachten. Trotzdem bestand ein himmelweiter Unterschied dazwischen, das alles zu wissen, und es auch zu akzeptieren.
Geduld gehörte nicht zu Burkes Tugenden. Er hielt sie nicht einmal für eine Tugend. Nach seiner Auffassung war Zeitbedarf gleichbedeutend mit Versagen. Denn an jedem Tag, den sie brauchten, um gute Arbeit zu leisten und handfeste Beweise zu sammeln, mit denen der Staatsanwalt eine Verurteilung erreichen konnten, ließen Dutzend von Jugendlichen sich von Dealern in ihrem Wohnviertel verführen. Oder ein Yuppie, der von einer Designerdroge high war, raste mit seinem BMW in einen Kleinbus, in dem eine Seniorengruppe zu einem Ausflug unterwegs war. Weitere Crack-Babys wurden geboren. Ein Teenager starb aufgrund von Drogenmißbrauch an Herzversagen. Ein anderer spritzte sich eine Überdosis und starb einen jämmerlichen Tod.
Aber da die einzige Alternative eine bedingungslose Kapitulation gewesen wäre, arbeiteten Burke und seine Kollegen weiter. Sie trugen in mühsamer Arbeit Beweise zusammen. Aber jedesmal, wenn sie dachten, es endlich geschafft zu haben, wenn sie glaubten, ihre nächste Razzia wäre die Mutter aller Razzien, wenn sie dachten, diesmal würden sie die Schweinehunde auf frischer Tat ertappen und für Jahre aus dem Verkehr ziehen, ging irgend etwas schief.
Es gab einen Verräter im Drogendezernat des New Orleans Police Departments.
Es mußte einen geben. Anders ließ sich die Tatsache, daß die Dealer ihnen immer einen Schritt voraus waren, nicht erklären. Das war zu oft passiert, als daß man dafür den Zufall oder Karma oder Künstlerpech oder menschliches Versagen oder Schicksalsmächte hätte verantwortlich machen können. Irgend jemand im Dezernat arbeitete für die andere Seite.
Gott helfe dem Dreckskerl, wenn Burke Basile herausbekam, wer es war, denn durch den Verrat dieses Cops war Nanci Stuart zur Witwe, waren ihre beiden jungen Söhne vaterlos geworden.
Burke hatte Kevin dringend ermahnt, in Deckung zu bleiben, bis das Fahrzeug mit dem Rest ihrer Gruppe kam, die Rammböcke, Gasmasken und Schnellfeuergewehre mitbringen würde. Sie waren einige Minuten vor den anderen eingetroffen, und Burke hatte die Haftbefehle in der Tasche. Aber in seiner Frustration wegen der vielen in letzter Zeit fehlgeschlagenen Razzien war Kevins irisches Temperament mit ihm durchgegangen. Er war durch das offene Rolltor ins Lagerhaus gestürmt. Burke hatte den Schußwechsel gehört, das Mündungsfeuer aufblitzen sehen und den Pulverdampf gerochen.
Dann waren Schreie zu hören gewesen.
Verdammt, irgend jemand war getroffen worden.
Burke hatte verzweifelt Kevins Namen gerufen.
Schweigen.
Je länger Kevins Antwort ausblieb, desto besorgter wurde er. »Gott im Himmel, nein, bitte nicht«, betete er. »Kevin, sag endlich was, du verdammter Ire!«
Dann wankte ein Mann aus dem schwarzen Rachen des offenen Lagerhaustors. In der Dunkelheit konnte Burke nicht erkennen, warum er sich so unbeholfen bewegte – aber er sah, daß der Mann eine Pistole in der Hand hielt und auf ihn zielte. Burke forderte ihn auf, er solle die Waffe fallen lassen, aber der Mann kam unbeirrbar weiter auf ihn zu. »Weg mit der Waffe!« rief Burke nochmals. »Hände hoch!«
Der Mann drückte zweimal ab.
Burke schoß nur einmal.
Aber dieser eine Schuß genügte. Kevin war tot, bevor Bardo seinen Leichnam zu Boden fallen ließ.
Als Burke auf seinen Freund zulief, den er versehentlich erschossen hatte, hörte er Bardos Lachen von den Metallwänden des Lagerhauses widerhallen. Wer dieser Unbekannte war, hatte er erst erfahren, nachdem seine Kollegen, die gerade noch rechtzeitig eingetroffen waren, um Bardo abzufangen, ihn hinter dem Lagerhaus festgenommen hatten. Der Vorbestrafte hatte Spuren von Kevins Blut und Fleisch und Knochen und Gehirnmasse im Gesicht, aber sein dreiteiliger Armani-Anzug hatte keinen einzigen Spritzer abbekommen. Wayne Bardo hatte sich nicht einmal die Hände schmutzig gemacht.
Die Pistole, mit der er geschossen hatte, wurde nie gefunden. In den wenigen Minuten bis zu seiner Festnahme hatte Bardo sie erfolgreich beseitigt, so daß es keinen Beweis für Burkes Behauptung gab, Bardo habe zwei Schüsse auf ihn abgegeben.
Vor Gericht wurde auch nie geklärt, weshalb Bardo in Toot Jenkins’ Drogenlabor gewesen war. Pinkie Duvall hatte argumentiert, Bardos Anwesenheit in einem Drogenlabor stehe in keinem Zusammenhang mit den Ereignissen, um die es in diesem Verfahren gehe, und könne nur dazu dienen, die Geschworenen gegen seinen Mandanten einzunehmen.
Mach Sachen, Einstein, hatte Burke sich dabei gedacht. Das sollte die Geschworenen gegen Bardo einnehmen.
In diesem Punkt hatte der Richter zugunsten des Angeklagten entschieden. Dafür gab es eine einfache Erklärung. Duvall spendete für die Wahlkampagnen vieler Richter. Die Kandidaten, die das meiste Geld ausgeben konnten, gewannen im allgemeinen – und behandelten dann die Anwälte, die ihnen zu ihrem Amt verholfen hatten, besonders zuvorkommend. Duvall hatte die meisten von ihnen in der Tasche.
Aber das war nicht das einzige schmutzige Spiel, das Pinkie Duvall trieb. Wayne Bardo war in jener Nacht in dem Lagerhaus gewesen, um einen Auftrag für seinen Boß auszuführen und sein Boß war Pinkie Duvall.
Im Drogendezernat galt es als ausgemacht, wenn es auch nicht beweisbar war, daß Pinkie Duvall der große Drahtzieher im Hintergrund war, hinter dem die Beamten seit Jahren her waren. Er hatte mehr Verbindungen zum Drogenhandel als Nutten zu Herpes. Jede Spur führte zu ihm, endete dann aber kurz vorher in einer Sackgasse. Obwohl es keinen handfesten Beweis gegen ihn gab, wußte Burke, daß dieser Dreckskerl im Drogenhandel mitmischte. Daß er ihn beherrschte.
Trotzdem blieb er unbehelligt, lebte in seiner Luxusvilla wie ein Fürst und feierte Kevin Stuarts Tod mit einer großen, lärmenden Party.
Die Bewegung, mit der eine der Terrassentüren sich öffnete, lenkte Burke von seinen verbitterten Überlegungen ab. Er trat etwas zwischen die Büsche zurück, damit die Frau, die durch den Garten zum Pavillon ging, ihn nicht sehen konnte.
Die Unbekannte war allein. Sie lehnte sich zuerst an einen der Eisenpfeiler, dann machte sie langsam einen Rundgang durch den Pavillon, eine Hand auf dem efeubewachsenen Geländer. Als sie den Ausgangspunkt wieder erreichte, lehnte sie sich erneut an den Pfeiler – diesmal mit dem Rücken.
Jetzt sah Burke zum erstenmal ihr Gesicht, und obwohl er es nicht laut sagte, dachte er: Wahnsinn!
Im kalten bläulichen Mondlicht schimmerte ihr schwarzes Haar, und ihre Haut wirkte blaß und fast durchsichtig wie Alabaster. Das kurze Cocktailkleid ließ sehr viel Bein sehen. Ihr Busen quoll fast aus dem tiefen Ausschnitt.
Burke schätzte sie sofort als eine der teuren Nutten ein, deren Jagdrevier die Bars von Luxushotels waren, wo Kongreßteilnehmer von auswärts viel Geld für ein bis zwei Stunden Fleischeslust mit einer Frau ausgaben, die ihnen als echte heißblütige Kreolin angepriesen wurde.
Burke Basile lächelte grimmig. Er wäre jede Wette eingegangen, daß die hier teurer als die meisten anderen war. Ihre ganze Aufmachung verkündete: Ich bin teuer und jeden Cent wert. Sie gehörte zu einer Elite, die sich prominente, finanzkräftige Freier wie Duvall angeln konnte.
Allerdings mußte sie dabei mit starker Konkurrenz rechnen. Ein Multimillionär wie Pinkie Duvall brauchte sich nicht mit häßlichen Frauen zu umgeben. Vielleicht war die Schwarzhaarige nur für heute abend zur Dekoration engagiert worden. Oder vielleicht war sie die Freundin eines Gastes. Oder sie konnte eine gewohnheitsmäßige Schmarotzerin sein, die Duvall und seinen Freunden für Designerkleidung und gute Drogen jederzeit zur Verfügung stand.
Daß Männer eine Geliebte aushielten, wurde in New Orleans seit Gründung der Stadt allgemein akzeptiert. Fleischvermarktung war in jeder Kongreßstadt ein wichtiger Gewerbezweig; New Orleans war in dieser Beziehung ganz sicher keine Ausnahme. Jeder Taxifahrer der Stadt kannte die Adresse von Ruby Bouchereaux’ Etablissement. Ihre Mädchen waren große Klasse. Ruby selbst gehörte zu den reichsten Frauen Louisianas.
Und es gab die Straßenmädchen, deren Revier die dunklen Ecken des French Quarters waren. Für einen Hit Crack waren sie zum Oralverkehr in einem Gassenwinkel bereit. Sie waren nicht wählerischer als die blutjungen Mädchen, die Storyville zu einem der berüchtigtsten Rotlichtbezirke der Welt gemacht hatten. Im Big Easy gab es in jeder Preisklasse Arbeit für hartgesottene Nutten.
Aber noch während Burke das dachte, erkannte er, daß diese hier nicht hartgesotten wirkte. Drogenhandel und Prostitution gingen oft Hand in Hand, und er hatte durch die Beobachtung dieser Mädchen viel gelernt. Er erkannte auf einen Blick, ob eine an diesem Leben zerbrechen würde oder den Killerinstinkt besaß, der zum Überleben notwendig war.
Er hätte nicht darauf wetten mögen, daß diese es schaffen würde. Klar, sie hatte Klasse. Aber sie sah nicht raubgierig und berechnend aus. Sie wirkte … traurig.
Noch immer ohne zu merken, daß sie beobachtet wurde, legte sie den Kopf entspannt an den reichverzierten Eisenpfeiler und schloß die Augen. Dann ließ sie die Hände über ihren Körper hinabgleiten, bis sie sich über dem Unterleib berührten.
Burke bekam einen trockenen Mund. Sein Magen verkrampfte sich.
Die Beamten des Sittendezernats zeigten oft pornographische Videos, Filme und Magazine herum, die sie als Beweismaterial beschlagnahmt hatten. Burke sah sie sich in der Regel nicht an, aber er war ganz normal veranlagt, und welcher Mann, ob er nun Cop war oder einen anderen Beruf hatte, hätte sich von dieser Szene abwenden können, ohne abzuwarten, was als nächstes geschehen würde?
Tatsächlich geschah gar nichts. Sie streifte kein Kleidungsstück ab. Sie streichelte diese erogene Zone nicht wirklich. Sie stöhnte und keuchte nicht, sie wand sich nicht und atmete auch nicht schwer durch teilweise geöffnete Lippen.
Trotzdem war ihre Haltung hinreißend. Sogar erregend.
Und offenbar war er nicht der einzige, der das fand.
Burke war von ihrem Anblick so gefesselt, daß er den Mann nur wenige Sekunden früher sah, als sie selbst Wayne Bardo wahrnahm.
4. Kapitel
Bardo, dachte Burke und verzog verächtlich den Mund, so daß sein Schnurrbart sich nach unten kräuselte.
Er hatte sie für eine Klassefrau gehalten, während sie in Wirklichkeit auf Bardo gewartet hatte – den Herrn der Erbärmlichen, diesen Berufsverbrecher, dem es dank Pinkie Duvalls geschickter Hilfe stets gelungen war, seiner gerechten Strafe zu entgehen.
Wußte sie, daß Bardo als Sechzehnjähriger eine Prostituierte ermordet hatte? Die beiden hatten S/M-Spiele getrieben, er hatte ihren Hals mit ihrem Handgelenk verwechselt und sie mit ihrem eigenen Strumpf erdrosselt. Nach Jugendstrafrecht war er wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt worden und hatte nur ein Jahr seiner Haftstrafe absitzen müssen, bevor er auf Bewährung freigekommen war. Wenn diese exklusive Nutte auf solche Verbrechertypen stand, hatte sie verdient, was sie bekam.
Bardo begrapschte sie jetzt überall, und sie drängte sich gegen ihn. Burke wandte sich angewidert ab, bahnte sich einen Weg durch die Hecke und kehrte zu seinem Toyota zurück, den er zwischen den BMWs und Jaguars geparkt hatte, die Duvalls Gästen gehörten.
»Angenehm kühl hier draußen, was?«
Remy zuckte zusammen, als sie die Augen öffnete und Wayne Bardo wie sprungbereit am Eingang des Pavillons stehen sah. Er hatte sich bewußt lautlos angeschlichen, weil er sie erschrecken wollte. Seine dunklen Gesichtszüge waren überschattet und unkenntlich wie die einer Gestalt in einem Alptraum.
Obwohl sie sofort die Hände sinken ließ, wußte sie, daß er gesehen hatte, wie sie ihren Körper berührten, denn sein Grinsen war diesmal noch anzüglicher als sonst. Er versperrte ihr den Weg. Wenn sie nicht über die Brüstung setzen wollte, konnte sie nirgendwohin ausweichen.
Ohne sich die Mühe zu machen, ihren Widerwillen zu verbergen, fragte sie: »Was tun Sie hier draußen?«
»Ich hab’ Sie auf der Party vermißt. Bin losgegangen, um Sie zu suchen.« Er trat näher. Obwohl Remy sich zwingen mußte, nicht vor ihm zurückzuzucken, hielt sie tapfer stand. Als er sich dicht vor aufgebaut hate, ließ er seinen Blick frech über ihren Körper gleiten und starrte besonders ihr Dekolleté an. Er senkte vertraulich die Stimme und sagte: »Und jetzt finde ich Sie hier.«
Bardo sah in der Art eines Stummfilmhelden gut aus. Sein schwarzes Haar war straff aus der breiten Stirn gekämmt, in deren Mitte sein Haaransatz spitz auslief. Er hatte einen dunklen, ebenmäßigen Teint. Er war schlank und sehnig und immer modisch angezogen. Aber seit Remy ihn kannte, hatte sie seinen glatten Manieren mißtraut und die Intensität, die er zur Schau trug, abstoßend gefunden.
Noch bevor Pinkie im Fall Stuart seine Verteidigung übernommen hatte, waren die beiden Geschäftspartner gewesen, so daß Bardo ein häufiger Gast im Hause Duvall war. Remy behandelte ihn mit kühler Höflichkeit, vermied aber jeglichen engeren Kontakt mit ihm. Von seinen glühenden Blicken bekam sie nur eine Gänsehaut.
Bei den seltenen Gelegenheiten, wo sie mit ihm allein war – meistens von ihm geschickt herbeigeführt –, sagte er unweigerlich irgend etwas Anzügliches, während aus seinem Grinsen alle möglichen Andeutungen sprachen. Dabei tat er immer so, als teilten Remy und er ein unanständiges kleines Geheimnis.
»Pinkie sucht mich bestimmt schon.«
Sie wollte an ihm vorbeigehen, aber anstatt ihr Platz zu machen, bedeckte er ihren Unterleib mit seiner Hand und massierte ihn mit den Fingern. »Wie wär’s, wenn Sie mich weitermachen ließen?«
Er hatte es noch nie gewagt, sie zu berühren, und sie war im ersten Augenblick vor Angst und Widerwillen wie gelähmt. Remy hatte genug von seinen prahlerischen Bemerkungen mitbekommen, um zu wissen, daß er alle Formen von Gewalt genoß – eine Vorliebe, die sich logischerweise auch auf seine Beziehungen zu Frauen auswirken mußte. Nicht weniger fürchtete sie jedoch das, was Pinkie tun würde, wenn er hörte, daß ein anderer Mann sie angefaßt hatte.
Bardos Kühnheit an diesem Abend war vermutlich darauf zurückzuführen, daß er sich nach seinem Freispruch unbesiegbar glaubte, und möglicherweise auf den Alkohol, den sie in seinem Atem roch. Seine Erregung hätte sich nur gesteigert, wenn sie sich ihre Angst hätte anmerken lassen. Statt dessen forderte sie ihn in scharfem, deutlichem Tonfall auf, seine Hand wegzunehmen.
Sein schmallippiges Grinsen wurde breiter, während er den Druck seiner Handfläche verstärkte. »Und wenn nicht, Mrs. Duvall?«
Remy hatte Mühe, die Worte zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorzustoßen. »Wenn Sie nicht sofort Ihre Hand von mir wegnehmen …«
»Er hat Sie gevögelt, stimmt’s?«
Sie schlug seine Hand weg, weil sie die Berührung keine Sekunde länger ertragen konnte. »Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe!« Diesmal wollte sie sich an ihm vorbeidrängen, aber er packte sie grob an den Schultern und stieß sie gegen den Eisenpfeiler.
»Deshalb sind Sie zu spät zur Party gekommen, stimmt’s? Pinkie hat sich die Seele aus dem Leib gevögelt. Ich würd’s tun, wenn Sie mir gehörten. Tag und Nacht. Ich würd’ Ihnen keine Ruhe mehr lassen. So oder so.«
Er rieb sein Becken lüstern an ihrem Unterleib. »Sie finden Pinkie gut? Bis Sie mich gehabt haben, wissen Sie nicht, was gut ist, Mrs. Duvall.« Er streckte die Zunge heraus, bewegte sie obszön und ließ sie dann über Remys Kehle gleiten. »Alles nur eine Frage der Zeit, wissen Sie. Irgendwann bekomme ich Sie.«
Sie schluckte ihre Übelkeit hinunter und stieß ihn mit aller Kraft von sich fort. Körperlich hätte sie ihn nicht überwältigen können, aber er ließ zu, daß sie ihn wegstieß. Während er einen Schritt zurücktrat, lachte er über ihre Bemühungen, ihn loszuwerden.
»Kommen Sie mir ja nicht wieder zu nahe, sonst …«
»Was sonst? Los, reden Sie schon, Mrs. Duvall: Was tun Sie sonst?«
Bardo legte eine Hand über ihrem Kopf an den Eisenpfeiler und beugte sich über sie. Seine Stimme klang herausfordernd. »Was tun Sie sonst? Mich bei Pinkie verpetzen?« Er schüttelte den Kopf. »Das täte ich nicht. Wenn Sie Ihrem Mann erzählen, daß ich mich an Sie rangemacht habe, kann’s passieren, daß er die Schuld dafür eher Ihnen als mir gibt. Er vertraut mir, wissen Sie? Und Sie haben so eine gewisse Art, Ihre Vorzüge zur Geltung zu bringen.«
Er griff nach ihrer Brust, aber sie schlug seine Hand weg. »Damit belästige ich Pinkie erst gar nicht. Mit Ihnen werde ich selbst fertig.«
»Sie werden mit mir fertig?« fragte er spöttisch. »Klingt vielversprechend.«
Ihre Augen glitzerten eisig wie das Schmuckstück an ihrem Hals, als sie ruhig fragte: »Mr. Bardo, Sie halten sich doch nicht etwa für den einzigen Killer, den mein Mann beschäftigt?«
Für einen kurzen Augenblick verrutschte sein arrogantes Grinsen, während seine dunklen Augen etwas von ihrem Glanz einbüßten. Remy nutzte diese vorübergehende Schwächung seines Selbstvertrauens aus, um ihn wegzustoßen. Diesmal gelang ihr die Flucht.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Fat Tuesday« bei Warner Books, Inc., New York
4. Auflage
Taschenbuchausgabe Juli 2000 bei Blanvalet, eine Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © by Sandra Brown Management Ltd. 1997
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1999 by Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: SOA/Voller Ernst ES · Herstellung: Heidrun Nawrot
eISBN 978-3-641-10335-4
www.blanvalet-verlag.de
www.randomhouse.de
Leseprobe