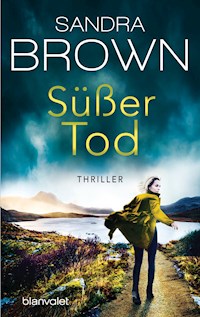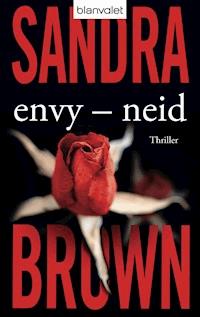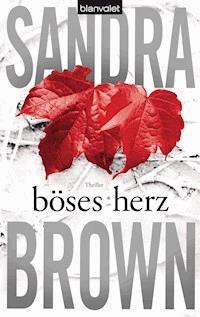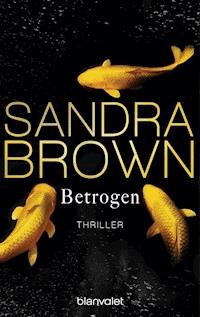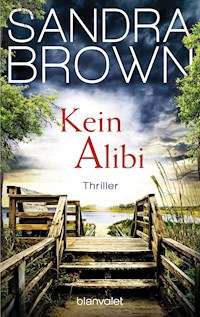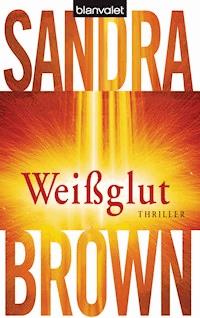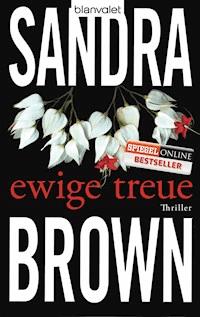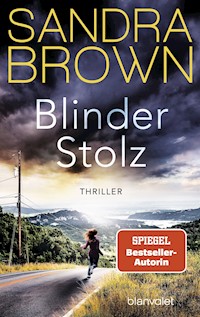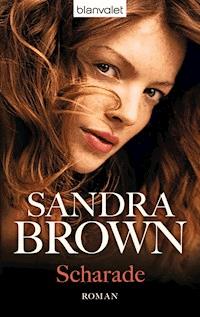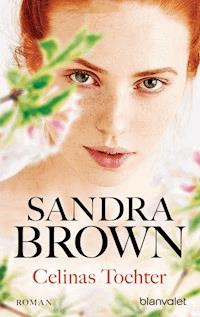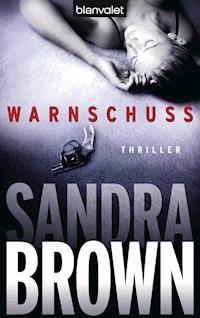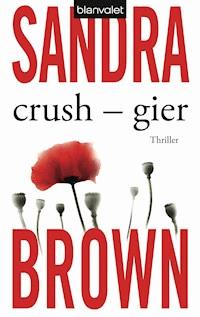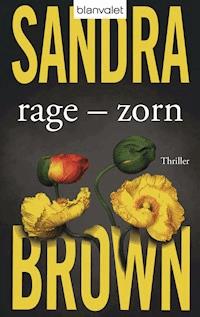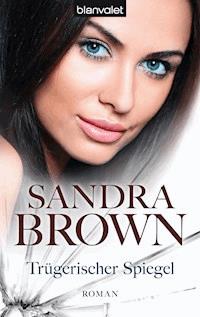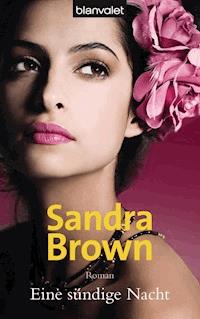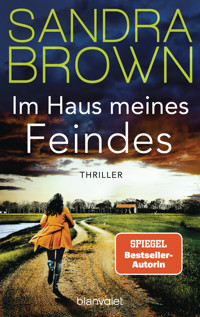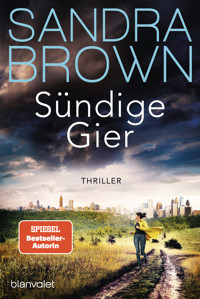
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eiskalte Spannung und heiße Gefühle – keine beherrscht sie besser als Sandra Brown
In einem Hotel in Atlanta wird der Millionär Paul Wheeler erschossen. Alles weist auf einen Raubüberfall hin. Doch seine Begleiterin Julie Rutledge ist sich sicher: Es war Mord. In Auftrag gegeben von Creighton Wheeler, Pauls Neffen und potenziellem Erben. Um zu verhindern, dass Creighton von Starverteidiger Derek Mitchell vertreten wird, beginnt sie ein perfides Spiel, dessen Kontrolle ihr schnell aus den Händen genommen wird. Denn Creighton hat Julie zur Hauptdarstellerin in seinem ganz persönlichen Drehbuch gemacht, das an Finesse und Bosheit nicht zu überbieten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ein leises »Ping« meldete die Ankunft des Aufzugs. Die Doppeltür glitt auf. In der Kabine standen drei Menschen: zwei Frauen mittleren Alters, die wie alte Freundinnen plauderten, und ein Mann in den Dreißigern, der das gestresste Gehabe eines Jungmanagers zeigte. Er trat hastig zurück, um dem Mann und der Frau Platz zu machen, die einsteigen wollten.
Sie traten mit einem freundlichen Lächeln ein und drehten sich dann zur Tür. Die fünf spiegelten sich schwach in den Messingtüren, als der Aufzug die Abwärtsfahrt zur Hotellobby fortsetzte.
Das Paar stand einvernehmlich schweigend nebeneinander. Eine der beiden Frauen hinter ihnen redete immer noch, hatte die Stimme aber höflich gedämpft. Ihre Freundin presste die Hand auf den Mund, um ein Kichern zu unterdrücken, und antwortete dann leise: »O Gott. Und sie war so stolz auf das verflixte Ding.«
Als der Aufzug langsamer wurde und das nächste Ping einen Zwischenstopp im achten Stock ankündigte, warf der junge Anzugträger einen verstohlenen Blick auf seine Uhr und verzog das Gesicht, als könnte er es kaum ertragen, dass sich die Fahrt schon wieder verzögerte.
Die Aufzugtür glitt auf.
Davor stand eine Person in einem dunkelblauen Jogging-anzug, mit einer umlaufenden, verspiegelten Sonnenbrille und einer Skimaske. Über der Mundpartie war ein Haifischmaul mit spitzen Zähnen in das Garn gesteppt.
Noch bevor die fünf im Aufzug auch nur Zeit hatten, überrascht zu reagieren, hatte die Gestalt den Handschuh in die Kabine gestreckt und mit der Faust gegen den Nottüröffner geschlagen. In der anderen Hand hielt sie eine Pistole.
»Hinknien. Sofort! Los!«
Der Befehl wurde in einem hohen Singsang erteilt und klang umso gruseliger, als er aus einem Haifischmaul kam. Die beiden Freundinnen ließen sich sofort auf die Knie fallen. Eine flehte wimmernd: »Bitte tun Sie uns nichts.«
»Schnauze! Du!« Der Haifisch schwenkte die Pistole auf den Geschäftsmann. »Auf die Knie.« Der junge Anzugträger hob die Hände und sank ebenfalls auf die Knie, sodass nur noch das Pärchen stand. »Seid ihr taub oder was? Runter!«
Die Frau sagte: »Er hat Arthritis.«
»Mir egal, selbst wenn er Lepra hat. Runter auf die Knie, verfluchte Scheiße! Sofort!«
Eine der Frauen an der Rückwand heulte: »Bitte tun Sie, was er sagt!«
Der grauhaarige Mann hielt sich an der Hand der Frau fest und ließ sich unter sichtbaren Schmerzen auf die Knie sinken. Widerstrebend folgte die Frau seinem Beispiel.
»Uhren und Ringe. Hier rein.« Der Angreifer hielt dem Geschäftsmann einen schwarzen Samtbeutel unter die Nase, damit der die Armbanduhr hineinlegte, die er eben noch so grimmig angesehen hatte.
Der Geschäftsmann reichte den Beutel an die Frauen hinter ihm weiter, die hastig ihren Schmuck hineinwarfen. »Die Ohrringe auch«, sagte der Räuber zu der einen Frau. Eilig kam sie seinem Befehl nach.
Als Letzter bekam der Herr mit den arthritischen Knien den Beutel gereicht. Er hielt ihn der Frau auf, die ebenfalls ihren Schmuck hineinfallen ließ.
»Tempo!«, befahl der Räuber mit seiner grauenvollen Mädchenstimme.
Der Herr legte seine Patek Philippe in den Beutel und hielt ihn dann dem Räuber hin, der ihn an sich riss und in die Tasche seiner Kapuzenjacke stopfte.
»Gut.« Der ältere Herr wirkte kein bisschen eingeschüchtert. »Sie haben bekommen, was Sie wollten. Jetzt lassen Sie uns in Frieden.«
Es knallte ohrenbetäubend.
Die beiden Freundinnen kreischten entsetzt auf.
Der junge Geschäftsmann fluchte fassungslos und heiser vor Schreck.
Die Frau neben dem älteren Herrn starrte in stummem Grauen auf die Blutspritzer an der Aufzugwand, die hinter dem langsam nach vorn kippenden Körper zum Vorschein kamen.
1
Creighton Wheeler stürmte über die Marmorterrasse, riss sich die Sonnenblende von der Stirn und schleuderte sie, nachdem er sich kurz mit der Hand den strömenden Schweiß vom Gesicht gewischt hatte, mitsamt dem feuchten Handtuch auf einen Liegestuhl, ohne dabei auch nur langsamer zu werden. »Wehe, es ist nicht wirklich wichtig. Ich war gerade dabei, ihm den Aufschlag abzunehmen.«
Die Haushälterin, die ihn vom Tenniscourt hereingerufen hatte, zeigte sich wenig beeindruckt von seinem Wutanfall. »Nicht in diesem Ton. Ihr Daddy möchte Sie sehen.«
Sie hieß Ruby. Ihren Nachnamen kannte Creighton nicht und hatte nie danach gefragt, obwohl sie schon vor seiner Geburt für seine Familie gearbeitet hatte. Wenn er mit ihr aneinandergeriet, rief sie ihm immer ins Gedächtnis, dass sie ihm schon den Hintern und die Nase geputzt hatte, dass beides nicht besonders angenehm gewesen war und dass sie es nicht besonders gern getan hatte. Dass sie einmal so vertraut mit seinem Körper war, auch wenn er damals noch ein Baby gewesen war, ärgerte ihn.
Er zwängte sich an ihrem Hundert-Kilo-Rumpf vorbei, durchquerte die Küche, mit der man ein Restaurant betreiben konnte, trat an einen der Kühlschränke und zog die Tür auf.
»Sofort, hat er gesagt.«
Ohne sie einer Antwort zu würdigen, holte Creighton eine Dose Cola aus dem Kühlfach, riss die Lasche auf und nahm einen langen, tiefen Zug. Dann rollte er die kalte Dose über seine Stirn. »Bring Scott auch eine davon.«
»Ihr Tennistrainer sitzt nicht im Rollstuhl.« Sie drehte sich wieder zur Küchentheke und klatschte mit der bloßen Hand auf den Rinderbraten, den sie gerade für den Bräter vorbereitete.
Jemand sollte ihr endlich mal diese Flausen austreiben, dachte Creighton, während er sich durch die Schwingtür schob und auf den Weg zur Vorderseite des Hauses machte, wo das Arbeitszimmer seines Vaters lag. Die Tür war nur angelehnt. Er blieb kurz davor stehen, klopfte einmal mit der Coladose gegen den Türstock, drückte den Türflügel dann auf und spazierte, den Tennisschläger über der Schulter zwirbelnd, ins Zimmer. Er sah vom Scheitel bis zur Sohle aus wie ein Aristokrat, den man von der täglichen Leibesertüchtigung weggerufen hatte. Diese Rolle war ihm auf den Leib geschneidert.
Doug Wheeler saß hinter seinem Schreibtisch, der von der Größe her dem Präsidenten angestanden hätte, aber viel protziger wirkte als alles, was im Oval Office zu finden war. Der Schreibtisch wurde von zwei Flaggenständern aus Mahagoni flankiert, die mit der Staatsflagge von Georgia beziehungsweise der Flagge der Vereinigten Staaten geschmückt waren. An beiden Seitenwänden starrten die Ölporträts von finster blickenden Vorfahren von der fleckigen Zypressenvertäfelung, die wahrscheinlich bis zum Jüngsten Gericht halten würden.
»Scott lässt sich jede Minute bezahlen, und die Uhr läuft«, sagte Creighton zur Begrüßung.
»Das hier kann leider nicht warten. Setz dich.«
Creighton ließ sich in einen der Ziegenledersessel vor dem Schreibtisch seines Vaters fallen und lehnte den Tennisschläger dagegen. »Ich wusste gar nicht, dass du zu Hause bist. Bist du heute Nachmittag nicht zum Golfen verabredet?« Er beugte sich vor und stellte die Coladose auf die polierte Schreibtischfläche.
Stirnrunzelnd schob Doug einen Untersetzer unter die Dose, damit kein Ring zurückblieb. »Ich bin nur kurz vorbeigekommen, um mich umzuziehen, bevor ich zum Club fahre«, erklärte er. »Aber dann ist etwas Wichtiges …«
»Sag nichts«, fiel Creighton ihm ins Wort. »Bei der Prüfung des Etats für Heftklammern hat sich herausgestellt, dass Geld veruntreut wurde. Diese raffinierten Sekretärinnen.«
»Paul ist tot.«
Creightons Herz setzte einen Schlag aus. Sein Lächeln fiel in sich zusammen. »Was?«
Doug räusperte sich. »Dein Onkel wurde vor einer Stunde im Hotel Moultrie erschossen.«
Creighton starrte seinen Vater wortlos an, bis er schließlich tief Luft holte. »Also, in den unsterblichen Worten von Forrest Gump oder genauer gesagt seiner Mutter: ›Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. ‹«
Sein Vater sprang auf. »Ist das alles, was dir dazu einfällt?«
»Ich finde, das trifft es ziemlich gut.«
Creighton hatte seinen Vater noch nie weinen sehen. Auch jetzt weinte er nicht, aber seine Augen wirkten gefährlich feucht, und er schluckte viel zu oft und zu schwer. Um zu vertuschen, dass seine Gefühle ihn zu übermannen drohten, trat er hinter dem Schreibtisch hervor und stellte sich an das Panoramafenster. Er blickte hinaus in den Garten, wo mexikanische Hilfsarbeiter tief gebückt das Unkraut aus den bunten Blumenbeeten zupften.
Deutlich leiser fragte Creighton: »Habe ich dich richtig verstanden, Vater? Onkel Paul wurde erschossen?«
»Mitten in die Stirn. Aus nächster Nähe. Offenbar bei einem Überfall.«
»Einem Überfall? Er wurde beraubt? Im Moultrie?«
»So unglaublich sich das anhört.«
Das Haar, das Doug mit seiner Hand durchkämmte, war genauso dicht und grau wie das seines Bruders – nunmehr verstorbenen Bruders –, der nur elf Monate älter gewesen war als er. Er und Paul gingen zum selben Friseur und zum selben Schneider. Weil sie annähernd gleich groß und gleich schwer waren, wurden sie von hinten oft verwechselt. Sie waren sich fast so vertraut gewesen wie Zwillinge.
»Genaueres weiß ich auch nicht«, fuhr Doug fort. »Julie war zu aufgewühlt, um viel zu sagen.«
»Sie wurde als Erste benachrichtigt?«
»Sie war dabei, als es passierte.«
»Im Hotel Moultrie. Am helllichten Tag.«
Doug drehte sich um und sah seinen Sohn streng an. »Sie war völlig außer sich. Sagte jedenfalls der Polizist. Ein Detective. Sie konnte nicht weitersprechen, darum übernahm er das Telefon. Er sagte, sie hätte darauf bestanden, mich persönlich anzurufen und zu benachrichtigen. Aber sie bekam nur ein paar unzusammenhängende Worte heraus, dann begann sie so zu weinen, dass ich nichts mehr verstand.« Er räusperte sich.
»Der Detective, ich glaube, er hieß Sanford, war sehr einfühlsam. Er sprach mir sein Beileid aus und sagte, ich könnte ins Leichenschauhaus kommen, wenn ich … wenn ich Pauls Leichnam sehen wollte. Natürlich werden sie ihn obduzieren.«
Creighton wandte das Gesicht ab. »Jesus.«
»Genau.« Doug seufzte schwer. »Ich kann es auch noch nicht glauben.«
»Haben sie den Typen geschnappt, der das getan hat?«
»Noch nicht.«
»Wo im Hotel ist es passiert?«
»Das hat der Detective nicht gesagt.«
»In einem der Läden?«
»Ich weiß nicht.«
»Wer raubt denn schon …«
»Ich weiß es nicht«, fuhr Doug ihn an.
Angespanntes Schweigen machte sich breit. Doug sackte zusammen. »Entschuldige, Creighton. Ich … ich bin nicht ich selbst.«
»Das kann ich verstehen. Es ist auch kaum zu glauben.«
Doug massierte seine Stirn. »Der Detective meinte, er würde mir alles erklären, wenn ich erst dort bin.« Er sah auf die offene Tür, machte aber keine Anstalten, aufzustehen und zu gehen, so als wollte er diesen Gang so lang wie möglich hinauszögern.
»Was ist mit Mutter? Weiß sie schon Bescheid?«
»Sie war hier, als Julie anrief. Natürlich ist sie außer sich, aber sie muss jetzt alles organisieren. Sie ist gerade oben und macht die ersten Anrufe.« Doug trat an die Bar und schenkte sich einen Bourbon ein. »Auch einen?«
»Nein danke.«
Doug leerte sein Glas in einem Zug und griff ein zweites Mal nach der Karaffe. »So schwer diese Tragödie auch zu begreifen ist, es gibt praktische Probleme, die wir angehen müssen.«
Creighton wappnete sich. Er verabscheute alles, was mit dem Wort praktisch verbunden war.
»Ich möchte, dass du morgen früh in die Zentrale fährst und die Belegschaft persönlich informierst.«
Creighton stöhnte innerlich auf. Er wollte so wenig wie möglich mit ihrer Belegschaft zu tun haben, einem Stamm von mehreren Hundert Mitarbeitern, die allesamt große Stücke auf seinen Onkel Paul hielten, wohingegen er meistens ignoriert wurde, wenn er die Firmenzentrale mit seiner Anwesenheit beehrte, was er so selten wie möglich tat.
Wheeler Enterprises produzierte und vertrieb irgendwelche Baustoffe. Wow. Wie aufregend.
Sein Vater sah ihn über die Schulter an. Offenbar wartete er auf eine Antwort.
»Natürlich. Was soll ich ihnen sagen?«
»Ich werde noch heute Abend etwas aufsetzen. Wir berufen für zehn Uhr eine Personalversammlung im großen Saal ein. Du hältst deine Rede, danach wäre vielleicht eine Schweigeminute angebracht.«
Creighton nickte ernst. »Sehr würdevoll.«
Doug kippte den zweiten Drink hinunter und stellte das Glas entschlossen auf die Bar zurück. »Du wirst mehr Aufgaben übernehmen müssen, bis wir alles geklärt haben.«
»Was alles?«
»Das mit der Beerdigung zum Beispiel.«
»Ach, natürlich. Das wird ein richtiger Staatsakt.«
»Bestimmt.« Doug seufzte. »Ich werde darauf achten, dass es so würdig wie möglich abläuft, aber dein Onkel hatte seine Finger …«
»Überall drin. Er war der ungekrönte König von Atlanta.«
Doug ließ sich nicht aus dem Takt bringen. »Genau, und jetzt ist der König tot. Nicht nur das, sondern er wurde umgebracht.« Bei dem Gedanken, dass sein Bruder brutal ermordet worden war, verzog er das Gesicht und fuhr sich müde mit der Hand übers Gesicht. »Jesus.« Sein Blick wanderte zur Bar, als würde er mit dem Gedanken spielen, sich noch ein Glas zu genehmigen, aber er tat es nicht. »Wir müssen die Polizei nach besten Kräften unterstützen.«
»Aber wie? Wir waren nicht dabei.«
»Trotzdem muss Pauls Mörder gefasst werden. Du wirst dazu beitragen, und zwar bereitwillig. Haben wir uns verstanden?«
»Natürlich, Vater.« Creighton zögerte und sagte dann: »Obwohl ich hoffe, dass du die Rolle des Familiensprechers übernimmst. Die Reporter werden über uns herfallen wie die Aasgeier.«
Doug nickte knapp. »Ich werde dafür sorgen, dass sie dich und deine Mutter in Frieden lassen. Natürlich werden wir ihn nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigen können, trotzdem werde ich darauf bestehen, dass die Trauerfeier so würdevoll wie möglich abläuft.
Wir müssen unseren Angestellten ein Vorbild sein und die Firma am Laufen halten, denn das hätte auch Paul gewollt. Darum möchte ich, dass du dich vorbereitest. Ich habe dir alle nötigen Unterlagen zusammenstellen lassen und in dein Zimmer gelegt. Du solltest sie heute Abend durchsehen und dich über unsere neuesten Produkte, unsere Marktposition und die Geschäftsziele fürs nächste Jahr informieren.«
»In Ordnung.« Vergiss es.
Sein Vater schien seine Gedanken zu lesen. Er fixierte ihn mit einem eisenharten Adlerblick. »Das ist das Mindeste, was du tun kannst, Creighton. Du wirst bald dreißig. Ich war zu nachsichtig mit dir und bin daher mitverantwortlich dafür, dass du dich so wenig für die Firma interessierst. Ich hätte dir mehr Verantwortung übertragen, dich mehr in unser expandierendes Geschäft einbinden sollen. Paul …« Er stockte bei dem Namen. »Paul hat mich immer dazu angehalten. Stattdessen habe ich dich gewähren lassen. Damit ist jetzt Schluss. Es ist an der Zeit, dass du dich deiner Aufgabe stellst. Jetzt, wo Paul tot ist, wirst du das Kommando übernehmen müssen, wenn ich mich eines Tages zur Ruhe setze.«
Wem wollte er etwas vormachen? Vielleicht sich selbst, aber Creighton ließ sich nicht täuschen. Sein Vater war völlig realitätsfern, wenn er glaubte, dass Creighton bereitwillig in seine unternehmerischen Fußstapfen treten würde. Er hatte keinen blassen Schimmer vom Geschäft und wollte auch nichts darüber lernen. Das Einzige, was ihn an diesem Unternehmen interessierte, war das Einkommen, das er daraus bezog. Er liebte sein Leben so, wie es war, und hatte nicht die Absicht, etwas daran zu ändern, indem er irgendeine Position übernahm, die genauso gut irgendein Wasserträger ausfüllen konnte.
Aber dies war nicht der Zeitpunkt, um ein weiteres Mal jenes Kammerspiel aufzuführen, das er und sein Vater schon tausendmal gegeben hatten und in dem ihm seine persönlichen Fehler sowie seine falsch gesetzten Prioritäten vorgehalten wurden, bevor an sein Pflichtgefühl und an seine Verantwortung als Erwachsener, als Mann und als Wheeler appelliert wurde. Der ganze Bockmist.
Um das Thema zu wechseln, fragte er: »Bringen sie es schon in den Nachrichten?«
»Wenn jetzt noch nicht, dann sicher bald.« Doug kehrte an den Schreibtisch zurück, griff nach einem Blatt und reichte es Creighton. »Würdest du bitte die Liste abtelefonieren und alle darauf benachrichtigen? Sie haben es verdient, dass ihnen ein Mitglied der Familie persönlich Bescheid gibt und sie es nicht aus dem Fernsehen erfahren.«
Creighton überflog die ausgedruckte Liste und erkannte in den meisten Namen enge persönliche Freunde seines Onkels Paul, wichtige Aktionäre von Wheeler Enterprises, Vertreter von Stadt und Staat und andere prominente Geschäftsleute.
»Und würdest du auch mit Ruby sprechen?«, bat Doug. »Sie weiß, dass etwas im Busch ist, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihr die Wahrheit zu sagen, vor allem unter diesen grässlichen Umständen. Du weißt, wie sehr sie Paul geliebt und bewundert hat.«
»Ja, mache ich.« Mit Vergnügen, dachte Creighton. Das war eine Möglichkeit, ihr die vielen Frechheiten heimzuzahlen. »Soll ich mit dir ins Leichenschauhaus fahren?«
»Danke, aber nein«, lehnte Doug ab. »Das kann ich nicht von dir verlangen.«
»Gut. Ich könnte mir tatsächlich kaum was Schlimmeres vorstellen.« Creighton tat so, als müsste er kurz überlegen, und schüttelte sich dann. »Außer vielleicht einer Seniorenkreuzfahrt.«
2
Julie?«
Sie hatte ins Leere gestarrt, ohne die klingelnden Telefone wahrzunehmen, die Hektik um sie herum, die vorbeihastenden Menschen und die neugierigen Blicke, die man ihr zuwarf. Als sie ihren Namen hörte, drehte sie sich um und stand auf, um den Mann zu begrüßen, der auf sie zukam. »Doug.«
Die Blutflecken auf ihrer Kleidung ließen Pauls Bruder kurz innehalten, tiefe Trauer kerbte sich in sein Gesicht. Sie hatte Gesicht, Hals, Arme und Hände mit der stark duftenden Desinfektionsseife auf der Damentoilette in der Polizeistation abgeschrubbt, aber sie hatte noch keine Gelegenheit gehabt, nach Hause zu fahren und sich umzuziehen.
Paul zuliebe hatten Doug und sie sich immer umeinander bemüht, trotzdem waren sie nie warm miteinander geworden. Doch jetzt fühlte sie bedingungslos mit ihm. Sie sah, dass es ihn schockierte, das Blut seines Bruders an ihren Kleidern zu sehen. Es war der unübersehbare Beweis dafür, wie brutal Paul aus dem Leben gerissen worden war.
Sie ging auf ihn zu, aber er war derjenige, der die Arme ausbreitete und sie umarmte. Verlegen. Trotzdem auf Abstand bedacht. So wie typischerweise ein Mann die Freundin seines Bruders umarmt.
»Es tut mir so leid, Doug«, flüsterte sie. »Du hast ihn geliebt. Er hat dich geliebt. Das muss entsetzlich für dich sein.«
Er ließ sie los. In seinen Augen glänzten Tränen, aber er hielt sich standhaft, so wie sie es von ihm erwartet hatte. »Wie geht es dir?«, fragte er dann. »Bist du verletzt?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er betrachtete sie prüfend und rieb sich dann mit beiden Händen übers Gesicht, als wollte er den Anblick der Blutflecken auf ihren Kleidern ausradieren.
Die beiden Detectives, die sich Julie vorgestellt hatten, gleich nachdem sie am Tatort eingetroffen waren, hielten sich diskret im Hintergrund, um ihr und Doug ein paar ungestörte Momente zu lassen.
Detective Homer Sanford war ein großer, breitschultriger Schwarzer, dem das Alter, Julies Schätzung nach knapp über vierzig, lediglich an einem kleinen Bäuchlein anzusehen war. Er wirkte wie ein ehemaliger Footballspieler.
Äußerlich war seine Partnerin das genaue Gegenteil. Detective Roberta Kimball war gerade mal einen Meter fünfzig groß und versuchte vergeblich, den zehn Kilo schweren Reifen um ihre Hüften zu verbergen, indem sie einen weit geschnittenen schwarzen Blazer über der grauen, straff um die Schenkel spannenden Stoffhose trug.
Auf den Notruf hin war im Hotel Moultrie zuerst eine Streife aus dem zuständigen Polizeirevier von Buckhead eingetroffen. Die Streifenbeamten hatten dann umgehend ein Spurensicherungskommando angefordert, das gemeinsam mit zwei Ermittlern vom Morddezernat angekommen war.
Julie hatte den Eindruck, dass Sanford und Kimball ausgesprochen professionell und umsichtig arbeiteten. Am Tatort hatten die beiden sie mit Glacéhandschuhen angefasst und sich immer wieder entschuldigt, dass sie schon jetzt die Ermittlungen aufnehmen und ihr Fragen stellen müssten, obwohl Julie nach dem Verbrechen, das Paul das Leben gekostet hatte, bestimmt noch unter Schock stand.
Jetzt wandte sich Kimball behutsam an Doug: »Brauchen Sie noch ein paar Minuten, bevor wir anfangen, Mr Wheeler?«
»Nein, es geht schon.« Die Antwort kam ein bisschen zu forsch, so als würde er sich selbst Mut zusprechen wollen.
Die Detectives hatten ihn direkt vom Leichenschauhaus hierhergefahren. Allen dreien haftete ein unverkennbarer Geruch an. Julie fröstelte nach ihrem Besuch in dieser freudlosen Gruft immer noch.
»Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn Mr Wheeler zuhört, während wir noch einmal Ihre Aussage durchgehen«, sagte Sanford.
»Gar nicht.« Irgendwann würde Doug ohnehin von ihr hören wollen, was sich eigentlich zugetragen hatte. Warum nicht gleich jetzt?
Sie betraten das Morddezernat, und Sanford führte sie in einen winzigen, von Stellwänden abgetrennten Arbeitsbereich, der offenbar sein Reich war. Julie hatte richtig getippt. An einer Wand hing ein Foto, auf dem er, einen Football unter den Arm geklemmt, in einem Bulldogs-Trikot und mit verkratztem Helm in die Endzone hechtete. Auf anderen Fotos waren drei lächelnde Kinder und eine hübsche Frau zu sehen. Er trug einen Ehering. Roberta Kimball nicht.
Sanford zog für Julie einen Stuhl heraus. »Ms Rutledge.« Sie setzte sich. Dann brachte er Doug einen zweiten Stuhl. Kimball behauptete, sie würde lieber stehen. Sanford setzte sich hinter den Schreibtisch und griff nach einem Ordner, auf dem das aktuelle Datum, Pauls Name und ein Aktenzeichen standen. Er war erst vor knapp fünf Stunden gestorben, und schon war er zu einer Nummer geworden.
Sanford wandte sich an Julie. »Die anderen Zeugen haben inzwischen auch ausgesagt. Ihre vorhin aufgezeichnete Aussage wurde währenddessen niedergeschrieben. Bevor Sie die Niederschrift unterzeichnen, möchte ich alles noch einmal mit Ihnen zusammen durchgehen, um zu sehen, ob Ihnen noch etwas einfällt, ob Sie etwas hinzufügen oder ändern wollen.«
Julie nickte. Sie verschränkte die Arme und umklammerte ihre Ellbogen.
Kimball bemerkte die Geste und sagte: »Wir wissen, wie schwer das für Sie sein muss.«
»Das ist es allerdings. Aber ich möchte helfen. Ich möchte, dass der Täter gefasst wird.«
»Wir auch.« Sanford nahm einen Kugelschreiber und klickte mehrmals damit, während er die oberste Seite in seinem Ordner überflog. »Vor dem Vorfall waren Sie zusammen mit Mr Wheeler in Zimmer Nummer 901? Das ist die Suite an der Ecke, korrekt?«
»Genau.«
Die Detectives sahen sie fragend an. Doug starrte auf seine Schuhe.
»Ich habe mich dort um halb zwei mit Paul getroffen«, sagte Julie.
»Sie sind direkt in die Suite gegangen. Sie haben nicht erst eingecheckt.«
»Das hatte Paul schon erledigt. Ich hatte mich um ein paar Minuten verspätet. Als ich ins Hotel kam, war er schon in der Suite.«
Der Detective und seine Partnerin tauschten schweigend einen kurzen Blick, dann sah Sanford wieder auf sein Blatt. Julie glaubte nicht, dass er davon ablas. Sie war überzeugt, dass er auf die Unterlagen verzichten konnte. Inzwischen wusste er bestimmt schon, dass Paul und sie diese Suite für jeden Dienstag reserviert hatten, sommers wie winters, zweiundfünfzig Wochen im Jahr. Sie würde sich nicht zu diesem Arrangement äußern. Das tat hier nichts zur Sache.
»Sie haben das Mittagessen beim Zimmerservice bestellt«, sagte Sanford.
Woraufhin Kimball erklärend hinzufügte: »Das wissen wir von der Hotelbelegschaft.«
Das hieß sicher, sie wussten auch, was sie und Paul gegessen hatten. Und sie wussten bestimmt auch, dass Paul heute Champagner bestellt hatte. Was würden sie daraus ableiten? Solange die beiden diesen Punkt nicht ansprachen, würde sie bestimmt nicht darauf eingehen.
Sanford fragte: »Abgesehen von dem Zimmerkellner hat niemand Sie in der Suite gesehen?«
»Nein.«
»Sie waren die ganze Zeit allein?«
»Ja.«
Nach einer vielsagenden und peinlichen Pause fuhr Sanford fort: »Sie haben vorhin ausgesagt, dass Sie die Suite gegen fünfzehn Uhr verlassen haben.«
»Ich hatte um vier Uhr einen Termin.«
»In Ihrer Galerie?«
»Genau.«
»Der Notruf ging um fünfzehn Uhr sechzehn ein«, sagte Sanford.
Als wollte sie seinen Satz vervollständigen, ergänzte Kimball: »Folglich muss sich der Raubüberfall ein paar Minuten zuvor ereignet haben.«
»Dann war es wohl kurz nach drei, als wir die Suite verlassen haben«, sagte Julie. »Weil wir von der Suite aus direkt zum Aufzug gingen und dort nicht lange warten mussten.«
Offenbar dauerte Doug die Diskussion über den genauen Zeitablauf zu lang, denn er meldete sich zu Wort: »Der Mörder konnte entkommen?«
»Genau das versuchen wir gerade herauszufinden, Mr Wheeler«, antwortete Sanford. »Wir sind dabei, alle Hotelgäste zu befragen. Und alle Angestellten.«
»Mit dieser grässlichen Maske konnte er unmöglich durchs Hotel spazieren«, sagte Julie.
»Wir vermuten, dass er sie sofort entsorgt hat«, sagte Kimball. »Aber obwohl wir das Hotel gründlich durchsucht haben, konnten wir bis jetzt nichts finden. Weder den Jogginganzug noch die Maske …«
»Gar nichts«, beendete Sanford den Satz für sie.
»In einem so großen Hotel wie dem Moultrie gibt es unzählige Verstecke«, sagte Doug.
»Die Suche ist noch nicht abgeschlossen«, bestätigte Sanford. »Wir durchsuchen auch die Müllschlucker, Belüftungsschächte, Abflüsse, einfach jeden Fleck, an dem er die Sachen verstaut haben könnte, falls er sie mit nach draußen genommen hat.«
»Er ist einfach aus dem Hotel spaziert?«, fragte Doug fassungslos.
Kimball schien das nur ungern zuzugeben, aber dann sagte sie: »Die Möglichkeit besteht.«
Doug fluchte leise.
Sanford klickte wieder mit dem Stift und vertiefte sich in sein Material. »Gehen wir noch einmal zurück.« Er sah Julie an. »Als Sie die Suite verließen, war niemand auf dem Gang?«
»Nein.«
»Kein Zimmermädchen, kein Kellner …«
»Niemand.« Sie rief sich ihren Weg zum Aufzug ins Gedächtnis. Paul hatte den Arm über ihre Schulter gelegt. Er hatte so schützend gewirkt. Stark, warm, voller Leben. So ganz anders als die Gestalt unter dem Laken im Leichenschauhaus. Er hatte sie gefragt, ob sie glücklich sei, und sie hatte Ja gesagt.
Kimball fragte: »Haben Sie mit jemandem gesprochen, als Sie in den Aufzug stiegen?«
»Nein.«
»Mr Wheeler auch nicht?«
»Nein.«
»Glauben Sie, dass jemand Sie oder ihn erkannt hat?«
»Nein.«
»Niemand hat Sie beide angesprochen? Oder irgendwie Kenntnis von Ihnen genommen?«
»Eigentlich nicht. Die beiden Frauen unterhielten sich und beachteten uns überhaupt nicht. Der junge Mann sagte nichts, aber er machte höflich Platz, damit wir in den Lift steigen konnten. Er schien mit den Gedanken woanders zu sein.«
»Er kommt aus Kalifornien und hatte um fünfzehn Uhr dreißig ein Vorstellungsgespräch. Er hatte Angst, dass er es nicht rechtzeitig schaffen würde«, erläuterte Kimball. »Wir haben das überprüft.«
»Die beiden Frauen stammen aus Nashville«, sagte Sanford. »Sie sind in Atlanta, weil ihre Nichte am Wochenende heiratet.«
»Das muss schrecklich für sie sein«, murmelte Julie.
Mit Sicherheit war jeder in diesem Aufzug traumatisiert. Aber im Unterschied zu ihr hatten die drei niemanden verloren. Abgesehen von dieser kurzen Fahrt im Lift verband sie nichts mit Paul Wheeler. Er war für sie nur ein Name, ein zu bedauerndes Mordopfer. Bestimmt würde der Vorfall Spuren hinterlassen, und sie würden sich bei jeder einzelnen Liftfahrt daran erinnern, aber er hatte in ihrem Leben kein Vakuum hinterlassen. Für sie hatte sein Tod keine irreparablen Konsequenzen.
Sanford ließ den Stift auf den Tisch fallen. »Warum schildern Sie von diesem Punkt an nicht alles noch einmal? Damit wäre Mr Wheeler geholfen und uns ebenfalls.« Er faltete die langen Finger und legte sie abwartend auf die Gürtelschnalle.
Kimball lehnte sich an die Schreibtischecke. Doug hatte eine Hand um Kinn und Mund geschlossen und sah Julie aufmerksam an.
Sie erzählte, wie sie eine Etage abwärts gefahren waren zum achten Stock, wie dort die Tür aufgegangen war, wie der Räuber in den Aufzug gefasst und den Knopf zum Öffnen der Tür in Notfällen gedrückt hatte.
»Ihr erster Eindruck?«, fragte Kimball.
»Die Maske. Das Haifischmaul.«
»Sein Gesicht konnten Sie nicht erkennen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es waren weder Haut noch Haare zu sehen. Nicht einmal die Handgelenke. Er hatte die Ärmel des Jogginganzugs über die Handschuhe gezogen. Die Maske steckte im Kragen seiner Kapuzenjacke, die er bis unters Kinn zugezogen hatte.«
»Größe, Gewicht?«
»Größer als ich, aber nicht viel. Gewicht durchschnittlich.« Die Detectives nickten, als hätten die anderen Zeugen den Täter genauso beschrieben.
Sanford sagte: »In den nächsten ein, zwei Tagen möchten wir Ihnen ein paar Bandaufnahmen vorspielen, die bei anderen Verbrechen gemacht wurden. Vielleicht erkennen Sie die Stimme wieder.«
Bei dem bloßen Gedanken an die gespenstische Stimme stellten sich die Härchen auf Julies Armen auf. »Sie war wirklich schrecklich.«
»Eine der Zeuginnen meinte, wie Fingernägel auf einer Schiefertafel.«
»Schlimmer. Viel beängstigender.«
Plötzlich tauchte verstörend real die umlaufende Sonnenbrille vor ihren Augen auf. »Die Brille war ganz dunkel, sein Blick war schwarz und undurchdringlich wie der eines Haifischs. Trotzdem konnte ich spüren, dass er mich ansah.«
Sanford beugte sich leicht nach vorn. »Woher wissen Sie, dass er Sie ansah, wenn Sie seine Augen nicht sehen konnten?«
»Ich weiß es einfach.«
Ein paar Sekunden schwiegen alle, bis Kimball auffordernd bemerkte: »Dann befahl er, dass sich alle hinknien sollten.«
Ohne noch einmal unterbrochen zu werden, erzählte sie weiter, bis sie zu dem Moment kam, in dem Paul den Räuber angesprochen hatte. »Er sagte: ›Gut. Sie haben bekommen, was Sie wollten. Jetzt lassen Sie uns in Frieden.‹ Ich hörte ihm an, dass er eher wütend als eingeschüchtert war.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Doug.
»Ich drehte mich zu ihm um und wollte ihn bitten, den Dieb nicht zu provozieren. Und in diesem Augenblick …«
Unfreiwillig und unerwartet stieg ein Schluchzen aus ihrer Kehle auf und raubte ihr die Stimme. Sie senkte den Kopf und drückte die Hand auf die Augen, um auszublenden, wie die Kugel in Pauls Kopf eingeschlagen war.
Niemand sagte etwas, die Stille wurde nur vom Ticken einer Armbanduhr durchbrochen. Doch das war Mahnung genug. Julie senkte die Hand wieder. »Warum wollte er nur den Schmuck und die Armbanduhren? Warum keine Geldbörsen? Wäre das nicht viel praktischer gewesen? Schmuck muss verkauft oder versetzt werden, in einer Börse stecken Geld und Kreditkarten.«
»Vielleicht wollte er möglichst wenig Ballast mit sich herumtragen«, sagte Kimball. »Er wollte sich nicht mit Portemonnaies oder Handtaschen belasten, die er erst durchsuchen und dann entsorgen musste, bevor er das Hotel verlassen konnte.«
»Was hat er getan, nachdem er Paul erschossen hatte? Wo ist er hingegangen?«, fragte Doug.
»Das weiß ich nicht mehr«, erwiderte Julie. »Ich war … nach dem Schuss weiß ich praktisch nichts mehr.«
Sanford sagte: »Die anderen drei im Aufzug waren ebenfalls zu geschockt, um mitzubekommen, wohin er lief, Mr Wheeler. Der junge Mann meint, bis er sich wieder halbwegs gefasst hatte, sei der Schütze verschwunden gewesen. Er drückte noch einmal auf den Knopf fürs Erdgeschoss. Er wusste nicht, was er sonst tun sollte.«
»Er hätte versuchen können, den Mann zu verfolgen.«
»Das kannst du ihm nicht vorwerfen, Doug«, ermahnte Julie ihn leise. »Er war bestimmt völlig verängstigt. Er hatte eben zusehen müssen, wie Paul in den Kopf geschossen wurde.«
Wieder sagte länger niemand ein Wort. Sanford klickte mit dem Kugelschreiber. »Also, wenn Sie sich an sonst nichts erinnern …«
»Doch«, bemerkte Julie plötzlich. »Er hatte keine Schuhe an. Ist das noch jemandem außer mir aufgefallen?«
»Einer der Frauen aus Nashville«, bestätigte Sanford. »Sie sagte, er sei in Socken gewesen.«
»Auch das ist nur eine Vermutung«, sagte Kimball, »aber wahrscheinlich wusste er, dass Schuhe, vor allem Sportschuhe, Abdrücke hinterlassen, die sich später abnehmen lassen.«
»Hat er denn Fußabdrücke hinterlassen?«, wollte Julie wissen.
»Unsere Spurensicherung hat keine gefunden. Nein.«
Doug atmete seufzend aus. »Anscheinend hat er an alles gedacht.«
»Nicht an alles, Mr Wheeler«, widersprach Sanford. »Es gibt kein perfektes Verbrechen. Ich bin zuversichtlich, dass wir ihn kriegen.«
Kimball bekräftigte die optimistische Prognose ihres Partners. »Verlassen Sie sich darauf.«
Sanford wartete ab, ob noch jemand etwas sagen wollte, und meinte dann: »Das wäre dann vorerst alles, Ms Rutledge. Würden Sie Ihre Aussage jetzt unterschreiben?«
Sie tat es, ohne zu zögern, dann führten die beiden Detectives sie und Doug hinaus. Als sie durch den Korridor zum Aufzug gingen, nahm Kimball ihren Arm. »Möchten Sie vielleicht lieber die Treppe nehmen, Ms Rutledge?«
Julie war dankbar für ihre Einfühlsamkeit. »Danke, aber nein. Es geht schon.«
Sanford erklärte Doug eben, dass er benachrichtigt würde, sobald der Gerichtsmediziner mit seiner Arbeit fertig war und der Leichnam für die Beerdigung an die Familie übergeben werden konnte.
»Ich würde gern so schnell wie möglich wissen, wann das sein wird«, sagte Doug. »Wir müssen eine Menge organisieren.«
»Natürlich. Wir würden uns gern auch mit den anderen Familienmitgliedern unterhalten. Ihrer Frau. Ihrem Sohn. Am liebsten morgen.«
Doug blieb stehen und sah ihn an. »Wieso das?«
»Routine. Falls Ihr Bruder Feinde hatte…«
»Hatte er aber nicht. Alle liebten Paul.«
»Bestimmt. Trotzdem könnte jemand aus seiner Umgebung etwas wissen, von dem er nicht ahnt, dass es relevant ist.«
»Wie sollte irgendjemand etwas wissen? Das war ein zufälliger Raubüberfall.«
Sanford sah kurz Kimball und dann wieder Doug an. »Im Moment gehen wir davon aus. Trotzdem müssen wir alle Möglichkeiten in Betracht ziehen.«
Doug schien schon etwas darauf erwidern zu wollen, entschied sich dann aber dagegen. Er sagte: »Ich versichere Ihnen, dass Julie und ich, dass meine ganze Familie alles tun wird, um Ihnen bei den Ermittlungen zu helfen.«
»Sie müssen eine Tragödie durchmachen, und Sie trauern, Mr Wheeler. Wir stören Sie in Ihrer Trauer. Das weiß ich, und es tut uns leid.« Trotz der Entschuldigung erklärte Sanford Doug, dass er am nächsten Vormittag anrufen würde, um ein Treffen zu vereinbaren. »Ms Rutledge«, wandte er sich an Julie. »Vielleicht werden wir uns bei Ihnen auch noch einmal melden.«
»Ich habe Ms Kimball meine Adresse und Telefonnummer gegeben. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, wann immer Sie mich brauchen.«
Falls sie die Nacht überlebte, dachte sie. Sie war so erschöpft, dass sie sich kaum noch bewegen konnte, trotzdem erschreckte sie die Aussicht, nach Hause zu fahren, ins Bett zu kriechen und die Lichter auszumachen. Wie sollte sie je wieder Schlaf finden, wo sich die Erinnerung an Pauls grauenvollen Tod so unauslöschlich in ihr Gedächtnis geätzt hatte?
Als hätte Kimball ihre Gedanken gelesen, fragte sie, ob sie jemanden hatte, der bei ihr blieb. Julie schüttelte den Kopf. »Wir könnten eine Polizistin …«
»Nein danke«, fiel Julie ihr ins Wort. »Ehrlich gesagt wäre ich lieber allein.«
Roberta Kimball nickte verständnisvoll.
Der Aufzug kam. Julies Herz krampfte sich zusammen, trotzdem trat sie in die Kabine und drehte sich um. Doug stellte sich neben sie. Sanford sah sie nacheinander mitfühlend an. »Ich möchte Ihnen noch einmal mein aufrichtiges Beileid aussprechen.«
»Ich auch«, ergänzte Kimball.
Dann glitt die Tür zu, und Julie war mit Doug alleine. Sie sagte: »Ich werde mich so weit wie möglich zurücknehmen, um der Familie Unannehmlichkeiten zu ersparen.« Sie hoffte, er würde ihr widersprechen. Er tat es nicht. »Ich habe nur eine Bitte, Doug. Erlaubst du mir, den Blumenschmuck für Pauls Sarg auszuwählen?« Ihr wurde die Kehle eng, doch sie weigerte sich, vor ihm zu weinen. Ihr Blick blieb fest auf die Fuge in der Aufzugtür gerichtet, der Kopf blieb hoch erhoben, der Rücken durchgestreckt. »Bitte.«
»Natürlich, Julie.«
»Danke.«
Er schluckte geräuschvoll, und sie sah aus den Augenwinkeln, dass er still weinte und die Schultern unter den lautlosen Schluchzern bebten. Instinktiv wollte sie ihm eine tröstende Hand reichen, ihm ihr Mitgefühl zeigen. Aber weil sie nicht wusste, wie er reagieren würde, ließ sie es.
»Ich kann es immer noch nicht glauben«, flüsterte er heiser.
»Ich auch nicht.«
»Er ist wirklich tot.«
»Ja.«
»Jesus. Er seufzte schwer und rieb sich mit der Faust über die Augen. »Was für ein schrecklich brutaler Akt. Und so dreist. Nur jemand, der absolut nichts zu verlieren hat, würde so etwas wagen.«
»Oder jemand, der sicher war, dass er damit durchkommt.«
Sie drehte sich um und sah ihm offen in die Augen. Dann glitten die Aufzugtüren zur Seite, und sie trat aus der Kabine, ohne sich noch einmal umzudrehen.
3
Die Entscheidung fiel bei der zweiten Bloody Mary. Wenigstens hatte er sich bis dahin entschieden; genau wie sie, den Signalen nach zu urteilen, die sie aussandte. Die Bedingungen waren nicht ideal. Es würde ein paar vertrackte Manöver brauchen, aber zum Glück hatte er eine Schwäche für vertrackte Manöver, und wo ein Wille war …
Im Moment drückte sein Wille vor allem gegen den Sicherheitsgurt.
Zum Glück flogen sie Erster Klasse und nicht in der Economy. Ein Erste-Klasse-Ticket war fast immer das Vermögen wert, das die Fluglinien für einen Transatlantikflug verlangten. Die Ledersessel waren weich und geräumig. Mit einem Tastendruck konnte der Passagier den Sessel genau so einstellen, wie er ihn gern hatte, auch ganz flach. Es war zwar keine Federkernmatratze, aber immerhin.
Jeder Passagier hatte sein eigenes Videosystem, obwohl er seines noch nicht genutzt hatte. Das Essen hatte für eine Fluggesellschaft besser als nur passabel geschmeckt. Seiner inneren Uhr nach war jetzt Frühstückszeit, doch man hatte ihm ein Mittagessen serviert. Während der vielen Gänge hatte er die europäische Ausgabe der New York Times studiert, die er auf seinem eiligen Gang durch den Flughafen Charles de Gaulle erstanden hatte.
Er war nie frühzeitig am Flughafen. Im Gegenteil, gewöhnlich traf er so knapp wie möglich ein und hatte gerade noch Zeit, nötigenfalls das Gepäck aufzugeben und die Security zu passieren, bevor er zum Gate eilte, wo meist gerade das Boarding begann. Jedes Mal wettete er mit sich, ob er es noch schaffen würde. Dieses Risiko verlieh der sonst so ermüdenden Prozedur etwas Spielerisches und machte die Flugreisen überhaupt erst erträglich.
Die Stewardess hatte ihn beschwatzt, nach dem Essen noch ein Hot Fudge Sundae zu bestellen, das mit seinem persönlich ausgewählten Topping gekrönt würde. Er hatte sich zu seiner Selbstdisziplin gratuliert, weil er auf die Schlagsahne verzichtet hatte.
Von den warmen Nüssen als Appetithäppchen bis zum üppigen Dessert hatte das Essen die ersten zwei Flugstunden aufs Angenehmste vertrieben. Nachdem noch acht Stunden bis zur Landung blieben, zog er die Fensterblende wie gewünscht nach unten, damit die anderen Passagiere schlafen konnten. Er schaltete seine Leselampe ein, machte es sich in seinem Sessel gemütlich und begann den neuen Thriller zu lesen, der auf Platz eins der Bestsellerliste stand. Er hatte die ersten fünf Kapitel geschafft, als die Frau von 5C auf dem Weg zur Toilette an seiner Sitzreihe vorbeikam.
Sie fiel ihm nicht zum ersten Mal auf.
Als die Passagiere der Ersten Klasse zum Boarding aufgerufen worden und sie beide gemächlich zum Ende der Warteschlange geschlendert waren, hatten sich ihre Blicke zufällig getroffen. Natürlich hatten sie sofort wieder weggesehen, wie es Fremde tun, doch dann hatten sie beide einen zweiten Blick riskiert. Und als sie an Bord ihr Handgepäck in den Fächern über ihren Sitzen verstauten, hatte er sie dabei ertappt, wie sie in seine Richtung sah.
Er sah, dass sie auf die Toilette ging. Er sah, wie sie wieder herauskam. Er beobachtete sie, während sie zu ihrem Sitz zurückkehrte, und freute sich kindisch, als sie an seiner Reihe stehen blieb, sich über den freien Sitz am Gang beugte und auf seinen Roman deutete. »Mir ist vorhin aufgefallen, was Sie da lesen. Ein gutes Buch.«
»Es fängt jedenfalls gut an.«
»Es wird noch besser.« Sie lächelte wieder und wollte schon weitergehen, als er sich aufsetzte und sie aufhielt: »Haben Sie seine anderen gelesen?«
»Ich liebe seine Bücher.«
»Ach. Interessant.«
»Warum?«
»Nennen Sie mich meinetwegen einen Sexisten, aber sind diese Bücher nicht eher was für Männer? Sie sind gewagt. Und schmutzig.«
»Sie sind ein Sexist.«
Die schlagfertige Antwort ließ ihn grinsen.
Sie meinte: »Manche Frauen mögen es gewagt und schmutzig.«
»Sie zum Beispiel?«
»Ich kann es nicht leugnen.«
Er deutete auf den freien Sitz an seiner Seite. »Darf ich Sie auf einen Drink einladen?«
»Ich komme gerade vom Mittagessen.«
»Darf ich Sie dann auf einen Drink nach dem Mittagessen einladen?«
Sie sah kurz zu ihrem Sitz, der sich zwei Reihen hinter seinem auf der anderen Seite des Ganges befand, dann schaute sie ihn wieder an. »Eine Bloody Mary?«
»Eine gute Wahl.«
Sie setzte sich, schlug die Beine übereinander und winkelte sie in seine Richtung ab. Schöne Beine. Hohe Absätze. Keine Strümpfe, was auch nicht nötig war. Sie ertappte ihn dabei, wie er auf den Rocksaum knapp über dem Knie sah, aber das schien sie nicht verlegen zu machen. Als er ihr wieder ins Gesicht sah, erwiderte sie seinen Blick ganz ruhig. Sehr hübsche Augen, bemerkte er. Wie Gewitterwolken über dem Ozean.
Er hob eine Hand und drückte den Knopf für die Stewardess. »Ich heiße Derek Mitchell.«
»Ich weiß.«
Ihm wurde warm vor Freude, weil er glaubte, dass sie ihn erkannt hatte, doch dann streckte sie die Hand über die Armlehne und tippte auf den Boardingpass, der aus seiner Hemdtasche ragte. Sein Name war deutlich zu lesen.
Sie lachte leise, als er verlegen lächelte, und fragte dann: »Sind Sie in Atlanta zu Hause?«
»Ja. Und Sie?«
»Ich auch. Was hat Sie nach Paris verschlagen? Das Geschäft, das Vergnügen, oder sind Sie dort nur umgestiegen?«
»Das Vergnügen. Wenn man es so nennen will. Wir haben den fünfundsechzigsten Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Sie war noch nie in Paris, darum hat sie meinen Dad erpresst, ihre Geburtstagsfeier dorthin zu verlegen, und so fiel eine ganze Armada von Mitchells über die Stadt her.«
»Eine große Familie?«
»Groß genug. Meinen jetzt jedenfalls die Pariser.«
Wieder das leise Lachen, das fast wie ein Schnurren klang. Er fragte sich, ob ihr bewusst war, wie sexy es klang, und beantwortete seine Frage gleich darauf mit Ja. Natürlich.
»Hat sich Ihre Mutter amüsiert?«
»Königlich.« Er sah nach vorn. Die Stewardess ließ sich reichlich Zeit.
Als hätte sie seine Gedanken gelesen, stand seine Begleiterin auf und trat in den Gang. Er hatte schon Angst, dass sie auf ihren Platz zurückkehren würde, aber sie flüsterte ihm zu: »Scharf?«
»Auf jeden Fall.«
Sie ging nach vorne, und er konnte sie in aller Ruhe von hinten begutachten. Sie war mehr als hübsch, sie war phantastisch. Ihr schwarzes Kostüm lag eng an, wirkte aber feminin. Der körperbetonte Schnitt sprach für ein Designermodell. Das dunkle Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebündelt, was ihn normalerweise nicht so reizte. Aber bei ihr funktionierte der klassische Look. Sie hatte Geschmack, hatte Klasse, und dazu hatte sie Witz und Sexappeal. Sie trug keinen Ehering.
Sie kehrte zurück, gefolgt von der Stewardess, die ein kleines Tablett trug. Die Stewardess beugte sich über den Sitz am Gang und reichte ihm ein eisgekühltes Glas mit der noch alkoholfreien Bloody Mary sowie ein Fläschchen Ketel One. Ihr Drink war schon fertig gemixt.
»Schauen Sie später wieder vorbei«, trug er der Stewardess auf.
»Wird gemacht.«
Er goss den Wodka in die Bloody Mary, rührte kurz mit dem Plastikstäbchen um und hob dann sein Glas. Sie tat es ihm nach. Sie stießen an und drückten die Gläser kurz gegeneinander, während sie sich in die Augen sahen. Dann warf sie einen Blick auf das Leselicht.
Ohne lange nachzudenken und ohne sie zu fragen, drückte er den Knopf in seiner Armlehne, und das Licht erlosch. »Besser?«
»Eindeutig. Das grelle Licht…« Sie sprach jetzt viel leiser, so als würde sie die Dunkelheit zum Flüstern verführen, und sie ließ den Rest des Satzes unausgesprochen. Stattdessen trank sie einen Schluck von ihrer Bloody Mary, fast ein bisschen nervös, wie er fand. Sie senkte den Kopf, sah angestrengt in ihr Glas und drückte mit dem Stäbchen gegen die darin treibende Limettenscheibe. »Was tun Sie?«
»Wogegen?«
Sie hob den Kopf und sah ihn tadelnd an.
Er lächelte. »Ich bin Jurist.«
»Wirtschaftsrecht?«
»Strafrecht.«
Das weckte ihr Interesse. Sie drehte sich ihm weiter zu, wobei ihre Schuhspitze über sein Hosenbein strich, und schlagartig verwandelte sich seine Wade in eine erogene Zone.
»Welche Seite?«
»Verteidiger.«
»Das hätte ich auch getippt.«
»Wirklich?«
»M-hm«, murmelte sie und nahm wieder einen Schluck. Sie musterte ihn kurz. »Für jemanden im öffentlichen Dienst sind Sie zu gut gekleidet.«
»Danke.« Und weil sie ihn immer noch musterte, fragte er: »Und?«
»Und für einen Staatsanwalt sehen Sie nicht…«, sie legte den Kopf schief und überlegte kurz, »… bieder genug aus.«
Er lachte, und zwar so laut, dass der Mann auf der anderen Seite des Ganges herübersah und am Lautstärkeregler für den Kopfhörer auf seinem Schädel drehte. Derek verstand die Anspielung und lehnte sich zu ihr hinüber, bis sein Gesicht direkt vor ihrem war. Sie wich nicht zurück. »Ich glaube nicht, dass mich irgendwer mit dem Wort bieder beschreiben würde.«
»Sie stören sich also nicht an den vielen Anwaltswitzen?«
»Ach was. Ehrlich gesagt liefere ich die Vorlage für die meisten davon.«
Aus Rücksicht auf den Mann auf der anderen Seite des Ganges verkniff sie sich das Lachen, indem sie sich auf die Unterlippe biss. Perfekte Zähne. Eine volle Unterlippe mit nur einer Spur Lipgloss. Alles in allem war der Mund ausgesprochen sexy.
»Warum Strafrecht?« Sie spielte am obersten Knopf ihrer Bluse herum, und für einen Augenblick lenkten ihn ihre Finger ab.
»Strafrecht? Weil da die bösen Buben sind.«
»Die Sie verteidigen.«
Wieder grinste er. »Mit Profit.«
Sie setzten ihr Geplänkel während der ersten Bloody Marys fort. Sie plauderten über ihre Lieblingsrestaurants in Atlanta, über die wachsenden Verkehrsprobleme, dies und das, aber nichts Persönliches oder Bedeutendes.
Dann sagte sie aus heiterem Himmel: »Ich nehme an, Sie sind nicht verheiratet.«
»Nein. Wie kommen Sie darauf?«
»Logische Schlussfolgerung. Wenn Sie verheiratet wären, glücklich oder unglücklich, dann würde Ihre Frau Sie begleiten. Keine Frau würde sich eine Reise nach Paris entgehen lassen, selbst wenn sie dafür die Geburtstagsfeier ihrer Schwiegermutter überstehen muss.«
»Meine Frau hätte auch mitkommen und ein paar Tage länger in Paris bleiben können, um sich die Stadt anzusehen.«
Sie ließ den Einwand ein paar Sekunden unbeantwortet, dann schaute sie in ihr Glas und schubste mit der Spitze des Plastikstäbchens die Eiswürfel an. »Ihre Frau würde Ihnen bestimmt zu sehr misstrauen, als dass sie Sie allein zurückfliegen ließe.«
»Ich sehe also nicht vertrauenswürdig aus?«
»Eine Frau würde vor allem den anderen Frauen misstrauen.«
Sein Ego begann sich beschwipst aufzuplustern. Er beugte sich einen Fingerbreit weiter vor. »Sie reisen auch allein.«
»Stimmt.«
»Privat oder geschäftlich?«
Sie leerte ihr Glas und blickte dann betont auf ihre linke Hand, an der kein Ehering zu sehen war. »Ich bin extra nach Paris geflogen, um meinen Mann in flagranti mit seiner kleinen Freundin zu erwischen.«
Bingo, dachte Derek. Er hatte gerade im Lotto gewonnen. Ihr Selbstbewusstsein hatte einen schweren Schlag abbekommen. Trotz der sturmgrauen Augen, der so kussbereiten Lippen, der Wahnsinnsbeine und der wohlgeformten Hinterbacken hatte ihr Mann eine andere Frau ihr vorgezogen. Sie war verletzt worden, sann auf Rache und suchte verzweifelt nach einer Bestätigung dafür, dass sie immer noch eine attraktive, verführerische Frau war.
Er nickte zu ihrem leeren Glas hin. »Noch eine?«
Sie wich seinem Blick nicht aus, und er sah ihr an, dass sie vor einer schweren Entscheidung stand. Sollte sie die zweite Bloody Mary höflich ausschlagen und auf ihren Platz zurückkehren? Oder hierbleiben und abwarten, wie sich die Dinge entwickelten? Wieder zog sie die verführerische Unterlippe zwischen die Zähne, und dann antwortete sie: »Klar. Warum nicht?«
Die Stewardess erschien diesmal sofort, nachdem sie den Knopf gedrückt hatten, und sie bestellten eine zweite Runde. Während sie darauf warteten, stellte er fest, dass die anderen Passagiere entweder schon schliefen oder sich in das Geschehen auf ihren kleinen Bildschirmen vertieft hatten. Die Lichter in der Kabine waren bis auf die Leuchten für die Notausgänge und Toiletten gelöscht. Auf der anderen Seite der Kabine las eine ältere Frau unter ihrer Leselampe, die einen Stecknadelstich Licht warf.
Die Stewardess kehrte zurück und servierte beide Drinks genauso wie beim ersten Mal. »Wieso ist Ihrer immer schon fertig gemixt?«, fragte er.
Sie senkte schüchtern den Kopf und spielte wieder am obersten Knopf ihrer Bluse herum. »Weil ich sie darum gebeten habe. Als ich vorn war, habe ich für mich eine doppelte bestellt.«
»Betrug!«, beschwerte er sich im Bühnenflüsterton.
»Sie sollten mich nicht für eine Trinkerin halten.« Endlich zog sie den Gummi aus ihrem Haar und schüttelte es aus. Die dunklen Haare senkten sich als seidiges Cape über ihre Schultern. Seufzend ließ sie den Kopf gegen die Lehne sinken und schloss die Augen. »Ich wollte mich endlich entspannen, loslassen können … die ganze … Szene … ausblenden.«
»Kein schönes Sightseeing in Paris?«
Sie schluckte mühsam, und eine Träne zwängte sich zwischen ihren Wimpern durch und rollte über ihre Wange. »Auf einer Skala von eins bis zehn?«
»Zehn?«
»Zwölf.«
»Das tut mir leid.«
»Danke.«
»Was für ein Idiot.«
»Nochmals danke.« Ohne den Kopf von der Lehne zu nehmen, drehte sie ihm das Gesicht zu. »Ich will nicht über ihn sprechen.«
»Ich auch nicht.« Er zählte still bis zehn, streckte dann den Zeigefinger vor und wischte mit der Fingerspitze die Träne von ihrer Wange. »Worüber sollen wir stattdessen sprechen?«
Den Blick fest ihm zugewandt zählte sie mindestens bis zwanzig, bevor sie mit rauchiger Stimme fragte: »Müssen wir denn sprechen?«
Ihr Blick senkte sich auf seinen Mund, verharrte dort ein paar Sekunden und hob sich dann wieder zu seinen Augen. In diesem Moment wusste er Bescheid. Damit stand es fest. Sie würden miteinander schlafen. Und zwar nicht erst in Atlanta. Sondern gleich hier. Jetzt.
Er hatte Freunde, die damit angegeben hatten, dass sie es im Flugzeug getrieben hatten. Er hatte moderne Mythen von Pärchen gehört, die man zu zweit aus der Toilette gezerrt hatte, aber all diese Geschichten hatte er für wenig glaubhaft gehalten.
Nüchtern betrachtet war es ein riskantes Unterfangen. Zum einen gab es hundert Möglichkeiten, erwischt zu werden, je nach Größe des Flugzeuges und der Anzahl der mitfliegenden Passagiere. Das zweite Problem war, einen geeigneten Platz zu finden, der auf jeden Fall beengt ausfallen würde.
Trotzdem schoss bei dem bloßen Gedanken daran das Testosteron durch seinen Körper.
Vor allem, nachdem seine potentielle Partnerin ihn so unverhohlen bedürftig ansah und nachdem ihr Blick vermuten ließ, dass sich unter dem kultivierten Äußeren ein heißes, erotisches Wesen verbarg. Vielleicht glaubte sie, dass ihr Mann sie betrogen hatte, weil sie im Ehebett zu reserviert geblieben war, weil sie nie ihre wilde Seite gezeigt, nie rein aus Instinkt gehandelt und alle Hemmungen in den Wind geschlagen hatte.
Auch egal.
Er sah sich um. Die Leserin hatte ihr Licht ausgeschaltet. Der Mann auf der anderen Seite des Ganges dämmerte durch seinen Film. Als Dereks Blick wieder auf ihren traf, leuchtete in seinen Augen eine unbeirrbare Willenskraft, mit der er sonst die Jury von der Unschuld seines Mandanten zu überzeugen versuchte.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Smash Cut« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Sandra Brown Management Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-10328-6
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe