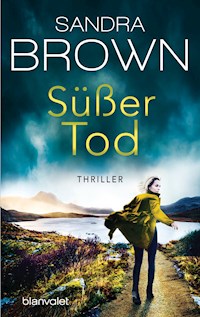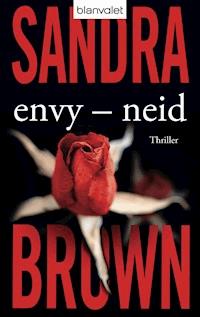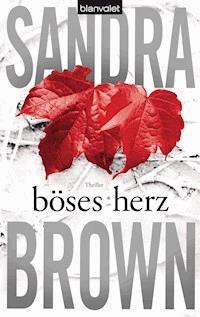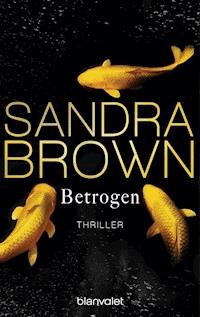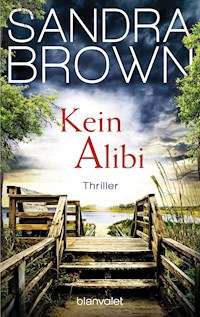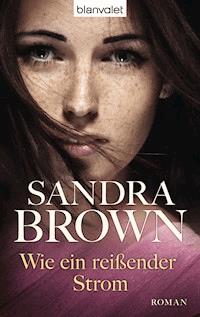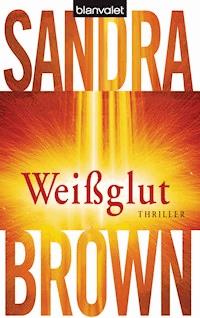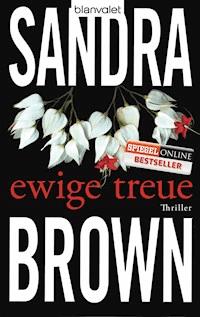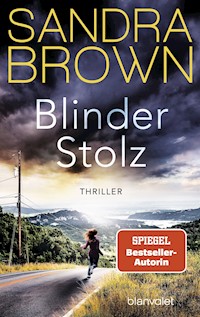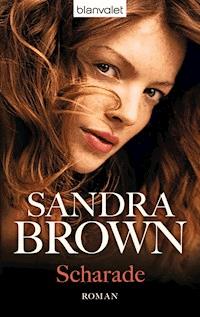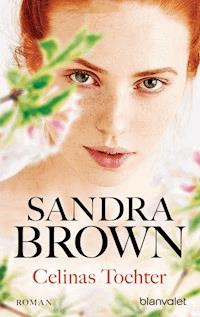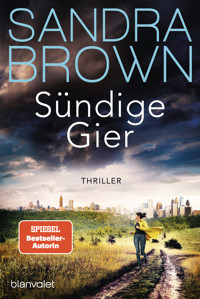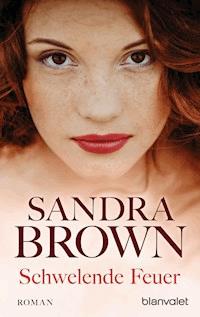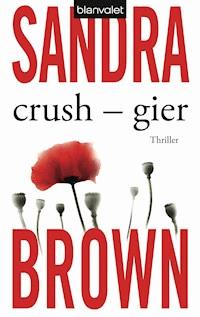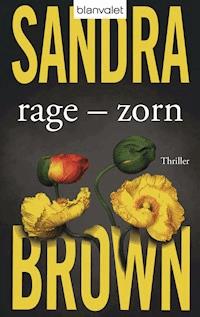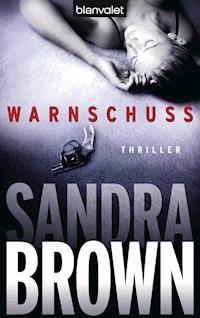
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Niemand spielt so gekonnt mit den Nerven ihrer Leser wie SPIEGEL-Bestsellerautorin Sandra Brown
Detektiv Duncan Hatcher ist fassungslos: Richter Laird stellt seinen wasserdichten Fall gegen einen Drogenbaron ein. Kurz darauf erschießt Elise, die Frau des Richters, einen Einbrecher: Notwehr! Angeblich. Hatcher gerät in eine prekäre Situation, denn er hegt für Elise mehr als freundschaftliche Gefühle. Doch kann er Elise trotz aller Indizien gegen sie wirklich trauen? Als Elise spurlos verschwindet, muss Hatcher alles auf eine Karte setzen. Denn sicher ist er sich nur in einem: Eine Nacht mit Elise war nicht genug …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 722
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Detective Duncan Hunter ist außer sich. Richter Laird hat den wasserdichten Fall gegen Drogenbaron Robert Savich wegen eines angeblichen Verfahrensfehlers eingestellt. Als die Frau des Richters einen Einbrecher erschießt und Duncan gerufen wird, gerät er in eine heikle Situation. Denn Duncan hegt für Elise mehr als nur freundschaftliche Gefühle. Und der Fall ist dubios: Hat Elise in Notwehr gehandelt, wie der Richter glauben machen will? Oder sollte sie das eigentliche Opfer sein, wie Elise ihn zu überzeugen sucht?
Dann verschwindet Elise und eine weitere Leiche taucht auf. Kann Ducan jetzt noch seinem Polizisteninstinkt vertrauen? Oder benutzt Elise ihn für irhre eigenen Zwecke? Auf der Jagd nach der Wahrheit setzt Duncan alles aufs Spiel. Denn sicher ist er sich nur in einem: Eine Nacht mit Elise war nicht genug ...
Autorin
Sandra Brown arbeitete mit großem Erfolg als Schauspielerin und TV-Journalistin, bevor sie mit ihrem Roman »Trügerischer Spiegel« auf Anhieb einen großen Erfolg landete. Inzwischen ist sie eine der erfolgreichsten internationalen Autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher die Spitzenplätze der »New-York-Times«-Bestsellerliste erreicht! Ihren großen Durchbruch als Thrillerautorin feierte Sandra Brown mit dem Roman »Die Zeugin«, der auch in Deutschland auf die Bestsellerlisten kletterte – eine Erfolg, den sie mit jedem neuen Roman noch einmal übertreffen konnte. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie abwechselnd in Texas und South Carolina.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sandra-brown.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Bergungseinsatz wurde um 18.56 Uhr abgebrochen.
Die düstere Nachricht gab Polizeichef Clarence Taylor auf einer Pressekonferenz bekannt, die auf allen Lokalsendern übertragen wurde.
Seine finstere Miene passte zu seinem Offiziershaarschnitt und seinem militärischen Gebaren. »Das Police Department und alle anderen eingesetzten Behörden haben unermüdlich gesucht, weil wir immer auf eine Rettung hofften. Oder zumindest eine Bergung.
Doch nachdem die tagelangen intensiven Bemühungen der Polizei, der Küstenwache und zahlloser Freiwilliger keinerlei ermutigende Ergebnisse erbracht haben, sind wir zu der traurigen Schlussfolgerung gelangt, dass es zwecklos wäre, die Suchaktion fortzuführen.«
Der einsame Trinker in der Bar kippte, den Blick auf einen in der Ecke hängenden flimmernden Bildschirm gerichtet, den Whisky in seinem Glas hinunter und winkte dem Barkeeper, ihm nachzuschenken.
Der Barkeeper hielt die offene Flasche einsatzbereit über das Highballglas. »Sicher? Sie lassen es ganz schön krachen, mein Freund.«
»Nur zu.«
»Wissen Sie, wie Sie heimkommen?«
Die Frage wurde von einem drohenden Blick erwidert. Der Barkeeper zuckte mit den Achseln und schenkte nach. »Ihre Beerdigung.«
Nein, nicht meine.
Das Smitty’s lag abseits der ausgetretenen Pfade in einem Viertel von billigen Mietwohnungen in Downtown Savannah und war kein Anlaufpunkt für Touristen oder gutsituierte Bürger. Es war keines der Wasserlöcher, an denen man sich zu Spiel und Spaß versammelte. Es war kein Teil des berüchtigten städtischen Pub-Marathons am St. Patrick’s Day. Hier wurden keine pastellfarbenen Drinks mit Phantasienamen serviert.
Hier wurden die Getränke pur geordert. Ob man eine Zitronenschalenspirale wie jene bekam, die der Barkeeper gedankenverloren schälte, während er die Sondersendung im Vorlauf einer alten Seinfeld-Episode verfolgte, war reine Glückssache.
Auf dem Fernsehschirm lobte Chief Taylor noch und noch die unermüdlichen Anstrengungen des Sheriffbüros, der Hundestaffel, der Marine und der Tauchtruppe, bla bla bla.
»Stellen Sie das leise, okay?«
Auf die Forderung seines Gastes hin griff der Barkeeper nach der Fernbedienung und stellte den Fernseher stumm. »Er windet sich so, weil er muss. Wenn man das ganze Gequatsche wegstreicht, sagt er schlicht, dass die Leiche längst Fischfutter ist.«
Der Trinker stützte die Ellbogen auf die Theke, ließ die Schultern hängen und schaute zu, wie der dunkelbraune Alkohol in seinem Glas schwappte, wenn er seinen Drink auf der polierten Holzfläche hin und her schob.
»Zehn Tage nachdem sie in den Fluss gefallen ist?« Der Barkeeper schüttelte pessimistisch den Kopf. »Das überlebt keiner. Trotzdem ist die Geschichte zum Heulen. Vor allem für die Familie. Ich meine, nie wirklich zu wissen, was aus einer geliebten Angehörigen geworden ist?« Er griff nach der nächsten Zitrone. »Ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass jemand, den ich liebe, ob lebendig oder tot, zwischen all dem Müll im Fluss oder sogar draußen im Ozean treibt …«
Er deutete mit dem Kinn auf das einzige Fenster in der Bar. Es war zwar breit, aber nur dreißig Zentimeter hoch und oben in der Wand eingelassen, viel näher an der Decke als am Boden, wodurch es einen äußerst begrenzten Blick auf die Welt draußen bot, wenn man denn einen erhaschen wollte. Es gestattete nur einem schmalen Streifen Halblicht, das bedrückende Dunkel der Bar zu durchbrechen, und verhieß den Hoffnungslosen hier drinnen nur wenig Erleuchtung.
Unwetterartiger Regen hatte während der vergangenen achtundvierzig Stunden das Tiefland Georgias und South Carolinas durchtränkt. Nicht nachlassender Regen. In Sturzbächen ergoss sich das Wasser aus den undurchdringlichen Wolken.
Zeitweise war der Regen so dicht, dass man nicht mal das andere Flussufer erkennen konnte. Tief liegende Gebiete hatten sich in Seen verwandelt. Straßen waren wegen Überflutung gesperrt worden. Wie über Stromschnellen raste das schäumende Wasser im Rinnstein den Gullys entgegen.
Der Barkeeper wischte den Zitronensaft von seinen Fingern und putzte die Messerklinge an einem Handtuch ab. »Man kann es ihnen nicht verübeln, dass sie bei diesem Regen die Suche abgeblasen haben. Wahrscheinlich werden sie die Leiche nie finden. Ich schätze, die Sache wird für immer ein Rätsel bleiben. War es Mord oder Selbstmord?« Er warf das Handtuch beiseite und stützte sich auf den Tresen. »Was, glauben Sie, ist da draußen passiert?«
Sein Gast sah ihn mit trüben Augen an und antwortete rau: »Ich weiß, was passiert ist.«
1
Es war der vierte Tag des Mordprozesses gegen Robert Savich.
Detective Duncan Hatcher von der Mordkommission fragte sich, was zum Teufel da gespielt wurde.
Sobald sich das Gericht nach der Mittagspause wieder versammelt hatte, hatte Stan Adams, der Anwalt des Angeklagten, den Richter um eine vertrauliche Unterredung gebeten. Richter Laird schien über diese Bitte ebenso überrascht wie der stellvertretende Staatsanwalt Mike Nelson, war ihr aber dennoch nachgekommen und mit den beiden in der Richterkammer verschwunden. Nachdem die Geschworenen ins Geschworenenzimmer zurückgeführt worden waren, blieben die Zuschauer allein zurück und fragten sich, was diese unerwartete Konferenz zu bedeuten hatte.
Mittlerweile waren die drei seit einer halben Stunde verschwunden. Duncans Nervosität wuchs mit jeder Minute. Er hätte sich gewünscht, dass der Prozess ohne alle Schönheitsfehler geführt wurde, die dazu führen konnten, dass Berufung eingelegt oder, Gott bewahre, der Angeklagte freigesprochen wurde. Darum machte ihn dieses Powwow hinter verschlossenen Türen so zappelig.
Seine Ungeduld trieb ihn schließlich in den Gang hinaus, wo er, allerdings immer in Hörweite des Gerichtssaales, auf und ab patrouillierte. Von seinem Beobachtungsposten im vierten Stock aus verfolgte er, wie zwei Schlepper ein Handelsschiff durch den Kanal in Richtung Ozean zogen. Dann konnte er die Spannung nicht länger ertragen und kehrte auf seinen Platz im Gerichtssaal zurück.
»Duncan, verflucht noch mal, bleib endlich sitzen. Du zappelst rum wie ein Zweijähriger.« Seine Partnerin DeeDee Bowen löste zum Zeitvertreib ein Kreuzworträtsel.
»Was haben die da drin nur zu bequatschen?«
»Vielleicht wollen sie was aushandeln? Womöglich auf Totschlag plädieren?«
»Vergiss es«, antwortete er. »Savich würde nicht mal zugeben, dass er falsch geparkt hat, geschweige denn, dass er einen erledigt hat.«
»Kennst du ein Wort mit zehn Buchstaben für aufgeben?«
»Kapitulieren.«
Sie sah ihn verdrossen an. »Wie ist dir das so schnell eingefallen?«
»Ich bin ein Genie.«
Sie probierte das Wort aus. »Von wegen. Es passt nicht. Außerdem hat es zwölf Buchstaben.«
»Sonst fällt mir nichts ein.«
Der am Tisch der Verteidigung sitzende Angeklagte Robert Savich wirkte eindeutig zu selbstgefällig für einen Mordangeklagten und viel zu zuversichtlich, um Duncans Nervosität zu lindern. Als würde er Duncans Blick in seinem Nacken spüren, drehte Savich sich um und lächelte ihn an. Seine Finger trommelten weiter müßig auf den Armlehnen seines Stuhles, als würden sie den Rhythmus zu einem fröhlichen Liedchen vorgeben, das nur er alleine hören konnte. Die Beine hatte er lässig übereinandergeschlagen. Er war die Gefasstheit in Person.
Jeder, der Robert Savich nicht kannte, hätte ihn für einen angesehenen Geschäftsmann mit leicht avantgardistischem Modegeschmack gehalten. Für den heutigen Gerichtstermin hatte er sich in einen konservativ grauen Anzug gekleidet, dessen schlanker Schnitt eindeutig europäisch wirkte. Sein Hemd war hellblau, die Krawatte lavendelfarben. Der bekannte Pferdeschwanz glänzte ölig. In seinem Ohrläppchen glitzerte ein mehrkarätiger Diamant.
Die erstklassige Kleidung und seine Unbekümmertheit waren Teil einer blank polierten Maske, die den gewissenlosen Kriminellen dahinter perfekt verbarg.
Man hatte Robert Savich schon wegen der unterschiedlichsten Verbrechen verhaftet und der Grand Jury vorgeführt, um festzustellen, ob Anklage erhoben werden sollte – mehrmals wegen Mordes, einmal wegen Brandstiftung sowie wegen diverser kleiner Vergehen, die größtenteils mit Drogenhandel zu tun hatten. Doch im Lauf seiner langen illustren Karriere war er nur zweimal tatsächlich angeklagt worden und hatte vor Gericht gestanden. Beim ersten Mal wegen Drogenhandels. Damals war er freigesprochen worden, weil der Staat seine zugegeben fadenscheinigen Beweise nicht untermauern konnte. Die zweite Verhandlung war der Prozess wegen Mordes an einem gewissen Andre Bonnet. Savich hatte sein Haus in die Luft gejagt. Gemeinsam mit Agenten vom ATF hatte Duncan in diesem Mordfall ermittelt. Bedauerlicherweise hatten sie fast ausschließlich Indizien in der Hand, aber diese Indizien schienen stark genug, um eine Verurteilung zu erreichen. Allerdings hatte der leitende Staatsanwalt den Fall einem Grünschnabel aus seinem Büro übergeben, der weder das Geschick noch die nötige Erfahrung besessen hatte, um die Geschworenen von Savichs Schuld zu überzeugen. Die Geschworenen konnten sich nicht auf eine Verurteilung einigen.
Aber damit nicht genug. Kurz darauf kam ans Tageslicht, dass der junge stellvertretende Staatsanwalt dem Verteidiger Stan Adams entlastendes Beweismaterial vorenthalten hatte. Der darauffolgende öffentliche Aufschrei hatte der Staatsanwaltschaft den Mumm zu einer zeitnahen erneuten Anklage geraubt. Der Fall lag immer noch bei den Akten und würde dort wahrscheinlich versauern.
Diese Niederlage lag Duncan immer noch im Magen. Obwohl der junge Staatsanwalt eindeutig gepfuscht hatte, hatte Duncan sich den Misserfolg persönlich zugeschrieben und geschworen, Savichs Karriere als gut verdienendem Kriminellen ein Ende zu setzen.
Diesmal setzte er alles auf eine Verurteilung. Savich war des Mordes an Freddy Morris angeklagt, eines seiner vielen Angestellten, einem Drogendealer, den einige Undercoveragenten aus dem Drogendezernat beim Herstellen und Verteilen von Methamphetamin erwischt hatten. Die Beweise gegen Freddy Morris waren erdrückend gewesen, seine Verurteilung praktisch garantiert, und als Wiederholungstäter hatte er mit vielen Jahren Knast zu rechnen.
Die staatlichen Fahnder von der Drug Enforcement Agency hatten sich mit den Kollegen aus dem Drogendezernat des Savannah Police Department zusammengesetzt und Freddy Morris einen Handel angeboten – eine weniger schwerwiegende Anklage und eine deutlich geringere Haftstrafe im Austausch gegen seinen Boss Robert Savich, dem Strippenzieher, hinter dem sie eigentlich her waren.
In Anbetracht der Haftstrafe, die ihn erwartete, war Freddy Morris auf das Angebot eingegangen. Aber bevor die penibel geplante Operation erledigt war, war es Morris. Er wurde mit einem Einschussloch im Hinterkopf bäuchlings in einem Sumpfgelände aufgefunden.
Duncan war zuversichtlich, dass Savich diesmal nicht straflos davonkommen würde. Der Staatsanwalt war weniger optimistisch. »Ich hoffe, dass du recht behältst, Dunk«, hatte Mike Nelson am Vorabend gesagt, während er Duncan auf seinen Auftritt im Zeugenstand vorbereitet hatte. »Von deiner Aussage hängt eine Menge ab.« Dann hatte er, an seiner Unterlippe zupfend, nachdenklich hinzugefügt: »Ich fürchte, Adams wird auf dem unzureichenden Verdacht rumreiten.«
»Ich hatte sehr wohl einen hinreichenden Verdacht, um Savich zu vernehmen«, wehrte sich Duncan. »Als wir Freddy den Vorschlag zum ersten Mal machten, erklärte er, dass Savich ihm die Zunge rausschneiden würde, wenn er auch nur in dessen Richtung furzte. Als ich Freddys Leichnam untersuche, stelle ich fest, dass nicht nur sein Hirn zu Pampe zerschossen, sondern auch seine Zunge rausgeschnitten worden war. Der Pathologe sagt, dass er noch am Leben war, als sie abgeschnitten wurde. Findest du nicht, dass mir das einen hinreichenden Verdacht gab, mich an Savichs Fersen zu heften?«
Das Blut war noch feucht und Freddys Leiche noch warm gewesen, als Duncan und DeeDee zu dem schaurigen Tatort gerufen wurden. Agenten der Drug Enforcement Agency und Fahnder des Savannah Police Department waren in einen erbitterten Streit verwickelt, wer Freddys Tarnung hatte auffliegen lassen.
»Sie sollten doch drei Männer abstellen, die jeden seiner Schritte überwachen«, brüllte ein DEA-Agent seinen Gegenpart vom SPD an.
»Sie hatten vier abgestellt! Wo waren die denn?«, brüllte der Drogenfahnder zurück.
»Die dachten, er säße zu Hause.«
»Ach ja? Tja, das dachten wir auch.«
»Jesus!«, fluchte der Bundespolizist frustriert. »Wie konnte er unbemerkt aus dem Haus kommen?«
Ganz gleich, wer die Operation in den Sand gesetzt hatte, Freddy war als Zeuge ausgefallen, darüber zu streiten war Zeitverschwendung. Duncan hatte es DeeDee überlassen, zwischen den beiden Fraktionen zu vermitteln, die sich mit Beleidigungen und Schuldzuweisungen überhäuften, und sich auf die Suche nach Savich gemacht.
»Ich hatte gar nicht vor, ihn zu verhaften«, hatte Duncan Mike Nelson erklärt. »Als ich in sein Büro gefahren bin, wollte ich ihn nur befragen. Ich schwöre es.«
»Du hast mit ihm gerauft, Dunk. Das könnte uns schaden. Adams wird das den Geschworenen unter die Nase reiben. Er wird etwas von unzulässiger Gewaltanwendung andeuten, falls er dir nicht direkt an den Karren fährt. Unberechtigte Festnahme. Scheiße, weiß der Geier, was er sonst noch aus dem Hut zaubert.«
Zu guter Letzt hatte Mike Nelson ihn noch ermahnt, dass nichts sicher sei und bei einer Verhandlung alles passieren könne.
Duncan verstand nicht, warum der Staatsanwalt so besorgt war. Ihm erschien der Fall klar und eindeutig. Er war direkt vom Tatort zu Savichs Büro gefahren. Dort war Duncan unangekündigt in Savichs Arbeitszimmer geplatzt und hatte ihn in Gesellschaft einer Frau vorgefunden, die anhand der Polizeifotos später als Lucille Jones identifiziert wurde und sich auf den Knien befand, um Savich mit einer Fellatio zu beglücken.
An diesem Morgen war es im Gerichtssaal kurz still geworden, als Duncan das in seiner Zeugenaussage erwähnte. Die hektische Betriebsamkeit erstarb. Der vor sich hin dösende Gerichtsdiener hatte sich schlagartig hellwach aufgesetzt. Duncan sah zu der Geschworenenbank hinüber. Eine der älteren Frauen hatte peinlich berührt den Kopf eingezogen. Eine zweite, etwa genauso alt wie die erste, schien sich über die Bedeutung des Wortes unschlüssig zu sein. Einer der vier männlichen Geschworenen blickte mit einem leicht bewundernden Schmunzeln auf Savich. Savich selbst betrachtete prüfend seine Fingernägel, als überlege er, ob er später noch zur Maniküre gehen solle.
Duncan hatte ausgesagt, dass Savich nach einer Waffe gegriffen habe, sobald er sein Büro betreten hatte. »Auf seinem Schreibtisch lag eine Pistole. Er hat danach gegriffen. Ich wusste, wenn er die Waffe in die Finger bekommt, bin ich tot.«
Adams sprang auf. »Einspruch, Euer Ehren. Unzulässige Schlussfolgerung.«
»Stattgegeben.«
Mike Nelson hatte die Frage umformuliert und den Geschworenen letztendlich bewiesen, dass Duncan Savich nur attackiert hatte, um sich vor einem möglichen Schaden zu bewahren. Der sich daraus entwickelnde Kampf war intensiv gewesen, doch zuletzt hatte Duncan Savich bändigen können.
»Detective Hatcher, haben Sie die Waffe als Beweismittel sichergestellt, nachdem Sie Mr Savich überwältigt hatten?« , fragte der Staatsanwalt.
Genau da wurde es knifflig. »Nein. Bis ich Savich in Gewahrsam genommen hatte, waren die Waffe und die Frau verschwunden.«
Von beiden fehlte seither jede Spur.
Duncan hatte Savich wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt verhaftet. Während er unter dieser Anklage festgehalten wurde, hatten Duncan, DeeDee und andere Kollegen Beweise dafür gesammelt, dass er den Mord an Freddy Morris begangen hatte.
Die Waffe, die Duncan gesehen hatte und mit der Savich ihrer Überzeugung nach nicht einmal eine Stunde zuvor Freddy Morris hingerichtet hatte, hatten sie nicht. Genauso wenig wie eine Aussage der Frau. Sie hatten nicht einmal Fuß- oder Reifenabdrücke vom Tatort, weil die hereinkommende Flut alles weggespült hatte, bevor der Leichnam entdeckt worden war.
Dafür hatten sie die Zeugenaussagen mehrerer anderer Agenten, die Freddys angsterfüllte Beteuerung gehört hatten, dass Savich ihm die Zunge herausschneiden und ihn anschließend umbringen würde, falls er einen Deal mit den Behörden abschloss oder auch nur mit ihnen redete. Außerdem konnte Savich, nachdem Lucille Jones’ Aufenthaltsort unbekannt blieb, kein glaubhaftes Alibi vorweisen. Die Staatsanwaltschaft hatte schon mit weniger Material eine Verurteilung erreicht, also war der Fall vor Gericht gekommen.
Nelson rechnete damit, dass Duncan an diesem Nachmittag von Savichs Anwalt ins Kreuzverhör genommen würde. In der Mittagspause hatte er ihn darauf vorzubereiten versucht. »Er wird dein Verhalten als Schikane hinstellen und den Geschworenen erzählen, dass du seit Jahren einen persönlichen Groll gegen seinen Mandanten hegst.«
»Du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass ich das tue«, sagte Duncan. »Dieser Hurensohn ist ein Mörder. Und ich habe einen Eid geschworen, Mörder hinter Gitter zu bringen.«
Nelson seufzte. »Pass nur auf, dass es nicht so klingt, als würdest du die Sache persönlich nehmen, okay?«
»Ich werde es versuchen.«
»Auch wenn es so ist.«
»Ich habe gesagt, ich werde es versuchen, Mike. Aber ja, inzwischen nehme ich es tatsächlich persönlich.«
»Erst wird Adams darauf verweisen, dass Savich eine Berechtigung zum Tragen einer Waffe hat, weshalb die Waffe selbst kein belastender Beweis ist. Dann wird er behaupten, dass es nie eine Waffe gegeben hat. Er könnte sogar anzweifeln, dass da wirklich eine Frau war, die ihm einen geblasen hat. Er wird alles abstreiten, abstreiten und noch mal abstreiten und bei den Geschworenen ein ganzes Feld voller Zweifel säen. Vielleicht wird er sogar einen Antrag stellen, deine Aussage für nicht verwertbar zu erklären, weil es keinerlei Bestätigung dafür gibt.«
Duncan wusste, was ihm bevorstand. Er hatte schon früher mit Stan Adams zu tun gehabt. Er konnte es kaum erwarten, die Sache hinter sich zu bringen.
Er starrte gerade auf die Tür und versuchte, sie mit der Kraft seiner Gedanken zu öffnen, als sie tatsächlich aufsprang.
»Erheben Sie sich!«, dröhnte der Gerichtsdiener.
Duncan schoss aus seinem Stuhl. Er versuchte die Mienen der drei Eintretenden zu deuten, die jetzt in den Gerichtssaal traten und ihre Plätze wieder einnahmen. Er beugte sich zu DeeDee hin. »Was hältst du davon?«
»Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht.«
Seine Partnerin verfügte über eine geradezu gespenstische und absolut zuverlässige Begabung, Menschen und Situationen zu deuten, und sie hatte eben seine eigene düstere Vorahnung bestätigt.
Ein schlechtes Zeichen war auch, dass Mike Nelson den Kopf abgewandt hatte und kein einziges Mal zu ihnen herübersah.
Stan Adams setzte sich neben seinen Mandanten und tätschelte den Ärmel von Savichs sündteurem Anzug.
Duncans Magen krampfte sich beklommen zusammen.
Der Richter trat hinter die Richterbank und gab dem Gerichtsdiener ein Zeichen, die Geschworenen wieder hereinzuführen. Dann nahm er seinen Platz hinter dem Podium ein und ordnete seine Robe. Er schob das Tablett mit dem Glas und der Karaffe Wasser einen Zentimeter nach rechts und rückte das Mikrofon zurecht, das keinesfalls zurechtgerückt werden musste.
Nachdem die Geschworenen wieder im Saal waren und jeder seinen Platz eingenommen hatte, verkündete er: »Meine Damen und Herren, ich bitte um Verzeihung für die Verzögerung, doch es ging um eine wichtige Angelegenheit, die sofort geklärt werden musste.«
Cato Laird war beim Publikum und bei der Presse, die er wie ein Freier umwarb, als Richter überaus beliebt. Obwohl er schon auf die fünfzig zuging, hatte er den Körper eines Dreißigjährigen und die Gesichtszüge eines Filmstars. Tatsächlich hatte er ein paar Jahre zuvor in einem Film, der in Savannah gedreht wurde, eine kleine Nebenrolle als Richter gespielt.
Er genoss es, vor der Kamera zu stehen, und war stets für einen markanten Kommentar gut, wenn es in den Nachrichten um Verbrechen, Verbrecher oder die Jurisprudenz ging. Auch jetzt sprach er mit seiner bekannten, oft vernommenen, sonoren Stimme: »Wie mir Mr Adams eben zur Kenntnis gebracht hat, vergaß während der Geschworenenbefragung die Geschworene Nummer zehn zu erwähnen, dass ihr Sohn an einem Ausbildungslehrgang für das Savannah-Chatham Metropolitan Police Department teilnehmen wird.«
Duncan sah auf die Geschworenenbank und entdeckte den freien Stuhl in der zweiten Reihe.
»Ach du Kacke«, murmelte DeeDee leise.
»Die Geschworene hat das bestätigt«, sagte Richter Laird. »Sie hatte nicht beabsichtigt, das Gericht zu täuschen, sie hatte einfach nicht erkannt, inwiefern diese Unterlassung den Ausgang des Verfahrens beeinflussen könnte.«
»Was?«
DeeDee stupste Duncan warnend an, nicht zu laut zu werden.
Der Richter sah in ihre Richtung, redete aber weiter.
»Wenn eine Jury zusammengestellt wird, hat der Anwalt jeder Partei Gelegenheit, alle Individuen abzulehnen, die seinem Gefühl nach das Potenzial besitzen, das Urteil unzulässig zu beeinflussen. Mr Adams ist der Meinung, dass eine Geschworene, deren Familienmitglied bald Polizist wird, fundamentale Vorurteile gegen jeden Angeklagten in einem Strafprozess hegen könnte, ganz besonders gegen einen, dem diese besonders ungeheuerliche Tat zur Last gelegt wird.«
Er schöpfte Atem und fuhr dann fort: »Ich stimme in diesem Punkt mit der Verteidigung überein und bin daher gezwungen, auf einen Verfahrensfehler zu erkennen.« Er knallte den Hammer auf den Tisch. »Geschworene, Sie sind entlassen. Mr Adams, Ihr Mandant ist frei und kann gehen. Die Sitzung ist geschlossen.«
Duncan sprang aus seinem Stuhl. »Sie machen Witze!«
Der Richter nagelte ihn mit seinem Blick fest und sagte mit einer Stimme, mit der man Diamanten hätte schneiden können: »Ich versichere Ihnen, dass ich keine Witze mache, Detective Hatcher.«
Duncan schob sich in den Mittelgang und eilte zur Absperrung vor. Er deutete auf Savich: »Euer Ehren, Sie können ihn unmöglich laufen lassen!«
Mike Nelson war an seiner Seite und flüsterte beschwörend auf ihn ein: »Ruhig, Dunk.«
»Sie können den Fall noch einmal vor Gericht bringen, Mr Nelson.« Der Richter hatte sich bereits erhoben und zum Gehen bereitgemacht. »Aber ich rate Ihnen, erst handfestere Beweise zu beschaffen.« Dann fixierte er Duncan und setzte nach: »Oder glaubwürdigere Zeugen.«
Duncan sah rot. »Sie glauben, dass ich lüge?«
»Duncan.«
DeeDee stand hinter ihm, hielt ihn am Oberarm zurück und versuchte ihn durch den Mittelgang zur Saaltür zu zerren, doch er riss sich los.
»Die Pistole war da. Sie hat praktisch noch geraucht. Die Frau war auch da. Sie ist aufgesprungen, als ich ins Zimmer kam und …«
Der Richter schlug kurz mit dem Hammer auf sein Pult und brachte ihn damit zum Schweigen. »Sie können im nächsten Prozess aussagen. Falls es einen gibt.«
Plötzlich war Savich vor ihm und füllte mit seinem Feixen Duncans ganzes Gesichtsfeld. »Sie haben es schon wieder vermasselt, Hatcher.«
Mike Nelson packte Duncan am Arm, damit er nicht über die Absperrung flankte. »Ich kriege dich noch, du Hurensohn.«
Mit bedrohlich tiefer Stimme sagte Savich: »Wir sehen uns. Bald.« Dann hauchte er Duncan einen Kuss zu.
Adams führte seinen Mandanten hastig an Duncan vorbei, der zum Richter schaute. »Wie können Sie zulassen, dass er hier rausspaziert?«
»Nicht ich lasse es zu, Detective Hatcher. Sondern das Gesetz.«
»Sie sind das Gesetz. Oder sollten es wenigstens sein.«
»Duncan, halt den Mund«, zischte DeeDee. »Wir verdoppeln unsere Anstrengungen, Lucille Jones zu finden. Vielleicht taucht auch die Waffe wieder auf. Früher oder später nageln wir Savich fest.«
»Wir hätten ihn längst festnageln können.« Er gab sich keine Mühe, leiser zu sprechen. »Wir hätten ihn heute festnageln können. Wir hätten ihn verflucht noch mal jetzt festnageln können, wenn wir einen Richter hätten, der zur Polizei hält und nicht zu den Kriminellen.«
»Ach du Scheiße«, stöhnte DeeDee.
»Detective Hatcher.« Richter Laird stützte sich auf seine Richterbank und sah Duncan zornfunkelnd an. Als würde er aus einem brennenden Busch zu ihm sprechen, donnerte er: »Ich bin gewillt, Ihnen einen Gefallen zu erweisen und diesen Kommentar zu überhören, weil ich mir das Ausmaß Ihrer Frustration vorstellen kann.«
»Sie können sich einen Scheißdreck vorstellen. Wenn Sie mir wirklich einen Gefallen erweisen wollten, Euer Ehren, dann hätten Sie die Geschworene ersetzt, statt den ganzen Prozess abzublasen. Wenn Sie mir wirklich einen Gefallen erweisen wollten, hätten Sie uns eine Chance gegeben, diesen Mörder endgültig aus dem Verkehr zu ziehen.«
Alle Muskeln im Gesicht des Richters verkrampften sich, doch seine Stimme blieb bemerkenswert beherrscht. »Ich rate Ihnen, diesen Gerichtssaal auf der Stelle zu verlassen, bevor Sie noch etwas sagen, wofür Sie wegen Missachtung des Gerichts bestraft werden müssen.«
Duncan zielte mit dem Finger auf den Ausgang, durch den Savich und sein Anwalt verschwunden waren. »Savich dreht Ihnen eine lange Nase, genau wie mir. Er bringt für sein Leben gern andere Menschen um, und Sie haben ihm eben einen Freifahrtschein übergeben, rauszugehen und ein paar Menschen mehr umzubringen.«
»Mein Beschluss entspricht dem, was das Gesetz diktiert.«
»Nein, was Sie getan haben …«
»Duncan, bitte«, beschwor ihn DeeDee.
»… ist der letzte Scheiß. Sie haben die Leute beschissen, die Sie gewählt haben, weil Sie geglaubt haben, Sie wären hart zu Kriminellen wie Savich, so wie Sie es versprochen haben. Sie haben Detective Bowen hier beschissen, die Staatsanwaltschaft und jeden anderen, der je versucht hat, diesen Dreckskerl hinter Gitter zu bringen. Genau das haben Sie getan. Euer Ehren.«
»›Haende hoch‹.«
»Was?«
»Das Wort mit zehn Buchstaben für Aufgeben.«
DeeDee verfolgte fassungslos, wie Duncan sich auf dem Beifahrersitz niederließ und den Gurt anlegte. »Achtundvierzig Stunden im Knast, und das ist das Erste, was du zu sagen hast?«
»Ich hatte jede Menge Zeit zum Nachdenken.«
»›Hände hoch‹ sind zwei Wörter, du Genie.«
»Ich wette, es passt trotzdem.«
»Wir werden es nie erfahren. Ich habe das Kreuzworträtsel weggeworfen.«
»Hast du es nicht fertig gebracht?« Er wusste, dass sie das ärgerte, weil er normalerweise jedes Rätsel lang vor ihr geknackt hatte. Er besaß die Gabe, Rätsel zu lösen; sie nicht.
»Nein, ich habe es weggeworfen, weil ich nichts behalten wollte, was mich an deinen peinlichen Auftritt im Gerichtssaal erinnert hätte.« Sie bog aus dem Parkplatz des Arrestgebäudes und fuhr in Richtung Innenstadt. »Du hast wirklich die Backen aufgeblasen.«
Er saß brütend neben ihr und schwieg.
»Hör zu, Duncan, ich verstehe genau, warum du Savich schnappen willst. Wir wollen das alle. Er ist das Fleisch gewordene Böse. Aber einen Richter in seinem eigenen Gerichtssaal beleidigen? Das ist Wahnsinn. Damit hast du dir und dem ganzen Department einen Bärendienst erwiesen.« Sie warf ihm einen kurzen Seitenblick zu. »Natürlich steht es mir nicht an, dich zu belehren. Immerhin bist du der Senior in unserem Team.«
»Danke, dass du das nicht vergessen hast.«
»Ich sage das als deine Freundin. Und ich sage es nur zu deinem Besten. Dein Eifer ist bewundernswert, aber du musst lernen, dein Temperament zu zügeln.«
Weil er sich überhaupt nicht eifrig fühlte, starrte er missmutig durch die Windschutzscheibe. Savannah schwitzte unter einer glühenden Sonne. Die Luft war mit Feuchtigkeit beladen. Alles wirkte schlaff, verwelkt und so ausgelaugt, wie er sich fühlte. Die Klimaanlage in DeeDees Wagen führte einen aussichtslosen Kampf gegen die schwüle Luft. Schon jetzt war sein Hemdrücken durchnässt.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ich habe heute Morgen geduscht, aber ich stinke immer noch nach Knast.«
»War es schlimm?«
»Eigentlich nicht, trotzdem möchte ich so schnell nicht wieder hin.«
»Gerard ist gar nicht glücklich mit dir.« Damit meinte sie Lieutenant Bill Gerard, ihren gemeinsamen direkten Vorgesetzten.
»Richter Laird lässt Savich davonspazieren, und Gerard ist nicht glücklich mit mir?«
DeeDee hielt an einer Ampel und sah ihn an. »Ich sag dir jetzt was, aber werd nicht gleich sauer.«
»Ich dachte, die Standpauke wäre überstanden.«
»Du hast dem Richter keine andere Wahl gelassen.« In den zwei Jahren, seit DeeDee ins Morddezernat gewechselt hatte und seine Partnerin geworden war, hatte er noch nie auch nur einen Funken Mutterinstinkt an ihr bemerkt. Doch jetzt wirkte ihre Miene beinahe mütterlich. »Nachdem du den Richter so beschimpft hast, sah er sich praktisch gezwungen, dich wegen Missachtung des Gerichts zu bestrafen.«
»Dann haben Seine Ehren und ich etwas gemeinsam. Ich sehe mich auch gezwungen, ihn mit Verachtung zu strafen.«
»Ich glaube, das hat er mitbekommen. Und was Gerard angeht, so vertritt er natürlich die Firma. Er kann nicht zulassen, dass seine Detectives einen Richter am Kammergericht beleidigen.«
»Okay, okay, ich gebe zu, dass ich mich nicht einwandfrei betragen habe. Ich gelobe, bei Savichs nächster Verhandlung als perfekter Gentleman aufzutreten, sanft wie ein Lamm, solange Richter Laird uns im Gegenzug etwas Spielraum lässt. Nach der Aktion von vorgestern ist er uns was schuldig.«
»Äh, Duncan.«
»Äh, was?«
»Mike Nelson hat heute Nachmittag angerufen.« Sie zögerte und seufzte dann. »Der Staatsanwalt ist der Auffassung, dass wir nicht genug gegen Savich in der Hand haben …«
»Ich möchte das eigentlich gar nicht hören, oder?«
»Er sagte, dass die Anklage von Anfang an auf wackeligen Füßen gestanden hätte, dass wir wahrscheinlich sowieso keine Verurteilung erreicht hätten und dass er den Fall nicht noch mal vor Gericht bringen wird. Nicht bevor wir unwiderlegbar nachweisen können, dass Savich am Tatort war.«
Duncan hatte das schon befürchtet, aber es tatsächlich zu hören war schlimm. Er ließ den Kopf gegen die Nackenstütze sinken und schloss die Augen. »Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich noch für Savich oder irgendeinen anderen dieser Kotzbrocken interessiere. Sonst tut es auch niemand. Wahrscheinlich ist der Staatsanwalt wütender auf mich als auf den Neandertaler, der gestern Nacht wegen eines Koteletts seine Frau massakriert hat. Er war in der Zelle neben meiner untergebracht. Ich kann gar nicht zählen, wie oft er mir erklärt hat, dass die Schlampe es nicht anders verdient hatte.«
Seufzend rollte er den Kopf zur Seite und schaute aus dem Fenster auf die ausladenden alten Eichen längs des Boulevards. Das von den Ästen hängende Louisianamoos wirkte in der drückenden Hitze schmutzig grau.
»Mal im Ernst, wozu machen wir uns überhaupt die Mühe?«, fragte er rhetorisch. »Im Grunde erweist Savich der Öffentlichkeit einen Dienst, wenn er ab und zu einen Speed-Dealer wie Freddy abknallt, oder?«
»Nein, weil Savich schon einen Ersatzmann ins Geschäft gebracht hat, noch bevor der Leichnam des Speed-Dealers ausgekühlt ist.«
»Also, ich wiederhole, wozu das Ganze? Ich kann nichts von dem Eifer spüren, den du mir zuschreibst. Mich interessiert das alles einen feuchten Dreck. Von jetzt an.«
DeeDee verdrehte die Augen.
»Weißt du, wie alt ich bin?«, fragte er.
»Siebenunddreißig.«
»Acht. Und in zwanzig Jahren bin ich achtundfünfzig. Dann habe ich eine Riesenprostata und einen Schrumpelschwanz. Mein Haar wird immer dünner und mein Bauch immer dicker.«
»Und deine Ansichten immer pessimistischer.«
»Damit hast du verflucht recht.« Er setzte sich wütend auf und hackte mit dem Zeigefinger auf das Armaturenbrett ein, während er seine Argumente herunterbetete. »Weil ich mich zwanzig weitere Jahre vergeblich abgerackert haben werde. Weil immer neue Saviches ihr Unwesen treiben werden. Wozu also das Ganze?«
Sie lenkte an den Bordstein und hielt an. Erst in diesem Augenblick ging ihm auf, dass sie ihn nach Hause gefahren hatte und nicht zu dem Parkplatz vor dem Gerichtsgebäude, wo sein Wagen stand, seit er in Arrest genommen und aus dem Gerichtssaal abgeführt worden war.
DeeDee sank in ihren Sitz zurück und sah ihn an. »Zugegeben, wir mussten einen Rückschlag hinnehmen. Morgen …«
»Rückschlag? Rückschlag? Wir sind so tot wie der arme Freddy Morris. Diese Exekution hat jeden von Savichs Drogenkurieren abgeschreckt, der auch nur im Entferntesten mit dem Gedanken gespielt hat, einen Deal mit uns oder den Bundesbehörden abzuschließen. Savich hat Freddy benützt, um eine Botschaft zu verbreiten, und diese Botschaft wurde überall verstanden. Wer quatscht, stirbt, und das auf eine sehr hässliche Art. Niemand wird reden.« Die letzten drei Wörter betonte er besonders.
Er rammte die Faust in die Handfläche. »Ich fasse es nicht, dass uns dieses aalglatte Arschloch schon wieder entwischt ist. Wie schafft er das nur? Niemand hat so viel übernatürliches Glück. Oder so viel Grips. Irgendwo auf seinem mit Leichen gepflasterten Weg muss er einen Deal mit dem Teufel geschlossen haben. Alle Dämonen der Hölle müssen für ihn arbeiten. Aber eines schwöre ich dir, DeeDee. Selbst wenn es das Letzte ist, was ich tue …« Er bemerkte ihr Lächeln und verstummte. »Was?«
»Schau nicht in den Spiegel, Duncan, aus dir glüht schon wieder der Eifer.«
Er brummelte ein, zwei Flüche, löste den Gurt und drückte die Autotür auf. »Danke fürs Mitnehmen.«
»Ich komme mit rein.« Bevor sie ausstieg, drehte sie sich zum Türhaken um, an dem ein Kleiderbügel mit dem Plastiküberzug der Trockenreinigung hing.
»Was ist das?«
»Das Kostüm, das ich heute Abend tragen werde. Ich ziehe mich bei dir um, dann erspare ich mir die lange Fahrt nach Hause und wieder in die Stadt zurück.«
»Was ist denn heute Abend?«
»Der Empfang zur Preisverleihung.« Sie sah ihn fassungslos an. »Sag bloß, du hast das vergessen.«
Er fuhr sich mit den Fingern durch das widerspenstige Haar. »Ja, habe ich. Entschuldige, Partner, aber danach steht mir heute absolut nicht der Sinn.«
Er wollte diesen Abend keinesfalls unter Kollegen verbringen. Er wollte Bill Gerard nicht auf einem halboffiziellen Anlass begegnen, wenn er wusste, dass er gleich morgen früh zu einer guten, altmodischen Gardinenpredigt in sein Büro zitiert würde. Zu einer durchaus verdienten Predigt, nachdem er im Gerichtssaal die Beherrschung verloren hatte. So gerechtfertigt Duncans Zorn auch war, es war falsch gewesen, ihm zu diesem Zeitpunkt freien Lauf zu lassen. DeeDee hatte ganz recht mit dem, was sie gesagt hatte – er hatte ihnen geschadet, nicht genutzt. Bestimmt hatte Savich das extrem gut gefallen.
Sie bückte sich, hob die beiden Zeitungen vom Gehweg auf und klatschte sie gegen seinen Bauch. »Du wirst zu dem Empfang gehen«, verkündete sie und erklomm die Ziegelstufen zum Eingang seines Stadthauses.
Sobald er die Tür aufgeschlossen hatte und sie beide im Haus waren, eilte er geradewegs zum Wandthermostat und stellte die Klimaanlage höher.
»Wie kommt’s, dass die Alarmanlage nicht eingeschaltet war?«, fragte DeeDee.
»Ich vergesse immer wieder den Code.«
»Du vergisst nie etwas. Du bist bloß zu faul. Es ist dumm, die Alarmanlage nicht einzuschalten, Duncan. Vor allem jetzt.«
»Warum vor allem jetzt?«
»Savich. Sein Abschiedsgruß: ›Wir sehen uns. Bald.‹ Das hat nach einer Drohung geklungen.«
»Ich wünschte, er wollte mir ans Leder. Das gäbe mir einen guten Grund.«
»Wofür?«
»Alles zu tun, was nötig ist.« Er schleuderte sein Sportsakko auf einen Stuhl und machte sich auf den Weg durch den Flur zur Küche, die auf der Rückseite des Hauses lag. »Du weißt, wo das Gästezimmer und das Bad sind.« Er deutete auf die Treppe. »Fühl dich wie zu Hause.«
DeeDee folgte ihm auf den Fersen. »Du wirst mit mir auf diesen Empfang gehen, Duncan.«
»O nein, denn ich werde mir ein Bier, eine Dusche und ein Schinkensandwich mit so scharfem Senf gönnen, dass es mir die Tränen in die Augen treibt, und dann werde ich …«
»Klavier spielen?«
»Ich spiele nicht Klavier.«
»Richtig«, ergänzte sie sarkastisch.
»Ich wollte sagen, dass ich dann den Sportkanal einschalten und früh ins Bett gehen werde. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich mich darauf freue, nach zwei Nächten auf einer Gefängnispritsche endlich wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. Vor allem werde ich auf gar keinen Fall in einen Anzug steigen und zu diesem Empfang gehen.«
Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Du hast es versprochen.«
Er öffnete den Kühlschrank, fasste ohne hinzusehen hinein, zog eine Bierdose heraus, öffnete sie und lutschte den Schaum von seinem Handrücken. »Das war vor meiner Einkerkerung.«
»Ich bekomme eine Belobigung.«
»Die du durchaus verdient hast. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Witwe geknackt, die mit dem Stemmeisen ihrem Knacker den Schädel eingeschlagen hat. Superinstinkt, Partner. Ich bin wirklich stolz auf dich.« Er prostete ihr mit seiner Bierdose zu und setzte sie dann an den Mund.
»Darum geht es gar nicht. Ich will nicht allein zu einem Galaempfang gehen. Du bist mein Geleit.«
Er lachte so, dass das Bier aus seinem Mund sprühte. »Ihr trefft euch nicht zum Quadrilletanzen. Und seit wann brauchst du Geleit? Ehrlich gesagt ist es das erste Mal, dass ich dieses Wort aus deinem Mund höre.«
»Wenn ich ohne Geleit auftauche, habe ich den ganzen Abend die Holzköpfe am Hals. Worley und Genossen werden behaupten, dass ich kein Date auftreiben könnte, selbst wenn es um Leben und Tod ginge. Du bist mein Partner, Duncan. Es ist deine Pflicht, mir Rückendeckung zu geben, und dazu gehört auch, dass du mir hilfst, mein Gesicht gegenüber diesen Knallchargen zu wahren, mit denen zu arbeiten ich gezwungen bin.«
»Ruf doch den Kollegen bei der Beweissicherung an. Wie heißt er noch? Der wird doch rot, sobald er dich nur sieht. Der würde dich bestimmt geleiten.«
Sie verzog angewidert das Gesicht. »Er hat einen feuchten Händedruck. Das kann ich nicht ab.« Sie sah ihn zutiefst entrüstet an. »Es kostet dich nur ein paar Stunden, Duncan.«
»Tut mir leid.«
»Du willst bloß nicht mit mir zusammen gesehen werden.«
»Was redest du da? Ich werde ständig mit dir zusammen gesehen.«
»Aber nie privat. Ein paar von den Leuten dort wissen möglicherweise nicht, dass ich deine Kollegin bin. Der Himmel möge verhüten, dass sie mich irrtümlich für deine Freundin halten. Mit einer kleinen kraushaarigen Dicken gesehen zu werden könnte deinem Ruf als Deckhengst schaden.«
Er knallte die Bierdose auf die Küchentheke. »Mach mich nicht sauer. Erstens habe ich keineswegs diesen Ruf. Und zweitens, wer nennt dich klein?«
»Worley hat mich als vertikal minderbemittelt bezeichnet.«
»Worley ist ein Arschloch. Und dick bist du erst recht nicht. Du bist kompakt gebaut. Muskulös, weil du trainierst wie eine Irre. Und deine Haare sind so kraus, weil du sie mit Dauerwellen strapazierst.«
»Dadurch sind sie pflegeleichter«, verteidigte sie sich. »Und sie fallen mir nicht immer in die Augen. Woher weißt du, dass es eine Dauerwelle ist?«
»Weil ich es rieche, wenn du sie frisch machen lässt. Meine Mom hat sich früher selbst zu Hause Dauerwellen gelegt. Das ganze Haus hat tagelang danach gestunken. Dad hat sie angebettelt, zum Frisiersalon zu gehen, aber sie meinte, das würde zu viel kosten.«
»Studio, Duncan. Man sagt nicht mehr Salon.«
»Ich weiß das wohl. Meine Mom nicht.«
»Wissen sie, dass du im Knast gesessen hast?«
»Ja.« Er klang zerknirscht. »Ich habe das eine mir zustehende Telefonat dazu verwendet, sie anzurufen, weil sie nervös werden, wenn sie nicht alle paar Tage von mir hören. Sie sind stolz auf meine Arbeit, aber sie haben auch Angst um mich. Du weißt, wie das ist.«
»Na ja, eigentlich nicht.« Sie klang so verdrossen wie immer, wenn es auch nur am Rande um ihre Eltern ging. »Wissen deine Leute von Savich?«, fragte sie.
Er zuckte mit den Achseln. »Ich spiele die Sache runter.«
»Was haben sie dazu gesagt, dass ihr Sohn im Knast sitzt?«
»Sie mussten mich schon mal während meiner HighSchool-Zeit aus dem Knast holen. Weil ich beim Trinken erwischt worden war. Im Unterschied zu damals hat mich mein Dad diesmal gelobt, weil ich für meine Überzeugung eingestanden bin. Natürlich habe ich ihm nicht erzählt, mit welchen Ausdrücken ich das getan habe.«
DeeDee lächelte. »Du hast wirklich Glück, dass sie so verständnisvoll sind.«
»Ich weiß.« Duncan wusste sehr wohl, wie glücklich er sich schätzen konnte. DeeDee hatte ein eher gespanntes Verhältnis zu ihren Eltern. In der Hoffnung, sie von diesem unangenehmen Thema abzulenken, sagte er: »Habe ich dir schon erzählt, dass Dad jetzt auf Hightech setzt? Er verfasst seine Predigten auf dem Computer. Er hat die ganze Bibel als Software und kann mit einem Tastendruck auf jede beliebige Stelle zugreifen. Allerdings sind nicht alle glücklich darüber. Ein Oldtimer in seiner Gemeinde ist überzeugt, dass das Internet vom Antichristen regiert wird.«
Sie lachte. »Vielleicht hat er recht.«
»Vielleicht.« Er griff nach seinem Bier und nahm noch einen Schluck.
»Nicht dass du mich gefragt hättest, aber ich hätte gern eine Cola Light, bitte.«
»Entschuldige.« Er öffnete den Kühlschrank und fasste hinein. Dann riss er mit einem Aufschrei die Hand zurück. »Uh!«
»Was denn?«
»Ich muss in Zukunft wirklich daran denken, die Alarmanlage einzuschalten.«
DeeDee schubste ihn beiseite und beugte sich in den Kühlschrank. Genau wie Duncan zuckte sie mit angewidertem Gesicht zurück. »Was ist das?«
»Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das ist Freddy Morris’ Zunge.«
2
Duncan wollte die abgeschnittene – und inzwischen mehrere Monate alte – Zunge am nächsten Morgen in die Gerichtsmedizin bringen. Einstweilen steckte er sie in einen Beweismittelbeutel und legte sie in den Kühlschrank zurück.
DeeDee traute ihren Augen nicht. »Du lässt sie doch nicht da drin, oder? Bei deinem Essen?«
»Ich möchte nicht, dass sie mir das Haus verstinkt.«
»Lässt du dein Haus auf Fingerabdrücke untersuchen?«
»Das würde nur Schmutz machen und nichts bringen.«
Wer auch in seinem Haus gewesen war, ob nun Savich oder einer seiner vielen Laufburschen – Duncan tippte auf Letzteres –, war bestimmt so schlau gewesen, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Dabei verstörte Duncan die Erkenntnis, dass jemand in sein Haus eingedrungen war, viel mehr als der Fund des ekligen, verschrumpelten Gewebeteiles. Für sich allein genommen war die hinterlegte Zunge nur ein geschmackloser Schabernack. Savichs Art, »Ätschbätsch« zu sagen. Er wollte Duncan die Niederlage unter die Nase reiben.
Die Botschaft, die damit ausgedrückt wurde, war allerdings nicht zum Lachen. Duncan hatte die unterschwellige Drohung in Savichs Abschiedsworten wohl vernommen, aber dies hier war nicht die Vergeltung, die Savich damit angekündigt hatte. Dies war nur ein Vorspiel, ein Vorgeschmack auf das, was noch folgen würde. Es verkündete aller Welt, dass Duncan verletzlich war und dass Savich es ernst meinte. Indem er in Duncans Heim eingedrungen war, hatte er ihren Krieg auf eine neue Ebene gehoben. Und nur einer von beiden würde überleben.
Obwohl Duncan in DeeDees Anwesenheit seine innere Unruhe nach besten Kräften überspielte, hütete er sich davor, Savich und seine Brutalität zu unterschätzen. Wenn er seine Attacke auf Duncan starten würde, dann wäre er gnadenlos.
Er hatte gehofft, der Vorfall würde ihn von der Verpflichtung befreien, DeeDee auf den Empfang zu begleiten. Bestimmt würde sie jetzt nicht mehr verlangen, dass er mitkam. Doch sie beharrte darauf, und letztendlich gab er sich geschlagen. Er zog einen dunklen Anzug an und fuhr mit ihr zu einem der großen Hotels am Fluss, wo der Empfang gegeben wurde.
Sobald er den Saal betreten hatte, ließ er den Blick über die Gäste schweifen und blieb wie angewurzelt stehen. »Ich glaube es einfach nicht!«, schnaufte er.
DeeDee folgte seinem Blick und stöhnte auf. »Ich wusste nicht, dass er auch kommt, Duncan, ehrlich.«
Richter Cato Laird plauderte, makellos gekleidet und so kühl wie der Drink in seiner Hand, gerade mit Chief Taylor.
»Hiermit entbinde ich dich offiziell von deinen Verpflichtungen«, sagte DeeDee. »Ich werde dir nicht widersprechen, falls du jetzt gehen möchtest.«
Duncans Blick lag wie gebannt auf dem Richter. Wenn Laird lachte, knitterten seine Augenwinkel elegant. Er sah aus wie ein Mann, der überzeugt war, in seinem ganzen Leben immer nur richtige Entscheidungen getroffen zu haben, von der Wahl seiner Krawatte heute Abend bis zu der Einstellung des Verfahrens gegen Savich.
Auf gar keinen Fall würde Duncan jetzt den Schwanz einziehen und davonschleichen. »Scheiße, nein«, sagte er zu DeeDee. »Ich lasse mir doch nicht die Gelegenheit entgehen, dir Geleit zu geben, wenn du so aufgeputzt bist. Du trägst sogar einen Rock. Das ist das erste Mal, dass ich dich in einem sehe.«
»Nach der katholischen Highschool habe ich ihnen für alle Zeiten abgeschworen, dachte ich zumindest.«
Er sah betont auf ihre Beine. »Besser als anständig. Sogar ziemlich gut.«
»Du bist so ein Lügner, aber danke.«
Gemeinsam arbeiteten sie sich durch die Menge vor, wobei sie ab und zu stehen blieben, um mit anderen Polizisten zu plaudern oder um Lebensabschnittsgefährten vorgestellt zu werden, die sie bis dahin nicht kennen gelernt hatten. Ein paarmal wurde Duncan auf seinen Gefängnisaufenthalt angesprochen, zum Teil erbost, zum Teil mitfühlend. Er reagierte jedes Mal mit einem Scherz.
Als Taylor sie entdeckte, löste sich der Polizeichef aus der Gruppe, in der er gerade stand, und kam auf sie zu, um DeeDee seine Glückwünsche zu der Belobigung auszusprechen, die sie an diesem Abend überreicht bekommen sollte. Während sie ihm noch dankte, sprach jemand Duncan von hinten an.
Er drehte sich um und sah sich Cato Laird gegenüber, dessen gefasstes Gesicht so unschuldig und treuherzig wirkte wie der erste Sopran im Kirchenchor seines Vaters. Duncans Kiefer spannte sich unwillkürlich an, aber er begrüßte ihn mit einem zivilen: »Richter Laird.«
»Detective. Ich hoffe, Sie tragen mir das nicht nach.« Er streckte ihm die rechte Hand hin.
Duncan ergriff sie. »Die Gefängnisstrafe? Das war ganz allein meine Schuld.«
»Und was ist mit der Verfahrenseinstellung?«
Duncan sah an der Schulter des Richters vorbei. Obwohl DeeDee gerade dem Bürgermeister vorgestellt wurde, der enthusiastisch ihre Hand auf und ab pumpte, blickte sie nervös zu ihm und Laird herüber. Duncan hätte dem Richter zu gern ausführlich und drastisch geschildert, was er von dessen Entscheidung hielt und wo er sich sein Hämmerchen hinschieben konnte.
Aber dieser Abend gehörte DeeDee. Er würde sich zügeln. Er würde dem Richter nicht einmal von der unappetitlichen Überraschung erzählen, die ihn bei seiner Heimkehr zu Hause erwartet hatte.
Sein Blick verband sich mit den dunklen Augen des Richters. »Sie wissen genauso gut wie ich, dass Savich für Morris’ Tod verantwortlich ist, daher bin ich überzeugt, dass Sie meine Vorbehalte, ihn freizulassen, teilen.« Er holte Luft, damit die Worte nachwirken konnten. »Aber ich bin genauso überzeugt, dass Sie unter den gegebenen Umständen entsprechend dem Gesetz und nach bestem Gewissen entschieden haben.«
Richter Laird nickte bedacht. »Ich bin froh, dass Sie die komplexen Bedingungen dieser Entscheidung nachvollziehen können.«
»Nun, ich hatte achtundvierzig Stunden Zeit, darüber nachzudenken.« Er lächelte, aber falls der Richter einen Funken Menschenkenntnis besaß, musste er erkennen, dass es kein freundliches Lächeln war. »Bitte entschuldigen Sie mich. Meine Partnerin möchte, dass ich wieder zu ihr stoße.«
»Natürlich. Genießen Sie den Abend.«
Der Richter trat beiseite, und Duncan schob sich an ihm vorbei.
»Was hat er gesagt?«, fragte DeeDee leise, als Duncan ihren Arm nahm und sie in Richtung Bar führte.
»Dass ich den Abend genießen soll. Und dazu gehört ein Drink, finde ich.«
Er drängelte sich durch die Menge an die Bar vor, wo er für sich einen Bourbon mit Wasser und für DeeDee eine Cola Light bestellte. Ein weiterer Detective aus ihrer Abteilung schob sich an ihn und DeeDee heran, einen Drink in der einen Hand balancierend und einen Teller voller Häppchen in der anderen.
»Hey, Dunk«, nuschelte er durch den Krabbendip in seinem Mund. »Stell mich deiner neuen Flamme vor.«
»Leck mich, Worley«, sagte sie.
»Hast du das gehört? Sie hört sich fast an wie Detective Bowen!«
Worley war ein guter Polizist, aber eine der »Knallchargen«, von denen DeeDee vorhin gesprochen hatte. Er hatte immer einen Zahnstocher im Mund, so auch jetzt, obwohl er gerade von seinem Teller voller Kanapees aß. Er und DeeDee lagen in ewigem Wettstreit, wer den anderen besser beleidigen konnte. Gewöhnlich lagen beide gleichauf.
»Verzieh dich, Worley«, sagte Duncan. »DeeDee ist heute Ehrengast. Also benimm dich.«
DeeDee war grundsätzlich im Polizeimodus. Nachdem Duncan inzwischen seit zwei Jahren mit ihr zusammenarbeitete, hielt er es für möglich, dass es für sie gar keinen anderen Modus gab. Selbst heute Abend dachte sie wie eine Polizistin, trotz des Rockes und des Lippenstiftes, den sie sich zur Feier des Tages ins Gesicht geschmiert hatte. »Erzähl Worley, was wir bei dir zu Hause gefunden haben.«
Duncan beschrieb die abgetrennte Zunge. Er deutete auf einen Fleischlappen auf Worleys Teller. »So ungefähr sieht sie aus.«
»Ihh.« Worley schüttelte sich. »Woher wisst ihr, dass sie rechtmäßig Morris gehört?«
»Das ist nur eine Vermutung, aber eine ziemlich naheliegende, meinst du nicht auch? Ich bringe sie morgen ins Labor.«
»Savich versucht dich zu verarschen.«
»Er ist ein richtiger Spaßvogel, ich weiß.«
»Aber dir in deiner eigenen Wohnung zuzusetzen…« Worley ließ den Zahnstocher in den anderen Mundwinkel wandern und stopfte sich den fraglichen Fleischlappen in den Mund. »Das ist irre. Macht er dir Angst damit?«
»Er wäre blöd, wenn er keine Angst hätte«, antwortete DeeDee für ihn. »Stimmt’s, Duncan?«
»Wahrscheinlich schon«, erwiderte er gedankenverloren. Er sann darüber nach, ob er wohl fähig wäre, Savich ohne Gewissensbisse abzuknallen, falls es zum Showdown käme. Wahrscheinlich schon, denn er wusste mit absoluter Gewissheit, dass Savich nicht zögern würde, ihn umzubringen.
Um die Stimmung ein wenig aufzulockern, sagte Worley: »Ehrlich, DeeDee, du siehst heute Abend irgendwie heiß aus.«
»Das wird dir nichts nutzen.«
»Wenn ich genug saufe, könnte ich dich sogar für eine richtige Frau halten.«
DeeDees Reaktion ließ nicht auf sich warten. »Leider kann ich unmöglich so viel trinken, dass ich dich für einen Mann halten könnte.«
Das war das gewohnte Bürogeplänkel. Die Männer im Dezernat für Gewaltverbrechen zogen DeeDee ständig auf, doch alle schätzten sie für ihre Fähigkeiten, ihren Einsatzwillen und für ihren Ehrgeiz, wovon sie mehr als genug besaß. Wenn es hart auf hart kam, verstummten alle Neckereien, und ihre Meinung wurde genauso respektiert wie die der Männer, manchmal sogar noch mehr. »Weibliche Intuition« war keine hohle Phrase mehr. Dank DeeDees Scharfblick hatten alle angefangen, daran zu glauben.
Da er wusste, dass sie auch ohne seine Hilfe zurechtkommen würde, wandte sich Duncan ab und ließ seinen Blick über die Menge wandern.
Später sollte er sich daran erinnern, dass ihm zuerst ihr Haar ins Auge gefallen war.
Sie stand direkt unter einem der Strahler, die alle zehn Meter in die Decke eingelassen waren. Das Licht wirkte wie ein Scheinwerfer, der ihr Haar fast weiß glänzen ließ und sie selbst aus der Menge heraushob, als wäre sie die einzige Blondine im ganzen Saal.
Es war schlicht, schon fast streng frisiert – zu einem kleinen Knoten knapp über ihrem Nacken –, es hob die perfekte Kopfform hervor und betonte den langen, elegant geschwungenen Hals. Er bewunderte immer noch ihren blassen Nacken, als eine unauffällige Frau, die ihm den Blick auf den Rest ihres Körpers verstellt hatte, beiseitetrat. Dann sah er ihren Rücken. Und zwar ganz. Verlockende nackte Haut vom Hals bis zur Taille, sogar noch ein Stück tiefer.
Er hatte nicht gewusst, dass man an diesem Körperteil überhaupt Schmuck tragen konnte, und doch prangte dort eine Brosche mit offenbar echten Diamanten, die ihm von ihrer Taille aus zuzuzwinkern schienen. Er stellte sich vor, dass die Steine von ihrer Haut angewärmt sein mussten.
Er merkte, wie seine Haut ebenfalls warm wurde, während er sie ansah.
Jemand trat von hinten an sie heran und sagte etwas zu ihr. Sie drehte sich um, und Duncan sah zum ersten Mal ihr Gesicht. Später war er nicht sicher, ob ihm in diesem Augenblick nicht das Kinn heruntergeklappt war.
»Dunk?« Worley stupste seinen Arm. »Alles okay?«
»Ja. Klar.«
»Ich hab dich gerade gefragt, wie es im Knast war.«
»Ach, ganz toll.«
Der Detective beugte sich vertraulich vor und feixte: »Musstest du viele Zellengenossen abwehren, die auf eine kleine Romanze gehofft haben?«
»Nein, die haben alle nach dir geschmachtet, Worley.«
DeeDee musste so lachen, dass sie dabei grunzte. »Gut gegeben, Duncan.«
Er wandte sich wieder ab, doch die Blondine war nicht mehr an dem Fleck, an dem er sie gesehen hatte. Ungeduldig suchten seine Augen die Menge ab, bis er sie wieder geortet hatte. Sie unterhielt sich gerade mit einem distinguierten älteren Paar und nippte an einem Glas Weißwein, ohne erkennbares Interesse an ihrem Getränk oder dem Gespräch zu zeigen. Sie lächelte höflich, doch ihr Blick wirkte abwesend, so als nähme sie gar nicht an dem Teil, was um sie herum vorging.
»Du sabberst.« DeeDee stand jetzt neben ihm und folgte seinem Blick auf die Frau. »Ehrlich, Duncan«, erklärte sie ihm genervt. »Du machst dich zum Clown.«
»Ich kann nicht anders. Ich bin ihr auf der Stelle verfallen.«
»Zügle dich.«
»Ich kann nicht, glaub mir.«
»Du willst nicht, meinst du.«
»Na schön, ich will nicht. Ich wusste nicht, dass es sich so gut anfühlt, vom Blitz getroffen zu werden.«
»Vom Blitz?«
»Genau. Oder von mehreren gleichzeitig.«
DeeDee musterte die Frau kritisch und zuckte mit den Achseln. »Sie ist okay, schätze ich. Wenn jemand auf groß, dünn, perfektes Haar und makellose Haut steht.«
»Ganz zu schweigen von ihrem Gesicht.«
Sie lutschte lautstark an ihrer Cola. »Das auch. Das muss man ihr neidlos zugestehen. Wie üblich hat dein sexuelles Radar das schärfste Babe im ganzen Saal erfasst.«
Er schenkte ihr ein boshaftes Lächeln. »Ich habe da so eine Gabe.«
Das Paar löste sich von der Frau, die daraufhin ganz allein inmitten der Menge stand. »Die Lady sieht einsam und verloren aus«, sagte Duncan. »Als müsste sie von einem großen starken Bullen gerettet werden. Halt mal mein Glas.« Er drückte DeeDee seinen Drink in die Hand.
»Hast du den Verstand verloren?« Sie baute sich vor ihm auf und verstellte ihm den Weg. »Das wäre der Gipfel der Blödheit. Ich werde nicht untätig zusehen, wie du dich selbst zerstörst.«
»Was redest du da?«
DeeDee sah ihn an, als würde ihr plötzlich ein Licht aufgehen. »Ach so. Du weißt es wirklich nicht.«
»Was?«
»Sie ist verheiratet, Duncan.«
»Scheiße. Sicher?«
»Mit Richter Cato Laird.«
»Was hat er zu dir gesagt?«
Elise Laird stellte ihre juwelenbesetzte Handtasche auf dem Frisiertisch ab und schlüpfte aus ihren Sandalen. Cato war vor ihr ins Schlafzimmer hochgegangen. Er war schon ausgezogen und saß im Bademantel auf der Bettkante.
»Wer?«, fragte sie.
»Duncan Hatcher.«
Sie zog eine Nadel aus ihrem Haar. »Wer?«
»Der Mann, mit dem du in der Wagenauffahrt gesprochen hast. Während ich den Burschen vom Parkservice bezahlt habe. Das hast du doch bestimmt nicht vergessen. Groß, kernig, müsste dringend zum Friseur, gebaut wie ein Footballspieler. Der er auch war. In Georgia, wenn ich mich recht entsinne.«
»Ach, der.« Sie ließ die Haarnadeln neben ihre Handtasche fallen, löste den Haarknoten und kämmte dann mit den Fingern durch ihre Haare. Das Gesicht dem Spiegel zugewandt, lächelte sie das Spiegelbild ihres Mannes an. »Er hat mich gefragt, ob ich ihm Geld wechseln könnte. Er wollte dem Burschen vom Parkdienst ein Trinkgeld geben und hatte keinen kleineren Schein als einen Zehner.«
»Er hat nur gefragt, ob du ihm wechseln kannst?«
»Hmm.« Sie fasste an ihren Rücken und versuchte, den Verschluss der Diamantbrosche an ihrer Taille zu lösen. »Könntest du mir bitte helfen?«
Cato stand vom Bett auf und trat hinter sie. Er löste den Verschluss, zog vorsichtig die Nadel aus der schwarzen Seide, reichte ihr dann die Brosche und legte die Hände auf ihre Schultern, um sie sanft zu massieren. »Hat Hatcher dich mit Namen angesprochen?«
»Das weiß ich wirklich nicht mehr. Warum? Wer ist er?«
»Ein Detective aus dem Morddezernat.«
»In Savannah?«
»Ein mehrfach ausgezeichneter Polizist und studierter Kriminologe. Mit Herz und Hirn.«
»Beeindruckend.«
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Ricochet« bei Simon & Schuster, New York.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe September 2010 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © by Sandra Brown Management Ltd., 2006
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH. Umschlaggestaltung: HildenDesign, MünchenHildenDesign, München, nach einer Vorlage von bürosüd°, München Umschlagfoto: Franco Vogt / Corbis MD · Herstellung: sam
eISBN 978-3-641-10324-8
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe