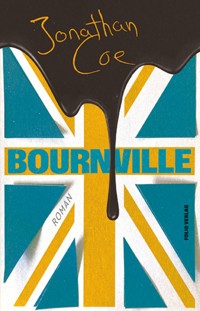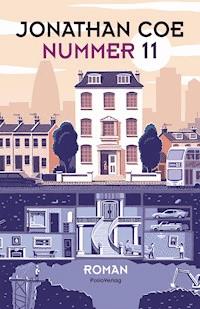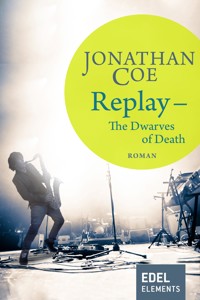Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Generation Z, rechte Denkfabriken und ein Mordfall. Finstere politische Machenschaften rütteln das langweilige Leben der jungen Phyl auf: Der Journalist Christopher will einen politischen Zirkel entlarven, der in Cambridge gegründet wurde, um die britische Regierung in eine rechtsextreme Richtung zu drängen. Seine Recherchen führen ihn zu einem Kongress in einem alten Herrenhaus. Dort nehmen die Ereignisse eine unheilvolle Wendung und ein Mord passiert. Liegt das Verbrechen in der aktuellen Politik oder in einem alten literarischen Rätsel begründet? Coes neuer Roman ist schön böse, witzig und messerscharf, spielt mit Genres und zeigt, dass der Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart oft in den dunkelsten Ecken der Vergangenheit zu finden ist. Ein raffiniertes literarisches Spiel und glänzende Unterhaltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Generation Z, rechte Denkfabriken und ein Mordfall.
Finstere politische Machenschaften rütteln das langweilige Leben der jungen Phyl auf: Der Journalist Christopher will einen politischen Zirkel entlarven, der in Cambridge gegründet wurde, um die britische Regierung in eine rechtsextreme Richtung zu drängen. Seine Recherchen führen ihn zu einem Kongress in einem alten Herrenhaus. Dort nehmen die Ereignisse eine unheilvolle Wendung und ein Mord passiert. Liegt das Verbrechen in der aktuellen Politik oder in einem alten literarischen Rätsel begründet? Coes neuer Roman ist schön böse, witzig und messerscharf, spielt mit Genres und zeigt, dass der Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart oft in den dunkelsten Ecken der Vergangenheit zu finden ist.
Ein raffiniertes literarisches Spiel und glänzende Unterhaltung.
»Der Roman ist ein verrücktes Verwirrspiel, ein schräges Memoir, ein raffiniertes Jeu d’esprit, ein heimliches Plädoyer für die Fiktion im postfaktischen Zeitalter und ein enormes Lesevergnügen.«The Guardian
www.folioverlag.com
»Meine Tochter‹, sagte er, ›hat wie immer eine starke Meinung, die sie auf unnachahmliche Weise kundtut. Wenn ihre Generation so denkt, müssen wir das akzeptieren. Noch lässt sich nicht sagen, ob Liz Truss tatsächlich ein Folterinstrument ist, das die Alten gegen die Jungen einsetzen wollen. Aber eins steht fest: Morgen wird sie Premierministerin, was bedeutet …‹ – und seine Worte würden Phyl im Gedächtnis bleiben und in den kommenden Wochen verfolgen –, ›dass sich Großbritannien morgen endgültig von der Realität verabschiedet. Morgen hört das reale Leben auf, und die Fiktion beginnt.«
DER AUTOR
JONATHAN COE, 1961 in Birmingham geboren, studierte am Trinity College in Cambridge und lebt in London. Neben dem Schreiben gilt seine Leidenschaft der Musik: Er hat mehrere Alben mit eigenen Kompositionen herausgebracht. Seine humorvollen und satirisch geprägten Romane stellen zumeist soziale Fragen in den Mittelpunkt. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Preis des Europäischen Buches 2019. Seine Bücher wurden verfilmt und in viele Sprachen übersetzt. Bei Folio sind auf Deutsch erschienen: Nummer 11 (2017), der Brexit-Roman und Bestseller Middle England (2020), Mr. Wilder & ich (2021) sowie Bournville (2023).
DIE ÜBERSETZERIN
CATHRINE HORNUNG gibt englischer und italienischer Literatur eine deutsche Stimme. Für Folio hat sie mehrere Romane von Jonathan Coe sowie Werke von Baret Magarian, Valeria Parrella und Massimo Carlotto über tragen. Ihre Übersetzungen entstehen an einem Schreibtisch in Süddeutschland und einem im Herzen Italiens.
Jonathan Coe
Der Beweis meiner Unschuld
Inhalt
Prolog 2. bis 5. September 2022
TEIL EINS Sieh hin
TEIL ZWEI Sag's weiter
TEIL DREI Sache geklärt
Epilog 27. Februar 2024
Dank
Anmerkungen der Übersetzerin
Die Kommissarin brauchte nicht lange, um ihre Zielperson in der Menge auszumachen, obwohl an diesem Dienstagvormittag reger Betrieb herrschte und die Halle von Paddington Station vor Fahrgästen wimmelte. Ihr Blick folgte der schattenhaften Gestalt, die verstohlen zu Gleis 5 huschte und in den Zug nach Worcester stieg.
Sie stieg ebenfalls ein und suchte sich einen Platz in der Nähe, aber nicht zu nah. Einen Wagen weiter. Wenn sie sich vorbeugte und durch die Glastür zwischen den beiden Waggons spähte, konnte sie die Zielperson im Auge behalten, ohne selbst gesehen zu werden.
Der Zug setzte sich pünktlich in Bewegung. Als er Fahrt aufnahm und durch die westlichen Vororte von London brauste, ertönte eine Durchsage aus dem Lautsprecher:
Wenn Sie etwas sehen, das Ihnen verdächtig vorkommt, sprechen Sie das Bahnpersonal darauf an oder senden Sie eine Textnachricht an die British Transport Police unter 61016.
Wir kümmern uns darum.
Sieh hin. Sag's weiter. Sache geklärt.
Etwas an der Durchsage störte die Kommissarin ungemein, wobei sie nicht genau sagen konnte, was es war. Sie wusste, dass die Zielperson in Moreton-in-Marsh aussteigen würde – eine Fahrt von etwa neunzig Minuten –, und sie hatte gehofft, diese Zeit nutzen zu können, um sich die Einzelheiten des Falls noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Aber alle paar Minuten wurde ihr Gedankengang von diesem nervigen Sicherheitshinweis unterbrochen.
Wenn Sie etwas sehen, das Ihnen verdächtig vorkommt, sprechen Sie das Bahnpersonal darauf an oder senden Sie eine Textnachricht an die British Transport Police unter 61016.
Wir kümmern uns darum.
Sieh hin. Sag's weiter. Sache geklärt.
Es war dieses ”Sache geklärt“, das sie so irritierte, befand sie schließlich. Das gekünstelt Volksnahe daran. Würde das irgendjemand ernsthaft so sagen? Wer auch immer sich das ausgedacht hatte, war offenbar krampfhaft bemüht gewesen, einen unelitären Ton anzuschlagen – einen, der alle ansprach –, aber musste der Slogan unbedingt so klingen, als stammte er aus einem Gangsterfilm, in dem so ein Schnösel aus der Londoner Oberschicht vergeblich einen auf Cockney macht?
Sie schüttelte den Gedanken ab und versuchte, sich auf den Fall zu konzentrieren, den Finger auf das eine Detail zu legen, das noch immer nicht passte. Sie war sich zu neunundneunzig Prozent sicher, dass die Person, die sie observierte, die Tat begangen hatte. Aber sie würde erst zufrieden sein, wenn das eine Prozent Zweifel ausgeräumt war.
Wenn Sie etwas sehen, das Ihnen verdächtig vorkommt, sprechen Sie das Bahnpersonal darauf an oder senden Sie eine Textnachricht an die British Transport Police unter 61016.
Wir kümmern uns darum.
Sieh hin. Sag's weiter. Sache geklärt.
Die Bahnhöfe zogen in rascher Folge vorüber. Reading. Oxford. Hanborough. Allmählich wurde die Zeit knapp. Charlbury. Kingham. Und da – nur fünf Minuten vor dem Ziel lichteten sich plötzlich die Wolken, und die Kommissarin glaubte das fehlende Puzzleteil gefunden zu haben. Sie zückte ihr Smartphone und landete nach wenigen Sekunden des Tippens und Scrollens auf einer Seite, die ihre Vermutung bestätigte. Voll und ganz bestätigte. Das letzte Prozent Zweifel war beseitigt. Der Moment war gekommen, die Vorsicht abzulegen und entschlossen zu handeln.
Die weißhaarige, ganz in Schwarz gekleidete Kommissarin erhob sich von ihrem Sitz und ging in den nächsten Wagen. Ihr Körper schwankte mit der Bewegung des Zuges. Dann stand sie vor der Zielperson: Sie war über ihr Smartphone gebeugt, auf dem eine Liveübertragung aus Downing Street No. 10 lief. Als der Schatten des Gesetzes auf das Display fiel, hob sie langsam den Blick und richtete ihre wachsamen, fragenden Augen auf die Kommissarin, die sah, wie der Funke des Wiedererkennens in ihnen aufflammte. Sie nannte den vollen Namen der Person und sagte: ”Ich verhafte Sie wegen des Mordes an –“, bevor sie erneut unterbrochen wurde.
Wenn Sie etwas sehen, das Ihnen verdächtig vorkommt, sprechen Sie das Bahnpersonal darauf an oder senden Sie eine Textnachricht an die British Transport Police unter 61016.
Wir kümmern uns darum.
Sieh hin. Sag's weiter. Sache geklärt.
Prolog 2. bis 5. September 2022
Phyl lehnte sich auf der Gartenbank nach vorn und spürte, wie ein Frösteln durch ihren Körper lief. Es war zwanzig vor acht, die Sonne ging bereits unter und die Abende wurden allmählich kühler. Die hohe, sorgfältig gestutzte Ligusterhecke warf lange Schatten auf den Rasen, den ihr Vater wenige Tage zuvor in saubere Streifen gemäht hatte. Aus den Tiefen des Seerosenteichs schwamm Gregory, der betagte Goldfisch mit dem alliterierenden Namen, gelegentlich an die Oberfläche und warf ihr mit seinen wulstigen Lippen gleichgültige Küsse zu. Vögel (sie wusste nicht, welche) saßen auf Bäumen, die sie nicht hätte benennen können, und sangen ihre Sonnenuntergangslieder. Wolken durchzogen den sich rötenden Himmel, und zwischen ihnen konnte sie in der Ferne das silberne Glitzern eines Flugzeugs erkennen, das sich im langsamen Anflug auf Heathrow befand. Es war ein friedliches Idyll, das sie völlig kaltließ. Sie hatte das Wort, das heute auf Wordle gesucht wurde, in drei von sechs möglichen Versuchen erraten und stellte beim Überprüfen ihrer Statistik fest, dass sie inzwischen achtundsechzig dieser Worträtsel gelöst hatte. Demnach waren heute, am Freitag, den 2. September, achtundsechzig Tage vergangen, seit sie die Universität verlassen hatte. Achtundsechzig Tage, seit ihr Vater mit dem neuen Toyota, auf den er so stolz war, nach Newcastle gekommen war, ihre Habseligkeiten auf dem Rücksitz verstaut und sie für immer von dem schmuddeligen, modrigen, rattenverseuchten Haus weggeholt hatte, in dem sie das glücklichste Jahr ihres Lebens verbracht hatte. Weg von den sechs Mitbewohnern, deren banale Gespräche, penetrante Fröhlichkeit und eklige Angewohnheiten sie mehr vermisste, als sie sich je hätte vorstellen können. Weg von all dem und zurück nach Hause, in die Bequemlichkeit, die Ruhe und den lähmenden Wohlstand des Lebensalltags ihrer alternden Eltern. Sie fröstelte erneut.
Siebzehn Minuten vor acht. Die Zeit verging so langsam, wenn sie nicht arbeitete. Seit drei Wochen schob Phyl Neun-Stunden-Schichten in der Filiale einer äußerst erfolgreichen Fast-Food-Kette, die auf japanische Gerichte spezialisiert war. Die Filiale befand sich im Terminal 5 von Heathrow, ungefähr fünfzehn Meilen vom Haus ihrer Eltern entfernt. Das innovative Alleinstellungsmerkmal dieser Kette waren Miniaturtabletts mit Sushi, die auf schmalen Förderbändern an den Tischen der Gäste entlangfuhren. Die meisten dieser Häppchen wurden vor Ort zubereitet, sodass Phyl ihre Tage damit verbrachte, Gemüse zu schnippeln und winzige Reisbriketts mit hauchdünnen Räucherlachsscheiben zu belegen. Allmählich konnte sie auch die diversen japanischen Küchenmesser unterscheiden: Das breitklingige Usuba, das an ein Beil erinnerte, wurde zum Gemüseschneiden verwendet; das Yanagiba war besonders geeignet, um rohen Fisch in zarte Sashimi zu schneiden; mit dem schwereren, dickeren Deba ließen sich Gräten und kleine Knochen durchtrennen. Es war harte Arbeit, und nach neun Stunden (und einer zwanzigminütigen Mittagspause) brannten ihre Augen, der Rücken schmerzte, die Beine waren schwer und ihre Hände rochen unappetitlich nach Fisch. Doch die stumpfsinnige Langeweile dieser Tätigkeit half ihr, vorübergehend die stumpfsinnige Langeweile ihres häuslichen Lebens zu vergessen, und die lange, komplizierte Busfahrt vom Flughafen nach Hause gab ihr Zeit, um über ihre Zukunftspläne nachzudenken, beziehungsweise darüber, dass sie keine hatte. Sie wusste nicht, um welchen Job sie sich als Nächstes bewerben sollte oder was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wollte. Das heißt – abgesehen von einer Idee, die ihr seit Kurzem durch den Kopf ging, die jedoch so intim und so … kühn war, dass sie mit niemandem darüber zu sprechen wagte, schon gar nicht mit ihrem Vater oder ihrer Mutter.
Sie trug sich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben.
Aber was für ein Buch sollte es werden? Ein Roman? Ein Memoir? Irgendwas in der Grauzone dazwischen? Sie wusste es nicht. Phyl hatte noch nie etwas geschrieben, obwohl sie eine leidenschaftliche Leserin war. Sie wusste nur, dass sie seit ihrer Rückkehr von der Universität – nein, schon länger: zum ersten Mal hatte sie es in den langen, lethargischen Wochen nach den Abschlussprüfungen bemerkt – einen zunehmenden Drang verspürte, ein wachsendes Bedürfnis (das Wort war nicht zu stark), etwas zu schaffen, Worte auf einen Bildschirm zu bringen, zu versuchen, etwas Formschönes und Gehaltvolles aus dem plumpen Marmorblock ihres drögen, ziellosen Dahinlebens zu meißeln.
Sie wusste nicht, worum es in dem Buch gehen sollte. Aber heute hatte sie beschlossen, eine Episode auf jeden Fall darin aufzunehmen, etwas, das ihr ein paar Stunden zuvor passiert war. Kein großer Vorfall, aber einer, von dem sie wusste, dass sie ihn so schnell nicht vergessen würde.
Nachdem ihre Schicht um 15 Uhr zu Ende gewesen war, hatte sich Phyl zu den Aufzügen begeben und darauf gewartet, dass einer kam. Im Terminal 5 war es ruhig. Der Aufzug musste erst drei Stockwerke zu ihrer Etage hinauffahren, und dann musste man noch kurz warten, bis die Türen aufgingen. Es gab einen Knopf, um den Aufzug zu rufen, und einen, um die Türen zu öffnen, aber Phyl hatte inzwischen begriffen, dass diese Knöpfe nur Fassade waren und alles automatisch ablief. Es war buchstäblich sinnlos, sie zu drücken. Kurz bevor der Aufzug auf ihrer Ebene hielt, kam ein Mann in ihrem Alter dazu und stellte sich neben sie. Er hatte eine Sporttasche bei sich und trug Shorts, die seine gebräunten, muskulösen, behaarten Beine zur Geltung brachten (seit Phyl in Heathrow arbeitete, wunderte sie sich darüber, dass so viele Männer auf Flugreisen Shorts trugen). Der junge Mann wackelte ungeduldig mit dem Bein, als der Fahrstuhl endlich eintraf. Phyl stand näher an den Knöpfen, drückte sie aber nicht: Sie wusste, dass sich die Aufzugstüren nach zehn Sekunden automatisch öffnen würden. Schließlich erlebte sie das jeden Tag. Doch nach neun Sekunden konnte der Mann seine Ungeduld nicht länger bezähmen. Er wollte nicht, dass sein Zeitplan wegen dieser passiven, hilflosen Frau durcheinandergeriet. Er lehnte sich an Phyl vorbei zur Seite, drückte den Knopf, und tatsächlich öffneten sich nach einer Sekunde die Türen. Sie traten beide ein.
Als die Fahrt ins Erdgeschoss begann, wusste Phyl genau, was der Mann dachte: Er hatte die Situation gerettet. Ohne sein rasches, entschlossenes Eingreifen würden sie immer noch im dritten Stock stehen und darauf warten, dass die Türen aufgingen. Er strahlte eine solche Selbstgefälligkeit aus, dass man hätte meinen können, er warte darauf, beglückwünscht zu werden. Aber sie hatte nicht vor, ihn zu beglückwünschen. Vielmehr wuchs ihr Unmut, und nachdem sie eine Etage nach unten gefahren waren, musste sie ihm Luft machen.
”Sie wären sowieso aufgegangen“, sagte sie.
Er sah von seinem Smartphone auf. ”Was?“
”Die Türen. Sie wären sowieso aufgegangen.“
Er schaute sie ausdruckslos an.
”Du hättest den Knopf nicht drücken müssen.“
”Hab ich aber“, sagte er.
”Hättest du aber nicht müssen.“
”Ich hab ihn gedrückt“, sagte er, ”und die Türen sind aufgegangen. Komischer Zufall, was?“
”Sie wären aber sowieso aufgegangen.“
”Fahrstuhltüren gehen nicht einfach so auf, bloß weil man davorsteht.“
”Tun sie doch“, sagte Phyl. ”Bei diesen Türen ist das so.“
Er zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder seinem Smartphone zu.
”Ich fahre jeden Tag mit diesem Aufzug“, fuhr sie fort.
”Schön für dich“, gab er zurück, ohne aufzuschauen. Und nach einer kurzen Pause: ”Dann bist du ja 'ne echte Vielfliegerin. Denk mal an deinen CO2-Fußabdruck.“
”Sehr witzig“, sagte Phyl. ”Ich arbeite hier vielleicht.“
”Jetzt mal Klartext“, sagte der Mann und löste widerwillig den Blick von seinem Smartphone. Er wollte das Gespräch mit dieser Irren eindeutig beenden. ”Wenn ich nicht gewesen wäre, würden wir immer noch da oben stehen. Gib's einfach zu.“
Der Fahrstuhl blieb stehen und die Türen gingen auf.
”Siehst du!“, sagte Phyl. ”Sie sind aufgegangen. Ohne dass einer von uns einen Knopf gedrückt hätte.“
”Besorg dir ein Leben“, sagte er, bevor er in Richtung Taxistand davonstob. ”Beschissene Loserin.“
Sie stand da wie versteinert und starrte ihm nach. Sie war fassungslos – fassungslos und gelähmt, und in den nächsten Stunden ging ihr die letzte Bemerkung des Mannes nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatte auf der Busfahrt nach Hause darüber nachgedacht, und sie dachte auch jetzt noch darüber nach. Wenn sie nichts dagegen unternahm, bestand die Gefahr, dass sie den ganzen Abend und die ganze Nacht darüber nachdachte, bis sie einschlief, falls ihr das überhaupt gelingen würde (Schlaflosigkeit war gerade eines ihrer vielen Probleme). Daher tat sie, was sie in stressigen Momenten zu tun pflegte. Sie ging zurück ins Haus – wobei sie darauf achtete, die Garage, in der ihr Vater nach Kartons suchte, und das Arbeitszimmer, in dem ihre Mutter am Computer saß, zu umgehen –, lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer und streckte sich auf dem Bett aus. Die EarPods im Ohr, das Smartphone vor der Nase, ging Phyl auf Netflix und scrollte nach unten, um nach einer Folge von Friends zu suchen, die ihr zusagte. Das war für sie ein zuverlässiger televisueller Trostspender und eine der besten Methoden, um der Welt vorübergehend zu entfliehen. Sie hatte sämtliche Folgen schon mehr als ein Dutzend Mal gesehen, sodass es eigentlich egal war, welche sie anklickte. Heute war es Staffel 1, Folge 21: Die zweite Monica – die, in der Monicas Kreditkarte und Identität gestohlen werden. Es war eine starke Folge, fand Phyl, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Diebin als überaus spannende Figur entpuppte. Am Ende wanderte sie ins Gefängnis, aber Phyl hatte es immer schade gefunden, dass sie in keiner weiteren Folge mehr auftauchte. Sie hätte gern mehr über sie erfahren: Was war an ihrem eigenen Leben so schlecht, dass sie beschloss, die Identität einer anderen Person zu klauen und sich neu zu erfinden? Eine verlockende Vorstellung, in vielerlei Hinsicht. Zu verschwinden, sich in Luft aufzulösen, ein Leben voller Pannen und Peinlichkeiten hinter sich zu lassen, um als jemand völlig anderes wiederaufzutauchen. Wie befreiend eine solche Wiedergeburt sein musste …
Natürlich waren auch die Nebenhandlungen unterhaltsam: Ross' Suche nach einem neuen Zuhause für sein Äffchen, Joeys Suche nach einem markanten Künstlernamen … Für Phyl bestand der ganze Reiz des Friends-Universums in der wunderbaren Vorhersehbarkeit, die alle 236 Folgen durchzog. Als die einundzwanzigste zu Ende war, fühlte sie sich (wie immer) viel besser. Der verletzende Nachgeschmack, den die Begegnung im Aufzug hinterlassen hatte, verflog allmählich, und zurück blieb nur der Ärger über die Arroganz des Mannes. Sie war mehr denn je davon überzeugt, dass es reinigend und kathartisch sein würde, darüber zu schreiben. Sie wusste nur nicht, wie sie anfangen sollte. Vielleicht war es am besten, einfach loszulegen und die Geschichte zu erzählen, sie in Worte zu fassen und zu sehen, wohin das führte. Gingen Schriftsteller so vor?
Sie beschloss, in der Bibliothek ihres Vaters nach Inspiration zu suchen.
Das Pfarrhaus von Rookthorne war ein spätviktorianisches Gebäude, genau wie die Kirche, und genau wie die Kirche hatte es nichts Einladendes an sich, aber was ihm an Charme fehlte, machte es durch seine Größe mehr als wett. Allein das Erdgeschoss beherbergte eine riesige Gewölbeküche, ein Esszimmer, zwei Empfangszimmer, das Arbeitszimmer, in dem Phyls Mutter mit ihrem ”Kirchenkram“ (wie die Tochter es nannte) zugange war, und ein weiteres Wohnzimmer, das voll und ganz von der absurden Büchersammlung ihres Vaters in Beschlag genommen wurde. Die ”Bibliothek“, wie ihre Eltern diesen Raum nannten, zeugte von einer Bibliomanie, die längst aus dem Ruder gelaufen war: Die Regale erstreckten sich über alle vier Wände und waren vom Boden bis zur Decke mit Tausenden von Büchern bepackt, die meisten davon ledergebundene Bände aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, dazwischen unzählige Geschichtsbücher und Biografien neueren Datums sowie, vereinzelt, ein paar moderne Erstausgaben. Drei bequeme Sessel standen mit dem Rücken zum Licht, das durch die Sprossenfenster fiel, und in einem dieser Sessel saß nun Phyls Vater Andrew und blickte angestrengt auf die winzige Schrift irgendeines vergessenen viktorianischen Romans oder dergleichen. Er war umgeben von Pappkartons und Stapeln von Büchern, die er nach einem undurchschaubaren Prinzip zu sortieren schien, indem er sie auf mehrere einsturzgefährdete Türme verteilte. Als seine Tochter hereinkam, blickte er auf und sagte: ”Alles in Ordnung, Liebes?“
”Ja, mir geht's gut“, antwortete sie und begutachtete das organisierte Chaos, in dem sich ihr Vater befand. ”Was machst du?“
”Ich schaffe Platz. Wir haben ein Überfluss-Problem.“ Er sah sich um und seufzte, scheinbar entmutigt von der Arbeit, die noch auf ihn wartete. ”Keine leichte Aufgabe. Ich muss mindestens fünf Meter Bücher aussortieren und einpacken.“
Phyl nahm ein Taschenbuch von einem der Stapel und betrachtete es mechanisch, ohne echtes Interesse.
”Und was machst du dann damit?“, fragte sie.
”Wahrscheinlich bringe ich sie zu Victor und versuche, sie zu verkaufen, so schwer es mir fällt.“
Sie überlegte, wer dieser Victor war. Dann fiel ihr ein, dass er ein Freund ihres Vaters war, ein Antiquar in London, mit dem er manchmal Geschäfte machte.
Andrew reckte den Hals, um das Cover des Buches zu sehen, das sie in der Hand hielt. ”Was ist das?“
Phyl sah sich den Band zum ersten Mal richtig an. Es war ein dicker Roman, über fünf-, sechshundert Seiten lang. Der Titel lautete Aufstand in Lilliput und der Autor hieß Piers Capon. Sowohl das Coverdesign als auch die Schriftart schienen aus einer fernen Epoche zu stammen. Sie warf einen Blick auf das Impressum des Buches und stellte fest, dass es 1993 erschienen war.
”Ich kann mich gar nicht erinnern, es gekauft zu haben“, sagte ihr Vater.
Phyl las den Klappentext. ”Wow. Hör dir das an: ‚Aufstand in Lilliput ist eine epische Satire auf den Wahnsinn des modernen Lebens, eine Geschichte, die Kontinente und Generationen umspannt und einen unserer brillantesten jungen Romanautoren auf dem Höhepunkt seines Schaffens zeigt. Dieser Roman hat zweifellos das Zeug zum Klassiker.‘“
Ihr Vater lachte trocken. ”Tja, daraus ist wohl nichts geworden. Wenn nicht einmal ich noch weiß, wer dieser … Piers Capon war. Leg es bitte auf den Stapel für den Wohlfahrtsladen.“
Phyl legte das Buch auf den Turm, auf den er wies, blieb dann davor stehen und blickte einen Moment lang nachdenklich auf den Band hinunter. Eine seltsame, unerklärliche Traurigkeit überkam sie bei dem Gedanken, dass Verleger und Kritiker einem Schriftsteller vor fast dreißig Jahren bescheinigt hatten, einen künftigen Klassiker geschrieben zu haben, den noch Generationen von Lesern bewundern würden, und jetzt war er völlig in Vergessenheit geraten, gänzlich ungelesen. Genauso gut hätte er sich die Mühe sparen können, überhaupt zu schreiben.
Ganz oben auf dem nächsten Stapel lag ein Buch, das sie kannte, wenngleich sie es nie gelesen hatte: Gierig von Martin Amis. Zwar hatte Andrew ihr immer wieder versichert, der Roman sei ein Meisterwerk, aber aus irgendeinem Grund hatte er sie nie interessiert. Sie schlug das Buch auf und sah, dass es auch einen Untertitel hatte: ”Ein Abschiedsbrief“. Das klang irgendwie spannend. Außerdem fiel ihr das schlichte, blassblaue Cover auf, das lediglich den Titel und den Namen des Autors trug. Und den Hinweis: ”Unkorrigiertes Leseexemplar. Nicht zum Zitieren oder zum Verkauf bestimmt“.
”Was bedeutet das?“, fragte sie. ”‚Unkorrigiertes Leseexemplar‘.“
”Ach, das sagt man so in der Buchbranche“, erklärte ihr Vater. ”Manchmal lassen Verlage ein Manuskript, das noch nicht bearbeitet ist, bereits drucken, vervielfältigen und binden, um es vorab an Zeitungen und potenzielle Rezensenten zu schicken. Der Gedanke dahinter ist, dass es mit größerer Wahrscheinlichkeit gelesen wird, wenn es wie ein richtiges Buch aussieht.“
”Aber sind da denn keine Fehler drin?“
”Doch, manchmal schon. Oft werden auch noch inhaltliche Änderungen vorgenommen. Deswegen können solche Leseexemplare mit der ursprünglichen Textfassung auf dem Sammlermarkt sehr wertvoll sein. Ich bringe es nächste Woche zu Victor. Er kann mir sagen, ob es etwas wert ist.“
Phyl legte das Buch zurück und griff zu einer schönen gebundenen Ausgabe von Der junge Titus, dem ersten Band der ”Gormenghast“-Trilogie von Mervyn Peake. Dieses Buch weckte gute Erinnerungen. Sie hatte es mit sechzehn oder siebzehn gelesen, sich genüsslich in den gruseligen Begebenheiten und den labyrinthischen Gängen von Schloss Gormenghast verloren und sich voll und ganz mit der Figur der eigensinnigen Fuchsia identifiziert, die dem eintönigen, abgeschiedenen Leben in dem riesigen Schloss entflieht, indem sie auf dem spinnwebverhangenen Dachboden alte Sagen und Märchen liest. In der Erwartung, dass die erste Seite einen köstlichen Rausch der Nostalgie bei ihr hervorrufen würde, setzte sich Phyl in einen der Sessel und begann zu lesen, musste aber feststellen, dass es ihr nicht einmal hier gelang, sich zu konzentrieren. Das Gefühl von Ziellosigkeit, von Unzufriedenheit, ließ sich nicht abschütteln. Sie legte auch dieses Buch beiseite und starrte düster vor sich hin.
Was sollte sie bloß mit dem Rest ihres Lebens anfangen?
”Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du mit der Uni fertig warst?“, fragte sie ihren Vater.
”O ja“, sagte er, während er mit dem Sortieren und Stapeln fortfuhr. ”Es war furchtbar. Total ernüchternd. Die drei Jahre waren im Handumdrehen vergangen, und plötzlich lebte ich wieder bei meinen Eltern. Ich war unglücklich – genau wie du jetzt.“
”Ich bin nicht unglücklich“, sagte Phyl trotzig. ”Nur ein bisschen konfus. Ich weiß einfach nicht, was ich als Nächstes tun soll.“
”Du hast alle Zeit der Welt, um darüber nachzudenken“, sagte ihr Vater. ”Setz dich nicht unter Druck. Du bist erst dreiundzwanzig.“
”Stimmt“, sagte Phyl. ”Aber, wie war das … Ich meine, als du so alt warst wie ich, hattest du da irgendwelche Pläne? Wusstest du schon, dass du mal … Dings werden wolltest?“ Ihr fiel die Berufsbezeichnung nicht mehr ein. ”Was war das noch mal, was du gemacht hast?“
”Immobiliensachverständiger. Dreißig Jahre lang.“
”Ach ja“, sagte Phyl. ”Tut mir leid. Keine Ahnung, warum ich mir das nicht merken kann.“
”Nein“, sagte Andrew, ”das hatte ich nie vorgehabt. Es war bestimmt kein Kindheitstraum. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Nichts Ungewöhnliches. Viele Leute rutschen irgendwo rein.“
Sein Blick fiel auf den Jungen Titus, den Phyl beiseitegelegt hatte. ”Das hat dir doch früher so gefallen“, sagte er. ”Was ist los? Bist du nicht in der Stimmung?“
”Im Moment nicht. Ich möchte etwas Aktuelleres. Etwas, das mir die Welt erklärt. Vielleicht was Politisches …“
”Seit wann interessierst du dich für Politik?“
”Du hast doch keine Ahnung, wofür ich mich interessiere“, erwiderte sie mit wachsender Empörung. ”In drei Tagen haben wir einen neuen Premierminister. Oder eine neue Premierministerin. Das ist doch interessant, oder?“
Andrew zuckte mit den Schultern und starrte lange auf ein Exemplar von Samuel Johnsons Rasselas. Er schien unschlüssig zu sein, was damit geschehen sollte. Schließlich sagte er nur: ”Premierminister kommen und gehen.“
Der lapidare Fatalismus dieser Bemerkung brachte Phyl auf die Palme. ”Wie soll ich mit dir ein vernünftiges Gespräch führen, wenn du so etwas sagst? Was soll das überhaupt heißen?“
”Wenn du über Politik reden möchtest“, sagte Andrew, ”kannst du das mit dem Freund deiner Mutter tun, der morgen zu Besuch kommt. Christopher. Er wird bestimmt erfreut darüber sein. In der Zwischenzeit kannst du ja seinen Blog lesen. Soviel ich weiß, ist der ziemlich politisch.“
Phyl bemerkte eine gewisse Pikiertheit in der Stimme ihres Vaters (und das, obwohl man ihm seine Emotionen sonst nicht anmerkte) und beschloss, das Feld zu räumen. Sie hatte ganz vergessen, dass der Freund ihrer Mutter zu Besuch kommen sollte. Ihr Vater hatte nicht gerade erfreut darüber geklungen, fand sie.
Sie schlenderte hinüber zur Küche, und als sie diese leer vorfand, überlegte sie kurz, ob sie das Abendessen zubereiten sollte, denn im Moment sah es nicht so aus, als ob das jemand übernehmen würde. Aber die Trägheit hatte sie fest im Griff, und nachdem sie drei schwarze Oliven aus einer Schale im Kühlschrank geangelt und sich in den Mund gesteckt hatte, suchte sie nach jemand anderem, mit dem sie reden konnte.
Ihre Mutter Joanna saß im Arbeitszimmer und hämmerte auf die Tastatur ihres Computers ein. Im Hintergrund lief Radio 3. Phyl schaute ihr über die Schulter, um zu sehen, was sie tippte. Offenbar handelte es sich um die Korrektur eines Gemeinderatsbeschlusses bezüglich der genauen Schriftart und Schriftgröße eines Warnhinweises, der in der Kirche angebracht werden sollte, um die Gläubigen auf die potenziell allergieauslösenden und gesundheitsgefährdenden Eigenschaften der Blumendekoration aufmerksam zu machen. Phyl setzte sich auf das kleine Sofa vor dem Schreibtisch ihrer Mutter und dachte niedergeschlagen, wie schonungslos ihr doch in den letzten Monaten die eigentliche Bedeutung des Wortes ”parochial“ vor Augen geführt worden war.
Die Musik aus dem Radio klang seltsam. Seltsam, aber irgendwie schön. Eine hohe Männerstimme – wie hieß das doch gleich? Ein Countertenor? – sang ein melancholisches Lied, begleitet von sanften, kaum hörbaren Gitarrenklängen. Die Aufnahme war sehr hallig.
”Das gefällt mir“, sagte Phyl. ”Was ist das?“
Ihre Mutter tippte weiter und sagte, ohne aufzuschauen: ”Ich hab nicht richtig zugehört.“
”Wieso lässt du das Radio laufen, wenn du nicht zuhörst?“
Die Finger ihrer Mutter klickten weiter auf der Tastatur. Phyl wurde klar, dass sie hier keine Unterhaltung bekommen würde, und wollte schon aufstehen und wieder gehen, aber das Lied hielt sie zurück. Es hatte etwas Gespenstisches an sich: eindringlich und wehmütig, aber mit einem leicht düsteren Unterton. Was den Text betraf, so war sie sich zunächst nicht sicher, ob sie ihn richtig verstand.
Oh, you have been poisoned, oh Randall, my son
You have been poisoned, my handsome young one
'Tis truth you've spoken, mother
'Tis truth you've spoken, mother
Please make my bed soon, for I'm sick to the heart
And fain would lie down
”Jemand wurde vergiftet, oder?“
”Warte kurz, Liebes. Ich bin gleich so weit.“
Phyl schloss die Augen und versuchte, sich auf den Text zu konzentrieren. Das Klicken der Tastatur lenkte sie ab.
Oh, what will you leave your sweetheart, my son?
What will you leave her, my handsome young one?
A rope from Hell to hang her
A rope from Hell to hang her
Oh make my bed soon, for I'm sick to the heart
And fain would lie down
”Und nachdem er vergiftet wurde, will er seine Liebste an einem Strick aus der Hölle aufhängen?“
Joanna drückte mehrmals die Löschtaste. ”Wieso macht er das?“, fragte sie. ”Er versucht ständig, den ganzen Text umzuformatieren.“
Das Lied verklang mit einer letzten, traurigen Kadenz. Einen Moment lang herrschte Stille, dann verkündete eine weibliche Stimme, dass es sich um ein altes Volkslied aus England – vielleicht auch aus Schottland, vielleicht auch aus dem Grenzland dazwischen – handelte, das ”Lord Randall“ hieß. Phyl prägte sich den Titel ein.
Dann sah sie zunehmend frustriert zu, wie ihre Mutter mit den Launen von Microsoft Word kämpfte.
”Kann ich dir irgendwie helfen?“, fragte sie.
”Nein, nein, ich krieg das schon hin“, sagte Joanna gereizt. ”Gib mir noch ein paar Minuten, ja?“
Phyl stand auf und ging zur Tür. Bevor sie das Arbeitszimmer verließ, fragte sie: ”Wie heißt dein Freund noch mal?“
”Mmh?“
”Dein Freund, der morgen kommt.“
”Ach so. Christopher.“
”Christopher – und weiter?“
”Swann. Mit Doppel-n.“
”Okay. Danke. Soll ich das Abendessen machen?“
”Dein Vater wird sich schon darum kümmern.“
Und so ging Phyl wieder hinauf in ihr Zimmer, streckte sich erneut auf dem Bett aus – diesmal mit den Füßen auf dem Kopfkissen – und klappte ihren Laptop auf. Sie gab ”christopher swann blog“ bei Google ein und wurde sofort fündig. Oben auf der Seite war das Foto eines Mannes zu sehen, der ihr vage von seinem letzten Besuch vor ein paar Jahren bekannt vorkam: dunkelbraunes Haar mit grauen Einsprengseln, eine hohe, intellektuelle Stirn, eine Drahtbügelbrille, ein forschendes, entschlossenes Funkeln in den Augen. Ja, jetzt erinnerte sie sich an ihn. Ein bisschen aufgeblasen hatte sie ihn gefunden. Ziemlich kalt und unnahbar. Mit einem Hang zum Mansplaining.
Das Foto war etwas unglücklich über einer Balkenüberschrift platziert: Die MachtDer WahrheitNutzen, umder Macht Die WahrheitZuSagen, ein äußerst schwaches Wortspiel, wie Phyl fand. Der neueste Beitrag (er hatte ihn erst drei Tage zuvor gepostet) war aber recht interessant.
Ein Luxushotel nahe eines malerischen Dörfchens in den Cotswolds [las sie] wird nächste Woche eine Nebenrolle in der politischen Geschichte Großbritanniens spielen, wenn sich die Delegierten zum ersten Mal zu einer Veranstaltung versammeln, die – so hat man uns versichert – von jetzt an jedes Jahr stattfinden wird: die British-TrueCon-Konferenz über die Zukunft des Konservatismus.
Stammleser dieses Blogs wissen vermutlich, worum es sich bei der TrueCon handelt. Die amerikanische Stiftung hat einen britischen Ableger gegründet und unterhält enge Beziehungen sowohl zu den extremsten Trumpisten in den Reihen der Republikaner als auch zum rechten Rand unserer eigenen guten alten Konservativen Partei.
Tatsächlich werden gleich mehrere Minister des Tory-Kabinetts an der dreitägigen Veranstaltung teilnehmen, zusammen mit den üblichen Vertretern des Pöbels aus rechten Kolumnisten, Intellektuellen und Online-Kulturkriegern. Zu den reizvollen Themen, die diese illustre Runde diskutieren wird, gehören „Der woke Feldzug gegen nationale Zugehörigkeit“ und „Familie, Flagge, Freiheit: Von der Notwendigkeit, unsere Lebensgewohnheiten zu verteidigen“.
Zwei Namen dürfen auf der Rednerliste natürlich nicht fehlen: Emeric Coutts und Roger Wagstaff. (In diesem Blog wurde bereits des Öfteren über sie berichtet.) Der inzwischen recht betagte Coutts gilt als einer der führenden konservativen Denker des Landes, seit er in den späten 1970er-Jahren in Cambridge seinen berühmten Salon ins Leben rief. Dort geriet Wagstaff als junger Student in seinen Bann, wenngleich er Coutts' Lehren seitdem in eine Richtung weiterentwickelt hat, die dem Meister nicht gefallen dürfte. Gleichwohl waren die letzten Jahre gute Jahre für Wagstaff. Seine Denkfabrik, die Processus Group, wurde offiziell Mitte der Neunzigerjahre gegründet (in embryonaler Form existierte sie aber schon seit seiner Zeit in Cambridge) und diente dazu, die Fackel Thatchers am Brennen zu halten, nachdem sie von Verrätern im eigenen Kabinett entmachtet worden war. Mehr als zwanzig Jahre lang fristete Processus ein Schattendasein in der politischen Wildnis, doch seit 2016, als das Brexit-Votum einen entscheidenden Rechtsruck bei den Tories bewirkte, sind Wagstaff und seine Mitstreiter sehr gefragt: Sie tauchen nicht nur in sämtlichen Fernseh- und Radiosendungen auf, wo sie unter dem Deckmantel der „Ausgewogenheit“ ihre bizarren Ansichten äußern, sondern fungieren auch als inoffizielle, manchmal sogar als bezahlte Berater einiger besonders hirnverbrannter Minister. Wenn Liz Truss nächste Woche unsere neue Premierministerin wird (und alle Umfragen deuten darauf hin), wird der Einfluss von Wagstaff und seinen Leuten zweifellos weiter zunehmen. Processus ist eine finstere Organisation mit einer konkreten, aber geheimen Agenda, die ich schon vor einiger Zeit zu enthüllen versprochen habe. Ich kann meinen Lesern versichern, dass ich jetzt die entscheidenden Beweise für die wahren Absichten dieser Denkfabrik habe: In wenigen Wochen, vielleicht auch schon in wenigen Tagen, werde ich ausführlich darüber berichten.
Diese Ankündigung entfachte Phyls Neugier. Als sie sich schließlich gegen zehn alle zum Abendessen versammelten (Andrew hatte das einzig Vernünftige getan und Pasta mit Pesto zubereitet), erwähnte sie es gegenüber ihren Eltern, erntete aber nur eine enttäuschende Reaktion.
”Ach herrje“, sagte ihre Mutter, ”du hast doch nicht etwa Christophers Blog gelesen? Ich wünschte, er würde damit aufhören.“
Phyl blickte überrascht drein, woraufhin ihr Vater nur sagte: ”Du musst wissen, dass Christopher manchmal ein ziemlicher …“ – er suchte nach dem richtigen Wort – ”Fantast ist.“
Als Phyl später im Bett darüber nachdachte, wurde ihr klar, dass es mindestens fünf Jahre her war, seit sie Christopher Swann zuletzt gesehen hatte. Aber sie konnte sich nicht daran erinnern, was er beruflich machte, und überhaupt wusste sie nichts über ihn, außer dass er eine Amerikanerin geheiratet und eine Zeit lang an der Ostküste gelebt hatte, bevor er sich scheiden ließ und nach Großbritannien zurückkehrte. Sie hatte vergessen zu fragen, wie lange er bleiben würde. Hoffentlich nicht länger als ein, zwei Tage.
Sie verpasste seine Ankunft am Samstagvormittag, da ihr Tag schon früh begonnen hatte: Ihre Mutter hatte sie pünktlich zu ihrer Sechs-Uhr-Schicht durch die fast noch dunkle Landschaft von Berkshire zum Flughafen gefahren. Daher sah sie den Gast erst, als sie am Nachmittag nach Hause kam. Ein weiterer Tag, den sie damit verbracht hatte, zuzusehen, wie sich Sushi-Schälchen um die mit nervösen Flugreisenden besetzten Tische schlängelten, war vergangen, und einmal mehr fühlte sie sich benommen und leer. Am Ende war sie zu müde, um die Heimfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten: eine Fahrt von nur fünfzehn Meilen, die jedoch bis zu drei Stunden dauern konnte, da die meisten lokalen Buslinien in den letzten Jahren eingestellt worden waren. Stattdessen investierte sie die Hälfte ihres gesamten Tagesverdiensts in ein Taxi und war um Viertel vor vier zu Hause.
Christopher und ihre Mutter waren in der Bibliothek. Sie steckten die Köpfe über einem alten Fotoalbum zusammen und kicherten so vertraut miteinander, dass Phyl ihre Zweisamkeit nicht stören wollte und sich gleich wieder verzog. Ihr Vater saß im Wohnzimmer und schaute eine alte britische Filmkomödie, die in einem Internat spielte und Das doppelte College hieß. Phyl erkannte gleich, dass der Streifen nichts für sie war, aber sie wusste, warum ihr Vater diese Art von Filmen mochte. Die Welt, die sie zeigten, hatte etwas wunderbar Beruhigendes an sich: das Schwarz-Weiß-Großbritannien der Fünfzigerjahre, mit seinen vertrauten Charakterdarstellern und den harmlos-komischen Situationen, in die sie gerieten. Wahrscheinlich waren diese Filme für ihn das, was die alten Friends-Folgen für sie waren: die unbestimmte Sehnsucht nach einer Zeit, die man selbst gar nicht erlebt hatte. Phyl freute sich, ihn so zufrieden lächeln zu sehen. Sie überließ ihn seinem Vergnügen und ging nach oben, um zu duschen und ein paar Stunden Schlaf nachzuholen.
Später, beim Abendessen, hatte sie Gelegenheit, die Dynamik zwischen ihrem Vater, ihrer Mutter und dem Freund ihrer Mutter zu beobachten.
Ihr war bewusst, dass Joanna Christopher schon länger kannte als ihren Vater. Die beiden hatten zusammen in Cambridge studiert, bevor Joanna und Andrew sich begegnet waren. Daher herrschte zwischen den Studienfreunden eine langjährige, besondere Vertrautheit, von der sich ihr Vater bestimmt ausgeschlossen fühlte. Die Unterhaltung kreiste um Joannas und Christophers Zeit in Cambridge, und Andrew, der eine andere, weniger bedeutende Universität besucht hatte, konnte nichts dazu beitragen. Genau wie Phyl blieb ihm nichts anderes übrig, als dazusitzen, zuzuhören und gelegentlich um eine Erläuterung zu bitten.
”Vor ein paar Wochen habe ich Brians Memoir gelesen“, sagte Joanna jetzt, ”und es hat so viele Erinnerungen geweckt. Manches hatte ich völlig vergessen.“
Ihr Mann sah bereits verwirrt aus. ”Wer war noch mal Brian?“
”Brian Collier. Christopher und ich haben doch schon oft über ihn gesprochen. Wir drei waren unzertrennlich, von Anfang an.“
”Ach ja – der Kerl, der letztes Jahr gestorben ist.“
”Genau. Er konnte gerade mal ein Jahr lang seinen Ruhestand genießen, bevor ihn der Krebs erwischt hat. Der Arme. Und in dieser Zeit hat er das kleine Memoir geschrieben.“
”Ich würde es gern lesen“, sagte Christopher. ”Kannst du es mir leihen? Ich könnte hineinschauen, während ich hier bin.“
”Selbstverständlich. Seine Witwe hat mir eine Kopie des Manuskripts geschickt. Es muss irgendwo in meinem Arbeitszimmer sein. Ehrlich gesagt, habe ich es bereits gesucht, aber ich kann es nirgends finden …“
”Joanna, du musst wirklich mehr Ordnung halten“, sagte Andrew.
Sie ignorierte die Ermahnung und fuhr fort: ”Ich hatte ganz vergessen, dass ich ihn immer zu Emerics Soireen mitgenommen habe. Anscheinend haben sie ihn schwer beeindruckt.“
”Warte – wer war doch gleich Emeric?“
”Also wirklich, Lieber. Ich habe dir doch schon so oft von ihm erzählt.“
”Der Geschichtsprofessor, vor dem alle ein bisschen Angst hatten?“
”Philosophieprofessor“, korrigierte ihn Joanna und tätschelte seinen Arm.
”Ach so – der mit der bezaubernden Tochter, die immer Cembalo spielte. Virginia, stimmt's?“
”Lavinia. Und es war ein Clavichord, kein Cembalo. Und sie spielte es auch nicht, sondern sang, während jemand anderes sie darauf begleitete.“
”Ah. Wie auch immer … Wenn ich mich nicht täusche, war Emeric für seinen literarischen Zirkel bekannt.“
”‚Literarisch‘ konnte man ihn nicht nennen“, entgegnete Christopher. ”Manchmal lud er Schriftsteller ein, aber im Wesentlichen ging es um Politik.“
”Das habe ich dir doch schon hundertmal erzählt“, sagte Joanna vorwurfsvoll.
”Übrigens treffe ich Emeric nächste Woche“, beeilte sich Christopher zu sagen, um einen Ehestreit abzuwenden. ”Ich glaube nicht, dass er die Konferenz mitorganisiert hat, aber er wird dort sein – als eine Art graue Eminenz.“
”Mein Gott, er muss inzwischen steinalt sein …“
”Ende achtzig, vermute ich mal. Im Grunde genommen ist die Veranstaltung ein richtiges Cambridge-Ehemaligentreffen. Natürlich wird auch Wagstaff dort sein.“
Einen Moment lang sah es so aus, als würde Andrew nicht fragen, wer denn nun wieder dieser Wagstaff war. Er schien es aufgegeben zu haben, dem Erinnerungsstrom der beiden zu folgen. Doch dann besann er sich auf seine Pflicht und sagte:
”Noch einer eurer alten Freunde, nehme ich an?“
”Gott bewahre“, sagte Joanna. ”Ein schrecklicher Mensch. Sogar ich habe ihn gehasst.“
”Nicht sehr christlich von dir“, stellte ihr Mann mit trockener Missbilligung fest.
”Niemand konnte Roger Wagstaff leiden.“
”Außer Rebecca“, warf Christopher ein.
”Rebecca! Die hatte ich ganz vergessen. Was für ein hoffnungsloser Fall sie war!“
In Anbetracht eines weiteren unbekannten Namens aus der schillernden Studienzeit seiner Frau riss Andrew endgültig der Geduldsfaden.
”Wer zum Teufel ist Rebecca?“, rief er. ”Und warum war sie ein hoffnungsloser Fall?“
”Warum regst du dich denn so auf?“ Joanna sah ihn erstaunt an. Sie wirkte fast ein wenig verletzt. ”Rebecca wohnte im selben Haus wie ich, das ist alles. Sie war … ach, ich weiß nicht. Wie würdest du sie beschreiben, Chris?“
”Sie hatte was von einem Mauerblümchen“, sagte Christopher.
”Ja, das stimmt. Ich meine, eigentlich war sie ganz nett … auf ihre Art. Aber sie hatte keinerlei Sex-Appeal und keiner der Männer beachtete sie – und das, obwohl Frauen in Cambridge damals Mangelware waren. Aber es wäre sowieso Zeitverschwendung gewesen, ihr den Hof zu machen, weil sie nur Augen für Roger hatte.“
”Also wirklich“, sagte Christopher. ”Es erstaunt mich immer wieder, dass du dich zur Seelenhirtin berufen gefühlt hast, obwohl du anscheinend überhaupt keine Menschenkenntnis besitzt. Oder du willst einfach nur das Beste in den Menschen sehen. Rebecca Wood kann man beim besten Willen nicht als ‚ganz nett‘ bezeichnen. Sie war eine knallharte Frau, und sie hat sich nur deshalb in Roger verknallt, weil die beiden Seelenverwandte waren. Sie war ein echtes Miststück.“
”Wie kommst du denn darauf?“
”Wusstest du, dass sie seit vierzig Jahren als seine persönliche Assistentin arbeitet? Was muss man für ein Mensch sein, um das als seine Lebensaufgabe zu betrachten? Diese Frau würde alles für Roger Wagstaff tun.“
”Um Himmels willen, Christopher“ – Joanna klang jetzt verärgert –, ”du fängst doch nicht etwa wieder mit diesem armen jungen Mann an, der die Treppe hinuntergefallen ist? Das war ein Unfall!“
”Rebecca war damals vor Ort, im selben Gebäude. Und niemand hat je herausgefunden, warum.“
Andrew, der mit seinen Gedanken woanders gewesen war, horchte auf. ”Jetzt wird es interessant“, sagte er. ”Ist das auch in Cambridge passiert?“
”Nein, das war Jahre später“, sagte Christopher.
”Nichts von alledem wurde je bewiesen“, warf Joanna ein.
”Stimmt, aber Roger hat es bestimmt nicht geschadet, dass dieser Mann so unverhofft aus dem Weg geräumt wurde. Schließlich stellte er eine Gefahr für seine Karriere dar. Die überhaupt nur eine Richtung kennt: steil nach oben. Wenn meine Quellen recht haben, zieht er schon bald ins Oberhaus ein.“
Joanna schnalzte ungehalten mit der Zunge. ”Wagstaff im House of Lords? Das ist wirklich eine Schande. Aber es überrascht mich keineswegs.“
”Nein, irgendwann musste es so kommen“, sagte Christopher. ”Er wird dafür geadelt, die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer gemacht zu haben. Und dafür, dass er alles in seiner Macht Stehende getan hat, um dieses Land in die Scheiße zu reiten.“
Bei dem Kraftausdruck zuckte Joanna zusammen. ”Ich frage mich, was Emeric wohl vom Erfolg seines Protegés hält.“
”Ich nehme an, dass er gemischte Gefühle hat. Wahrscheinlich fühlt er sich von ihm benutzt. Schließlich hatte Emeric in den Achtzigern Einfluss auf Maggie Thatcher. Ich bin mir sicher, dass er sie in politischen Fragen beraten hat. John Major, glaube ich, auch. Aber vor ungefähr zehn Jahren wurde er kaltgestellt. Jetzt ist es Wagstaff, der das halbe Kabinett im Kurzwahlspeicher hat. Daher auch das Angebot, den Lords beizutreten. Und wenn die Tories ihren Rechtsruck fortsetzen und am Montag eine neue Führung wählen, wird er zweifellos einflussreicher sein denn je.“
Phyl dachte darüber nach, während sie an ihrem Wein nippte. Dann setzte sie sich aufrecht hin und sagte: ”Sorry, aber ich finde es einfach krank, dass wir in einem modernen, entwickelten Land leben, im Jahr 2022, und die Leute sich immer noch Lord und Baron und Dame oder was weiß ich nennen, und dass sie diese aufgeblasenen Titel für irgendwelche Dienste bekommen und nicht mal einen Hehl daraus machen. Ich meine, passiert so was auch anderswo auf der Welt, oder sind wir die Einzigen, die so korrupt und sonderbar sind?“
Christopher lächelte bitter. ”Großbritannien ist in vielerlei Hinsicht einzigartig.“
”Wahrscheinlich tanzt es deswegen aus der Reihe“, sagte Joanna fröhlich.
Natürlich hatte sie das nur so dahingesagt, aber Phyl ärgerte sich maßlos über die Bemerkung ihrer Mutter. Passivität, verharmlosender Humor, achselzuckende Resignation: Mit diesen Mitteln schien Joanna neuerdings allen möglichen unangenehmen Dingen zu begegnen. Phyl ging das auf die Nerven.
Auch Andrew hatte offenbar genug von dieser Unterhaltung.
”Sollen wir einen Film anschauen?“, schlug er vor.
Es folgte ein längeres Hin und Her: Joanna wünschte sich ”etwas Moderneres als sonst“, womit sie, wie sich herausstellte, einen in Farbe gedrehten Film meinte, der möglichst nicht älter als sechzig Jahre sein sollte. Phyl legte ihr Veto gegen Wenn die Gondeln Trauer tragen ein, mit dem Argument, sie habe diesen Horrorthriller (in dem ein trauerndes Paar nach Venedig reist, um über den Tod der kleinen Tochter hinwegzukommen, und auf eine mörderische Zwergin in rotem Mantel trifft), schon viel zu oft anschauen müssen. Schlussendlich einigten sie sich auf die Ken-Russell-Verfilmung von D. H. Lawrence' RomanLiebende Frauen. Zu ihrer Überraschung fand Phyl den Film gar nicht so übel – vor allem die Szene, in der Gerald Crich und Rupert Birkin nackt miteinander ringen, gefiel ihr –, aber sie war auch sehr müde von der langen Schicht und schlief auf dem Sofa ein, bevor der Film zu Ende war.
*
Am nächsten Morgen wachte sie spät auf und war erleichtert, als ihr einfiel, dass sie heute nicht arbeiten musste. Als sie gegen elf nach unten kam, fand sie Christopher allein in der Küche vor, wo er Tee trank und die Sonntagszeitung las. Er bemerkte sie zunächst nicht, da er Kopfhörer trug und Musik hörte. Als er sich ihrer Anwesenheit bewusst wurde und die Kopfhörer abnahm, stellte Phyl überrascht fest, dass er offenbar Jazz-Funk aus den Siebzigern hörte.
Ihre Mutter war beim Morgengottesdienst, und ihr Vater hatte sie wie üblich zur moralischen Unterstützung in die Kirche begleiten müssen (obwohl er Atheist war). Sie machte sich einen Kaffee und aß eine Schale Müsli. Anschließend schlug Christopher einen Spaziergang vor.
Sie durchquerten die ungepflegte Grünanlage zwischen dem Pfarrhaus und dem Zentrum von Rookthorne und schlenderten die High Street entlang. Die Straße war nie besonders reizvoll gewesen und hatte sich während der Zeit, in der Phyl auf der Universität gewesen war, zum Schlechten verändert. Die beiden wichtigsten Pubs, das Bell und das White Horse, hatten beide dichtgemacht und waren mit Brettern verschlagen. Die Metzgerei Abelman, die zwei Jahrzehnte lang ein fester Bezugspunkt ihrer Familie gewesen war, hatte Anfang des Jahres geschlossen, ebenso die Post, die letzte Bankfiliale im Ort und eine einst florierende unabhängige Buchhandlung. Das einzige neue Geschäft, das sich hier unlängst angesiedelt hatte, war ein Pizzalieferdienst, der jetzt im alten Postamt untergebracht war. Die Fenster waren noch mit Zeitungspapier verhängt, und am Eingang hing ein provisorisches Schild. Etwa anderthalb Meilen entfernt, am äußersten Rand des Städtchens, war vor Kurzem ein neues Gewerbegebiet mit zwei Supermärkten, einem Möbelhaus, einem Discounter und einem Coffeeshop entstanden, die alle zu großen nationalen Ketten gehörten. Und dorthin strömten die Bewohner von Rookthorne nun jeden Tag, stellten ihre Autos auf dem riesigen Parkplatz ab, durchforsteten die Läden nach Sonderangeboten und waren dennoch bereit, fünf Pfund für einen Kaffee zu zahlen, wenn sie dafür kostenloses WLAN bekamen und so lange im Warmen sitzen konnten, wie sie wollten. Derweil lag die High Street einsam und verlassen da.
”Der Ort ist kaum wiederzuerkennen“, sagte Christopher. ”Er hat sich vollkommen verändert, seit ich zuletzt hier war.“ Er blieb stehen und runzelte konzentriert die Stirn, als wollte er sich etwas ins Gedächtnis rufen. Dann rezitierte er: ”Mein Aubrunn, holdes Dorf, du Liebling der Natur! / Verwelkt ist all dein Schmuck, verödet deine Flur.“ Er sah Phyl erwartungsvoll an, in der Annahme, dass sie das Zitat erkannte. ”Komm schon“, ermunterte er sie. ”Du hast doch Englische Literatur studiert! Du musst doch wissen, woraus das ist.“
Sie schüttelte den Kopf.
”‚Weh einem Staate, dem nur Reichtum Stärke dünkt / Der an Vermögen steigt und an Bevölkrung sinkt.‘ Na? Klingelt da was?“
”Ich fürchte nein.“
Er seufzte. ”Tja, das zeigt wohl, dass ich alt werde. Ich hatte gedacht, dass Gedichte wie ‚Das verlassene Dorf‘ noch auf dem Lehrplan stehen. Oliver Goldsmith – der ist dir ein Begriff, oder? Der Pfarrer von Wakefield?“
Wieder schüttelte Phyl den Kopf. ”Ich komme mir sehr dumm vor.“
”Na ja.“ Er lächelte. ”Die Dinge haben sich seit meiner Studienzeit verändert, das ist mir klar. Heute werden an der Uni viele interessante Texte gelesen, die man in den Achtzigerjahren in Cambridge nie zu Gesicht bekommen hätte. Trotzdem: Es ist ein gutes Gedicht, hochaktuell, falls du mal Lust hast, es zu lesen. Bestimmt hat dein Vater noch irgendwo ein Exemplar von Goldsmith herumliegen. Es geht im Wesentlichen darum, wie der Kapitalismus Gemeinschaften zerstört.“
”Hat er nie erwähnt. Aber Dad redet eigentlich nie über seine Bücher. Oder über Politik. Oder … über irgendwas.“
Während sie an einem Friseursalon, einem Nagelstudio und einem Kosmetikinstitut vorbeigingen, sagte Christopher: ”Es muss schwer für dich sein, nach drei Jahren an der Uni wieder bei deinen Eltern zu leben.“
Phyl zuckte mit den Schultern. ”Am Anfang war es ganz okay. Aber langsam nervt es echt.“
”Wenigstens hast du einen Job.“
”Ja, toll! Einen Mindestlohnjob mit einem Null-Stunden-Vertrag, das heißt, ich arbeite auf Abruf und nur, wenn Bedarf besteht. Auf diese Weise halte ich die kapitalistische Maschinerie am Laufen.“
”Das klingt ganz schön zynisch“, sagte Christopher.
”Meine Generation macht sich eben keine Illusionen über den Schlamassel, den ihr uns hinterlassen habt.“
”Ich weiß.“ Sie blieben vor der ehemaligen Bank stehen, und Christopher starrte nachdenklich auf das Loch in der Wand, wo früher der Bankautomat gewesen war. ”Es ist eine Riesenschande. Übrigens habe ich darüber schon öfters in meinem Blog geschrieben.“
”Ach ja“, sagte Phyl, während sie weitergingen, ”ich glaube, ich habe ein paar dieser Posts gelesen.“
”Oh!“, sagte Christopher. Er wirkte überrascht und erfreut. ”Du hast den Blog besucht?“
Phyl ärgerte sich über sich selbst, weil sie es zugegeben hatte. ”Ein, zwei Mal“, sagte sie.
Dann überlegte sie, wie sie sich um einen Kommentar herumdrücken konnte. Wahrscheinlich wäre es taktlos gewesen, ihm zu sagen, dass das, was er geschrieben hatte, sicherlich gut gemeint gewesen war; dennoch hatte es etwas Herablassendes, wenn ein Mann Anfang sechzig sein Mitgefühl für die Misere junger Erwachsener zur Schau trug, die gerade erst anfingen, sich in der Welt zu behaupten. Daher lenkte sie das Gespräch rasch auf seinen neuesten Beitrag.
”Ich habe das mit der Konferenz gelesen.“
”Ach ja. Die TrueCon. Das verspricht eine seltsame Versammlung zu werden.“
”Gehst du hin?“
”Ja klar. Natürlich bin ich dort ungefähr so willkommen wie ein Tripper, aber es ist eine öffentliche Veranstaltung. Ich habe mich angemeldet und bezahlt wie alle anderen auch. Sie können mich also nicht daran hindern, aufzukreuzen.“
”Was sind das für Leute?“, wollte Phyl wissen.
”Ein gemischter Haufen. Manche sind harmlose Spinner, andere durch und durch rassistisch und nationalistisch, aber am schlimmsten finde ich Roger Wagstaff und Konsorten. Du hast ja gehört, was wir gestern beim Essen über ihn gesagt haben. Deine Mutter und ich waren in Cambridge im selben Jahrgang wie er. Ein Schüler von Emeric Coutts. Ich verfolge seinen Werdegang schon seit geraumer Zeit.“ Obwohl sie die High Street mehr oder weniger für sich allein hatten, senkte Christopher jetzt die Stimme. ”Die sind wirklich gefährlich. Und damit meine ich nicht nur ihre politischen Fantastereien, die in den letzten Jahren zum Mainstream geworden sind, was erschreckend genug ist. Ich meine …“ – und er sprach noch leiser –, ”dass sie richtig gefährlich sind.“
Phyl war sich nicht sicher, worauf er hinauswollte. Aus irgendeinem Grund verspürte sie plötzlich den Drang, zu kichern, unterdrückte ihn aber.
”Du meinst …?“
Er nickte. ”Ja, ich wurde schon mehrfach bedroht. Und vor ein paar Monaten wäre ich fast überfahren worden. Von einem Motorrad.“
”Wie schrecklich“, sagte Phyl, fügte aber hinzu: ”Vielleicht war es ja nur ein Zufall …“
Christopher schüttelte den Kopf. ”Das glaube ich nicht. Was sie mit dem National Health Service vorhaben, planen sie schon seit vielen Jahren. Und eine Menge sehr mächtiger amerikanischer Big-Business-Leute wartet nur darauf, dass sie es endlich durchziehen. Es geht um sehr viel Geld. Riesige Summen.“
”Aber Mord?“, sagte Phyl ungläubig. ”Ist das nicht ein bisschen … weit hergeholt?“
Christopher sagte zunächst nichts. Er blieb mit dem Rücken zum Schaufenster eines Ladens stehen, kniff die Augen gegen das Sonnenlicht zusammen und blickte argwöhnisch in die Ferne, als hielte er nach möglichen Auftragskillern Ausschau. Phyl fiel wieder ein, was ihr Vater über ihn gesagt hatte: dass er manchmal ”ein ziemlicher Fantast“ sei.
Schließlich sagte Christopher: ”Mord“ – und er legte eine Kunstpause ein – ”ist tief in der britischen Lebensart verankert.“
Mit diesen Worten drehte er sich um und deutete auf den Inhalt des Schaufensters. Sie standen vor einem Wohlfahrtsladen, einem der wenigen Geschäfte in der High Street von Rookthorne, die noch zu florieren schienen. Zwischen Brettspielen, DVDs, billigem Schmuck und abgenutztem Geschirr hatte jemand ein Dutzend gebrauchter Bücher in die Auslage gestellt. Alles Taschenbücher, alle leicht ramponiert, und alle über das gleiche Thema. Phyl sah sich die Titel genauer an: Mord im Pfarrhaus; Böse Saat: Die Gartencenter-Morde; Ein mordlustiger Kegelclub; Tod auf dem Golfplatz; Eine Leiche zum Tee (Letzterer war, wie das Cover verriet, ”Der siebte Band der Devonshire-Krimireihe“ und ”Ein gemütlicher Murder Mystery für lange Winterabende“).
”Verstehe“, sagte Phyl, fasziniert von der Auslage.
”Schon seltsam“, sagte Christopher. ”Das Cosy-Crime-Phänomen. Krimis zum Wohlfühlen. Ich glaube, kein anderes Land der Welt würde auf die Idee kommen, brutale Morde als etwas ‚Gemütliches‘ zu bezeichnen. In gewisser Weise ist das sehr britisch.“
”Lesen die Leute dieses Zeug?“, fragte Phyl.
”O ja, sie sind ganz verrückt danach. Es ist ein riesiger Markt.“
Das brachte sie auf eine Idee. Könnte sie nicht auch so ein Buch schreiben? Wenn sie noch nicht so weit war, ihr Innerstes zu offenbaren (und sie hatte das Gefühl, noch nicht ganz so weit zu sein) und etwas Ernsthaftes zu Papier zu bringen, etwas, das wirklich ihre Sicht vom Leben wiedergab, warum nicht einen Krimi schreiben und rasch ein bisschen Kohle machen? Besser, als den ganzen Tag Gemüse zu schnippeln, war das allemal, und wie schwierig konnte es schon sein? Das Rezept war simpel: Man nehme einen idyllischen, ländlichen Schauplatz (”urenglisch“, was auch immer das hieß), gebe ein paar Vikare, Pub-Wirte und Cricketspieler dazu und denke sich eine triviale Mordgeschichte aus. Natürlich musste es auch einen Kommissar geben, überlegte sie, einen, der schrullig und ungewöhnlich war – am besten mit einem Holzbein oder einem seltsamen Hobby wie Schmetterlinge sammeln oder Hochrad fahren. Das wäre, als würde man einen Schulaufsatz schreiben: Man musste bloß darauf achten, dass man ihn richtig strukturiert und sich an die Aufgabenstellung hält, und schon bekam man eine passable Zwei. Einen Versuch wäre es jedenfalls wert.
”Tja“, sagte sie, als sie ihren Spaziergang fortsetzten, ”wenn man nach diesen Büchern geht, wird dir nichts zustoßen, solange du dich von Pfarrhäusern, Gartencentern und Olde English Tea Rooms fernhältst.“
”Schon möglich“, sagte Christopher. ”Aber wenn du mich fragst, wäre das Nobelhotel, in dem die Konferenz stattfindet, genau der richtige Ort für so einen Mord.“
*
Am Nachmittag fand Phyl ihre Mutter auf Knien im Hauswirtschaftsraum vor, wobei sie diesmal nicht betete, sondern Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner beförderte.
”Wo sind die anderen?“, fragte Phyl.
”Dein Vater ist einkaufen. Und Christopher ist nach Heathrow gefahren, um seine Tochter abzuholen.“
”Um wen abzuholen?“
Joanna kam mit einer partnerlosen Socke in der Hand auf die Füße. ”Hatten wir das nicht erwähnt? Rashida heißt sie. Sie wird ein paar Tage bei uns bleiben.“ Und dann, als sie merkte, dass ihre Tochter nicht gerade begeistert wirkte: ”Ich dachte, du würdest dich freuen.“
”Warum sollte ich mich freuen?“
”Na ja – sie ist in deinem Alter. Bestimmt werdet ihr euch gut verstehen.“
”Mum“, sagte Phyl, ”wenn ich sieben wäre, würde es einleuchten, dass man mir eine andere Siebenjährige vor die Nase setzt und sagt: ‚Ihr zwei werdet euch ganz toll verstehen – schließlich seid ihr beide sieben.‘ Aber mit Anfang zwanzig funktioniert das nicht mehr. Man muss schon ein bisschen mehr gemein haben als das Alter.“
”Sie ist nicht seine richtige Tochter, sondern seine Adoptivtochter“, sagte Joanna, als würde das einen Unterschied machen. ”Elspeth und er konnten keine Kinder bekommen.“ Und dann fügte sie hinzu: ”Rashida stammt aus Äthiopien“, als wäre das ausschlaggebend.
Phyl wusste genau, was ihre Mutter damit bezweckte: Für jemanden wie sie, deren Generation ach so eifrig Multikulti predigte, musste der Hinweis auf die Herkunft der ultimative Köder sein. Aber Phyl biss nicht an.
”Du hättest mich wenigstens vorwarnen können“, murrte sie nur.
”Ich verstehe dich einfach nicht“, gab Joanna gereizt zurück. ”Du beklagst dich doch ständig darüber, wie allein du dich fühlst, seit du hier mit deinem Vater und mir festsitzt.“
”Ja, aber ich bin gern allein. Ich finde soziale Situationen anstrengend. Eigentlich müsstest du das inzwischen bemerkt haben.“
Missmutig verzog sie sich ins Wohnzimmer und verbrachte ein paar Minuten damit, auf ihrem Smartphone ein Kartenspiel namens Pyramid zu spielen, bis sie vom Geräusch eines Autos gestört wurde, das auf knirschendem Kies in die Einfahrt fuhr. Wahrscheinlich Christopher und seine Tochter. Phyl schlüpfte in eine der Fensternischen und beobachtete, wie eine große, attraktive Frau in ihrem Alter – aber mit einem ganz anderen Auftreten, viel selbstsicherer und gelassener – vom Beifahrersitz stieg und ihr malvenfarbenes Handgepäck aus dem Kofferraum holte. Als die beiden durch die Eingangstür, die nie abgeschlossen war, das Haus betraten, hörte sie, wie sich die Frau bei ihrem Vater lautstark über etwas beschwerte, und stellte dann beunruhigt fest, dass die Stimmen immer näher kamen. Wenige Sekunden später betraten Vater und Tochter das Wohnzimmer, und Rashida redete immer noch:
”Also, man braucht den Knopf gar nicht zu drücken, weil die Aufzüge automatisch sind. Es gibt sogar ein Schild, auf dem steht, dass sie automatisch sind.“
Zu Phyls Erstaunen hatte sie einen starken amerikanischen Akzent. Ihre Stimme war tief und melodisch.
”Aha“, sagte Christopher zerstreut. Er schien nicht richtig zuzuhören, sondern blickte auf das Display seines Smartphones. ”Und du meinst, dieser Typ hat das nicht bemerkt?“
”Der hat überhaupt nichts gepeilt“, sagte sie, und dann entdeckte sie Phyl, die am Fenster stand.
”Hallo.“ Ihre Lippen verzogen sich zu einem selbstbewussten halben Lächeln. ”Ich hatte gar nicht bemerkt, dass du dich hier versteckst.“
”Tja, also … Hi. Ich bin Phyl“, sagte Phyl, trat einen Schritt nach vorn und winkte linkisch.
”Ich weiß, wer du bist“, sagte Rashida und winkte zurück. ”Und ich bin –“
”Ich weiß, wer du bist“, sagte Phyl. Inzwischen war sie in der Lage, das halbe Lächeln zu erwidern.
Und dann:
”Redest du über das, was ich denke?“
”Keine Ahnung – was denkst du denn, worüber ich rede?“
”Über die Aufzüge in Terminal 5.“
Rashida riss freudig überrascht die Augen auf. ”Ja“, sagte sie mit Nachdruck. ”Ja, genau.“
”Die sind nämlich automatisch“, sagte Phyl zu Christopher, der mit seinem Smartphone fertig war und von der einen zur anderen blickte, bemüht, ihr geteiltes Leid zu verstehen.
”Sie haben Knöpfe, aber es macht keinen Unterschied, ob man sie drückt oder nicht. Nur ist da immer irgendein Typ …“ – sie schaute Rashida an – ”Es war doch ein Mann, oder?“
”Ja klar.“
”Irgendein Typ, der im letzten Moment dazukommt …“
”Genau, und dann drückt er den Knopf, und dann gehen die Türen auf, und der Typ macht so ein verdammt selbstgefälliges Gesicht, weil er denkt, sie seien nur wegen ihm aufgegangen.“ Sie drehte sich zu Phyl. ”Das ist dir also auch passiert?“
”Ja, neulich.“
”Mir gerade eben. Meinst du, es war derselbe Typ?“
”Meiner war groß und blond und trug Shorts.“
”Meiner war klein und dunkelhaarig und trug enge Jeans.“
”Anderer Mann, gleiche Einstellung.“
”Stimmt. Ich weiß schon, eigentlich sollte uns das kaltlassen, es ist ja nicht so wichtig, aber es macht mich wahnsinnig, ich rege mich schon seit einer halben Stunde darüber auf. Diese Arroganz, diese Anmaßung …“
”Phyl, ist deine Mutter da?“, platzte Christopher dazwischen. ”Ich habe mich nur gefragt, welches Zimmer Rash bekommt.“
”Ach, keine Sorge“, sagte Phyl und schnappte sich den malvenfarbenen Koffer. ”Ich weiß, wo du schläfst. Komm mit.“
Und gemeinsam gingen sie die Treppe hinauf.
*
Phyl wusste nicht mehr genau, warum sie die Push-Benachrichtigungen von BBC News auf ihrem Smartphone aktiviert hatte. Die Meldungen poppten viel zu oft auf, und die nervige kleine Erkennungsmelodie machte einen mit der Zeit verrückt. Jedenfalls erfuhr sie so, dass die Mitglieder der Konservativen Partei Liz Truss zu ihrer Vorsitzenden gewählt hatten – und damit automatisch zur neuen Premierministerin Großbritanniens. Die Nachricht erschien am Montag, dem 5. September, während der zwanzigminütigen Mittagspause, die den neunstündigen Marathon aus Gemüseschnippeln und Fischtranchieren unterbrach, auf Phyls Display. Sie teilte die Neuigkeit ein paar ihrer Kollegen mit, aber keiner von ihnen schien sich besonders dafür zu interessieren. Für Phyl war das alles Teil des Tropf-tropf-Effekts – schlechte Nachrichten, die unablässig aus dem Smartphone sickerten und in ihrem Gehirn mit anderen Hiobsbotschaften um Platz rangen: die Unterdrückung Palästinas, der Krieg in der Ukraine, die jüngsten Überschwemmungen in Pakistan, der Klimawandel im Allgemeinen … Stein um Stein wurde so eine Mauer der Verzweiflung errichtet, die jede Aussicht auf eine lebenswerte Zukunft zu versperren schien.
In Anbetracht all dieser Katastrophen war eine Premierministerin, die noch weiter rechts stand als ihr Vorgänger, halb so wild, oder? Vielleicht. Aber es war ein weiterer kleiner Stein, der sie auch am Ende ihrer langen, komplizierten Heimfahrt noch beschäftigte. Christopher und seine Tochter waren im Wohnzimmer und unterhielten sich mit Joanna, aber Phyl schlich sich rasch an der Tür vorbei, ohne Hallo zu sagen. Irgendwie nahm sie den Gästen die Anwesenheit in ihrem Haus übel. Oben in ihrem Zimmer setzte sie sich mit dem Rücken zur Wand aufs Bett, tippte auf die Netflix-App ihres Smartphones und begann, wahllos eine Friends-Folge anzuschauen. Zufällig war es Staffel 3, Folge 3. Sie war gerade bei der Szene angelangt, in der Ross und Rachel Chandler Nachhilfe in Sachen Freundschaft geben, als sie Rashida in der Tür stehen sah. Phyl zuckte schuldbewusst zusammen und legte das Smartphone zur Seite, als wäre sie beim Pornoschauen ertappt worden. Aber Rashida sagte nur freundlich:
”Süße Gelüste, stimmt's?“
Phyl nickte. Es war erstaunlich, wie viele Leute – noch dazu solche, von denen man das gar nicht erwartet hätte – die Friends-Folgen offenbar auswendig kannten.
”Stimmt.“
”Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, worum es da geht.“