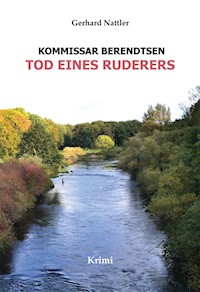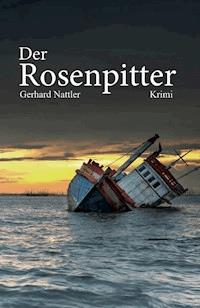Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Giulio Tedone, ein junger Anwalt, wird von seinem Onkel als späterer Nachfolger in dessen Bauunternehmen eingeführt. Schnell ist ihm klar, dass dieser außerdem an organisiertem Diamantenschmuggel beteiligt ist. Nach anfänglicher Begeisterung macht Giulio im Kongo eine interessante Bekanntschaft mit einer Frau, die seine Sichtweise auf die illegalen Geschäfte verändert. Doch dieser Wandel bringt ihn in akute Lebensgefahr - denn Giulio weiß mittlerweile einfach zu viel...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Nattler
Brillant ist nur der Tod
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Meran, den 15. August
Am selben Tag
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Sonntag, der 15. August
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Impressum neobooks
Meran, den 15. August
Octavio Altani hätte zufrieden sein können mit seinen Eisdielen. Das Wetter war wunderbar warm heute am 15. August, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Heute war für die meisten Italiener der Beginn des Urlaubs. Die Sonne gab ihr Bestes. Die Promenade in Meran war gut besucht, um nicht von Überfüllung zu sprechen. Die Einheimischen hatten sich nach dem Kirchgang in St. Nikolaus unter die Touristen gemischt und den ganzen Tag lang strebte alles in die Lokale, Cafés und Eisdielen um sich zu erfrischen, sei es mit einem Glas Prosecco, einem Viertele oder einfach einem Eis im Hörnchen. Jedoch kümmerte es ihn wenig. Er lag eingerollt in einer festen Plastikfolie im Kofferraum seines BMW X5 und war tot.
So dachten jedenfalls die Fahrer.
Wie lange er bewusstlos gewesen war, wusste er nicht. Sein Kopf dröhnte, schien zu platzen. Bei jedem Kanaldeckel hätte er am liebsten laut aufgeschrien, aber mit Rücksicht auf die Unterhaltung der Männer auf den Vordersitzen zog er es vor, die Zähne zusammenzubeißen und ruhig zu bleiben. Er ging davon aus, dass Fahrer und Beifahrer die gleichen Leute waren, die ihm in seiner Apfelplantage mit einem Betonstab eins übergezogen hatten. Seine Sinne arbeiteten fieberhaft. Tatsache war: er war in einer überaus misslichen Lage. Die Chance, hier noch einmal davonzukommen, war gleich null. Allerdings war es nicht das erste Mal, dass er den Tod vor Augen hatte. Das Wichtigste war zunächst, absolute Ruhe zu bewahren und seine Widersacher im Glauben zu lassen, er sei tatsächlich tot.
Octavio versuchte, sich zu erinnern:
Er war gegen drei Uhr am Nachmittag in die Plantage gefahren. Die Zeit wusste er genau. Er hatte ein Telefongespräch geführt. Jemand hatte ihn angerufen, um ihm mitzuteilen, dass der Obstbauer, der die Anbaufläche neben ihm bewirtschaftete, seinen Garten mit Insektengift einsprühen würde. Dieses war im Vinschgau streng verboten. Die Bauern hatten sich darauf geeinigt, abgestimmt und die Verordnung verkündet, dass keiner sprühen durfte, damit das Obst aus dieser Region das Prädikat »Bio« für sich beanspruchen durfte. Der Anruf war anonym gewesen. Das war logisch. Keiner würde es sich mit der Dorfgemeinschaft verderben wollen, weil er solche Nachrichten weitergab. Also hatte er sich schleunigst auf den Weg gemacht. Von einem Sünder war allerdings nichts zu sehen gewesen. Da er nun schon einmal vor Ort war, konnte er auch eben seinen Besitz kontrollieren, um wegen des vorausgesagten Gewitters keine Überraschung zu erleben. Das kam im Vinschgau immer recht heftig nieder, häufig mit dicken Hagelkörnern, wie jeder wusste, der sich hier ein wenig auskannte. Stutzig hätte er werden müssen, als er auf der Grasnarbe zwischen den Fahrspuren des Traktors frische Tritte festgestellt hatte. Zwei Personen. Außerdem war einer der beiden anscheinend auf dem feuchten Untergrund ausgerutscht und hatte sein Messer verloren. Beim Betrachten dieses schweren Messer mit Springklinge fiel ihm ein Emblem am Anfang der Klinge auf. Es handelte sich um ein stilisiertes Stiergehörn. Das Zeichen erinnerte ihn an das Zeichen für das Sternbild Stier. Darunter stand »MADE IN USA«. Er hatte das Messer in seinen Gummistiefel gesteckt und überlegt, während er die Netze kontrolliert hatte, woher er dieses Zeichen kannte. Er meinte auch jetzt, dieses Zeichen schon einmal irgendwo gesehen zu haben.
Ihm fielen die Augen zu.
Am selben Tag
»Zwei Bar, passt!« Georg war zufrieden mit dem Luftdruck. »Hast du deinen Reifendruck geprüft?«
»Gestern.«
Die beiden Freunde und Kollegen Georg und Markus befestigten ihre Mountainbikes auf dem Dach von Georgs Passat und verstauten die Rücksäcke im Kofferraum. Ein kurzer Blick nach dem Reparatur-Set. Komplett.
»Ich habe vier belegte Semmeln, Käse, eine Kaminwurzen und für jeden einen Apfel. Auf die Capes können wir bei diesem Wetter getrost verzichten, denke ich.«
Er klopfte seine Taschen ab.
»Mein Taschenmesser habe ich in der Hosentasche, Wasser insgesamt drei Liter und das, was noch in den Haltern ist. Hier sind noch zwei Schoko- und Müsli-Riegel. Das reicht. Was ist mit deinem Helm?«
Markus lief zurück und brachte den Helm.
»Hast du neue Schuhe? Shimano … Geil! Die kosten richtig Asche, oder?« Georg begutachtete sie genau.
»Gar nicht mal. Es ist ein Vorjahresmodell. Dreißig Prozent. Weißt du, nach dem Ski-Unfall im Februar habe ich mir diese Schuhe gegönnt. Man kann bei denen die Fersengröße anpassen. Weil ich seit der Achillessehnen-OP die kleine Narbe habe, drücken hinten die alten Treter bei längerer Fahrt. Das ist nervig. Diese habe ich perfekt auf die jeweilige Hacke eingestellt. Solltest du auch probieren. Ich habe sie in der Reha bereits beim Spinning benutzt und inzwischen drei kleine Fahrten damit gemacht. Ich muss sagen, sie gefallen mir sehr gut. Vor allen Dingen konnte ich die Pedalplatten der alten Schuhe übernehmen.«
»Die sind verdammt leicht.«
»750 Gramm komplett mit Cleats.«
»Sauber!«
Die kurvenreiche Straße mit Kehren und Tunneln endete auf einem großen Parkplatz in 1200 Metern Höhe, direkt beim Gasthaus Thurner. Er war noch kaum zu einem Drittel gefüllt. Er parkte seinen Wagen so, dass er bei seiner Rückkehr am späten Nachmittag im Schatten stehen würde. Marie war gerade dabei, die Tische für die erwarteten Gäste zu decken und winkte ihnen zu.
»Na, Markus, wie geht’s immer mit dem Bein?«
»Soweit bin ich zufrieden. Heute kommt der erste größere Test. Bin gespannt.«
Er warf ihr einen Handkuss zu, den sie nur zu gerne erwiderte. Sie wäre gerne auch einmal mit ihm zusammen gefahren oder noch lieber einmal gewandert. Mit dem Mountainbike zu fahren, war nicht ihr Ding. Beim Après Ski einen Tag vor seinem Unfall hatten sie beide sich in den Holzschober zurückgezogen und er hatte sie intensiv geküsst. Sie hatte an dem Abend die Hoffnung gehabt, dass Markus diese Küsse ebenso genossen hatte wie sie. Leider hatte er am nächsten Tag den Sturz gebaut, vielleicht wäre sonst mehr daraus geworden. Ein stiller Seufzer hob ihr Dirndl an. »Ich wünsche euch viel Spaß. Übernimm dich nicht, Markus«, rief sie noch hinterher. »Und lasst euch mal wieder sehen.«
Er winkte kurz.
Der Sessellift stand still. »Wartungsarbeiten«, las Georg auf einem Hinweisschild. »Dann bekommen wir wahrscheinlich beim Prandler-Wirt auch noch einen Platz auf der Terrasse«, freute sich Georg.
»Also müssen wir mit Muskelkraft da hinauf«, stellte Markus fest, unsicher, ob er die Steigung ohne Absteigen schaffte. »Ich lag vor drei Tagen noch mit Halsschmerzen im Bett und habe vorgestern die letzte Amoxi genommen. Das steckt man auch nicht so einfach weg. Die machen schlapp. Ich war bis gestern krankgeschrieben.«
»Nur Mut! Warum haben wir dich wohl zwei Monate in die Reha geschickt? Wir versuchen es. Es ist ja nur das erste Stück, das so steil ist. Wenn wir die Höhe erreicht haben, ist es ja eine Spazierfahrt. Denke an die Endorphine. Was wirst du einen Kick haben, wenn du dich erst einmal wieder richtig verausgabt hast. Wir machen Pause, sobald du anzeigst ›Halt!‹. Versprochen. Also … du fährst vorne und bestimmst die Geschwindigkeit. Kein falscher Ehrgeiz. Mir musst du nichts beweisen.«
Auf der Hälfte des ersten Anstiegs fand Markus den Mangel an Kondition allerdings gar nicht so gravierend, wie er gestern Abend noch befürchtet hatte. Das erstaunte ihn.
Sie waren eine dreiviertel Stunde unterwegs, als Markus seinen Freund auf eine alte Holzbank hinwies, auf der sie schon des Öfteren Halt gemacht hatten und mit der sie eine schöne Erinnerung aus ihrer gemeinsamen Schulzeit verknüpften. Sie hatte seit Jahren nur mehr drei statt der normalen vier Sitzbretter, was der Stabilität aber keinen Abbruch tat.
»Was war das damals für eine Sause, als wir unser Picknick nach dem Abi dort oben am Kreuz veranstaltet haben. Da wurde auch hier auf halbem Weg eine Pause eingelegt …«
»… und dabei das vierte Brett aus der Bank gebrochen. Ich glaube, der Uli war’s. Der hatte stets ein Händchen dafür, irgendwo irgendetwas abzubrechen. Der Kartenständer ging auch auf sein Konto.« Sie brachen in fürchterliches Gelächter aus.
»Was hat der Direx sich aufgeregt. Ich dachte, er platzt. Mein Gott …«
»Zu drei Stunden Sozialarbeit hat er uns verdonnert. Aber Spaß haben wir dabei gehabt. Weißt du noch? Die schöne Anja?«
»Der haben wir immer weiß gemacht, dass wir vom Setzen der Stecklinge keine Ahnung hätten, nur damit sie sich wieder bücken musste und wir die schöne Aussicht genießen konnten.« Das Gelächter flammte wieder auf.
Georg kramte das Wasser aus dem Rucksack. Als er die Flasche an seine Lippen setzte, blitzte die Erinnerung an Anja wieder auf und er konnte es nicht vermeiden. Er prustete das Wasser bei einem erneuten lauten Lachanfall im hohen Bogen in die Wiese. Eine Kuh hatte nicht mit dem plötzlichen Gewitter gerechnet und sprang mit einem riesigen Satz die Böschung hinab, woraufhin ihr manche andere folgten und schließlich die ganze Herde die Wiese hinunter galoppierte und für eine weitere Lachsalve sorgte. Sie hatten Mühe, sich zu beruhigen.
Schließlich kamen sie doch noch dazu, die Semmeln auszupacken. Sie saßen beide kauend auf der Bank und ließen ihre Blicke schweifen, die mal an Bergspitzen, an Wolken oder an Vögeln kurz haften blieben, bis Georg zuletzt einen Drachenflieger längere Zeit beobachtete, der einen Aufwind gefunden hatte und immer im Kreis in der Nähe eines Abhanges über dem Tal schwebte. Er stieß mit dem Ellenbogen seinen Freund an und zeigte mit dem Taschenmesser in der Hand auf den Fallschirm: »Man kann es beinahe nicht für möglich halten, dass ein Aufwind so stark ist, dass er ohne Probleme einen Mann samt Drachen immer höher hinauf trägt. So eine kleine Fläche zieht hundert und mehr Kilo in die Höhe.« Er sprach mit reichlich vollem Mund und musste mehrmals den Inhalt mit der Hand zurückschieben.
»Jetzt sieh dir das an!« Markus zeigte unten auf eine Almhütte. »Sieh dir nur die alte Hofer-Alm an. Sie stand doch seit dem Tod der alten Ladurner monatelang leer. Dann auf einmal ist sie renoviert worden und ein Afrikaner ist eingezogen. Der scheint es aber nicht lange hier ausgehalten zu haben. Er war nicht mal ein halbes Jahr hier. Ist eben ein Unterschied, Berge in Südtirol oder Steppe in Afrika. Als wir zuletzt hier oben Ski gefahren sind, waren dort schon den ganzen Tag die Blendläden zugeklappt. Jetzt scheint wieder jemand zu wohnen. Ich muss die Marie doch mal fragen, wer das ist. Die Ladurner selbst wollen bestimmt nicht einziehen. Sie besitzen doch ihre Villa oberhalb von Marling. Ich weiß nicht, wie der Junge das gemacht hat. Er ist vor wenigen Jahren hierher versetzt worden und schon hat er … ja fast einen Gutshof.«
Sie saßen noch keine Stunde im Sattel, da erschien schon der Hinweis auf die Prandler-Alm. Sie beschlossen, den Wirt zu besuchen.
»Hallo, wen sehen da meine trüben Augen? Die Herren Doktoren geben sich die Ehre. Wie geht’s denn immer so? Wieder mal auf Tour?“, begrüßte sie der Prandler und bot ihnen seine raue, gegerbte Hand, »Alles bestens? Was macht das Bein? Alles wieder gut inzwischen? Keine Probleme mehr?«
»Alles in Ordnung, völlig wieder hergestellt. Zeig her die Karte, was gibt’s als Tagesgericht?«
»Der Leberkäse ist heute besonders gut, mit Bratkartoffeln und Spiegelei, nur hereinspaziert. Und ein frisches Weizen habe ich auch noch.«
»Dann ist ja für alles gesorgt. Fein«, freute sich Georg.
Sie dehnten die Pause weit länger aus als sonst. Wie vorausgesehen, war wenig Betrieb. Der Prandler setzte sich zu ihnen und spendierte noch ein Schnapserl, das sie nicht nehmen wollten, aber mussten. Dann hatte er dafür ein Weizen auf ihre Kosten zu trinken und so kamen sie ins Reden und sprachen über Gott und die Welt, aber wer in Ladurners Häuschen einziehen sollte, wusste der Prandler auch nicht. Schließlich setzten sie ihre Radtour fort. Allzu weit kamen sie aber nicht mehr. Sie mussten sich wegen der beiden Weizenbiere und den zwei Trebern bald wieder auf den Heimweg machen. Sie bedauerten nicht ernsthaft, heute die ausgewählte Tour nicht zu Ende gefahren zu haben, dafür hatten sie so viel Spaß gehabt wie lange nicht.
»Lass uns doch am Wetterkreuz vorbei über die Sockelwiese zurückfahren. Da haben wir noch schöne Sonne und der Weg ist gut zu radeln«, schlug Georg vor. Der Weg führte sanft bergab und sie kamen gut voran. Bald machte er eine scharfe Biegung und verlief dann oberhalb eines frischen Kahlschlags, so dass die beiden unverhofft einen wunderbaren Ausblick auf die in der Ferne liegende Rotwand erhielten, die durch die schon im Westen stehende Sonne angestrahlt wurde und ihre unverwechselbare rote Farbe angenommen hatte. Dort hielten sie inne und setzten sich nebeneinander auf einen frisch geschlagenen Stamm. Den Rucksack stellte Georg zwischen seine Beine. Einen Apfel hatte er noch, den er sich mit Markus teilte. Der hatte aber schon wieder die Hofer-Alm ins Visier genommen. »Sieh nur, Georg. Von hier aus erkennt man, dass sie auch eine Garage bauen. Es will ganz bestimmt wieder jemand einziehen. Hoffentlich haben die Ladurner jetzt mehr Glück mit dem Mieter. Ich hätte ihnen sofort prophezeien können, dass es einem, der mit dieser Gegend nicht vertraut ist, hier nicht gefällt. Unser Schlag ist nun einmal etwas eigensinnig und kommt nicht sogleich mit jedem aus. Es dauert immer seine Zeit. Man kann nicht einfach in die Berge umziehen und denken, es gefällt einem. Er hätte sich doch ausrechnen können, dass er nicht sofort Kontakte knüpfen kann.«
»Wollte er ja vielleicht auch gar nicht. Ich habe auch schon mal daran gedacht, ganz abseits zu wohnen. Jedenfalls ist es vernünftig, wieder jemanden dort wohnen zu lassen. Es verkommt sonst zu schnell. So eine schöne Lage! So versteckt. Wäre doch schade, wenn so etwas ungenutzt bliebe.«
»Also die Zufahrt zur Garage… ich weiß nicht… So nah am Abhang? Das hätte man doch bestimmt auch anders regeln können. Wenn sie schon den halben Wald abholzen, dann wäre es doch auf ein paar Bäume mehr auch nicht angekommen. Bin gespannt, wann wir den ersten Unfall davon reinbekommen.«
»Das ist ja nun nicht unser Problem. Lass uns aufsitzen. Wir sind spät dran, Markus. Schau, der Prandler ist auch schon auf dem Weg nach unten … und der ist immer der letzte auf dem Berg, weil der seine Kühe noch versorgen muss.«
Während Georg gerade ihre Sachen zusammenpackte und den Rucksack aufnahm, hörten sie mit einem Mal, wie ein Auto sich dem Haus über den Wiesenweg näherte. Vor der Garage hielt es an. Zwei kräftige junge Burschen stiegen aus, verzichteten aber darauf, den Motor abzustellen.
»Für die Umwelt nun auch nicht gerade vorteilhaft, das sollte sich eigentlich hier auch schon herumgesprochen haben«, beanstandete Markus, als auch schon die beiden begannen, sich an dem Zaun zu schaffen zu machen. Georg hatte sein Fernglas mit.
»Die beiden holen einen Plastiksack aus dem Koffer-raum … da ist jemand drin eingewickelt. Markus … Markus, du glaubst es nicht … der ist tot.«
»Was!?« Markus riss ihm das Fernglas aus der Hand. »Die setzen den Toten hinters Lenkrad … und schnallen ihn an!«
»Markus, ich glaube, wir sollten die Gendarmerie anrufen.« Georg zeigte Nerven.
»Da setzt ein zweiter Wagen an das Haus heran.«
Dann kam ihnen ein Gedanke, der sie entsetzte und dem sie beinahe keinen Glauben schenken wollten. Sie verschanzten sich hinter den Baumstämmen. Georgs Handy hatte keinen Empfang, aber Fotos konnte er machen.
Die Geschichte begann vor fünf Jahren.
Kapitel 1
Es war warm in Genua an dem Tag, als Giulio Tedone seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Der Wind kam vom Meer und strich luftig durch die geöffneten Fenster des kleinen Hauses an der Via Marcello. Jetzt durfte er sich »Avvocato« nennen. Er würde endlich sein eigenes Geld verdienen und der Mutter nicht mehr auf der Tasche liegen. Vielleicht entkam er ja einmal der kleinen Wohnung am Rande der Stadt. Er hatte Pläne. Er wollte weg aus Genua, dieser langweiligen Stadt, wie er meinte. Fort in die mächtigen Zentren der Politik, wo die richtig großen Prozesse geführt wurden, nach Mailand oder Rom. Da wollte er in eine Kanzlei einsteigen und Partner werden. Sein großer Traum. Eigentlich hatte er ja nicht seiner Mutter sondern seinem Onkel Antonio Tedone seinen Unterhalt zu verdanken, da sein Vater bei einem Verkehrsunfall zu Tode gekommen war, als er gerade 12 Jahre alt war. Er konnte sich noch daran erinnern, wie ein älterer Commissario und sein junger Begleiter seiner Mutter die Nachricht überbracht hatten. Sie hatte es zunächst gefasst aufgenommen, als ob sie schon länger geahnt hätte, dass so etwas passieren sollte. Später dann, als die beiden gegangen waren, hatte sie sich an den Küchentisch gesetzt, ein Geschirrtuch aus ihrer Schürze genommen und bitterlich geweint. Er hatte sich zu ihr gesetzt und versucht, sie in seine Arme zu nehmen, aber er hatte nicht helfen können.
Giulio konnte sich an seinen Vater noch gut erinnern. Es waren einzelne Begebenheiten, die er sogar noch genau wusste und an die er manchmal sehnsüchtig zurückdachte. Ja er wünschte sie sich herbei. Wie gerne wäre er noch einmal mit Papa zum Angeln herausgefahren. Das Boot schaukelte manchmal recht heftig und Papa hatte ihn mit einem langen Tau an der Reling festgemacht. »Schwimmwesten halten einen über Wasser, aber sie verhindern nicht, dass man hineinfällt!«, hatte er immer gewarnt und zog ihn dann ganz nahe an sich heran. Er erinnerte sich noch an den Geruch der Seemannsjacke, seine »Spezialjacke für Seeleute«, die Papa immer beim Angeln trug. An seinem zehnten Geburtstag hatte er endlich auch eine bekommen. »Auf hoher See«, wie er stets wiederholte, warfen sie ihre beiden Angeln aus und saßen ruhig nebeneinander, tauschten dann und wann ein paar Sätze aus, und wurden erst aktiv, wenn ein Fisch angebissen hatte. Das dauerte meist gar nicht sehr lange bei seinem Gespür bei der Auswahl der Köder. Wenn Papa mit der Größe des Fangs nicht einverstanden war, warf er diesen gleich zurück ins Meer. »Der ist zu klein. Der muss noch wachsen. Im nächsten Jahr knöpfen wir uns den noch einmal vor. Dann wird einer von ihm satt. Schnappen wir ihn erst in zwei Jahren … auch nicht schlimm. Dann werden wir alle drei satt.« Voller Stolz zeigten sie Mama abends ihre Beute. Wie der Fang auch ausgegangen war, er wurde gelobt. »Ihr könntet damit unseren Lebensunterhalt verdienen, wenn ihr wolltet. Dann sollten wir uns einen richtigen, hochseetauglichen Kutter kaufen und könnten dann sogar damit in die Karibik in Urlaub fahren.« Das war ihr Traum. Einmal in die Karibik zu reisen, ohne auf die Lire sehen müssen. Arm waren sie nicht gewesen. Papa hatte immer gut verdient, wie er manchmal mitbekommen hatte. Aber bis in die Karibik hatten sie es nie geschafft. Als Mama damals die neue Küche hatte haben wollen, hatte sie eine bekommen mit allen Schikanen, die so eine moderne Küche haben konnte. Zur Einweihung hatte sie sogar eine Party gegeben und allen Gästen voller Stolz vorgeführt, was die Küche zu bieten hatte. Ein neues Auto wurde auch regelmäßig angeschafft, da Papa ja viel damit unterwegs war. Er fuhr Audi Avant, Mama Cinquecento. Wenn er zu Kunden fuhr, trug er immer einen Anzug mit Nadelstreifen, schwarz oder blau, im Sommer beige mit dunkelbraunen Streifen. Manchmal fuhr er bis Florenz und kam erst am Abend zurück. Dann durfte er, als er noch nicht zur Schule ging, immer so lange aufbleiben, bis er zurückkam. Dann brachte Papa ihn ins Bett und erzählte noch eine Gute-Nacht-Geschichte. Meistens war es eine aus dem Orient. Fliegende Teppiche und fliegende Pferde, schöne Prinzessinnen und kluge Jungen, die ihr aus der Not halfen.
Später sahen sie sich zusammen die Liga- und Länderspiele an. Sein Favorit war und ist der AC Milano. Papa hielt zu Genua, weil sein Vater dort in der ersten Mannschaft mitgespielt hatte. Er soll, wie Papa stets gerne vortrug, gegen Lazio Rom einmal in einem Pokalspiel das siegreiche 1:0 geschossen haben. Nach Papas Tod wurden nur mehr recht selten Fußballspiele angeschaut. Mama hatte nur Interesse an Länderspielen, besonders bei einer WM oder EM. Alleine Spiele anzuschauen, machte ihm keinen Spaß. Manchmal schaute er mit Onkel Toni.
Das Top-Event, wie man heute auf Neu-Italienisch auszudrücken pflegte, war ein Besuch bei einem Formula-Uno-Rennen in Monza gewesen. Ferrari feierte mit beiden Fahrern auf dem Treppchen. Und sie beide hatten dabei sein können. Dritter war McLaren. Vater hatte sich gefreut, wie ein Kind an Weihnachten. Damals war es das einzige Mal, dass er seinen Vater hatte vor Freude in die Luft springen sehen. Die Krönung des Ereignisses: sie waren von dem Leiter der Scuderia Ferrari eingeladen worden, den Rennstall zu besuchen. Papa hatte offensichtlich gute Kontakte. Er war stolz auf seinen Papa gewesen. Der Mann – Papa nannte ihn Dottore Faraone – hatte ihm zum Abschied einen roten Ferrari Rennwagen von Burago geschenkt. Er war so glücklich gewesen.
Das war alles lange vorbei. Manchmal versuchte er sich vorzustellen, wie sein Vater wohl aussehen würde, wenn er noch lebte. Er wäre inzwischen achtundfünfzig Jahre alt geworden, rechnete er aus. Er war zwei Jahre jünger als Onkel Toni. Ob er wohl auch einen Wohlstandsbauch bekommen hätte wie sein Bruder? Er hielt es für wahrscheinlich. Mama war immer noch so schlank wie auf dem Hochzeitsfoto. Fast. Das Hochzeitskleid hing jedenfalls noch im Schrank. Man könnte es ja einmal ausprobieren.
Wenn er so träumte, hörte er die Stimme seines Vaters, als spräche er gerade jetzt zu ihm. Manchmal erschrak er dann und ärgerte sich gleich darüber, weil der Traum dann abrupt zu Ende gegangen war. Er hatte sich immer gut mit Papa verstanden. Mama wohl auch.
»Hallo Maria!«, rief jemand von der Straße aus. »Bist du zuhause?« Giulio hatte die Stimme seines Onkels erkannt und winkte ihm vom Balkon zu. Onkel Toni stand in seinem beigen, sportlich-eleganten Anzug unten auf der Straße. Mit der dunklen Sonnenbrille und seinem weißen Bigalli-Hut auf dem Kopf sah er mit seinen sechzig Jahren noch recht smart aus, obwohl er seine Figur »über die Zeit etwas ausgebaut« hatte, wie er zu zugeben musste. Er nahm die Brille ab und winkte Giulio freudig zu.
»Hallo Onkel Toni!«, rief er begeistert und sprang die Stufen hinunter. Beinahe hätte er in seiner Begeisterung seinen Onkel umgerannt. Der stand schon im Treppenhaus. Onkel Antonio hatte Mühe, nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Ich habe alles gewusst, sie haben mich mit ihren Fragen gelöchert, aber ich konnte alles ordentlich beantworten. Insgesamt habe ich als einer der besten abgeschnitten«, antwortete er ohne auf die Frage des Onkels zu warten. »Das hat mir der Vorsitzende der Kommission selbst zugeflüstert, als er mir das Zeugnis überreicht hat.«
»Gratuliere, mein Junge. Ich wusste, dass Du so tüchtig bist wie dein Vater. Es hätte ihn glücklich gemacht. Schade, dass er das nicht mehr miterleben durfte. Du bist ein guter Sohn geworden!« Der Onkel umarmte seinen Neffen mit Stolz im Gesicht. »Ist deine Mutter zuhause? Ich möchte auch ihr gratulieren.«
»Sie ist oben.«
»Hallo Antonio, was sagst du zu dem Jungen?«, strahlte die Mutter ihren Schwager an.
»Ich gratuliere euch beiden von ganzem Herzen.«
Er legte den Hut offen auf den Tisch und warf die Sonnenbrille hinein, ohne sie vorher zusammenzuklappen. Seiner Ledertasche, die er wie gewöhnlich bei sich trug, entnahm er eine in Styropor kühl gehaltene Flasche Prosecco, stellte sie auf den Tisch und lockerte die Agraffe. Ehe er die Flasche ganz geöffnet hatte, standen auch schon drei Kelche auf dem Tisch, die bis oben gefüllt wurden. Er strich seinem Neffen, der nun schon erwachsen war, über die Haare und ruckelte freundlich sein Kinn hin und her.
»Wie schnell doch die Zeit vergangen ist. Wann habe ich dich zur Taufe getragen? Gestern? Geschrien hat der Junge damals wie am Spieß«, wandte er sich an seine Schwägerin und drückte sie an seine Brust. »Jetzt ist er mir über den Kopf gewachsen. So schnell vergeht die Zeit!«
»Ich glaube, wir werden älter. Das sieht man am ehesten an den Kindern.« Sie streichelte ihrem Schwager zärtlich die Wange und den Haaransatz, der inzwischen mehr von seiner Stirn freigab. Haare hatte er allerdings noch genug. Von Glatze war keine Spur zu ahnen. Allerdings waren sie grau.
Nachdem er sich über einzelne Fächer hatte informieren lassen und das Zeugnis sowie die Urkunde ausgiebig bewundert hatte, kam er zur Sache:
»Salute!« Onkel Toni schenkte jedem noch einmal nach. »Auf die Zukunft … auf eine erfolgreiche Zukunft! Ich wünsche dir alles Glück der Erde, mein Junge. Halte dich tapfer und triff die richtigen Entscheidungen. Dann wirst du ein erfolgreicher Mann.«
Sie saßen alle drei um den Tisch herum, der immer noch der gleiche war, an dem die Mutter damals so fürchterlich um den Vater getrauert hatte. Giulio hoffte, dass sie den Tod ihres Mannes verkraftet hätte. Es hatte jedenfalls den Anschein, auch wenn eine kleine Träne in ihren Augenwinkeln zu glitzern schien.
»Und? Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, mein Junge, was du nun tun möchtest?«, fragte Onkel Antonio.
»Leider kann mich die Kanzlei Dibiati, in der ich meine Praktika absolviert habe, nicht einstellen. Kein Bedarf. Schade, ich wäre gerne bei ihnen geblieben. Sie waren alle sehr nett.«
»Ich denke, wir werden schon eine gescheite Anstellung für dich finden«, versprach der Onkel. »Möchtest Du unbedingt in einer Kanzlei arbeiten und Prozesse führen und dich mit anderen Leuten streiten …? Oder … vielleicht in der Industrie Verträge ausarbeiten? … Du hast nun viele Möglichkeiten. Mit diesem Abschluss steht dir die Welt offen.«
Sie plauderten von alten Zeiten, von Onkel Tonis Frau, Giulios Tante Angela, die leider keine Kinder bekommen konnte und schon mit 36 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben war. Dann vom Dorf, wie sie den Stadtteil Albaro nannten, und dem neuesten Tratsch, den seine Mutter vom Friseur mitgebracht hatte. Man redete über Politik, den Euro und die EZB und machte sich Gedanken über die Zukunft des Jungen und schmiedete Pläne. Es waren mehr als zwei Stunden vergangen, als Onkel Antonio sich auf den Weg machen musste. Er klemmte sich die Tasche unter den Arm, nahm seinen Hut in die eine, die Sonnenbrille in die andere Hand und ging auf Maria zu, um sich zu verabschieden. Er küsste sie auf beide Wangen.
»Wenn du einen Rat brauchst oder Hilfe, … du weißt …« Giulio strich er übers Haar, klopfte ihm auf die Schulter und spornte ihn an: »Nur weiter so, Junge. Dann wird aus dir einmal ein wohlhabender Mann.»
Maria blickte ihren Schwager skeptisch an.
Kapitel 2
Am Sonntag nach der Messe trafen sie sich vor dem Hauptportal der Kirche.
»Hallo Onkel Antonio«, freute sich Giulio seinen Paten zu sehen.
»Hallo Ihr zwei, ich wünsche einen schönen Sonntag. Wie geht’s? Darf ich euch zu einem Kaffee einladen? Es würde mich freuen.«
Sie bestellten drei eiskalte Kaffee mit Sahne. Giulio bat noch um einen Eisbecher. Der Ober brachte etwas Gebäck dazu. Es war schon recht warm und Onkel Antonio legte sein Jackett über die Stuhllehne. Nach kurzem Einführungsplausch kam der Onkel zur Sache:
»Was macht die Berufswahl? Hast du schon etwas angepackt?«
Giulio hatte schon einiges unternommen. Ein Vorstellungsgespräch hatte er schon absolviert, zwei standen noch aus. Leider keines bei einem Anwalt. Der aktuellen Situation geschuldet, in der neue Steuergesetze bevorstanden, hatte niemand Lust, das Personal aufzustocken. Im Gegenteil. Alle Freiberufler, ob Anwälte, Makler oder Ärzte mit eigener Praxis würden in Zukunft stärker belastet. Durch neue Vorschriften bei der Dokumentation und im Zahlungsverkehr stieg einerseits die Bürokratie an und dadurch die Kosten und andererseits würde es nicht mehr so leicht möglich sein, Gelder am Fiskus vorbei zu schleusen. Das war er schon als Praktikant gewahr geworden. Er konnte nicht so recht verstehen, warum so viele Leute ihre Steuern nicht bezahlen wollten. Die Leute, die hunderttausend Euro verdienten, hatten doch Geld genug, die Steuern zu bezahlen. So hatte er sich dazu durchgerungen, auch in der Industrie nach Möglichkeiten zu suchen. Eine Hotelkette mit angeschlossenen Reisebüros wollte ihn wohl anstellen, aber die Bedingungen hatten so gar nicht seinen Vorstellungen entsprochen. Er solle in San Remo ein »Büro leiten«. In Wirklichkeit war er dort der einzige Mitarbeiter, der Leute an die Hotels vermitteln sollte. Er hatte auch zwei Bewerbungen an große Firmen in Mailand und in Turin geschickt, die allerdings noch nicht geantwortet hatten. Ging ja auch nicht, wie er wohl einsah. Die Zeit war ja bisher zu kurz. Er rechnete mit drei bis vier Wochen.
»Was hältst du davon, wenn ich dir ein Angebot mache? Es wird bestimmt nicht kleinlich ausfallen. Du weißt, dass ich immer auf der Suche nach guten und vertrauenswürdigen Mitarbeitern bin.«
Noch ehe der Junge antworten konnte, wehrte die Mutter rigoros ab.
»Kommt nicht in Frage! Auf gar keinen Fall! In dem Geschäft deines Onkels hast du nichts zu suchen. Das verhindere die Mutter Gottes!«
Giulio war verdutzt. So kannte er seine Mutter nicht. Sie war sonst immer kulant und auf Ausgleich bedacht. So undiplomatisch hatte er sie noch nie erlebt. Auch der Onkel war recht verwundert.
»Aber Mama!?«
»Nein!«
»Warum?«
»Nein!«
»Sieh mal Maria: die Zeiten sind nicht so, dass man sich die Jobs aussuchen kann wie früher. Selbst hier in Ligurien ist das Angebot …«
»Nein! Basta!«
Die Stimmung war leicht gedrückt, man sah sich nach den Leuten um, die das Café passierten und schwieg. Giulio löffelte stumm den Rest von seinem Eisbecher Napoli und gab die Waffel an seine Mutter weiter, weil sie diese so gerne hatte. Nach einer Weile brachte Onkel Antonio das Gespräch wieder in Gang.
»Wie geht es deiner Familie in Frankreich?«, fragte er Maria möglichst unverfänglich. »Wie lange ist es her mit deinem Vater? Drei Jahre?«
»Jetzt genau drei Jahre und einen Monat. Die Zeit vergeht. Er wäre in diesem Jahr neunundachtzig geworden.« Sie griff zu ihrer Handtasche und zog aus der Seite ein Taschentuch hervor, in das sie kurz schnäuzte. Onkel Toni, davon leicht berührt, sah zu, wie der Ober den Nachbartisch polierte und die Stühle wieder ordentlich rückte. Dann fuhr sie fort: »Jetzt ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Sie ist in Behandlung, aber sie verträgt die Chemo nicht. Meine Schwester hat mit dem Arzt gesprochen. Er glaubt, sie wird es nicht mehr lange machen. Vielleicht wird sie das Weihnachtsfest nicht mehr erleben.«
»Wenn ich dir irgendwie helfen kann…«, bot Antonio seine Unterstützung an, aber im Moment war diese nicht von Nöten. Alles was für die Mutter wichtig war, bezahlte die Versicherung. Finanziell kamen sie auch gut klar, wie der Onkel wusste. Die eine Schwester war bei der Hafenpolizei in Bandol, die andere in der Verwaltung der Stadt und beide waren gut verheiratet. Der Bruder war ein höherer Beamter beim Zoll in Marseille. Alle beide hatten ein Eigenheim an dem Südhang, der sich hinter der Stadt herzog, mit wunderbarem Blick auf die Cote d'Azur.
Als die Mutter sich kurz entschuldigte und Onkel Antonio bezahlte, wandte er sich vertraulich an seinen Neffen:
»Was hältst du davon, wenn ich dich in dieser Woche einmal besuche. Vielleicht können wir deine Mutter doch noch umstimmen?«
Der Junge war nicht abgeneigt. »Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, Onkel Toni. Ich mag dich, das weißt du.«
»Ich mag dich auch.«
*****
Es war gegen Abend, als Onkel Toni mit seinem nagelneuen Maserati GranCabrio vorgefahren kam. Giulio kam gerade vom Einkaufen, was er jetzt öfter tat, seit er so viel Freizeit hatte. Diesen unverkennbar röhrenden Motor hätte er auch im Schlaf erkannt. Er war jedoch sehr überrascht, als er seinen Onkel hinterm Steuer erkannte. Statt des üblichen Hutes trug er eine Baseballmütze mit dem Dreizack. Außerdem trug er einen passenden Schal mit eben diesem Logo.
»Na, was hältst du von dem Maschinchen? Gefällt es dir? Super? Es soll 270 Sachen machen. Ich würde gerne mal nach Deutschland fahren, um es auszuprobieren. Kommst du mit?«
Sie lachten.
Das Dach war geöffnet und der Junge bestaunte die noble Einrichtung des roten Cabrios mit den schwarzen Felgen. Das helle Leder fühlte sich edel an. Er streichelte über das Lenkrad. »Mit Schaltwippen? Nice! Griffig!«, stellte er fest. Er lief um den Wagen herum. Er erkannte sofort die Qualität. »Neues Modell! Wunderbar!«
»Wenn du mich die Einkäufe nach oben tragen lässt, könntest du eine Runde mit dem Auto fahren. Ganz nebenbei könntest du mir sogar einen Gefallen tun. Hole meinen Butler vom Flughafen ab. Er landet gegen halb zehn. Du hast Zeit genug. Kennst du Oscar schon? Er ist bei mir seit April, seit Giovanni seinen verdienten Ruhestand genießt.«
Giulio kannte den neuen Mann, aber im Moment konnte er nicht antworten. Er war sprachlos. Natürlich war der Tausch Gemüse gegen Autoschlüssel schnell beschlossen. Er versprach, vorsichtig zu fahren und Oscar gesund zu seiner Villa zu bringen.
»Hier Junge, nimm die Mütze. Ich habe sie von der Firma geschenkt bekommen. Du darfst sie behalten.«
Der Onkel schaute zu, wie sich sein Neffe mit dem Wagen vertraut machte und dann vorsichtig wendete in Richtung Containerhafen. Als er außer Sichtweite war, klopfte er bei seiner Schwägerin an die Tür und trat ein. Im Sommer stand die Tür immer offen. Maria hantierte in der Küche und bereitete einen Pizzateig. Wegen der mehligen Hände konnte sie ihn nur mit einem flüchtigen Küsschen begrüßen. Dabei hielt sie die Hände weit auseinander. Antonio aber nahm sie in seine Arme und drückte sie.
»Das Essen steht fertig. Bitte setz dich. Der Junge kommt auch jeden Moment. Er ist zum Einkaufen. Er müsste eigentlich schon zurück sein. Na, vielleicht hat er noch jemanden getroffen.«
»Der Junge ist unterwegs zum Flughafen. Ich habe die Einkäufe hier in der Tüte. Er wird eine Weile beschäftigt sein, weil der Flug, mit dem Oscar aus Zürich kommt, mindestens eine halbe Stunde Verspätung hat. Ich habe mit Oscar telefoniert, der auf das Boarding wartet. Sie haben dort ein schweres Gewitter und Hagel. Nichts geht dort.«
»Du hast ihn einfach weggeschickt? Er hätte vorher etwas essen sollen.«
»Meine liebe Maria, mache dir keine unnötigen Gedanken. Der Junge ist erwachsen. Wenn er Hunger hat, wird er schon etwas zu essen finden. Ich habe ihm meinen neuen Wagen anvertraut. Was ist dabei? Er freut sich, dass er fahren darf. Ist eben ein Junge. Ich weiß, dass er damit zurecht kommt. Er ist ja auch schon früher mit meinen Autos unterwegs gewesen. Mache dir bitte keine Sorgen.«
Beim Abendessen vermieden sie es, über die Zukunft des Jungen zu reden. Eigentlich war es Maria, die darüber nicht sprechen wollte. Sie erzählte die neuesten Nachrichten aus Bondol.
Sie lag in seinen Armen. »Du, Antonio, … hast du es am Sonntag ernst gemeint mit der Anstellung in deiner Firma?«
»Natürlich. Was spricht dagegen? Er ist tüchtig und vertrauenswürdig, er gehört zur Familie. Solche Leute brauche ich.«
Sie löste sich von ihm und zog sich an. »Ich finde, er ist einer Aufgabe in deinem Betrieb nicht gewachsen. Er ist zu weich. Kannst du ihm nicht zu einer Anstellung in einer anderen Firma verhelfen. Du hast doch Beziehungen zu allen möglichen Leuten. Vielleicht könnte er bei der Stadtverwaltung anfangen.«
»Maria, der Junge ist zu tüchtig für die Stadtverwaltung. Er kann mehr.«
»Bitte!«
Antonio wog den Kopf hin und her.
»Natürlich ist da etwas zu organisieren … für die ersten Jahre jedenfalls. Aber je früher er bei mir einsteigt, desto eher erfüllt er die Voraussetzungen, in der Firma aufzusteigen. Er soll es weit bringen. Ich habe Großes mit ihm vor. Er muss nur wollen.«
»Toni, ich … habe Angst … ich habe Angst, ihn auch zu verlieren«. Sie stand da und man sah ihr die Furcht an. »Die Geschäfte, die du machst, sind gefährlich.«
»Du denkst an Mario?«
Kapitel 3
Don Antonio loggte sich ein. Unter »Entwürfe« fand er eine neue Nachricht. Diese Art der Kommunikation hielt er für die sicherste, Informationen auszutauschen, ohne dass eine Nachricht verschickt werden musste. So war keine E-Mail nachzuverfolgen oder abzufangen. Drei Leute hatten Zugang zu diesem Konto, er selbst, der Bürgermeister Adolfo Sartori und der Polizeichef Fran-cesco Manola. Wenn einer von ihnen etwas mitzuteilen hatte, was für die Öffentlichkeit nicht so von Bedeutung war oder sein sollte, schrieb derjenige eine Mail und speicherte diese als Entwurf. Man konnte ihn an allen Orten der Welt lesen.
»Wichtig! Nachricht aus Rom: Großfahndung der Policia die Stato in der gesamten Lombardei in Vorbereitung. Schwerpunkt Raum Turin, Autoschieber. DIA ist eingeschaltet. Fahndung nach Radomir Milanovic, gebürtig in Belgrad, gemeldet in Mailand. Kurzfristig. Ich halte dich auf dem Laufenden. Francesco.«
Kurzfristig. DIA. Das waren zwei Wörter, die konnte er gar nicht vertragen. Die Direzione Investigativa Antimafia konnte er hier überhaupt nicht leiden. Die brachte mit ihren dummen Fragen nur Unruhe in die Gesellschaft.
Er las die nächste Nachricht: »Die Firma ADN hat ihre Offerte abgegeben. Du findest sie im Anhang. Das Angebot geht heute in einer Woche in den Bau-Ausschuss. Gruß Adolfo.«
Jetzt kam alles auf einmal. Wer war dieser Milanovic, der ihm jetzt das Leben schwer machte? Es durfte nicht sein, dass wegen eines Serben der ganze Norden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er brauchte Klarheit. Er griff zum Telefon. Den Kerl würde er schon ans Messer liefern. Man müsste ihn nur erst haben.
»Luca? Ich brauche dich hier. Avanti!«
Luca war das Mädchen für alles. Immer wenn es brenzlig wurde, war er gefragt. Er ließ sich nie aus der Ruhe bringen, war schlau wie ein Fuchs und stark wie ein Bär, was man ihm äußerlich gar nicht ansah. Er war rank und schlank wie ein Marathonläufer und fit wie ein Turnschuh. Allerdings rauchte er wie ein Schlot. Man sah ihn kaum ohne eine Zigarette in der Hand. Zeige- und Mittelfinger wiesen schon die typische Nikotinfarbe auf. Auch die Zähne zeigten den rauchergelben Zahnbelag. Oft behielt er die Kippe im Mund und lies die Asche wachsen bis sie von alleine abfiel. Der bissige Qualm zog dann langsam an seinem Gesicht in die Höhe und sorgte für ein halb zugekniffenes Auge und eine gerunzelte Stirn. Für Nichtraucher war er ein Gräuel, weil sein ganzer Körper nach Rauch stank. Daran änderte auch sein intensives Aftershave nichts. Don Antonio sah es ihm nach. Er brauchte ihn. Außerdem war er loyal, was Don Antonio an ihm sehr schätzte. Den größten Teil seiner Freizeit verbrachte Luca mit Tennis und Golf. Hatte er einen entsprechenden Gegner gefunden, spielte er auch gerne Schach. Zur Not standen ihm die entsprechenden Apps auf seinem iPhone zur Verfügung oder, wenn Zeit war, auch auf dem iPad. Überhaupt war er ein Elektronik-Freak. Wenn es Neuerscheinungen gab – er hatte sie. Kalkulationen machen, Dokumente verwalten … das alles gehörte in seinen Aufgabenbereich.
Don Antonio schrieb: »Ich brauche ein Bild! Pronto! Gruß Antonio.« Er meldete sich ab. Er rief nach Oscar und bekam bald seinen Bourbon mit Eis. Das Glas in der Linken, die Faust in der Tasche, wanderte er über seine Terrasse. Er las noch einmal die zweite Nachricht, öffnete den Anhang. Er überflog das Angebot seines Konkurrenten im Bausegment. Er hatte die Zahlen nicht genau im Kopf, aber er schätzte, dass die Konkurrenz knapp 250 T€ günstiger war. Das hatte er erwartet, aber es musste jetzt gehandelt werden.
Luca fuhr vor. Ehe er eine Frage stellen konnte, klärte ihn der Boss auf:
»Probleme! Zwei Probleme!« Don Antonio ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder und bedeutete seinem Geschäftsführer, sich zu setzen. Er las ihm die Nachrichten vor. »Wenn die Mafiapolizei hier auftaucht, ist das kein Weihnachtsgeschenk. Wir müssen diesen Mi- Mi- Milosovicchio finden. Schaffst du das? Wie viel Leute haben wir zur Verfügung?«
»Ruhig Blut, Don Antonio. Den Milanovic, so heiß er, haben wir bald am Wickel. Unsere Freunde aus Mailand haben uns schon Bescheid gegeben, dass er ihnen das Leben dort oben schwer macht. Er kommt ihnen gewaltig ins Gehege. Die Brüsseler Leute haben über die Diebstahlhäufigkeit von Automobilen in Europa eine Statistik herausgegeben. Da sehen die Mailänder nicht gut aus. Jetzt fahndet die Polizei dort oben wie verrückt. Das können unsere Freunde in Mailand ebenso wenig gebrauchen wie wir. Nur nennt er sich hier nicht Milanovic, sondern schlicht und einfach Rossi. Er soll hier an der Riviera eine Hütte haben, munkeln die Freunde aus Mailand. Wir finden heraus, wo er sich aufhält. Keine Sorge Don Antonio.«
Dem Chef wurde sichtlich wohler. Er strahlte fast bis über beide Ohren.
»Wenn wir ihn haben …, sollen wir ihn der Polizei übergeben? Oder …?«. Er machte eine eindeutige Geste mit seinem Daumen.
»Natürlich übergeben wir ihn der Polizei. Am besten direkt Francesco. Allerdings sollte man darüber nachdenken, wie man ihn schweigsam hält. Wer kann schon wissen, was der Mann alles ausplaudern kann. Diese unprofessionellen Neulinge aus dem Osten sind ja einem Verhör bei den italienischen Bullen gar nicht gewachsen. Außerdem muss so einer bestraft werden. Wenn er auch hier keine Geschäfte macht, so hat er doch hier in unserer Gegend nichts zu suchen. Wir sollten ein für alle Mal ein Exempel statuieren.«
»Geht klar, Don Antonio! Soll ich Umberto beauftragen, unser Angebot für die Renovierung des Krankenhauses noch einmal nachzurechnen? Er hat soweit alles fertig. Muss nur die neuen Beträge einsetzen.«
Der Chef trank das Glas leer.
»Bis wann glaubst du, kann er damit fertig sein? Wäre schön, wenn es recht zügig voran ginge. Es sieht nicht schön aus, wenn wir am letzten Tag einreichen.«
»Es kommt darauf an, was wir welchen Leuten noch anbieten müssen. Manchmal haben sie größere Ansprüche als wir vorhergesehen haben. Besonders, wenn vorher nichts ausgemacht wurde. Vielleicht könnten Sie in Erfahrung bringen, welche Vorstellungen da so im Raum schweben«.
»Das werde ich bis heute Abend herausfinden. Ich will versuchen, mit dem Bürgermeister heute noch einen Termin zu vereinbaren. Wenn ich dir morgen … vielleicht morgen Mittag die Ergebnisse mitteile, bis wann sind dann die Angebote fertig?«
»Dann sollten Sie noch in Erfahrung bringen, welchen Anschluss-Auftrag wir noch bekommen, der nicht ausgeschrieben werden muss.«
»Leuchtet ein.«
»Das neue Papier könnte dann zwei Tage später auf Ihrem Schreibtisch liegen.«
Dem Don ging es sichtlich besser. Das ganze Gespräch hatte keine halbe Stunde gedauert. Er hatte gute Leute. Die brauchte man auch in seinem Gewerbe. Er unterschied zwischen zwei Kategorien: Die einen mussten Verstand haben, die anderen Mut.
Als Luca gegangen war, setzte er sich wieder hinter seinen Schreibtisch und verfasste einen Entwurf:
»Hallo Adolfo, danke für die Info. Alles wird bearbeitet. Wenn wir uns heute noch treffen, kannst du übermorgen unser Angebot nicht mehr ausschlagen.
Treffen um 12:15 Uhr an alter Stelle? Ich bin da.
Eine kleine Bitte habe ich noch: Mein Neffe Giulio sucht eine Anstellung. Er ist Anwalt. Gibt es eine Möglichkeit, ihn bei der Stadt zu beschäftigen?«
Da erschien ein neuer Entwurf mit dem Bild von Milanovic.
Für heute hatte er seine häuslichen Aufgaben erledigt. Jetzt ging es an die Geschäfte. Er setzte sich in seinen neuen Wagen und fuhr hinunter zum Meer. Er hatte eine versteckte Bucht zu seinem Lieblingsplatz erkoren. Dort hatte er eine für seine Verhältnisse eher kleine Capanna bauen lassen, wie er die Hütte nannte, oder auch Refugio, je nachdem, wozu er sie gerade nutzen wollte. Von außen sah sie aus wie die Arbeiterhütte einer Baustelle, die der besseren Stabilität wegen direkt an den felsigen Abhang der Küste gebaut war. Sie war gesichert durch einen Metallzaun mit spitzen Enden, der nur durch ein mit drei Schlössern gesichertes Tor Einlass gewährte. Auf einem gelben Schild mit schwarzem Rand war zu lesen:
Umweltzone
Städtische Messstation
Betreten verboten!
Der Bürgermeister
Ein Antennenwald und mehrere Windräder unterstützten die Glaubwürdigkeit des Schildes.
Wenn jemand die Hütte betrat, traf er auf einen einfachen Raum mit zwei Türen. Auf der einen waren die bekannten Symbole für Damen und Herren eingebrannt. Eingerichtet war sie mit einem niedrigen Tisch, zwei Sesseln, einer Couch, einem kleinen Sideboard an der einen Wand und einigen kleinen Bildern und einem Monitor an der anderen. Der Monitor zeigte zwei Bilder der Überwachungskameras. Eine Stehlampe und zwei Wandleuchten sorgten für Licht. Fenster gab es nicht. Die zweite Tür führte in eine voll ausgestattete Bar mit allem was dazu gehört, samt Aircondition. Die Hütte war, von außen nicht sichtbar, in den Küstenfelsen hineingebaut. Wer noch durch die nächste Tür gelassen wurde, kam in einen gefliesten Raum mit Sauna und Dusche. Die Benutzung dieses Teils der Anlage kam eher selten vor und war nur zu besonderen Anlässen erforderlich, eben wenn Don Antonio sicher gehen wollte, dass sein Verhandlungspartner keinerlei Abhörgeräte oder sonstige elektronische Helfer mitgebracht hatte, die ihm später vielleicht unangenehm zusetzen konnten. In dieser Hütte waren schon manche Beratungen geführt, mancher Entschluss gefasst und so etliche Absprachen getroffen worden. Es gab wohl manche Leute, die von der Hütte wussten, aber nur einige wenige, die sie jemals betreten hatten. Zwei von diesen Leuten hatten inzwischen das Zeitliche gesegnet.
Er holte zwei Campingstühle und ein Tischchen heraus und setzte sich ein wenig abseits der Hütte nahe ans Wasser, um den frischen Wind zu genießen, der die Hitze ein wenig erträglicher machte. Mit einem Campari Soda in der Hand schaute er aufs Meer. Er wollte nachdenken. Schließlich gab es noch zwei ungelöste Probleme: die Asylantenwohnungen und ein Nachfolger für sein Unternehmen.
Zum vorgeschlagenen Zeitpunkt kam ein blauer Wagen des Elektrizitätswerks langsam den Sandweg herabgefahren. Es war der Bürgermeister, ein korpulenter Weingutbesitzer mit Halbglatze, der wohl sein Geschäft verstand und den eigenen Wein zu einem guten Essen auch selbst zu genießen wusste. Das Jackett über dem Arm tragend, die Ärmel aufgekrempelt mühte er sich durch den Sand. Der Kragenknopf und der erste Hemdenknopf waren geöffnet. Dementsprechend saß die Krawatte auf Halbmast. Schweißperlen rannen ihm von der Stirn. Er keuchte und musste auf dem kurzen Weg zweimal kurz pausieren. Don Antonio begrüßte seinen Freund Adolfo auf das Herzlichste und wies ihm den zweiten Stuhl zu. Ein kleines Gläschen würde ihn schon in die richtige Stimmung versetzen. Schließlich wollte er die Geschäfte heute unter Dach und Fach bringen. Dem Bürgermeister servierte er auf Wunsch ebenfalls Campari. Seinem Blick nach hatte er schon darauf gehofft.
»Adolfo, schön dass du dich frei machen konntest. Ist es nicht immer wieder schön hier unten? Man sollte sich ein Häuschen in der Karibik bauen. Findest du nicht? Nur … leider kann man von dort aus nicht so gute Geschäfte machen.« Er lachte. »Trotz des Digitalen Zeitalters! Manchmal gehört zu guten Geschäften eben noch die gute alte analoge Heimarbeit.« Er lachte lauthals. Dabei drückte er seinem Freund das Glas in die Hand. »Du weißt warum du hier bist?«
»Ich denke, du möchtest mir einige gute Argumente verraten, die mir helfen, den Bauausschuss zu überzeugen, dir den Zuschlag für die Renovierung des Krankenhauses in die Hand zu legen. Oder?«
»Die Argumente werden auf dem Papier stehen. Ich habe meine Bauingenieure angewiesen, der Stadt, die ich so ins Herz geschlossen habe, ein außerordentlich günstiges Angebot zu unterbreiten. Schließlich hat mein Vater das Krankenhaus gebaut. Du weißt, wie sehr ich um die Gesundheit der Bürger hier besorgt bin. Denke nur an die Kinderspielplätze, die ich eingerichtet habe. Die Straßenlaternen sind auch von mir. So sind die Leute auch abends sicher unterwegs. Die Privatklinik, die ich hier angesiedelt habe, ist nicht von alleine in diesen Ort gezogen. Es war nicht immer leicht, aber ich habe es gerne gemacht. Ich freue mich, wenn du zufrieden bist und der Liebe Gott diese Wohltaten gegen die kleinen Sünden, die ich hin und wieder begehe … begehen muss, aufrechnet.« Nach einer Schluckpause: »Allerdings … also … ganz ohne eine kleine Unterstützung hier und da geht so etwas schlecht. Schließlich muss ich für die Wohltätigkeiten etwas Geld in die Hand nehmen … hmm … was die Argumente betrifft, so denke ich, die werden sie nicht ausschlagen. Sie sind ja immerhin dem Stadtkämmerer zu Rechenschaft verpflichtet. Hast du ihn soweit im Griff?«
»Was könnte ich wohl für dich tun, lieber Antonio? Ich könnte mir vorstellen, dass du mehr Umsatz brauchst. Ja? Sollte man vielleicht einen separaten Anbau für die Küche des Krankenhauses bauen lassen? Wenn die Entscheidung im Rat der Stadt kurzfristig vor Abschluss der ausgeschriebenen Renovierung entschieden würde, dann brauchte man keine zweite Ausschreibung, wenn du verstehst … So im Keller, wo sie jetzt ist, fühlen sich die Köche nicht so wohl, wie sie sollten. Schließlich kochen fröhliche Köche wahrscheinlich bessere Pasta, nicht wahr? Ist das nicht so?«
»Mein Freund! Ich wusste, dass du mich verstehst! Wir sind ein eingespieltes Team. Was haben wir beide schon für tolle und erfolgreiche Geschäfte durchgezogen. Darauf trinken wir! Salute!« Er wollte gerade mit seinem Freund anstoßen, als der weitere Bedenken anmeldete.
»Es ist nicht so einfach.« Er runzelte die Stirn, nahm einen Schluck, wischte sich mit seinem Taschentuch ein paar Schweißtropfen von Stirn und Glatze und faltete es umständlich wieder zusammen. »Da sind ja noch so manche Leute in meiner Partei, die von Bedeutung sind, aber nicht so recht mitspielen wollen.«
»Wer?«
Der Bürgermeister gab sich nachdenklich. Er kratzte sich am Kopf, als hätte er ein Problem zu lösen. Er holte sein Tuch abermals aus der Hosentasche und wischte sich über die Wangen.
»Der Parteivorsitzende z. B. und der Kämmerer. Er muss ja schließlich sein OK geben. Sein Vorgänger hätte wahrscheinlich zugestimmt, wenn man in unserem Seniorenheim vielleicht die Küche renoviert hätte. Seine Mutter …«, er bekreuzigte sich und blickte zum Himmel, »war darin untergebracht und wusste gute Küche zu genießen. Hier und heute müsste man etwas nachhelfen. Vielleicht könntest du dich erkenntlich zeigen. Er ist jung, hat gerade geheiratet und eine schöne Wohnung eingerichtet … das Baby … Er ist es gewöhnt, auf jede Lira zu achten – oder Cent, wie es heute heißt. Du weiß, wie es ist am Beginn eines Familienlebens. Das merkt man auch manchmal im Ausschuss.«
»Wären Zehn genug? Was meinst Du?«
»Du bist großzügig, Antonio. Wirklich. Sie beide werden deine Aufmerksamkeit zu schätzen wissen.«
»Beide?!«
»Der Parteivorsitzende. Er ist wichtig für uns. Auch in Zukunft. Es wird dein Schaden nicht sein.«
»Für jeden fünf! Maximum! Und jetzt lass uns auf das Geschäft anstoßen!«
»Die Köche könnte man veranlassen, die neue Arbeitsstätte mit einem Exquisit-Menü einzuweihen. Vielleicht könntest du die Zutaten bestellen. Kochen würden sie dann schon selbst.«
Don Antonio wirkte etwas genervt. »Sonst noch jemand mit Sonderwünschen!?«
»Sonst nichts. Es wäre auch für dein Image gut, wenn die Leute wüssten, dass du, großherzig wie du bist, die Zutaten gespendet hättest.« Er trank ein Schlückchen, schaute zum Himmel, dann in die Augen seines Freundes. »Solltest du überlegen. Es muss aber nicht sein. Außerdem … was deinen Neffen betrifft … ich könnte mit dem Kämmerer reden. In seinem Vorzimmer wäre er gut aufgehoben. Der Mann ist tüchtig. Er könnte ihm manche nützliche Dinge beibringen, was die Haushaltsführung angeht und … wir wollen es nicht unterschätzen: er ist dann auf meiner Etage. Ich könnte ihm einige Kenntnisse verschaffen, z. B. Umgang mit Leuten und … wie man Zusagen einhält.«
»Die Absprache gilt? Dein Anteil wie immer?«
»Sie gilt!«
Die beiden Männer räumten ab und verstauten alles in der Hütte. Sie verabschiedeten sich und Adolfo stieg in seinen Wagen, nicht ohne vorher mit einiger Mühe den Sand aus seinen Slippern geschüttet zu haben. Als er gewendet hatte, winkte ihn Antonio noch einmal zu sich.
»Was ist mit dem Autoschieber aus Mailand? Ist Manola daran interessiert?«
»Auf jeden Fall. Es wird seiner Karriere sicher nicht schaden.«
Drei Jahre darauf.
Kapitel 4
Giulio Tedone war seit zwei Jahren Stadtkämmerer von Genua. Der Wunsch seines Vorgängers, eines geborenen Südtirolers aus dem Dorf Hafling bei Meran, einmal in die Provinz Bozen versetzt zu werden, war mit einem Male ganz kurzfristig genehmigt worden. Er erhoffte sich dort schnellere Aufstiegsmöglichkeiten. Viele Anträge waren von ihm gestellt worden, die aber trotz seiner Zweisprachigkeit bisher alle abgewiesen worden waren. Leute in höheren Ämtern oder Polizeibeamte wurden selten in ihrer Heimatregion eingesetzt, um irgendwelcher Korruption vorzubeugen. So wurde Giulio für den Posten vorgeschlagen und natürlich auch angenommen. Er machte seine Sache gut und verschaffte seinem Onkel Informationen und Vorteile, wo er konnte. Er hatte im Grunde nur den Stempel und seine Unterschrift unter die Dokumente zu setzen. Diese kamen dann jeweils in einem weißen Umschlag statt einem aus recyceltem Papier. Ein Bleistiftstrich in der unteren linken Ecke machte ihm klar, dass es wohl keine bessere Möglichkeit für die Stadt gab als die empfohlene. Ja es kam sogar in letzter Zeit immer häufiger vor, dass er doch noch eine elegantere Lösung vorzuschlagen wusste, die dann auch seinen Onkel vollauf begeisterte. Dass er tüchtig war und manches Mal kurzfristig und unbürokratisch Lösungen anbieten konnte, sprach sich schnell herum, auch über die Grenzen von Genua hinaus. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte ihn noch hin und wieder das Gewissen geplagt, wenn irgendwelche Entscheidungen bereits gefallen waren, ehe sie auf seinem Schreibtisch landeten. Das hatte sich aber bald gelegt, als er feststellen konnte, wie einträglich sich diese Zusammenarbeit gestaltete, zumal diese Entscheidungen – wenn sie Onkel Toni betrafen – für ihn nicht mehr mit viel Arbeit verbunden waren, da sie schon alle fix und fertig durchgerechnet waren. Er träumte schon von einem neuen Auto. Das hätte er auch längst sein Eigen nennen können, wenn Onkel Toni ihn nicht in letzter Minute gewarnt hätte.
An einem Montagmorgen im Juni betrat ein Mann sein Büro, der ihm bekannt vorkam.
»Bongiorno, mein Junge, kennst du mich noch …?«
Giulio überlegte.
»Das macht nichts. Es ist lange her. Ich freue mich, dass du so fleißig bist und einen so guten Beruf gewählt hast. Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen.«
Giulio erhob sich und reichte ihm die Hand. »Giulio Tedone ist mein Name.«
»Ich weiß. Ich habe deinen Vater gut gekannt. Bist du auch ein solcher Autonarr wie er?«
»Sie sind … sind sie der Dottore aus der Scuderia?«
»Gratuliere! Giulio. Lass dich umarmen.«
Der Dottore nahm Platz. Sie unterhielten sich eine Weile über alte Geschichten und vor allen Dingen über den schönen Tag, als Giulio von ihm das Burago-Auto bekommen hatte.
»Den Ferrari habe ich noch. Inzwischen ist es eine ganze Sammlung geworden. Das Geschenk von Ihnen hat sogar einen Ehrenplatz.«
»Was würdest du sagen, wenn du mal einen echten Ferrari fahren könntest. Ich meine … nicht nur eine Probefahrt. Möchtest du nicht gern einen eigenen Ferrari besitzen? … Ganz ehrlich?«
Giulio grinste ihn an. »Wer möchte das nicht? Vielleicht wird der Wunsch irgendwann erfüllt.«
»Könnte schneller Wirklichkeit werden, als du denkst. Ich habe ein kleines Anliegen. Ich weiß, es fällt nicht in dein Resort, aber ein Talent wie du hat doch Möglichkeiten …«
»Ich helfe gerne, wenn ich kann. Wo gibt es denn Schwierigkeiten?«
»Es gibt kein Problem. Ich habe lediglich einen kleinen Wunsch. Sieh mal Junge, ich habe vor, hier in Genua ein Haus zu bauen … nur für mich. Ein Ferienhaus. Weißt du? Ich komme aus der Toscana und möchte deshalb ein Haus mit schöner Terrasse und Meerblick. Vielleicht könntest du mir dabei helfen …«
Giulio versprach, sein Bestes zu geben.
»Es gibt hier in Genua einen wunderbaren Yachthafen. Ich habe ihn angeschaut. Leider ist er komplett?«
»Sie brauchen einen Liegeplatz … Das ist schwierig. Allerdings. Wie groß ist das Boot?«
»Sechzig mal zwanzig Fuß. Acht tief.«
»Mama mia!«
»Ich würde mich für die Anstrengung und die Mehrarbeit erkenntlich zeigen. Denke an deine geheimen Träume …«
Er gab Giulio einen einfachen Zettel mit seiner Handynummer. »Die Nummer ist nur für dich, nicht zur Weitergabe. Ich erwarte deinen Anruf in spätestens zwei Wochen. Arrivederci.« Ebenso plötzlich wie er gekommen war, verschwand er wieder.
Giulio informierte seine Kontakte. Dann ging er wieder zum Tagesgeschäft über.
Später rief er seinen Onkel in seinem Büro an.
»Hallo Onkel Toni, heute ist ein wunderschöner Tag. Um 12 Uhr habe ich Dienstschluss und würde gerne mit dir eine Tour mit dem Cabrio unternehmen. Was hältst du davon? Ich hätte auch eine gute Idee für ein Ziel, vielleicht sogar verbunden mit einem neuen Geschäftszweig. Ich würde mich freuen, wenn du Zeit hättest.«
Sie fuhren im offenen Wagen zum Fischereihafen. Giulio führte seinen Onkel auf die Terrasse eines verlassenen Lokals, von der man einen wunderbaren Überblick über den Hafen genießen konnte. Sie war ein wenig marode und sie mussten Acht geben, nicht über lockere Balken zu stolpern. Der Junge wies mit einer ausladenden Armbewegung über die ganze Breite des Hafens.
»Schau! Ist es nicht schön hier, Onkel Toni? Sieh mal alle die schönen bunten Fischerboote. Sie sind heute viel größer als damals, als ich noch ein Junge war. Wie sich die Zeiten ändern. Nicht wahr, Onkel Toni?«
»Was soll das? Nur um mir das zu zeigen, fahren wir hierher?« Er trat einen Schritt beiseite um ihn genauer zu betrachten. »So wie ich dich kenne, führst du etwas im Schilde?«
»Fällt dir nichts auf? Es ist kein Fischer da, der seine Netze flickt. Man lässt sie einfach so über die Bordwand hängen. Warum lassen die Fischer sie so verrotten? Was meinst Du?«
»Ich bin kein Fischer. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht sind sie einfach zu träge? Vielleicht arbeiten sie jetzt außerhalb in irgendwelchen Fabriken. Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich auch wenig. Lass sie, wenn sie nicht wollen. Wenn sie Hunger haben, werden sie schon wieder rausfahren.«
Giulio mochte seinen Onkel sehr. Er bewunderte ihn. Er war immer gut zu ihm und ein im Grunde sehr lieber Mensch, aber diesen rauen Geschäftston konnte er nicht leiden. Er mochte nicht die eiskalte Seite dieses einfühlsamen Menschen.
»Hunger haben sie schon. Sie fahren nicht raus, weil es nicht genug zu fischen gibt! Sie haben die Netze nicht mal mehr halb voll. Deshalb fährt immer nur noch jeder Dritte hinaus auf die See. Sie wechseln sich ab. Ich habe das in den letzten Monaten beobachtet. Die große Ernte fahren die großen Reedereien in Neapel ein, Catania und Palermo. Die fischen in großem Stil unser schönes Mittelmeer leer. Sie stören sich nicht daran, dass Küstenfischerei für große Fangflotten tabu ist. Es kümmert sie einen Dreck. Die Küstenpolizei wird gefügig gehalten. Sie arbeiten mit Methoden, dagegen sind wir reine Engel. Sie haben den Vorteil auf ihrer Seite. Sie brauchen keinen Fischmarkt. Sie haben eine voll ausgestattete Fischfabrik an Bord. Die Fische sind schon tiefgefroren, wenn sie an Land kommen. Sie geben den Fang direkt auf den Transport. Das ist sicher für diese Region nicht schön. Es ist der Tod für die alt eingesessenen Fischer. Man sollte was tun!« Giulio blickte weiter stur auf den Hafen, aber der Onkel fühlte sich angesprochen.
»Ich? Ich kann doch da nichts machen!?« Er fasste seinen Neffen an die Schulter, drehte ihn zu sich. »Sieh mich an!« Er legte die Hand auf sein Herz, um zu bestätigen, dass es ihm leidtäte, aber er leider nicht helfen könnte. »Ich kann mich doch nicht auch hier noch engagieren. Ich tue genug für diese Region.«
»Du sollst es ja nicht umsonst tun. Es könnte der Anfang einer große Freundschaft mit ihnen sein und ein riesiges Geschäft!«
Der Onkel blickte ihn verblüfft an. »Was?! Welches Geschäft sollte ich wohl mit Fischern machen?«
»Sieh’ doch mal die riesige brachliegende Kapazität der Boote. Fällt dir dabei nichts ein? Ich will dir mal einen Tipp geben: wer braucht Boote, wer hat keine oder jedenfalls nur schlechte, ganz schlechte?«
»Ich weiß nicht. Ich jedenfalls nicht.«
»Flüchtlinge!«
Antonio blickte seinen Neffen entgeistert an. Er brauchte eine Sekunde, aber er hatte kapiert. »Du meinst wir sollten …«
»… den Schleppern das Leben schwer machen. Wir täten dann nicht nur ein gutes Werk, indem wir Leben retten, sondern wir beteiligen uns an den Millionenumsätzen! Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um uns von dem Gewinn eine Scheibe, eine riesige Scheibe abzuschneiden. Wir haben die Boote. Wir werden den Fischern klar machen, dass sie ihr Können zur Verfügung stellen und wir haben die Leute, die uns die Schleuser vom Hals halten können. Wir haben freie Fahrt! Wir müssen nur noch eine Möglichkeit finden, wie und wo wir die Flüchtlinge gefahrlos aufspüren, noch ehe die Schlepper sie in die Hände bekommen. Dreitausend bis viertausend Euro pro Nase sind drin. Später sogar noch mehr, wenn bekannt wird, dass unsere Boote sicherer sind. Und es wird sich wie ein Lauffeuer herumsprechen. Auf so ein Boot gehen …? Na?« Er zuckte mit den Schultern. »Wenig bestimmt nicht.«