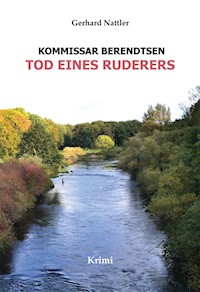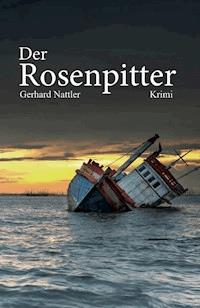
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spannende Jagd auf dunkle Geschäfte Mord in der Lüneburger Heide. Kommissar Berendtsen geht nicht von einem großen Fall aus, doch dann führt die erste Spur zu dem im Hamburger Milieu gut bekannten Hotelbesitzer Peter Friedmann. Noch ehe dieser befragt werden kann wird er unter den Augen zweier LKA-Beamter erschossen. Während die Untersuchungen beginnen finden Friedmanns Kinder heraus, dass ihr Vater noch an anderen, gefährlichen Geschäften beteiligt war. Dadurch geraten Sie selbst ins Visier der Killer und eine rasante Jagd weit über die Grenzen von Deutschland beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Nattler
Der Rosenpitter
Gefährliches Erbe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Impressum neobooks
Prolog
Der Rosenpitter
Ein gefährliches Erbe
Gerhard Nattler
Impressum
Texte: © Copyright by Gerhard NattlerUmschlag: © Copyright iStock.com/pungem
Verlag: VermGes. b.R.
Lessingstr. 1
45896 Gelsenkirchen
Druck: epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Nachdem der alte Toyota schon eine ganze Weile dem Wirtschaftsweg gefolgt war und der asphaltierte Teil des Weges zunächst in einen Schotterweg, dann in einen Sandweg übergegangen war mit dicker Grasnarbe in der Mitte zwischen den beiden Fahrspuren, hält der Fahrer den Wagen an und steigt aus, um sich anhand einer Geländekarte zu orientieren. Dann setzt er seine Fahrt noch ein Stück fort, bis er nach einer kleinen Biegung an einen Holzschober kommt, in dem, wie man ihm beschrieben hatte, ein Pferdeanhänger steht und eine Pferdebox eingerichtet ist. Die Box ist leer. Der Schimmel grast einsam auf der Weide. Durch sein Fernglas kann er einige Kühe in der Ferne auf einer Nachbarwiese beobachten, die zufrieden im Gras liegen und wiederkäuen. Der Verschlag ist offen und so fällt sein Blick durch ein kleines Fenster auf der Rückseite des Holzbaus direkt auf das Haus, zweigeschossig, Satteldach, zwei Garagen, große Terrasse mit eingeklapptem Sonnenschirm. Er hat es gefunden, knapp 100 m entfernt. Alles ist ruhig. Kein Luftzug, kein Hauch. Die Vögel haben ihren morgendlichen Gesang unterbrochen, nur ein Specht hat noch seine liebe Arbeit mit dem hohlen Baumstamm einer Kiefer. Alles ist friedlich. Die Morgensonne steht schon am Himmel und erleuchtet direkt die Terrasse, die er gesucht hat. Mit einem Laser misst er die Entfernung: 98,5 Meter. Es stellt ihn zufrieden, dass man heute alles so genau messen kann und der Zufall eine nicht mehr so große Rolle spielt. Er begutachtet seinen Arbeitsplatz, indem er zweimal langsam und mit prüfendem Blick um den Schober herumgeht. Er findet einen alten Holztisch, prüft die Haltbarkeit – zufriedenstellend. Er rückt ihn an die Holzwand des Schobers.
Er klappt den Kofferraum auf und entnimmt seinen altgedienten Werkzeugkasten. Er klettert mit dem Koffer auf das Dach des Schobers und beginnt mit seinen Vorbereitungen. Zuerst wird das Stativ aufgebaut und auf Standsicherheit geprüft. Er ist unzufrieden mit dem Untergrund, das Dach ist uneben und so nicht gerade geeignet für Präzisionsarbeit. Er sieht sich nach geeignetem Material um und findet zwei kleine alte Brettchen, die halb unter einem Heuhaufen verborgen sind, wischt sie mit einem Büschel Heu und danach noch einmal mit seinen feinen Lederhandschuhen ab. Er bläst das letzte Heu fort, wirft einen prüfenden Blick darüber, findet sie gut geeignet. Er legt die beiden Brettchen nebeneinander auf die Dachpappe unter die vier Standbeine des Stativs. Jetzt ist es so stabil, dass es seinen Ansprüchen standhält. Nur die kleine Luftblase oben in der Wasserwaage zeigt ganz nach rechts. Das Einjustieren ist mittels zweier kleiner Dreher, mit denen die Füße etwas weiter aus- und eingefahren werden können, schnell erledigt. Darauf montiert er das Präzisionsgewehr und schließlich das Zielfernrohr. Ziel fixieren, scharf stellen und die Entfernung am Gewehr einjustieren. Alles ist Routine. Jetzt braucht er nur noch zu warten.
1. Kapitel
Peter Friedmann sah so aus, wie man sich einen Geschäftsmann aus den fetten Jahren des Aufschwungs nach dem Krieg vorstellt, mit einem kleinen Wohlstandsbauch, Hornbrille, Anzug und Hut, Limousine und Chauffeur. Wenn das Wetter es erforderte, trug er einen Trenchcoat. Klein war er nicht mit seinen 1,80 m. Er war, auch für seine fünfundfünfzig Jahre, recht konservativ ausgerichtet, wenn man nicht bieder sagen wollte. Auch in der Freizeit waren ihm Jeans ein Gräuel. Er sorgte für seine Familie, gab für alle sein Bestes und freute sich, wenn es allen gut ging, und seine Frau und die beiden Kinder ihm dankbar waren, was zweifellos auch der Fall war. Hobbies hatte er keine, außer seinen Geschäften. Geschäfte machen und Erfolg dabei haben war seine Leidenschaft. Wenn ihm mal wieder ein Coup gelungen war, konnte er sich diebisch freuen. Immer noch, denn finanziell war inzwischen alles im sogenannten grünen Bereich und es gelang ihm dann häufig, seine Frau anschließend zu einem eleganten Essen auszuführen. Den einzigen Luxus, den er sich gönnte, war der Kauf eines Cabrios. Alle Jahre, wenn ein neues Modell oder ein Facelift auf den Markt kam, gönnte er sich diese Ausgabe, denn er hatte als Jugendlicher immer davon geträumt, einmal einen Mercedes SL sein Eigen zu nennen und nun war dieser Traum in Erfüllung gegangen. Er hatte sehr viel Spaß daran. Es war für Peter Friedmann immer wieder ein Genuss, in einer lauen Sommernacht, so wie es heute eine war, mit geöffnetem Cabrio durch die Heide zu fahren. Wie oft hatte er mit seiner Frau früher eine Nachttour unternommen. Wenn sie beide nach dem Abendessen noch auf der Terrasse saßen, dann fuhren sie oft einfach los und genossen die laue Luft in der Heide. Er nahm sich vor, sein Leben wieder mehr zu genießen, ja er würde seinen Kindern das Unternehmen übergeben und sich ganz ins Privatleben zurückzuziehen. Er musste nur jetzt erst alles in geordnete Bahnen lenken, die »schlechten Geschäfte«, wie er sie nannte, abwerfen und nur noch das Kerngeschäft behalten. Das ganze schlechte Umfeld musste er verlassen. Aber wie? Er musste dies alles mit Magdalene besprechen. Gleich morgen. Sie würde ihm helfen, denn sie hatte immer gute Ideen, wenn er in einer schwierigen Lage war, einfach weil sie außen vor stand und auf diese Weise ein anderes Blickfeld hatte. Schließlich wollte er nicht so enden wie Gregori.
Der Wagen bog in die Einfahrt ein. Er schloss das Dach, öffnete das Garagentor und stellte den Wagen ab, nahm den Koffer und die kleine Tasche aus dem Kofferraum und wollte gerade die Haustür aufschließen, als Magdalene schon in der Tür stand und ihn begrüßte. Sie hatte ihn erwartet und das Auto gehört.
»Hallo Peter! Schön, dass du heile wieder zuhause bist. Wie war der Flug?«
Ehe er antwortete, stellte er das Gepäck ab, nahm sie fest in seine Arme und küsste sie lange auf ihren rot geschminkten Mund. Er mochte dieses kräftige Rot und freute sich, dass sie es für ihn noch so spät am Abend aufgelegt hatte. »Hallo meine liebe Magdalene, gut siehst du aus!«, sagte er zuerst und sie freute sich über das Kompliment. Dann fuhr er fort: »Der Flug war angenehm, aber die Maschine hat sich auf dem kurzen Stück von Larnaka nach Hamburg um eine dreiviertel Stunde verspätet. Erst verzögerte sich der Abflug und dann konnten wir nicht pünktlich landen. Ich weiß nicht warum. Ich habe aber mehr als zwei Stunden fest geschlafen. Diese neuen Schlafsitze sind wunderbar«. Er reckte sich. »Aber jetzt bin ich froh, dass ich wieder zuhause bin.«
Sie wischte ihm einen kleinen roten Streifen von der Oberlippe. »Warum hast du nach der Landung nicht angerufen?«, fragte sie ihn auf dem Weg zum Wohnzimmer und fuhr sogleich fort: »Komm erst einmal herein. Setzen wir uns noch ein wenig auf die Terrasse? Ich habe dir ein Bier kalt gestellt.«
Zunächst hängte er sein Jackett an die Garderobe. Den Autoschlüssel warf er lässig in die Schale auf dem kleinen Schränkchen und seine Schuhe tauschte er mit den Filzpantoffeln. Sie hatten waren nicht mehr die neusten, aber er trug sie immer gerne. Er zog seine alte Strickweste über und antwortete ihr: »Ich habe nicht gedacht, dass du so lange auf mich wartest, dachte, du liegst schon im Bett und wollte dich nicht aufwecken. Bist du wach geblieben?«.
»Ich habe den Abend vor dem Fernseher verbracht. Ich bin während eines alten Tatorts eingenickt und erst aufgewacht, als ich deinen Wagen bemerkt habe.
Er trank den ersten Schluck mit Genuss. »Richtiges Bier gibt es eigentlich nur hier bei uns. Habe mich schon unterwegs darauf gefreut.«
»Wie waren die Tage auf Zypern? Hast du etwas über Gregoris Tod erfahren?«
»Sie gehen davon aus, dass er von seinem Boot gestürzt und ertrunken ist. Vorstellen kann ich mir das nicht.«
»Der Mann ist mit Booten aufgewachsen. Er hat doch schon als Kind seinem Vater beim Bootsbau geholfen.« Magdalene machte ein nachdenkliches Gesicht. »Wann hat er den Bootsbau von seinem Vater übernommen? Vor zwanzig Jahren? Oder länger?«
Sie schwiegen eine Weile, Peter trank einen Schluck und machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Vor jetzt bald zwanzig.«
»Aber… wer sollte ihm etwas antun? Und warum?«, fuhr Magdalene fort. »Jetzt auf einmal.«
»Ich weiß es nicht. Es war mit ihm etwas im Gange, womit er nicht herausgerückt ist. Er ist ja nicht nach Zypern gekommen, um Urlaub zu machen. Ich habe vor knapp zwei Wochen mit ihm telefoniert und er sagte mir, dass es in Ägypten Probleme gäbe und er eine Weile dorthin wollte, um sich um verschiedene Angelegenheiten zu kümmern. Er hat sich nicht darüber ausgelassen, was es war, obwohl ich ihn mehrfach gefragt habe, ob ich ihm helfen könnte. Es muss sich aber um etwas sehr Wichtiges gehandelt haben. Er wollte mir bei Gelegenheit Bescheid geben. Dann könnte ich etwas für ihn tun.«
»Was sollte das sein?«
»Ich habe eine Vermutung, denn er hat mir aus Limassol eine kurze SMS geschrieben, aber ich kann noch nicht darüber reden, denn ich muss erst noch etwas telefonieren. Morgen Mittag weiß ich bestimmt schon mehr.« Er holte eine zweite Flasche Bier aus dem Kühlschrank und schenkte sich ein. »Das Blöde ist, er hatte wichtige Informationen, die ich unbedingt brauche und wollte mir deswegen eine Nachricht zukommen lassen.« Er trank sein Bier. »Wie soll ich jetzt an diese Daten kommen?«
»Für die Geschäfte? …Wichtig?«
»Ganz wichtig, aber das erzähle ich alles morgen, wenn ich telefoniert habe. Jetzt lass uns einfach etwas plaudern«, er trank mit großen Schlucken das halbe Glas leer, dann fuhr er fort: »Wir sollten wieder öfter eine Cabrio-Tour unternehmen. Es war so schön heute Abend von Hamburg bis hierher. Ich bin den ganzen Weg über die Landstraße gefahren. Weißt du noch, wie wir früher oft abends losgefahren sind? Manchmal waren wir erst um drei Uhr nachts wieder zuhause. Daran musste ich heute Abend denken, als ich durch die Heide kam.«
Sie plauschten beide noch lange von alten Zeiten und es wurde spät, bis sie zufrieden ins Bett gingen.
»Du hast aber lange geschlafen, mein Lieber! Ich sitze schon fast eine halbe Stunde hier auf der Terrasse und warte auf dich. Was möchtest du frühstücken?«
Er begrüßte seine Frau mit einem Guten-Morgen-Kuss, strich ihr übers Haar, blinzelte in die Runde und sah so aus, als habe er immer noch nicht richtig ausgeschlafen. »Ich habe gar nicht bemerkt, dass du aufgestanden bist.« Er ordnete seinen Morgenmantel neu und band ihn etwas fester zu. »Nur erst einmal Kaffee, dann vielleicht einen Toast.« Er nahm auf seiner Bank Platz, angelte nach der Zeitung und begann zu lesen. »Immer dasselbe«, sagte er noch zu Magdalene, »ich kann den ganzen Blödsinn und das Lügen über den Nahen Osten bald nicht mehr hören«, aber seine Frau überhörte seine Bemerkung, weil sie diese seine Ansichten schon recht oft unterbreitet bekommen hatte.
Als sie den Kaffee angestellt und sich um den Toast gekümmert hatte, schellte es an der Tür. Auf dem Bildschirm im Flur erkannte sie zwei Männer. Sie schaltete die Sprechanlage ein.
»Bitte?«
»Landeskriminalamt Hamburg. Guten Morgen«, stellten sie sich vor und einer der beiden hielt seinen Ausweis unter die Kamera.
Sie öffnete die Tür. »Was gibt uns die Ehre so früh am Morgen?«
»Mein Name ist Schwertfeger, Kommissar Schwertfeger und das ist mein Kollege Kampmann. Sind wir hier richtig bei Friedmann, Peter Friedmann?«
»Ja, das ist mein Mann. Warum?«
»Dürfen wir bitte hineinkommen? Wir hätten Ihrem Mann einige Fragen zu stellen. Nichts Schlimmes, nur einige wenige Auskünfte.«
»Wir wollen ihn nur zu einer Person befragen«, ergänzte Kampmann.
»Wir sind noch gar nicht auf Besuch eingestellt. Mein Mann ist heute Nacht aus Larnaka gekommen und gerade erst aufgestanden. Er sitzt im Morgenmantel auf der Terrasse. Bitte kommen Sie herein.« Sie wich einen Schritt zurück und schloss hinter den beiden die Haustür.
Als die beiden Männer ihre Garderobe ablegten, war ein kurzes Stöhnen zu hören, ein unterdrückter Schrei. Ein Stuhl kippte um, Geschirr fiel zu Boden. Die Geräusche kamen eindeutig aus Richtung der Terrasse.
Frau Friedmann war tief erschrocken. »Peter? Peter, ist alles in Ordnung?«, schrie sie. Sie erinnerte sich an eine Herzattacke ihres Mannes, die er vor einem Jahr schon einmal hatte durchstehen müssen und geriet in Panik. Er war damals knapp mit dem Leben davon gekommen und hatte lange gebraucht, bis er sich wieder richtig erholt hatte.
Dann standen sie auch schon alle auf der Terrasse. Peter Friedmann lag zusammengebrochen neben dem Tisch. Er hatte die Augen geöffnet und sah seine Frau hilfesuchend an, was aber nur kurz währte, denn dann erlosch ihr Glanz und sie waren starr auf den Himmel gerichtet. Die Tischdecke hatte er bei seinem Sturz mitgezogen. Er hielt sie noch fest in der Hand. Die Zeitung verdeckte einen Teil seines Oberkörpers. Darunter erkannte Kampmann eine kleine Blutlache, die schnell größer wurde. Die Scherben des Frühstücksgeschirrs waren bis hin zu den Blumenbeeten verstreut. Harald Kampmann stand die Angst im Gesicht. Er brauchte einige Augenblicke, um sich von dem Schrecken zu erholen. Man sah ihm an, dass er einen Würgereiz unterdrücken musste. Er zog seine Waffe unter seinem Jackett hervor, nahm Deckung hinter einem Kaminvorsprung und sah sich nach allen Seiten um und als er glaubte, sich nicht in unmittelbarer Gefahr zu befinden, legte er sich flach auf den Boden und robbte zu Friedmann hinüber, fühlte den Puls und die Halsschlagader. Er warf einen Blick unter die Zeitung. Er schüttelte den Kopf.
»Nichts mehr zu machen! Mitten in die Brust, Herz wahrscheinlich!« Er strich mit seiner Handfläche über das Gesicht des Toten und schloss so seine Augen. Peter Friedmann war tot.
Magdalene schlug mit einem Schrei die Hände vor ihr Gesicht und wollte sich zu ihrem Mann niederbeugen, ihr wurde aber dabei schwindelig und sie musste sich am Tisch aufstützen. Sie schwankte stark. Beinahe wäre sie kollabiert und der Länge nach auf die Fliesen gestürzt, hätte Schwertfeger sie nicht geistesgegenwärtig aufgefangen. Er hob sie an, um sie auf einem Gartensessel zu platzieren, der etwas abseits stand. Dabei rückte er ihr den Morgenmantel wieder zurecht, dessen zu einem Knoten gebundene Kordel, die ihn zusammenhalten sollte, aufgegangen war. Kampmann blickte sich nach dem Schützen um. Weit und breit nichts zu sehen, nur Kühe auf der Wiese lagen in aller Ruhe da und sahen keinen Anlass, ihr Wiederkäuen zu unterbrechen. Ein unruhiger Schimmel tänzelte über die Weide. Schwertfeger versuchte, sich ebenfalls ein Bild von der Umgebung zu machen, musste aber ständig mit einer Hand die Frau auf dem Stuhl festhalten, die immer wieder aufzustehen versuchte, um zu ihrem Mann zu gelangen. Dabei rief sie immer leiser werdend: »Peter, Peter, was machst du?« Sie blickte mit entsetzten Augen den Kommissar fragend an: »Ist er tot? Ist mein Mann tot?« Schwertfeger brachte es nicht fertig, ihr eine Antwort zu geben. Schließlich hielt er es für das Beste, die Frau vom Ort des Geschehens fernzuhalten. Er griff ihr unter die Arme und beförderte sie zurück ins Haus, um sie im Wohnzimmer auf der Couch hinzulegen. Sie hatte die Augen geschlossen und war kreidebleich. Mit leichten Schlägen auf ihre Wangen, weckte er sie auf und versuchte, beruhigend auf sie einzureden, was ihm aber alsbald völlig sinnlos erschien. Sie sah, noch verstärkt durch ihr hageres Gesicht, das nun jede Durchblutung verloren hatte, geisterhaft aus, war völlig abwesend und gab keinen Ton von sich. Kampmann telefonierte indessen mit dem Kommissariat, um die ganze Maschinerie in Gang zu setzen, die bei einem solchen Ereignis vorgesehen war. Es war das erste Tötungsdelikt in seiner Laufbahn, bei dem er die Tat direkt miterlebte. Er war nervlich fast überfordert und musste auf seinem Spickzettel nachsehen, bei welcher Adresse er sich befand. So bemerkte er vor lauter Aufregung nicht, obwohl er beim Telefonieren in die Richtung blickte, dass sich auf der anderen Seite der hinter dem Haus gelegenen Wiese ein kleiner blauer Toyota von dem Holzschober verabschiedete.
2. Kapitel
Auf dem Polizeirevier Jesteburg war die Stimmung gedrückt. Zur Lagebesprechung um acht Uhr morgens waren alle anwesend, auch die, die eigentlich wegen der Nachtschicht seit sechs Uhr Feierabend hatten. Sie waren dazu verdonnert worden, bei dem Briefing, wie die Leute aus Hamburg die morgendliche Besprechung heute nannten, anwesend zu sein. Die Stühle mussten zusammengerückt werden und verschiedene Kollegen holten weitere aus den benachbarten Büros, bis alle einen Sitzplatz hatten. Ein Einsatzkommando aus Hamburg war angereist »zur Unterstützung der Ermittlungen«, wie sie es nannten.
Hauptkommissar Berendtsen, ein untersetzter Mittvierziger im grauen Anzug mit roter Krawatte, stellte sich und seine beiden Kollegen vor. Es handelte sich um die beiden Kriminalassistenten Holler und Weinheim. Dann fand er ein Papiertaschentuch in seiner Hosentasche und polierte die Gläser seiner Hornbrille. Dann wandte er sich an die Anwesenden.
»Guten Morgen, meine Herren«, in diesem Augenblick erspähte er die einzige Dame im Raum. Es war Laura, die Praktikantin.
»Entschuldigung bitte. Also noch einmal: guten Morgen, meine Dame und meine Herren.
Was haben wir bisher? Kann bitte jemand die Situation zusammenfassen? Wie ist die Lage?« Er machte eine einladende Handbewegung. »Herr Kollege Schmidt, bitte?« Dieser war der Leiter der Dienststelle und so dem Beamten aus Hamburg inzwischen bekannt.
Der erhob sich von seinem Platz.
»Viel haben wir nicht, wie sie ja wissen, aber wir hatten ja auch noch keine Möglichkeit, der Sache richtig nachzugehen, weil Ihre Leute ja alles an sich gerissen haben, ohne dass sie die Gegebenheiten hier in der Heide kennen. Hamburg und Heide sind zwei Paar Stiefel….«
»Meine Leute haben gar nichts an sich gerissen. Wir haben genug zu tun, da brauchen wir nicht noch mehr Arbeit hinterher zu laufen. Außerdem kennen wir die Gegebenheiten, …auch hier in der Heide.«
»Ich fasse zusammen:«, fuhr Schmidt fort und man sah ihm an, dass er sich fühlte wie ein begossener Pudel. »Heute Nacht um 1 Uhr 25 hörte ein Gast im Hotel‚ ›Lamm‹ in Marxen einen lauten Schrei, der aus dem Zimmer 206 zu kommen schien. Als er an die Tür klopfte, hörte er mehrmals das Wort »Hilfe, Hilfe«. Er versuchte vergebens, die Tür zu öffnen – dort sind die Zimmer mit Türschlössern versehen, die nur mit einer Zimmerkarte zu öffnen sind«, fügte er anmerkend hinzu und sah dabei in die Runde als wolle er sicher gehen, dass alle Anwesenden ihn verstanden hatten. Dann glitten seine Augen kurz suchend über sein Konzept und er fuhr fort: »Er rief in etwa: ›Kann ich helfen? Aufmachen! Ich trete die Tür ein‹! Er rappelte mehrfach an der Türklinke, als auch schon von innen geöffnet wurde und ein Mann das Zimmer fluchtartig verließ und Herrn Kohlmann – so heißt der Zeuge – so heftig zur Seite stieß, dass dieser zu Fall kam. Der Täter entfernte sich über den Gang. Dieser Herr Kohlmann betrat das Zimmer und fand ein regungslos im Bett liegendes Mädchen im Alter von ungefähr fünfundzwanzig Jahren. Er konnte weder Atemgeräusche noch den Puls des Mädchens ausmachen und ging davon aus, dass sie tot war. Während er die 110 anrief, hörte er die Nebentür zufallen, die auf die Feuerleiter führt. Vond dort aus gelangt man auf den Parkplatz.«
»War diese Tür nach außen etwa offen!?«, unterbrach ihn Hauptkommissar Berendtsen mit völligem Unverständnis.
»Diese Tür ist nachts zwar nicht abgeschlossen, sondern nur zugezogen, weil sie als Notausgang gilt und nicht abgeschlossen werden darf. Sie ist aber durch ein Spezialschloss gesichert und nicht von außen, sondern nur von innen her zu öffnen. Als die Nachtschicht und der Notarzt eintrafen, stellte…«, er blätterte seinen Notizblock um, »Herr Dr. Wellenberg, ein Arzt hier aus dem Jesteburger Krankenhaus, den Tod fest. Nach erstem Anschein wurde ihr wohl das Genick gebrochen. Es handelt sich also mit ziemlicher Sicherheit um einen professionellen Killer, denn viel Gegenwehr hat das Mädchen auf keinen Fall geleistet. Der Kollege Groß sah sich im Zimmer um und fand einen Zettel mit der Adresse ›Asendorfer Heide 19‹. Es handelt sich um einen Zettel – wohl von einem Werbeblöckchen – mit einem Firmenlogo und griechischer Schrift darunter. Die Adresse war ganz normal in lateinischen Großbuchstaben geschrieben. Wir haben die Kriminalpolizei in Hamburg benachrichtig, wie es in diesem Fall vorgeschrieben ist und den Zettel an einen Herrn Kommissar…« Er wollte gerade wieder auf seinen Block schauen, da ergänzte Berendtsen…
»Schwertfeger«
»Genau. Der ist inzwischen zu dieser Adresse unterwegs.«
»Kennt jemand die Adresse?«, fragte Bernds
Es meldete sich die Praktikantin: »Es ist die Adresse von Herrn Peter Friedmann. Ich kenne das Haus. Es sind Nachbarn von meiner Tante.«
»Was sind das für Leute, die Friedmanns?«
Schmidt antwortete: »Es sind Geschäftsleute. Dem Mann gehören in Hamburg drei Etablissements im Rotlichtviertel, eines davon liegt auf der Reeperbahn. Außerdem gehören ihm einige Hotels.«
»Könnte es sein, dass sich das Mädchen bei ihm vorstellen wollte?«
»Das glaube ich kaum, denn diese Mädchen waren hier noch nie zu sehen. Die gehen direkt zu den Häusern. Da befinden sich auch die Leute, die sie begutachten.« Unangebrachte Kommentare erfüllten den Raum.
»Meine Herren…bitte!« Der Kommissar bat um erneute Aufmerksamkeit.
In dem Moment schellte das Mobiltelefon in Berendtsens Hosentasche. Er nahm an.
»Hier Berendtsen.«
Es meldete sich Kampmann, der von dem Geschehen bei Friedmann berichtete.
»Was?!...« Berendtsen war entsetzt. »Das kann ja wohl nicht wahr sein. Friedmann ist tot? Der Schütze konnte entkommen? Und Ihr zwei Schafsköpfe konntet nichts machen? Das will ich aber schriftlich. Heute noch! Und zwar in Schönschrift!« Sein Gesicht, was vorher mit leichten roten Äderchen durchzogen war, schwoll auffallend an und bekam jetzt eine tiefrote Farbe, die vermuten ließ, dass er im nächsten Moment einem Schlaganfall erliegen könnte, zumal er mit seinem leichten Übergewicht nicht der Sportlichste zu sein schien. In dem Konferenzraum herrschte eisige Stille. Die Anwesenden bekamen es mit der Angst, dass der Hauptkommissar gleich selbst einen Notarzt benötigte. Dann hörte er einen Augenblick wieder zu, um gleich darauf wieder laut zu werden: »Ihr habt alle beide keine Ahnung, woher der Schuss kam?«
»Keinen blassen Schimmer! Wir können uns nicht einmal daran erinnern, einen Schuss gehört zu haben. Tut uns leid. Wir hatten keine Chance.«
»Dann schicke ich mal die Leute«
»Die haben wir bereits benachrichtigt.«
»Auch gut, dann läuft das ja wenigstens.« Dann wandte er sich an die kleine Versammlung, musste allerdings einmal tief Luft holen:
»Herr Peter Friedmann ist vor wenigen Minuten in seinem Haus erschossen worden….«
Es entstand Unruhe und er musste seine Mitteilung für einige Augenblicke unterbrechen, um den Kollegen Zeit zu geben, das Geschehen zu verarbeiten und auch sich selbst darüber klar zu werden, was ihm da jetzt mitgeteilt worden war. Dann hob er die Hand und die Anwesenden unterbrachen ihre Gespräche, so dass im Raum eine Stille herrschte, in der man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Dann fuhr er fort: »…unter der Anwesenheit von den beiden Kollegen Schwertfeger und Kampmann. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur. Es muss sich nach erstem Anschein um einen Schuss aus einem Präzisionsgewehr gehandelt haben, das aus größerer Entfernung abgefeuert worden ist. Es fiel nur ein einziger Schuss und der traf Herrn Friedmann direkt tödlich in die Brust.«
Damit wurde die Konferenz erst einmal vertagt. Das allgemeine Gemurmel auf dem Gang ging hauptsächlich darum, was denn nun mit der stillen und gemütlichen Heide passiert. Jahrelang keine Vorkommnisse, außer vielleicht einiger Verkehrsdelikte. Und bei denen kannte man immer die Übeltäter. Meist handelte es sich um Leute aus den umliegenden Dörfern und die hatten meistens auch eine plausible Erklärung für ihr Verhalten, so dass man gar keine Personalien aufnehmen, geschweige denn, eine Anzeige zu Protokoll bringen musste. Da ließ man schon mal fünfe gerade sein. Und dann auf einmal zwei Vergehen an einem Tag, innerhalb von acht Stunden, und beides Morde. Wohin sollte das führen. Hatte die Mafia die Heide für sich entdeckt? Na dann gute Nacht…
Hauptwachtmeister Schmidt wollte gerade mit seinen Akten unter dem Arm stillschweigend in seinem Büro verschwinden, als er von den Kollegen Wimmer und Olschewski an der Schulter gehalten wurde.
»Mensch Wolle, nun schau nicht so trist drein, mein Jung. Ärgerst du dich über die arrogante freche Schnauze von dem Berendtsen? Die müssen so quatschen...«
»..sonst verlieren diese Kapazitäten ihre Autorität und werden versetzt… auf Streife«, ergänzte der andere, machte eine Pause vor »Kapazitäten« und »Autorität« und sprach jedes der beiden Wörter in einzelnen Silben aus, um diesen eine herrschaftlich, wichtige Note zu geben. »Das darfst du gar nicht persönlich nehmen … Da hast du doch schon ganz andere Dinge gehört. Bist doch sonst auch hart im Nehmen.«
»Ein Quatschkopp ist der«, versuchte Schmidt seinen Frust zu verbergen. »Macht hier auf wichtig. …Ich möchte mal wissen, wie klein der wird, wenn der von oben einen Anschiss kriegt. …Man muss sich den nur einmal in langen Unterhosen vorstellen, dann sieht die Sache schon wieder anders aus.«
»Dann guck auch anders aus der Wäsche.« Wimmer klopfte ihm auf die Schulter. »Was ist? Gehen wir drei kurz nach Ulla frühstücken?«
»Nee, heute geht das nicht. Ich muss mit zum Tatort. Sie brauchen da jeden Mann, meint der Döskopp. Eigentlich solltet Ihr zwei auch mit, aber ich habe gesagt, wir hätten heute den Radarwagen hier und ihr seid damit unterwegs.«
»Das war die beste Idee heute Morgen. Hast du gut gemacht. Danke«, freuten sich die beiden anderen.
»Dann sehen wir uns heute Nachmittag«.
»Wenn wir bis dahin fertig sind. Man weiß ja gar nicht, wie aufwändig sich die Besichtigung des Tatorts hinzieht. Das scheint ja nicht sowas Normales zu sein. Aber wir wollen erst mal sagen bis heute Nachmittag. Jedenfalls hoffe ich, dass pünktlich Feierabend ist! Hab nämlich meiner Frau versprochen, heute frühzeitig zuhause zu sein. Ich soll mit ihr zum Shoppen.«
»Dann viel Spaß bei der Untersuchung«, meinte Wimmer und Olschewski sagte nur:
»Bis dahin.«
»Schöne Grüße an Ulla«, gab Schmidt ihnen noch mit auf den Weg. Und gib nicht so viel Geld aus.
3. Kapitel
In der Asendorfer Heide war die Maschinerie angelaufen. Weitläufig war ein Areal um das Haus von Friedmann abgesperrt und die Spurensicherung suchte nach der Stelle, von der aus der Schuss abgefeuert worden war.
Frau Friedmann lag auf dem Sofa und man hatte ihr die Füße mit drei Kissen unterlegt, die gerade griffbereit gewesen waren. Kommissar Schwertfeger hatte sich den Hocker geholt, der vor dem Fernsehsessel gestanden hatte, saß neben ihr und hielt ihre Hand. Dabei beobachtete er die Eifrigkeit der Spurensicherung. Die Männer in den weißen Überzügen schwirrten nur so durch die Wohnung und erweckten den Eindruck, als stände einer dem andern im Weg. »Immer wieder sieht es aus wie das Durcheinander auf einem Ameisenhaufen, aber dennoch hat alles seinen Sinn«, dachte er bei sich. Er sah sich im Zimmer um. Ganz normal wie überall, wie auch bei ihm zuhause. Helle Ledergarnitur mit Dreier-Sofa, Zweisitzer und einem Sessel, ein separater Fernsehsessel mit einem Hocker, zu dem Flachbildschirm in der Ecke ausgerichtet, Parkettfußboden, Bilder an der Wand und eine Standuhr mit Perpendikel und zwei Gewichten mit Kettenaufzug. In der ihm gegenüberliegenden Ecke gab es über einer halb herunter gebrannten Wachskerze ein Kruzifix, hinter dem ein Palmenzweig hervorguckte. Friedmanns waren dem Anschein nach ganz normale Leute. Nur eben machten die Möbel und die anderen Gegenstände, so wie das Haus selbst, den Eindruck, dass das Ehepaar Friedmann einen guten Geschmack hatte und auch bereit war, dafür das nötige Kleingeld aufzuwenden. Nichts Auffälliges, außer der großen Vase mit den Blumen, die auf dem Boden vor der Schiebetür stand, die zur Terrasse führte, und eine Ikone an der Wand neben der Tür zur Küche. Diese beiden Dinge erschienen ihm außergewöhnlich teuer und er dachte kurz darüber nach, wo die Friedmanns wohl diese Exoten erworben hatten, denn er hatte so etwas noch nie gesehen. In Deutschland waren seinem Wissen nach diese großen Ikonen nicht zu bekommen. Dann erst fiel ihm auf dem Parkett ein wohl 3 ½ über 4 ½ Meter großer Perserteppich auf, der seiner laienhaften Meinung nach mit sehr hohem Seidenanteil gewebt war, denn er hatte niemals vorher einen so schönen Teppich gesehen, der so wunderbar zart in der durch die großen Terrassentüren scheinenden Morgensonne glänzte. Er war ganz leicht rosa gefärbt mit einer etwas dunkleren Rosette in der Mitte und einem Rand in der gleichen Farbe. Darauf standen drei Tischchen auf verchromten Metallrahmen in verschiedenen Größen mit Glasflächen, so dass die Schönheit des Teppichs nicht verdeckt wurde. Arm schienen die Friedmanns jedenfalls nicht zu sein. In der Ecke, in dem der Bildschirm auf einem wahrscheinlich von einem Schreiner nach Maß angefertigten Fernsehschrank stand, waren Familienbilder zu sehen. Er betrachtete die Frau. Sie war immer noch ein schönes Mädchen, dessen Eleganz durch einen wunderschönen Morgenmantel, einem gestickten Kimono nicht unähnlich, unterstrichen wurde. Für seinen Geschmack war sie etwas zu schlank. Hände und Gesicht waren sehr gepflegt, auch ohne Morgentoilette, zu der sie ja noch keine Gelegenheit gehabt hatte, wie die dunkelblonden Haare bewiesen, die völlig unfrisiert über ihre Schultern hingen. Er schätzte sie auf etwas über vierzig Jahre. Unter dem Morgenmantel her erschienen auffallend schöne gerade Beine mit schlanken Fesseln und keinerlei Anzeichen von Krampfadern. Seine Frau würde sich solche Beine wünschen, obwohl sie einige Jahre jünger war.
Nachdem der Polizeiarzt die Leiche inspiziert und die erste Vermutung der Todesursache von Kampmann bestätigt hatte, betrat er das Wohnzimmer, um sich der Frau zu widmen. Er begrüßte sie, stellte sich als Dr. Trynogga vor und gab dann dem Kommissar die Hand.
»Moin Michael, wie geht’s?«
»Moin Ernst, ich bin zufrieden. Alles in Ordnung.«
»Sodbrennen ist besser geworden?«
»Alles wieder in Ordnung. Hat gut geholfen. Muss ich die Pillen alle zu Ende nehmen?«
»Wenn’s besser ist, kannst du aufhören.«
Dann wandte er sich der Frau zu. Er nahm ihre Hand, fühlte ihren Puls, schob einen Ärmel hoch und maß den Blutdruck. Dann öffnete er seinen Arztkoffer, entnahm aus einem kleinen metallenen Behältnis eine fertig aufgezogene Spritze, setzte nur die Nadel auf, zog die sterile Hülle ab und verabreichte ihr eine Injektion.
»Das wird Ihren Kreislauf stabilisieren und etwas beruhigen. Sie werden sehen: in weniger als 15 Minuten geht es ihnen besser, wenigstens soweit die Umstände es zulassen«. Er blieb noch einen Augenblick bei ihr sitzen, um die Verträglichkeit der Spritze abzuwarten, dann klappte er seinen Koffer zu. Bevor er sich jedoch auf den Weg machte, fragte er:
»Frau Friedmann, wer ist Ihr Hausarzt?«
»Dr. Vogel, hier ganz in der Nähe.«
»Soll ich ihn kurz benachrichtigen?«
»Das ist wohl nicht nötig«, antwortete sie müde.
»Ich werde ihn auf jeden Fall informieren, dann kann er ja heute oder morgen vielleicht einmal nach Ihnen sehen. Sollen wir das so machen?«
»Ja, so machen wir’s.« Irgendwie freute sie es trotz ihrer schlimmen Lage, dass jemand für sie da war. Das merkte man an dem leichten Schmunzeln, das an ihren Augenfältchen zu sehen war. Während der Arzt mit Frau Friedmann beschäftigt war, hatte der Kommissar angefangen, einen kleinen Rundgang durch die untere Etage der Wohnung zu unternehmen, denn er hatte die Erfahrung gemacht, dass es für die Betroffenen angenehmer war, wenn sie mit dem Arzt alleine waren. So konnten sie vertraulicher sprechen.
Zuerst war er dementsprechend in das nebenan liegende Arbeitszimmer des Verstorbenen eingetreten, wo gerade die Beamten die Festplatte des Computers ausbauten. Außerdem fanden sie noch eine externe Festplatte, die sie ebenfalls in die mitgebrachten Kartons einpackten. Er besah sich ein von Hand geschriebenes Telefonbuch, das allerding schon einen recht betagten Eindruck machte und dem er keine Aktualität zumaß. Er sah sich zunächst auf dem Schreibtisch um. Oberhalb einer aus grünem Leder bestehenden Unterlage stach ihm eine wertvolle Schreibgarnitur ins Auge, bestehend aus einem schweren, mit goldener Feder ausgestatteten Füllfederhalter mit einem weißen Stern auf der Kappe, einem Tintenfass, wie er es schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte, und einem Löschblattroller, auf dem sich sogar Tintenrückstände befanden. Die Garnitur wurde also tatsächlich benutzt. Daneben lag ein iPad. Er schaltete es ein und besah sich die Apps. Er öffnete das Icon »Kontakte«. Er wischte nach unten und fand einen Eintrag »Friedmann, Carla und Friedmann, Peter«. Durch Antippen des zweiten Eintrags kam er in die Details und fand eine Adresse in Buchholz mit Telefon, Fax und Mobilrufnummer sowie eine Geschäftsadresse.
Ein Mitarbeiter der Polizei fragte durch die offene Bürotür, die Klinke in der Hand:
»Sollen wir uns die obere Etage auch vornehmen? Was meinen Sie?«
»Ich denke, hier unten das genügt. Wir wollen ja keine Hausdurchsuchung veranstalten. Wenn wir den Rechner haben, sollte uns das einstweilen genügen.«
Der Mitarbeiter verschwand mit einem kaum hörbar gebrummten »Okay Chef!«
Er nahm sich wieder das iPad vor. Unter Carla fand er ebenfalls die kompletten Daten mit der Anschrift in Hittfeld und den entsprechenden Telefonnummern. Er sah nach Frau Friedmann. Sie schlief. Dann entschied er, dass er den Sohn anrufen sollte. Er war der ältere der beiden, wie er auf den Fotos gesehen hatte und außerdem fand er es für sich angenehmer, mit einem Mann zu sprechen. Das ging nach seinen Erfahrungen meist sachlicher ab. Er nahm das Telefon und blätterte die Namen durch. Er sah auf seine Uhr. Um diese Zeit war er sicher nicht mehr zuhause. Er entschied sich für den Mobilfunk.
»Friedmann!«
»Guten Morgen, Herr Friedmann. Mein Name ist Schwertfeger, Kommissar Schwertfeger von der Hamburger Kriminalpolizei….«
Noch ehe er weiter reden konnte, kam schon die Nachfrage:
»Kriminalpolizei? Ist etwas passiert? Was ist los?«
»Herr Friedmann, sind Sie der Sohn von Herrn Peter Friedmann?«
»Ja sicher. Was ist denn nun?«
»Ich habe eine schlimme Nachricht für Sie. Es ist etwas Schreckliches passiert. Ihr Vater ist heute Morgen erschossen worden.«
»Erschossen?«, kam es postwendend durch die Leitung.
»Hier im Haus an der Asendorfer Heide 19. Ich möchte sie bitten…«
»Ich bin schon unterwegs. Ich bin hier in Hamburg in meinem Büro. Ich werde meine Schwester in Hittfeld abholen. Das ist kein großer Umweg. Ich bin in einer Stunde da.
»Ich bleibe ohnehin hier. Dann sprechen wir uns gleich.«
Während Schwertfeger die letzten Worte sprach, hörte er das der Sohn hatte das Gespräch beendet hatte.
Schwertfeger sah sich um. Das Arbeitszimmer wirkte, wenn er davon absah, dass seine Kollegen hier schon alles einmal durchsucht hatten, sehr aufgeräumt. Als erstes bemerkte er, außer den Resten des Computers samt Bildschirm, ein großes Gerät, das er bei näherem Hinsehen als Kopierer, Fax und Scanner erkannte. In dem Aktenschrank an der anderen Wand, der bereits geöffnet war, stand ein üppiger Tresor. Es war nicht einer der neuesten, das sah er an der Art des Schlosses, das kein Tastenfeld hatte, sondern noch mit einem Drehring geöffnet werden musste. Die Größe ließ darauf schließen, dass nicht nur Geld, sondern vor allem Akten und Papiere darin aufbewahrt wurden. Er ging die Ordner durch, fand aber nichts, was ihm hätte weiterhelfen können. Die Kollegen hatten wohl auch nichts gefunden, denn die Ordner standen in Reihe und Glied nebeneinander und keiner schien zu fehlen.
Er kam wieder ins Wohnzimmer. Frau Friedmann lag trotz des Betriebes immer noch im Tiefschlaf. Er nahm die Decke, die er in dem Fernsehsessel gesehen hatte, legte sie über ihre Beine und zog sie dann auseinander bis ihr Oberkörper gerade eben zugedeckt war.
Die Küchentür stand offen. Er schaltete zuerst die Kaffeemaschine aus, die schon einen Geruch von allzu schwarzem Kaffeekonzentrat von sich gab. Im Toaster steckten zwei auf den Punkt gebräunte Schnitten. Er fasste nichts an, blickte sich nur um. Eine wunderbare, recht große Küche. Ganz modern eingerichtet, alles vom Feinsten. In der Mitte der Küche war die Kochstelle mit einem großen Abzug. Er staunte nicht schlecht, denn in Natura hatte er so etwas noch nie gesehen, nur in Prospekten. Butter, Käse, Milch, Aufschnitt und ein Messer lagen auf der Arbeitsfläche. Er stellte die verderblichen Sachen in den Kühlschrank. Auf der Innenseite der Küchentür hing eine bunte Schürze.
Er betrat das Esszimmer. Ein weites Zimmer mit einem großen, für die ganze Familie ausreichenden Tisch, der, wie er feststellte, ein Ausziehtisch war. Also hatten wohl gut zwölf Personen daran Platz.
Er sah sich im Flur um, vier Heidebilder hingen an den Wänden, Garderobe mit einem Trenchcoat, ein kleines Schränkchen mit einer Schale, die die Form eines Apfels hatte, und ein Schlüsselanhänger mit einem Autoschlüssel und einem Bild von Frau Friedmann aus früheren Tagen. Die Farben waren schon leicht verblasst und ins bräunliche umgeschlagen. Den BKS-Schlüssel probierte er in der Haustür. Er passte. Gäste-WC mit vergoldeten Armaturen. Er betrachtete sich im Spiegel. Facettenschliff! Er sah müde aus. Dann ordnete er mit den Fingern seine Haare.
»Nichts Auffälliges«, murmelte er vor sich hin, »wenn man mal von der außergewöhnlichen Einrichtung absieht« und ging wieder zurück ins Wohnzimmer.
Inzwischen waren alle Fotos gemacht und der Leichnam war zum Abtransport freigegeben.
Als die beiden Leute vom Beerdigungsinstitut, das mit der Polizei zusammenarbeitete, den Sarg durch das Zimmer trugen, erwachte die Frau und konnte nicht begreifen, was sie da sah. Sie legte die Decke beiseite und richtete sich auf. Sie hatte sich nach der Behandlung durch den Polizeiarzt und dem kurzen Schlaf etwas erholt und die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück, aber Schwertfeger musste sie daran hindern, den Leuten nachzugehen, weil sie keinen stabilen und standfesten Eindruck machte. In diesem Moment traten die beiden Kinder zu ihr ins Wohnzimmer, die zuerst den Leichnam hatten passieren lassen müssen. Peter, der mit seinen knapp 1,90 m Größe seine Schwester einen ganzen Kopf überragte, hatte sie bei dem Anblick schützend in seine Arme genommen und versuchte, ihr, so gut es ging, Halt zu geben. Dann erst gingen sie auf ihre Mutter zu. Es war für beide ein bitterer Anblick, wie Kommissar Schwertfeger an ihrem Gesichtsausdruck ausmachen konnte. Nach den Bildern, die er gerade betrachtet hatte, zu urteilen, waren sie alle zusammen eine harmonische Familie gewesen, wie man sie sich nur wünschen konnte.
»Mein Gott, Mama! Was ist nur passiert? Warum? Hast du eine Ahnung, warum?«. Die Tochter setzte sich zu ihrer Mutter auf das Sofa und legte ihr den Arm um die Schultern, aber die Mutter sah sie nur aus völlig abwesenden Augen an. Regungslos. »Ich weiß überhaupt nichts. Rein gar nichts. Es ist für mich alles so sinnlos. Papa hat doch keinem etwas getan. Er hat doch den Leuten geholfen, wo er konnte, wenn jemand ihn nur ganz leicht um irgendetwas gebeten hat, hat er getan, was er konnte. Ich kann mir gar keinen Reim machen auf das Ganze.«
Peter ging in den Garten und sah sich um. Zu allererst betrachtete er die Stelle, an der sein Vater gelegen hatte, was an dem Blutfleck und der weißen Kreidezeichnung, mit der die Lage des Leichnams festgehalten werden sollte, unschwer zu erkennen war. Erst jetzt wurde ihm die Tatsache bewusst, dass sein Vater die Familie ein für alle Mal verlassen hatte. Er ging er auf Kampmann zu und lies sich den Verlauf der Tat schildern. Er blickte sich um, wies auf den Pferdestall auf der anderen Seite und fragte: »Wenn Sie keine Stelle finden, von der der Schuss ausgegangen sein könnte …«, er machte eine kurze Pause, in der er sich noch einmal seine Ansicht durch den Kopf gingen lies, »… vielleicht kam dann der Schuss von dort? Wäre das möglich? Auf diese Distanz?« Peter zeigte auf die Scheune.
»Mit einem Präzisionsgewehr treffen Könner auf diese Entfernung ein Zwei-Euro-Stück! Das ist für solche Leute kein Problem. Ich habe mal an einem Sportschießen teilgenommen …«
»War Fanni auf der Weide?«, unterbrach Peter ihn, bevor er ins Erzählen geriet. »Hat sie gegrast oder konnten Sie feststellen, ob sie unruhig war?«
»Der Schimmel dort ist über die Wiese galoppiert. Ich hielt das für ganz normal. Ich kenne mich mit Pferden nicht aus, eigentlich weiß ich von ihnen nur, wie sie aussehen.«
»Dann sollten die Leute vielleicht mal dort nachsehen. Irgendetwas muss doch festzustellen sein.«
Kampmann gab Anweisung und sofort setzte sich ein Beamter mit seinem Motorrad in Bewegung und machte sich auf den Weg über den Wirtschaftsweg in Richtung Holzverschlag. Er war noch nicht weit gekommen, als der Einsatzleiter Bescheid bekam, dass man in und auf dem Holzschober Spuren gefunden habe. Kampmann winkte ihn zurück, nahm auf dem Sozius Platz, um sich persönlich an Ort und Stelle ein Bild von der Abschussstelle zu machen. Er traf dort auf einen ihm auch privat bekannten Leiter des Spurendienstes, Klaus Seeger.
»Moin Klaus«, begrüßte er ihn, »du hast schon den Täter identifiziert, habe ich gehört?«
»Das hättest du dir wohl so gewünscht«, lachte der, ging auf Kampmann zu und reichte ihm die Hand. »Moin Harald.« Er führte Kampmann zum Eingang der Hütte. »Auf dem trockenen Boden sind deutlich frische Fußspuren auszumachen, hier, grobe Stollen, auch der Holztisch, der wohl vorher in der Bude gestanden hat, ist an die Seite des Verschlags herangeschoben worden. Auf dem Dach finden sich deutliche Kratzer, die von Schuhen mit fester Sohle oder sogar Metallbeschlag stammen müssen, denn die Dachpappe ist durch die Hitze der letzten Tage etwas weich geworden und die Kanten der Schuhsohlen haben sich, während der Schütze sich auf seine Tat vorbereite hat, in den Teer eingedrückt.« Sie stiegen auf den Holztisch, nicht ohne zu probieren, ob der wohl zwei Leute tragen könnte.
»Irgendwelche Spuren wie Fingerabdrücke oder DNA?«
»Bis jetzt nichts, aber wir sind ja auch gerade erst am Anfang. Allerdings rechne ich nicht mit Fingerabdrücken. Das war ein Profi! DNA-Spuren will ich nicht ausschließen. Das passiert den Besten. Aber bis wir die gefunden und ausgewertet haben… Ich denke der Täter ist längst über alle Berge.«
Seeger stellte fest: »Er hatte die Füße gespreizt.« Dabei zeigte er auf zwei kantig aufgeschobene kleine Wellen in der Pappe. »Er hatte also liegend mit Hilfe eines Stativs gezielt. Seeger erklärte ihm: »Die beiden kleinen Bretter, die da nebeneinander liegen, stammen unten aus der Bude, wo der Pferdeanhänger steht, da liegen noch einige mehr. Das ist alles. Keine weiteren Spuren. Keine Patronenhülse, nichts… Das heißt, an einem der Nägel, mit dem die Dachpappe am Rand befestigt ist, hängen einzelne Fäden. Sie könnten vielleicht vom Täter sein, aber ebenso von dem, der das Dach gedeckt hat, denn das ist noch nicht allzu lange her. Dafür ist es noch zu sauber und die Nagelköpfe sind noch blank.«
»Bei dem Fahrzeug muss es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben, Golfgröße oder kleiner. Man kann das hier erkennen, wo der Wagen mit einer Seite im Gras gestanden hat. Der Radstand ist eher klein. Dazu passen auch die – ich nehme mal an – 175er oder 185er Reifen«, ergab die erste Analyse eines Mitarbeiters der Spurensicherung.
»Moin, Kampmann mein Name, Harald Kampmann«. Er gab dem Berichterstatter die Hand.
»Granzow, Moin erst mal.«
4. Kapitel
Das Telefon läutete fünfmal durch.
»Bitte?«
»Wie ist es gelaufen?«
Er erkannte den Tunesier an seiner vom vielen Rauchen heiseren Stimme. »Die Probleme sind beseitigt! Ich musste allerdings etwas härter durchgreifen.«
»Gut. Was ist mit der Ware?«, krächzte der Tunesier und räusperte sich deftig. Sogleich inhalierte er einen weiteren Zug an seiner Zigarette.
»Konnte ich leider nicht herausfinden. Die Puppe hat einen solchen Krawall gemacht, dass ich ihr keine Fragen mehr stellen konnte. Es war für nichts Zeit. Ich musste sie etwas härter anfassen. Dabei ist sie verreckt. Ein unvorhergesehenes Arschloch hat an der Tür gerappelt wie ein Weltmeister und das ganze Hotel in Aufruhr gebracht. Kann froh sein, dass er noch am Leben ist. Wollte ihn auch alle machen, aber als ich ihn packen wollte, ist er auf die Schnauze geflogen. Dann hörte ich aus den Nachbarzimmern schon Gerede und ich habe dann gemacht, dass ich fort kam.«
»Du weißt nicht, wo die Ware ist!?«, brüllte es durch den Hörer, »Weshalb haben wir dich denn dahin geschickt?« Er hustete den Zigarettenrauch aus. Genehmigte sich aber sogleich einen neuen Zug.
»Wie denn? Glaubst du, die Kuh gibt sofort Milch, wenn ich sie melken will? Erst habe ich es mit Streicheln versucht, dann musste ich ihr die Klappe zuhalten, aber das Fräulein gab ja keine Ruhe. Als es dann an der Tür gerappelt hat, konnte ich keine Diskussion mehr starten. Ist selbst schuld, die Ziege. Mit der hätte ich lieber etwas Anderes unternommen.«
»Wo sind denn da die Probleme beseitigt? Jetzt haben wir neue, noch größere! Sorge dafür, dass wir den Standort erfahren. Du kennst ja die Marschrichtung.« Dann fügte er nach einer kleinen Pause hinzu: »Was ist mit dem anderen?«
»Alle! Begnadete Schussposition. Dach, kein Wind, alles ruhig. Ein einziger Puff. Die Karre steht irgendwo in einer Tiefgarage. Der Anzug ist verbrannt.«
»Also kümmere dich kurzfristig um die Ware. Dir ist schon bewusst, wie eilig es ist! Und wie wichtig! Wenn du es nicht schaffst, sind wir erledigt. Du bist der erste, der dran glauben muss! Glaube mir!«
»Wie soll ich das machen? Ich habe doch gar keinen Anhaltspunkt. Ich bin doch in gar nichts eingeweiht. Ich brauche wenigstens ein paar Einzelheiten. Auf jeden Fall brauche ich Unterstützung. Ich kann doch hier niemandem die Knarre an die Schläfe halten. Es wimmelt doch jetzt überall von Bullen.«
»Ich sehe zu, was ich machen kann.«
Der Anrufer wollte schon auflegen, doch dann erinnerte er noch freundlich daran: »Du weißt doch, was passiert, wenn einer seine Aufgaben nicht richtig erledigt. Oder? Ich will dir ja nichts tun, aber was soll ich machen? Es wäre schade um deine Mitarbeit.«
»Ich will mir ja alle Mühe geben, aber der Auftrag hieß: ›auf jeden Fall so schnell wie möglich. Der Kerl darf erst gar nicht sein Telefon in die Hand nehmen‹. Das waren Ihre Worte.«
»Hat dich jemand gesehen?«
»Keiner. Das weiß ich ganz genau. Die tappen völlig im Dunkeln.«
»Dann gib dir Mühe. Vielleicht hat der Sohn inzwischen die Daten. Das darf nicht passieren. Auf keinen Fall!«
»Glaube ich nicht, denn es ist ja alles noch zu frisch. Die müssen die Daten ja erst einmal finden…. Und wenn die einer findet, dann sowieso die Bullen. Ich glaube aber nicht, dass die damit etwas anfangen können. Die Listen sind so verschlüsselt…«
»Jedenfalls darf der Junge nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten. Wenn der erst hier herunter kommt, dann kriegen wir alle Hände voll zu tun. Mache also keine Fehler!«
»Ich kümmere mich.«
5. Kapitel
Im Labor in Hamburg liefen allerdings inzwischen die Untersuchungen der Spuren, die man am Tatort sichergestellt hatte, auf vollen Touren. Am frühen Nachmittag gab es die ersten mageren, aber wichtigen Ergebnisse. Das Gewehr war, wie Seeger sich in der Heide schon gedacht hatte, ein Scharfschützengewehr. Für die Identifikation brauchte er einige Zeit, aber durch die Beschreibung des Tathergangs durch die beiden Kommissare konnte er die Anzahl der Möglichkeiten schon wesentlich eingrenzen. Sie beide hatten keinen Schussknall gehört. Der aufgerissene Schusskanal, der mitten in die Brust wies, aber Herz, Leber und Nieren in Mitleidenschaft gezogen hatte, ließ die Vermutung zu, dass es sich wahrscheinlich um eine WSS-Wintore gehandelt haben musste. Dieses bestätigte auch das Projektil, das in seinem Körper gefunden wurde. Die Größe neunmal neununddreißig Millimeter wurde, soweit er wusste, nur im Osten verwendet.
»Wahrscheinlich hat der Täter sie aus sowjetischen Armeebeständen erworben – da ist ja heute fast alles zu bekommen – oder sie hat jemand aus dem Georgienkrieg mitgebracht. Dort war sie auf jeden Fall im Einsatz. Da fällt mir ein: in Afghanistan, glaube ich, wurde diese Waffe von den Taliban eingesetzt«, erklärte er Berendtsen am Telefon, damit er schon einmal einen Anhaltspunkt hatte. »Außerdem würde dieses Gewehr auch für die Entfernung passen«, erklärte Seeger und übergab dem Kommissar den Bericht.
»Was mich nur wundert, dass wir alle keinen Schuss gehört haben?«, wollte Berendtsen noch wissen. »Wie kann das sein? Wegen der Entfernung? Aber einen Schuss hört man doch meilenweit. Es ist mir nicht so wichtig, aber ich hätte es einfach mal gerne gewusst. Aus Neugier.«
»Das Gewehr hat einen eingebauten Schalldämpfer und mit der Munition, einer sogenannten ›Unterschallmunition‹ ist das Gewehr recht leise und man kann auf diese Entfernung nichts hören.«
»Sie sind ja wirklich ein Ass«, lobte Berendtsen den Leiter der Spurensicherung. »Werde Sie weiterempfehlen.«
Berendtsen setzte sich hinter seinen Schreibtisch und blätterte den Obduktionsbericht durch, legte ihn beiseite und beschloss, sich den Tatort des Mordes an dem Mädchen anzusehen.
An der Rezeption bat man ihn, sich einen Moment zu gedulden und in einem Sessel des Foyers Platz zu nehmen, da die zuständige Ansprechpartnerin sich in einem Telefongespräch befand. Er war ganz in Gedanken versunken, als er angesprochen wurde.
»Herr Berendtsen? Meine Kollegin Frau Kemper ist jetzt für Sie zu sprechen. Bitte kommen Sie. Ich möchte Sie ins Kaminzimmer begleiten. Da ist bei diesem Wetter keiner. Da können Sie sich ungestört unterhalten.« Sie wies ihm einen Sessel an. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Frau Kemper kommt jeden Moment.«
Er wollte ein Wasser. Während der Kommissar wartete, stand er noch einmal auf und warf einen Blick durch das Fenster des Kaminzimmers. Es zeigte auf eine wunderbar gepflegte Rasenanlage, auf der sich die Gäste auf sehr großzügigen Liegen entspannten, teils in der Sonne, teils im Schatten von kleinen Apfelbäumen, die auf dem Rasen verteilt standen. Andere lagen am Pool. Das Hotel war anscheinend gut besucht. Er war erstaunt, dass so viele Leute in der Heide ihren Urlaub verbrachten. »Ist ja auch schön hier. Mir würde es auch hier gefallen«, fand er und nickte sachte mit dem Kopf.
Frau Kemper erschien in einem dunkelblauen Hosenanzug mit Nadelstreifen und einem goldenen Namensschild auf dem Revers. Sie setzte sich mit der Garderobe von den anderen Mitarbeiterinnen an der Rezeption ab, die alle einen knielangen hellblauen Rock trugen und dazu eine Bluse mit Firmenlogo, einem mit nur einem Strich stilisierten liegendem Schaf und einem silbernen Schild. Die Dame wirkte sehr sympathisch auf den Kommissar und machte einen kompetenten Eindruck. Auffallend schön war ihr Haar. Es glänzte und fiele sanft bis fast auf ihre Schultern, wie man es sonst nur aus der Werbung kannte. Er hätte am liebsten einmal darüber gestrichen. Er schätzte sie auf etwas mehr als dreißig Jahre. Durch ihre selbstsichere Art merkte man, dass sie die Chefin der Rezeption war. Sie nahm in dem Sessel gegenüber dem Kommissar Platz und sie beide hatten einen niedrigen Tisch zwischen sich. Sie stellte ihre Beine graziös nebeneinander und legte, leicht vorgebeugt, die Hände auf ihre Knie und es kostete ihn Mühe, den Blick abzuwenden hin zu dem kalten Kamin, in dem eine Glasvase mit bunten Wiesenblumen dekoriert war. Nach kurzem Small-Talk und belanglosem Gerede über das Wetter, das, wie sie beide fanden, kaum besser sein konnte, wurde das Wasser serviert. Dann begann Frau Kemper, die an dem besagten Abend den Dienst beaufsichtigt hatte, dem Kommissar zu berichten. Er sah ihr an, dass sie von der Wichtigkeit dieses Interviews überzeugt war.
»Die Dame, nach der Sie fragen, ist von der Mitarbeiterin Anita Vossbeck eingecheckt worden. Wir mussten Anita leider erst einmal einige Tage frei geben, denn sie ist mit den Nerven völlig am Ende.« Sie faltete die Hände und hob sie ein wenig in die Höhe, um sie gleich wieder in ihren Schoß zu legen. Sie fingerte einen Zettel aus einer verdeckten Tasche in ihrem Rock.
»Frau Maria Koráshvili. Unter diesem Namen hat sie sich hier eingetragen und auf diesen Namen war auch die Kreditkarte ausgestellt, und zwar VISA von einer ausländischen Bank. Ich vermute mal, irgendein Land aus dem Ostblock, vielleicht Georgien, jedenfalls ein teilweise kyrillisches Schriftbild«, dabei legte sie dem Kommissar das Anmeldeformular vor. »Wir ziehen immer sofort die Kreditkarte durch, für alle Fälle«. Sie machte eine Handbewegung, die wohl erklären sollte, dass man sich nicht auf jede Zahlung verlassen kann. »Sie kam vor zwei Tagen an, abends gegen 20:09 Uhr. Ich habe gerade auf dem Kassenterminal ihre Eincheckzeit nachgesehen. Die Nachrichten waren gerade angelaufen. – Wir haben im Foyer einen Fernseher, der den ganzen Tag läuft.« – Sie deutete mit dem Glas in der Hand in Richtung Rezeption. Dann trank sie einen Schluck. Hielt das Glas in der Hand und fuhr fort: »Ich habe sie nur im Vorübergehen begrüßt, aber merkte sofort, dass sie gutes Deutsch sprach, mit nur leichtem Akzent, der mich dennoch auf den Ostblock hinwies. Bei dem Namen dachte ich schon gleich an Georgien. Wegen der Endung.« Sie lachte ein wenig trotz der Wichtigkeit des Gesprächs und hielt sich leicht erschrocken die Hand vor den Mund. »Nebenbei: ich kenne zwei Fußballspieler, die Georgier sind und so ähnlich heißen.« Dann fuhr sie wieder mit ernstem Gesicht fort: »Unser Service begleitete sie auf ihr Zimmer. Abends habe ich sie noch einmal bei einem Glas Wasser an der Bar entdeckt. Da kam sie auf mich zu und fragte mich nach einer Adresse, die sie auf einem Merkzettel notiert hatte. Ich wusste, dass es die Adresse von Friedmann ist. Die Familie ist hier bekannt durch Familienfeiern und Betriebsfeste. Ich habe ihr erklärt, wie sie dorthin kommen kann. Sie wirkte sehr unsicher und traute sich nicht zu, den Weg zu finden. Ich konnte sie insoweit beruhigen, dass jeder Taxifahrer aus dieser Gegend die Adresse kennt.«
»Können Sie sich vorstellen, wie der Täter sie gefunden haben könnte? Haben Sie etwas bemerkt, hat sich jemand erkundigt?«
Sie überlegte, schüttete dem Kommissar und sich Wasser nach und blickte nachdenklich auf die Bücher auf dem Kaminsims, dann aus dem Fenster nach draußen auf den Hof, auf dem die Sonnenschirme aufgespannt waren und die Urlaubsgäste in der Sonne lagen. Dann erhellte sich ihr Blick und sie sagte ganz aufgeregt: »Da fällt mir etwas ein: ein Mann hat gestern Nachmittag an der Rezeption nachgefragt, ob eine Nachricht für Frau Koráshvili eingetroffen sei. Das Mädchen hat in ihrem Fach nachgeschaut, aber das war leer.«
»Wären Sie bitte so freundlich, mir die Fächer zu zeigen?«
Frau Kemper ging vor. Sie zeigte ihm die Regalwand, mit den Fächern, in denen früher die Zimmerschlüssel aufbewahrt worden waren. Heute wurden sie nur mehr für Nachrichten an die Gäste benutzt. Unter jedem Fach stand auf einem kleinen goldenen Messingschild die Zimmernummer. Sie wurde bleich. »Jetzt hat sie ihm praktisch mitgeteilt, in welchem Zimmer sie übernachtet. Das kann ja wohl nicht sein, dass jemand so blöde war«. Sie schlug sich die Hand vor den Kopf. »Wir müssen die Ablagefächer anders platzieren. So etwas darf nie wieder passieren.«
»Wenn diese Mitarbeiterin es nicht gesagt hätten, dann eine andere. Solche Fehler kann man erst abstellen, wenn sie gemacht worden sind. Fehler gibt es überall, auch bei der Polizei. Glauben Sie mir. Wichtig ist anschließend nicht, dass man diesen Fehler eines Einzelnen behebt, sondern dass man dafür Sorge trägt, dass das gleiche Unglück nicht wieder geschehen kann. Nun ist es passiert und nicht rückgängig zu machen. Wenn er es nicht so erfahren hätte, dann anders. Oder der Mann hätte ihr aufgelauert. Was er auch wohl getan hat, denn das wäre für ihn wohl einfacher gewesen. Aber sie hat das Hotel ja nicht verlassen«, beruhigte sie der Hauptkommissar. »Können Sie den Mann beschreiben? Ungefähr?«
»Ich frage mal nach, wer dem Mann die Auskunft gegeben hat.« Sie war, gelinde gesagt, ungehalten.
Kurz darauf kam sie mit einer Angestellten aus dem Service zurück. Das Mädchen hatte gerade eine Rüge hinter sich. Das sah man ihr an.
»Ich war auf dem Weg ins Rezeptionsbüro um die Reservierungen für das Restaurant am Abend abzuholen, als der Mann mich nach der Nachricht fragte. Ich gab ihm die Auskunft, weil die Kollegin, die On Duty war, in ein längeres Telefongespräch wegen einer Reklamation verwickelt war und der Mann einen recht ungeduldigen Eindruck machte. Es schien ihr, dass er sehr ungehalten war wegen der Zeit, die er schon gewartet hatte. Die Kollegin nickte mir zu, damit ich mich kümmern sollte.«
»War niemand anderes zur Stelle?«, wollte Hauptkommissar Berendtsen wissen.
»Nachmittags ist die Rezeption immer nur einfach besetzt im Gegensatz zu zwei Mitarbeitern am Abend. Morgens sind sogar immer drei Leute eingeteilt. Ich habe es nur gut gemeint und wollte die Situation entschärfen.« Sie hatte die Tränen schon in den Augen stehen und es fehlte nicht viel und sie wäre angefangen zu weinen.
Dann beruhigte Frau Kemper sie und sie fing sich wieder. Sie dachte nach und erzählte:
»Er war groß und kräftig, so ein Boxertyp. Ich schätze mal so 1,95 m, 120 Kilo, rauer Typ, jedenfalls nicht gepflegt. Ost-Akzent. Er trug einen grauen Anzug, ein weißes Hemd ohne Krawatte und hatte einen schwarzen Hut auf, den er nicht absetzte, was mich gewundert hat.«
»Haben Sie vielleicht noch irgendetwas bemerkt? Sein Auto vielleicht gesehen? Eine Narbe?«