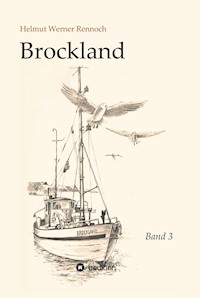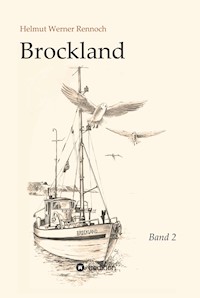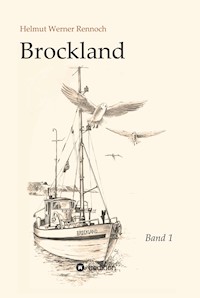
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Brockland
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt in drei Bänden die Geschichte der deutsch-dänischen Kaufmannsfamilie Halmstedt, von ihren Beziehungen zu Brockland, einer Insel in der Nordsee, und ihren Bewohnern. Dargestellt werden der Krieg von 1914-1918, Aufstieg und Niedergang eines Imperiums, die Revolution, ein zerbrechlicher Frieden, bevor sich die Katastrophe des Krieges während des Nationalsozialismus fortsetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über den Autor:
Helmut Werner Rennoch wurde ziemlich genau 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges – wie das Ereignis in den Geschichtsbüchern genannt wird – am 02. Mai 1955 in Damme im südlichen Oldenburg, einer katholischen Enklave im südlichen Niedersachsen, als Kind evangelischer Eltern geboren, deren Wurzeln und Erfahrungen zurückreichen in die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Vertreibung, Flucht, Neubeginn und schließlich Ankommen in einer Gesellschaft, die, zunächst fremd, dann Heimat, zu einer der vielen Paten dieses Buches wurde.
Helmut Werner Rennoch begann jenseits der vierzig, nach Ende seiner beruflichen Laufbahn, zu schreiben.
BROCKLAND
BAND 1
Helmut Werner Rennoch
© 2021 Helmut Werner Rennoch
Verlag & Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-21694-5
Hardcover
978-3-347-21695-2
e-Book
978-3-347-21696-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Meinen Eltern
Vorwort des Autors
Wenn ein geplagter Schulmeister oder eine gepeinigte Schulmeisterin feststellt, dass einer seiner oder ihrer Schüler das neue Geschichtsbuch bereits während der ersten Tage von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen hat, fühlt er oder sie sich geschmeichelt. Dem Schüler entstehen dadurch postwendend Vorteile, die nicht hoch genug einzuschätzen sind.
Ich war ein solcher Schüler und genoss sowohl die Sympathie meiner Lehrer, wie den Wissensvorsprung vor meinen Mitschülern. In Wahrheit ging es mir jedoch nur darum, spannende und anregende Geschichten zu lesen, wobei es mir an entsprechender Lektüre keineswegs mangelte.
Besonders angetan hatten es mir die alten Germanen: Die Männer wilde Kerle mit Keulen und schartigen Schwertern, die ihre Heimat mit Todesverachtung gegen die eindringenden Römer verteidigten, die Frauen sanfte Wesen mit langem, braunem Haar, deren anmutige Körper in selbstgefertigten Wollkleidern steckten, ihrem Manne eine treue Begleiterin. So stand es da! So zeigten es die Illustrationen! Und wer war ich, dass ich am Gedruckten zweifeln durfte?
Heute ist so gut wie alles, was seinerzeit Kindern über unsere Vorfahren in die Geschichtsbücher geschrieben wurde, widerlegt. Wir stammen nicht von einem einheitlichen Volk ab, das sich mit einem Indianerstamm aus den Büchern eines Karl May verwechseln ließe. Doch so wenig es die Indianer des sächsischen, so fantasiebegabten, Autors gegeben hat, so prosaisch ist die Vergangenheit, unsere Geschichte. Aber warum erzähle ich das?
Die Insel Brockland, meine Insel Brockland, ist Fiktion. Es gibt sie nicht, und gab sie nie. Sie ist Erfindung, Legende, Lüge! Man kann in der südöstlichen Nordsee herumkreuzen wie und so lange man will. Man wird nichts finden! Brockland entspricht nicht der Wahrheit. Die Insel ist nicht Realität! Aber ist das wirklich so?
Was ist Realität, was Fiktion? Was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass SMS, WhatsApp und E-Mails beim Empfänger ankommen. Aber wie? Warum verschafft uns diese Unwissenheit kein mulmiges Gefühl? Wir spüren die Allmacht des Internets. Aber was ist das überhaupt, von Kabeln und Drähten abgesehen? Wir alle schalten täglich Lampen und Geräte an und wieder aus. Aber hat jemals ein Mensch den elektrischen Strom gesehen? Wie, wenn man nicht daran zu glauben vermag, dass Gott die Menschen schuf, erklärt sich das Lächeln eines Kindes? Aus Kosmos und Ursuppe? Welchen Wert besitzt unser Wissen, wenn es von unserer Bereitschaft und vom Alltag geforderter Umstände abhängig ist, zu glauben?
Nein! Brockland existiert nicht nur, samt allen Menschen und Geschichten. Die Fiktion ist die Sprache der Erklärung und des Beispiels. Niemand würde ein biblisches Gleichnis als Lüge bezeichnen, und längst akzeptieren wir zerfliessende Uhren als Mittel des Ausdrucks.
Wenn es darüber hinaus stimmt, dass Geschichte immer die Geschichte des Siegers ist, und vieles spricht dafür, dann müssen wir skeptisch sein und uns Erklärungen schaffen. Vielleicht gibt es in einzelnen Fällen auch mehr als nur eine einzige Wahrheit. Vielleicht gibt es neben Wahrheiten, die sich messen lassen, solche, die nur fühlbar sind. Vielleicht fehlt uns in unseren Sprachen ein Wort für all die Räume, Ebenen und Dimensionen der Wahrheit. Mein Vorschlag; Brockland!
Danksagung
Ich habe all denen zu danken, die mir durch Kritik und Zuspruch halfen, weiter zu machen. Über die lange Zeit, die die Arbeit in Anspruch nahm, waren es derer nicht wenige.Ungenannt heißt nicht vergessen.
Mein besonderer Dank gebührt Eva-Maria Braun, die mit großer Klarheit und Geduld das Manuskript durchsah und es dahin führte, wo es sich heute befindet.
Nicht zuletzt bin ich Herrn Ernst J. Herlet etwas schuldig, der die wunderbaren Illustrationen beisteuerte.
Dezember 2020
ERSTER TEIL:
Funkenflug
Kapitel 1
Der Tisch war gedeckt wie jeden Morgen. Frisch gebackenes Brot, gesalzene Butter, Pflaumenmus vom vergangenen Herbst; dazu eine Kanne Tee, braunen Zucker und ein paar Löffel Sahne in einem schlichten Gefäß aus grobem Porzellan. Für drei Personen gedeckt, erweckte die Anordnung der Lebensmittel und die Verteilung des Geschirrs den Eindruck, als fehle jemand, der früher mit an diesem Tisch gesessen hatte, dessen Zugehörigkeit zu der Tischgemeinschaft jedoch ungebrochen war.
Una strich kurz, und weil sie sich unbeobachtet wusste, einem morgendlichen Ritual gleich, über den freigelassenen Platz und dachte nicht ohne Stolz, vor allem aber mit mütterlicher Sorge, an Simon. In wenigen Wochen würde das Semester zu Ende sein, und er würde den Sommer auf Brockland, hier bei ihr, verbringen. Dann sagte sie sich wieder einmal, allerspätestens dann, musste Finn reiner Wein eingeschenkt werden. Er hatte es nicht verdient, dass man ihm die Wahrheit vorenthielt. Una kannte ihren Bruder gut. Er wird enttäuscht sein, dachte sie, und sich belogen und betrogen fühlen und damit auch recht haben. Una seufzte unter der Last des schlechten Gewissens.
Der späteste Zeitpunkt zum Aufstehen war der Sonnenaufgang. Dies galt auch für das Pfarrhaus und für Pastor Finn selbst. Das kurze Haar gescheitelt, korrekt gekleidet, einschließlich der äußeren Zeichen seiner Amtswürde, betrat er die Küche zur gleichen Zeit wie gestern und vorgestern und wie er es morgen und übermorgen tun würde. Er grüsste seine Schwester kurz wie anders:
„Moin! Na?“
Er lächelte das unbewusst für Familienangehörige reservierte Lächeln und erkundigte sich höflich und ein wenig steif, wie sie geschlafen habe. Dann öffnete er, ohne ihre Antwort abzuwarten, die Tür, die zu der kleinen Terrasse führte, trat hinaus, und versorgte die Schwester mit dem Wetterbericht, als sei dies die erste Pflicht des Tages. Für gewöhnlich benutzte er dazu feststehende Ausdrücke wie: „So gegossen hat es ja nicht mehr seit …“, oder: „Schon so früh so warm …“, woraufhin sie antwortete, sie habe selbst Augen im Kopf, oder, sie wisse, dass Sommer sei. Doch in den letzten Wochen, ja, Monaten, antwortete sie nur mit „Danke.“ oder „Ja, ich sehe es.“ Sie war nicht mehr so schnippisch wie früher, fand Pastor Finn, der die kleinen morgendlichen Geplänkel vermisste, und hatte ganz allmählich begonnen, sich zu sorgen. War etwas mit Simon, dem Neffen? Oder mit Una, der Schwester, selbst? War sie krank? Jedenfalls hatte sie sich verändert. Er musste mit ihr sprechen. Aber wann und wie? Viel zu lange schob er es schon vor sich her, als fürchte er die Antworten. Warum fiel es ihm im eigenen Haus, innerhalb der eigenen Familie, so schwer, was bei anderen, er erschrak, Routine war?
Finn kehrte nach ein paar Schritten auf und ab, und nachdem er seine Lunge mit frischer Luft gefüllt hatte, in die Küche zurück.
„Ist Mutter noch nicht auf?“, fragte er.
Una schüttelte verneinend mit dem Kopf und begann, die Tassen mit Tee zu füllen:
„Ich sehe gleich nach ihr!“, antwortete sie.
„Ja. Gut. Oder nein. Warte noch. Vielleicht sollten wir beide uns einmal in Ruhe unterhalten. Was meinst du?“
Una zuckte zusammen und spürte die Gänsehaut, die sich auf ihren Rücken legte. Hatte er es herausgefunden? Und wenn ja, wie? Doch welche Rolle spielte das! Gut! Dann musste es eben jetzt sein:
„Ja. Ich glaube, dass wir das tun sollten. Es ist so …“
Sie unterbrach sich und begann von Neuem.
„Finn …!“
Obwohl sie die ältere der Geschwister war, eine angesehene und gestandene Frau, kamen ihr die Worte nur zögerlich über die Lippen.
„Warum setzen wir uns nicht?“, sagte sie endlich.
„Ja. Setzen wir uns!“ stimmte er mit belegter Stimme zu.
Ein Kloß machte sich breit in seinem Hals und erschwerte das Atmen. Das Gefühl hatte ihn also nicht getäuscht. Es gab da etwas! Etwas, das in ihren Alltag hinein schnitt und ihr Leben zu verändern drohte. Er stemmte sich gegen die Unruhe, die nach ihm griff, und senkte die Augen, die ihn verraten konnten. Sie kannten einander zu gut.
Una rückte mit ihrem Stuhl ein wenig vom Tisch ab, legte die gefalteten Hände in den Schoß und, wie um den Anfang eines Taktes zu akzentuieren, nickte sie einmal bedeutsam, und das Orchester ihrer Seele begann zu spielen, und durfte nun endlich im Freien erklingen. Der Anfangsakkord verriet noch nichts darüber, von welcher Beschaffenheit die Darbietung sein würde. Symphony oder Passion!
„Es ist so:“
„Das sagtest du bereits.“
Finns Beschwerde klang ein wenig ungestümer als beabsichtigt.
„Was?“
Er verdrehte die Augen, indem er sie offen ansah.
„Also weiter“, mahnte er.
Er war jetzt bereit, sich die unbekannte Last auf die Schultern zu legen, und war froh darüber, dass sie miteinander sprachen, wie sie es früher getan hatten.
„Es geht um Simon!“
Jedes einzelne Wort war betont und Una ließ erkennen, dass sie sich jetzt nicht mehr unterbrechen lassen würde. Es leuchtete in ihren großen, schönen Augen, als sie den Namen des Sohnes aussprach.
Gott sei Dank, dachte Finn. Gott sei Dank. Er nahm es hin, dass sie nun ein wenig ausholte.
„Du weißt, Finn, dass Oscarson seinen Sohn nie gesehen hat, und Simon seinen Vater nicht. Ob es das Los, das Schicksal der Fischer ist, auf See zu bleiben…? Wer weiß! Seine, Oskarsons, war es! Aber so jung? Wir beide, er und ich, so jung!“
Finn nickte. Es gab nichts zu sagen, das nicht schon gesagt war. Fast zwanzig Jahre war es her, dass Oscarson, Unas Ehemann und Simons Vater, auf See geblieben war. Die Orkane im Spätherbst waren unberechenbar. Heute war das Leben der Fischer nicht weniger gefährlich als früher. Die See nährte sie alle wie eine Mutter, aber sie forderte auch Opfer. Immer wieder! So war das eben!
Una fuhr fort:
„Für Simon bist du der Vater gewesen, Finn. Einen anderen kannte und kennt er nicht. Ein Sohn kann seinen Vater nicht mehr lieben, als Simon dich liebt. Und ich glaube, Finn, dir geht es ebenso. Du erwiderst Simons Gefühle auf die gleiche Weise! Du wünschst dir in Simon jemanden, der etwas von dir weiterträgt, und du hast recht damit und Anspruch darauf, wie es ein Vater hat. Doch ein Mensch, dazu ein junger Mensch, kann nicht alles tragen, was man ihm auferlegt. Er muss auch eigene Wege suchen und gehen lernen.“
„Damit hast du sicher recht, Schwester!“, antwortete Finn. Und ein fragender Ausdruck legte sich auf sein Gesicht.
„Aber was willst du mir sagen? Hat Simon eine Dummheit in der großen Stadt gemacht?“
„Eine Dummheit?“, fragte Una überrascht.
„Der Junge ist fast zwanzig Jahre alt und die Versuchungen lauern an den Straßenecken“ erklärte Finn.
„Hamburg ist eine der größten Hafenstädte der Welt! Schiffe, Matrosen und …“
Straßenecken! An dergleichen, und natürlich war ihr klar, worauf Finn hinaus wollte, hatte sie im Zusammenhang mit ihrem Sohn noch nie gedacht. Simon und eines dieser Mädchen? Zorn stieg in ihr auf, doch sie beherrschte sich:
„Dummes Zeug. Ein Grünschnabel ist er.“
Sie las die Gedanken aus seinem Blick: Wie viel älter war Oscarson, als er… Ein Jahr? Zwei Jahre?
„Ein Mädchen von der Straße ist nicht das schlimmste, das einem in Hamburg geschehen kann!“, sagte er fast streng.
Una schüttelte sich. Offenbar war auch ihr Bruder, auch ein Pastor, nur ein Mann. Simon dagegen war anders. Ganz bestimmt! Damit kehrte sie zu dem zurück, was sie zu sagen hatte:
„Simon ist nach Hamburg gegangen, um Theologie zu studieren und um Pastor zu werden, so wie du.“
„Das ist mir nicht verborgen geblieben.“
Sie überhörte die Bemerkung und ignorierte deren Verpackung:
„Simon glaubte, dass er dir das schuldig sei. Dass du das von ihm erwartest.“
„Keine Erwartung. Keine Schulden. Hoffnung ja, das gebe ich zu. Simon hat das Zeug zu einem guten Geistlichen.“
„Daraus wird aber nichts!“.
„Nein“, sagte Finn einfach.
„Daraus wird nichts!“
Una sah ihren Bruder staunend an. Sie hätte nicht zu sagen vermocht, mit welcher Reaktion sie gerechnet hatte. Mit dieser jedenfalls nicht.
„Hast du mich nicht verstanden?“, sagte sie.
„Simon wird nicht Pastor werden! Er hat die Fakultät gewechselt!“
Ohne jede Spur von Erregung oder Enttäuschung sagte Finn:
„Auch Ärzte werden gebraucht.“
Una starrte ihren Bruder an, als habe sie, oder er, oder beide, den Verstand verloren:
„Du hast es gewusst!“
Bis hierhin hatte sie größten Wert auf Beherrschung gelegt, doch jetzt ließ sie sich von ihrem Temperament mitreißen:
„Du hast es tatsächlich gewusst!“
„Schwester!“
Ermahnend legte Finn den Zeigefinger auf die Lippen und deutete auf die Tür, hinter der sie ihre Mutter wussten.
„Du hast es doch tatsächlich gewusst!“
„Nicht gewusst!“, erklärte er.
„Aber als Simon nach Hamburg ging, entband ich ihn von allen vermeintlichen und eingebildeten Verpflichtungen. Und du kannst mir glauben, Una, sein Blick, die Erleichterung, sprachen Bände. Dazu die Bücher, die er las und teilweise sogar nach Hamburg mitnahm. Medizinische Bücher. Man muss kein Detektiv sein, um das Offensichtliche zu erkennen.“
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“
„Dann hol jetzt Mutter und lass uns zusammen frühstücken.“
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und eine Frau in den Siebzigern mit langem, ergrautem Haar, bekleidet mit einem viel zu großen, flatternden Nachthemd, zeigte sich auf der Schwelle. Vorwurfsvoll näherte sie sich und sah erst ihre Tochter und dann ihren Sohn an. Plötzlich legten sich ihr Misstrauen, Erstaunen und Missbilligung aufs Gesicht.
„Wer seid ihr? Wo sind meine Kinder? Haben sie euch reingelassen? Ich kenne euch nicht…“
Das Billett wurde von einem Boten überbracht, und der Text lautete:
‚Sir! Ein gottgefälliges Schicksal hat mich mein Schiff nach England verpassen lassen. Nehme also Ihr Angebot an, um Ihr Domizil kennenzulernen. Hoffe, Sie haben es sich nicht anders überlegt …’
Gustav las die Unterschrift noch einmal. Dann erinnerte er sich. Vor zwei Tagen, während des Empfangs anlässlich der Eröffnung der Britisch-Skandinavischen Wirtschaftskonsultationen, hier in Kopenhagen … David Godley mochte Ende vierzig sein, hatte schütteres, rotblondes Haar und eine wächserne, pigmentarme Gesichtsfarbe, die ihn jedoch offensichtlich nicht davon abhielt, wie keinen Engländer vor ihm, ausgedehnte Reisen nach Afrika, in den Orient und selbstverständlich nach Indien zu unternehmen. Er war der jüngste Bruder des gegenwärtigen Earl of Sandcrest, reiste mit Butler und Privatsekretär, zelebrierte britisches Understatement wie eine Lebensanschauung, und war darüber hinaus ein höchst umgänglicher Mensch, und, dessen war sich Gustav sicher, ein Gentleman.
Sehr früh am Morgen des übernächsten Tages …
Die Fähre wandte sich zunächst nach Süden, entlang der Ostküste Seelands, dann westwärts durch die Storstrom-Meerenge hinein in das Smalland-Gewässer mit Westkurs auf Langeland zu. Und schließlich durch den Kleinen Belt und die schleswigsche Ostküste hinauf durch das Kattegat, der Nordspitze Jütlands entgegen.
Mit verbundenen Augen hätte Gustav sagen können, wo sie sich gerade befanden und welche der vielen hundert Inseln sie gerade passierten. Der Archipel hatte einen bestimmten Duft, energetisch und erotisch, und war untrennbar mit Gustavs Kindheit verbunden. Im Skagerrak, der Seestrasse zwischen Norwegen und Dänemark, trafen Ostsee und Nordsee aufeinander und feierten schäumende Vereinigung, ohne Rücksicht auf Wasserfahrzeuge und menschliche Schicksale zu nehmen.
Nicht lange darauf legte die Fähre, nachdem sie einige wenige Seemeilen einem Südkurs gefolgt war, in einem kleinen Fjord an, um dort die Nacht zu verbringen.
Bei deftigem dänischem Essen, Wein, Bier und schärferen Essenzen kamen sich die Passagiere schnell näher. Schließlich tauchte von irgendwo ein Akkordeon auf. Es wurde getanzt und gesungen. Gustav hatte in der Hoffnung darauf, Godley könne Gefallen an Vergnügungen solcher Art finden, diese eindrucksvolle Route, die nicht die Kürzeste war, für sie gewählt. Sehr früh am Morgen setzte das Schiff seine Fahrt fort, und je weiter sie nach Süden kamen, desto mehr lichtete sich der Nebel und die Sicht verbesserte sich zusehends. Im Verlauf des Vormittags, an einem Tag Anfang Mai 1914, erreichten sie Esbjerg. Hier wechselten sie das Schiff.
Die ‚Prinzessin Irene’ war ein Frachter, nicht zu vergleichen mit der modernen und komfortablen Küstenfähre, die sich inzwischen bereits wieder auf der Rückfahrt nach Kopenhagen befand. Doch die vier Männer machten es sich trotzdem irgendwie bequem, jungenhaft wie Pfadfinder, und gaben sich gut gelaunt einem Streitgespräch über die Seefahrt hin, das ohne Standesdünkel geführt wurde. Denn Benjamin, Godleys Butler, und John Russel, sein Sekretär, hielten begeistert mit: Wikinger und Normannen, Störtebecker und die Hanse, Strömungen und Untiefen, Trafalgar, der fliegende Holländer, fantastische Leuchtphänomene und so weiter, und sie schafften es gerade noch, den alten Klabautermann herauszuhalten.
Obwohl es noch längst nicht Mittag war, tranken sie Rum. Dies sei Tradition, beharrte Gustav.
„Erstaunlich, dass wir eine Passage auf diesem prächtigen Schiff gefunden haben!“ meinte Godley, den die Tatsache, dass es keine Kabine für Passagiere gab, oder diese nicht zur Verfügung stand, nicht zu stören schien.
„Die ‚Irene’ ist in den Inventarlisten von Halmstedt verzeichnet.“, gab Gustav bescheiden zurück. Er hätte auch sagen können, dass die ‚Irene’ sein Schiff sei, und er der Eigner war.
„Schiffe…“, sagte Godley,
„…sollten nicht in Inventaren geführt werden. Sie atmen, sie leiden, sie haben eine Seele. Finden Sie nicht, Gustav? Der Mensch baut Schiffe nach seinem Abbild!“
Die philosophische und poetische Bemerkung war Gustav ein wenig unangenehm, ohne dass er sagen konnte, warum, und er unterließ die gedankliche Überprüfung der These.
„Der Kapitän ist ein bisschen böse auf mich, weil er auf uns warten musste. Aber der famose Ostwind wird ihn schon beruhigen und uns den kleinen Zeitverlust aufholen lassen.“ Erläuterte Gustav.
„Ich mache Ihnen Umstände, Sir“, sagte Godley.
Gustav winkte ab:
„Nicht im Geringsten. Wirklich nicht!“
„Dann darf ich vielleicht auf die Einladung zu einem kleinen Rundgang hoffen?“
„Ich zeige Ihnen gern das Schiff, Sir!“
So streiften sie eine Zeit lang auf dem voll getakelten Dreimaster mit dem riesigen Laderaum und seinen funktionellen Aufbauten und Einrichtungen herum. Godley interessierte sich für alles, stellte Fragen, die ihn als sachkundig auswiesen, und Gustav war ein geduldiger, ja stolzer Führer. Schließlich sagte der Engländer:
„Erzählen Sie von Brockland, unserem Reiseziel. Was muss man über die Insel und die Menschen dort wissen? Was fasziniert Sie persönlich, Gustav?“
Gustav bemerkte, dass sein Gast seinen Vornamen bereits wiederholt benutzt hatte. Die nordeuropäischen Kulturen unterschieden sich, fand er, in nur wenigem. Eines davon war die Verwendung des Vornamens und die Form der Anrede. Sie oder Du? Wie den Dänen das ‚du’ nahe war, und die englische Sprache für beides nur ein Wort besaß, bedurften die Deutschen einer Zeremonie, um vom ‚Sie’ auf das ‚du’ zu wechseln. Von nun an würde er ‚David’ sagen, um Godley nicht zu beleidigen.
„Fragen Sie einen Maulwurf, warum es ihm unter der Erde gefällt!“, sagte Gustav, ohne das Gesicht zu verziehen, und erst als Godley lachte, wurde ihm bewusst, dass seine Antwort als Witz aufgefasst werden konnte. Doch davon unbeirrt, versuchte er jetzt, die Frage zu beantworten.
„Die Menschen auf Brockland…“, begann er, „sind Nachfahren von Piraten und Schmugglern, und sie sind verdammt stolz darauf. Sie seien Friesen und Wikinger, betonen sie und hätten mit Dänemark, dem jetzigen Dänemark, Schleswig und Deutschland nichts zu tun. Tatsächlich wird die Insel in keinem einzigen offiziellen Vertrag oder Dokument genannt, selbst, wenn Sie tausend Jahre und mehr in den Archiven zurückgehen. Doch das alte Schmugglerblut lässt sie allen Nationen gegenüber offen sein und diskriminiert niemanden. Sie sind gute Kaufleute, die den Wert ihrer Waren genau kennen. Verträge werden per Handschlag geschlossen. Nichts wird aufgeschrieben! Wer es dennoch versucht, gerät unter Verdacht. Wer sich an Verträge nicht hält, ist erledigt, und verkauft keinen Knopf mehr auf Brockland!“
„Interessant!“
Gustav bemerkte, dass Godley ihm mit aufrichtigem Interesse zuhörte.
„Brockland wird durch eine Art Kanal geteilt, der etwa in Nord-Süd-Richtung verläuft. Der östlich abgespaltene Teil ist unbewohnt und wird Kimberland genannt.“
„Wir Engländer nennen die ganze jütländische Halbinsel Kimberland!“, sagte Godley.
„Die gemeinsamen Wurzeln, David.“
„So muss man es wohl sehen. Aber fahren Sie bitte fort.“
„Im Osten gibt es einen alten Deich. Niemand weiß genau, wie alt er ist. Er wird regelmäßig gewartet und ist, soweit ich das beurteilen kann, gut in Schuss. Kimberland ist wichtig für die Viehwirtschaft des Gemeinwesens. Es wimmelt dort vor Kühen, Schafen, Ziegen und Gänsen. Im Süden Kimberlands finden Sie Sandbänke, Halligen und ein paar kleine Inseln. Die größte ist Butland. Ein, sagen wir, geheimnisvoller Ort, an dem die alten Götter nicht totzukriegen sind. Anordnungen keltischer und germanischer Gräber und Ritualsteine, so behaupte ich als Laie jedenfalls, findet man dort.“
Godley bewegte den Kopf nachdenklich hin und her. Diese Sachverhalte schienen ihn weniger zu interessieren. Gnädig bemerkte er:
„Ich verstehe. Was wären wir Briten ohne unsere Gespenster.“
Gustav fuhr fort:
„Die Hauptinsel steigt nach Westen hin zuerst leicht, dann spürbar an, und das Westkap, wenn man so will, ist eine felsige Steilküste, die sich nach Norden hin wieder leicht verflacht und Baumwuchs zulässt, der landeinwärts dichter wird. Der Wald im Norden, Eichen, Tannenarten und Birken, besäumt wie ein Schutzwall gegen die Nordwinde und Orkane die Insel, und bewahrt den kostbaren Humusboden vor dem Abgetragenwerden. Hier, im Norden Brocklands, wird Landwirtschaft betrieben. Schönere Felder, Getreide, Mais, Raps, haben Sie nie gesehen, David!“
Der Süden gehört, nehmen Sie das nicht wörtlich, den Fischern. Der Hauptort liegt im Südosten und wird von einem neueren Deich geschützt. Die Kirche, der Marktplatz mit dem alten Brunnen, eine nicht geringe Anhäufung Steinhäuser, teils aus den Resten des Kirchbaus gefertigt, Ausbeute des kleinen, im äußersten Nordwesten gelegenen Steinbruchs, teils aus roten gebrannten Ziegeln. In einem dieser Häuser ist unser Kontor untergebracht, und ich besitze dort eine Wohnung.
Das Gesicht des Hafens, der einen großen Teil des Südens einnimmt, ist geprägt durch eine Kaimauer, die etwa dreimal so lang ist, wie der Durchmesser des Ortskerns. Links und rechts von der Kaimauer ragen zwei lange, gebogene Molen wie Scherenblätter südlich hinaus in die See. Eine perfekte, einfache und nützliche Konstruktion, an deren südlichstem Punkt sich die Hafeneinfahrt befindet.
Die Straße, die einmal die ganze Hauptinsel mehr oder weniger an ihrem äußeren Rand umrundet, mal gut ausgebaut, mal den Namen nicht verdienend, verläuft im Süden dicht an der Kaimauer entlang. Auf beiden Seiten der Straße, in der Nähe des Hafens, findet man Areale von Lagerhäusern, Schuppen und anderen nützlichen Gebäuden, ohne die Handel zu treiben, nicht denkbar wäre. Über die gesamte Südküste verteilt leben die Fischer in traditionellen Häusern nach alter friesischer Bauart. Fachwerk, aus Lehm gestampfte Fußböden, gemauerte Kamine, Reetdächer. Im Nordwesten finden Sie ein Dorf der Bauern, das zuletzt hübsch gewachsen ist, und dem Hauptort Konkurrenz zu machen droht. Hier, wie bei den nicht wenigen, über die Insel verstreuten großen Höfen, die gleiche Bauweise. Und dann sollten Sie noch wissen, David, dass jeder Fischer gleichzeitig Bauer, jeder Schafzüchter gleichzeitig Handeltreibender ist, je nach Möglichkeit, Tradition und persönlichem Engagement. Doch die Schwerpunkte sind klar verteilt: Fisch im Süden; Ackerbau- und Viehzucht im Norden. Kimberland gehört allen, und der Hafen ist der Mittelpunkt Brocklands!“
Gustav machte eine Pause und zündete sich eine Pfeife an. Godley erinnerte sich daran, dass sein Gastgeber auf dem Empfang in Kopenhagen Zigarren geraucht hatte, sagte aber nichts. Stattdessen holte er einen silbernen Flakon hervor und reichte ihn Gustav:
„Schottisch. Garantiert zwölf Jahre alt. Gott schütze den König.“
Sie tranken, und als sei der eine zum Weitersprechen animiert worden, und als habe der Andere genau das beabsichtigt, sagte Gustav:
„Nun ja! Was gibt es sonst noch Wissenswertes? Ach ja! Die Kolonie …“
„Kolonie?“, fragte Godley erstaunt.
„Ja. Künstler in der Regel. Maler, Bildhauer, Schriftsteller und sicher auch ein paar, die sich dafür halten. Unweit der westlichen Strasse. Blockhütten, aber auch ein paar Bungalows und sogar zwei oder drei kleine Fachwerkhäuser, bis hin zum Miniaturherrensitz … Ich meine damit die recht hübsche, kleine Villa der Baronin von Gassen.“
„Von Gassen?“, rief Godley plötzlich wie elektrisiert.
„Ingelis von Gassen? Ich besitze eine Arbeit von ihr. Ein beachtliches Werk. Gute Güte. Die Versicherung kostet mich ein Vermögen, hol mich der Teufel.“
Sie lachten amüsiert und ohne Erinnerung an Erziehung und Protokoll, das es auf See ohnehin nicht gab, und fast war es so, als schlössen sie einen Vorvertrag über eine zukünftige Freundschaft.
„Sie müssen mich ihr vorstellen, Gustav. Und wenn es das letzte ist, um das ich Sie bitte.“
„Nicht nötig! Ich muss Sie ohnehin in der Kolonie einquartieren. Ich bin auf Gäste auf der Insel nicht eingerichtet, fürchte ich.“
„Ich? In der Kolonie? Aber ich bin kein Künstler.“
Godley hatte abwehrend die Hände erhoben, als habe man ihn aufgefordert, ein altes walisisches Volkslied in gälischer Sprache zu singen und dabei tanzend eine Schüssel mit Porridge auf dem Kopf zu balancieren.
„Es reicht, wenn Sie trinkfest sind. Die Baronin wird an ihre Tür klopfen, um zu fragen, wer Sie sind. Und wenn Sie ihr sympathisch sind, wird sich unter ihrem Arm eine Flasche Champagner befinden.“
Godley hätte sich am liebsten weiter nach Ingelis erkundigt, doch er ließ es sein.
„Das ist aber nun wirklich alles, was zu berichten lohnt.“
Godley sah Gustav eindringlich an:
„Wirklich? Haben Sie nicht doch etwas vergessen? Was ist mit Ihrer Verwandtschaft?“
Broderson! Ja, es stimmte. Broderson hatte Gustav vergessen. Nein. Nicht vergessen, sondern …
„Broderson! Mein Schwager Oswin Broderson. Es wundert mich nicht, dass Sie als Engländer Broderson kennen.“
„Ich bin fasziniert von der Idee, Lebensmittel in Konserven zu stecken, haltbar zu machen und …“
Godley vollführte eine unbestimmte Handbewegung:
„… Deckel drauf und fertig! Ja. Sie haben recht: die Briten lieben Konserven. Ich hörte, man gibt sich inzwischen mit der Fischverarbeitung nicht mehr zufrieden?“
„Stimmt!“, sagte Gustav.
„Aber nur um Kapazitäten auszulasten. Großzügigerweise überlässt Oswin mir den Ostseehandel. Ich glaube wir haben dort in den letzten Jahren ein paar Tonnen Pflaumenmus in Dosen an den Mann gebracht.“
„Ich bewundere Ihren Schwager, Gustav. Verstehen Sie mich richtig. Halmstedt ist Halmstedt. Aber dieser Broderson … Wie man hört: ganz aus eigener Kraft. Wenn auch Ihre Familie selbstverständlich … Ich meine …“
Er brach ab und fragte:
„Rede ich mich gerade um Kopf und Kragen?“
„Nein, David.“
Gustav winkte ab.
„Was Broderson geschäftlich auf die Beine gestellt hat, ist aller Achtung wert. Ich zolle ihm ohne Einschränkung Respekt. Er weiß das. Sie sollten sich die ‚Iliana’ ansehen.“
Gustav erklärte, dass die ‚Iliana’, das Flaggschiff in Oswin Brodersons Flotte, eines der neuesten und modernsten Verarbeitungs- und Kühlschiffe im Nordatlantik sei.
„Famos, ganz famos. Ich würde diese schwimmende Fabrik gern sehen.“
„Das lässt sich sicher machen“, sagte Gustav, wobei sein Blick nachdenklich auf seine Stiefelspitzen fiel.
„Haben Sie etwas, Gustav?“
Eine schwimmende Fabrik! Kein Neid, nur Anerkennung, und ein wenig Wehmut und Erinnerung.
„Nein. Alles in Ordnung.“
Dann wies Gustav mit dem Finger in eine Richtung und sein Blick hellte sich auf:
„Da ist sie! Da ist Brockland!“
Urban Axon trug saubere, polierte Seestiefel, die wie frisch geputzt erschienen, und nicht, als hätten sie einen langen Arbeitstag an den großen Füßen ihres Besitzers hinter sich. Unter dem groben, offenen Baumwollrock lugten breite Hosenträger hervor, die sich über eine mächtige Brust spannten, und ein breiter Ledergürtel umgab die kräftigen Hüften. Er war ein Hüne von Gestalt, besaß schaufelartige Hände, einen stiernackigen Hals und einen Kopf, dem keine Wand gewachsen schien. Die glänzende, freie Fläche inmitten des buschigen Haarkranzes funkelte trotzig Sonne und Wolken entgegen. Er war glatt und gut rasiert, ungewöhnlich für einen Brockländer. Das Gesicht war gleichmäßig geschnitten, mit einer kräftigen Nase, ausladendem Kinn und tief liegenden, hellen skeptischen Augen. Und gerade diese Augen waren es, die ihm Sorge bereiteten. Natürlich ging das niemanden etwas an, und es handelte sich auch nicht darum, dass er die Handelsbriefe und Zeitungen mit langen, ausgestreckten Armen halten oder einen Schritt zurücktreten musste, um einzelne Buchstaben oder Ziffern erkennen zu können. Dieses Phänomen kannte Urban und hatte es bei vielen anderen Menschen oft beobachtet. Jenes Leiden trat auf, wenn man, wie man sagte, in die Jahre kam. Nein; sein Problem war ein anderes! Da war etwas Gräuliches und Milchiges…. Gott sei Dank nur auf der einen, der linken Seite. Eine Art Trübung, die sich vor den klaren Fernblick schob. Das vergeht, wie es gekommen ist. Eine vorübergehende Geschichte hatte er sich anfangs gesagt. Doch das Ärgernis war geblieben und jetzt dachte Urban darüber nach, ob nicht eine Brille helfen könne. Allerdings hatte niemals jemand in seiner Familie eine Brille getragen. Die Axons waren eine alte Dynastie von Fischern, Seeleuten und Kriegern, die keinem König, nur ihren Waffen gedient hatten. Sie waren Männer, die nicht nur ihr eigenes Leben fest im Griff hatten, sondern Anführer, zu denen man um Rat kam, und um von ihnen Hilfe zu erbitten. Männer, die Autorität besaßen, und zu denen aufgesehen wurde. Keine Knechte, wie etwa Broderson sie in seiner Fabrik und auf seinen Schiffen beschäftigte. Die Axons, und ganz sicher auch er selbst, Urban Axon, waren aus anderem Holz geschnitzt. Er war der unangetastete Erste unter seinesgleichen. Was würde eine Brille aus ihm machen? Er blinzelte, hielt sich die Hand aufs linke Auge und sah es jetzt deutlich. Da war sie! Endlich. Wurde auch Zeit! Verdammt noch mal! Sein Magen knurrte. Er wollte nach Hause, etwas essen und sich ein oder zwei Stunden Ruhe gönnen. Der Tag eines Fischers begann lange vor Sonnenaufgang. Außerdem hatte er eine junge Frau, Enid, die, wenn er nur an sie dachte, sein Blut schneller fließen ließ. Die Verspätung der ‚Irene’, auch wenn sie kaum der Rede wert war, verzögerte den Genuss dieser Annehmlichkeiten. Er sah über die Schulter, um festzustellen, ob seine Leute die gleiche Beobachtung gemacht hatten wie er selbst. Das sparte Worte. Und… Es war der Fall, denn sie bewegten sich bereits langsam in Richtung ihrer Kutter, um jetzt auch bald den Arbeitstag hinter sich lassen zu können.
Das Umladen des Fangs hinein in den Bauch der ‚Irene’ war wie jede Arbeit auf See hart. Von frühester Jugend an daran gewöhnt, beklagte sich niemand und würde es auch zukünftig nicht tun. Ein Mann wurde daran gemessen, dass er durchhielt, sich seines Schweißes nicht schämte, seine Familie ernährte, und nicht durch Jammern und Lamentieren den Verlust seines Gesichtes riskierte. Wer viele Worte machte, hatte nichts zu sagen. Gefühle gehörten, wenn überhaupt, an den heimischen Herd, nicht dahin, wo Kraft, Geschicklichkeit und Erfahrung eines Mannes gebraucht wurden.
Makrele, Lachs, Dorsch, Scholle … Dazu Beifang, ein nicht bestimmbares Allerlei von kleinen Seetieren mit Krusten und Schalen, sowie verschiedenster Meeresorganismen, unsortiert hinüber und hinein in den für die Aufnahme des Fangs präparierten Laderaum. Einer nach dem anderen kam, in für Außenstehende nicht erkennbarer, aber tadellos funktionierender Ordnung, an die Reihe, legte sich mittschiffs, und präsentierte seine Schätze. Fässer wurden gezählt, Strichlisten geführt, die silbrig, glitschige Masse verteilt und mit Eisquadern untermischt. Ganz langsam sank die ‚Irene’ Zentimeter für Zentimeter. Die kleinen Wetten unter den Fischern über die Menge des Fangs gehörten zum täglichen Ritual.
Zur Herstellung von Fischmehl und Fischöl musste nicht sortiert werden. Allerdings wurde darauf geachtet, dass der Anteil an Beifang nicht zu groß war. Die Qualität des Fischmehls hing davon ab, dass möglichst viel guter Speisefisch verarbeitet werden konnte. Die Herstellung und der Vertrieb von Fischmehl und Fischöl war ein nicht unbedeutender Geschäftsbereich der Firma Halmstedt. Fast alles, was Urban und seine Männer in den letzten Jahren gefangen hatten, war so in die nordeuropäische Landwirtschaft gelangt. Die Bedeutung des Fischmehls als Viehfutter war groß und nahm zu. Ganz anders sah es bei der Nachfrage nach Fischöl aus. Petroleum und künstliche Stoffe ersetzten den Tran, und hatten bereits einen ganzen Industriezweig, den Walfang, zum Erliegen gebracht.
„Gleich werden Sie einen wichtigen Mann kennenlernen, David“, sagte Gustav.
Die vier Reisenden wurden von einem Beiboot an den Kai gebracht, das sofort zur ‚Irene’ zurückkehrte, nachdem die Männer an Land gegangen waren. Die beiden Seeleute, die mit ihren muskulösen, tätowierten Armen die flach wie eine Obstschale im Wasser liegende Barke wie im Schlaf bedienten, hatten die strikte Anweisung ihres Kapitäns befolgt. Hier warte die Arbeit, hatte dieser mit ernstem Gesicht betont. Die Autorität eines Kapitäns auf einem Schiff stand über der des Eigners. Doch der Skipper der ‚Irene’ hatte sich, als kluger Mann, der er war, zuvor herzlich von Gustav, seinem Arbeitgeber, verabschiedet.
Urban trat auf die kleine Gruppe zu, grüßte verhalten in die Runde, bedachte Gustav mit einem undurchsichtigen Nicken und sagte:
„Hab ich mir gedacht, dass du an Bord bist. Immer dann müssen wir auf sie, die ‚Irene’, warten. Wenn unser Fisch vergammelt ist, bezahlst du ihn nicht.“
„Schon immer zahle ich für euren vergammelten Fisch. Was könnte heute anders sein?“
Urban verzog keine Miene, und es war Godley nicht möglich, einzuschätzen, was die Worte Gustavs bewirkt hatten und was zwischen den Kontrahenten vorging. Der große Brockländer gefiel ihm eigentlich ganz gut, und da Gustav völlig entspannt blieb, stellte sich wohl vorläufig nicht die Frage, wie locker hier die Messer steckten. Doch sicher war er sich nicht. Im Notfall konnte er sich auf Russel und Benjamin verlassen. Und auch er selbst, David Godley, war alles andere als ein Feigling und Schwächling.
Gustav unterbrach die Stille, die Godley alarmiert hatte.
„Urban! Ich möchte dir ein paar neue Freunde Brocklands vorstellen!“
In der Reihenfolge, in der Gustav die Betreffenden beim Namen nannte, wies er mit leichter Handbewegung auf sie.
“Mister David Godley! Benjamin! Mister John Russel! Mister Godley ist mein Gast. Die beiden Gentlemen hier arbeiten für ihn.“
Urban hatte aufmerksam zugehört, und jedem Einzelnen, im Moment seiner Vorstellung, kurz ins Gesicht gesehen. Die Männer schienen in Ordnung! Er entschied, dass er für heute genug gearbeitet habe. Auf Dietz, den Sohn, und Pontus, dessen Freund, und auch auf die anderen, war Verlass. Er, Urban, musste jetzt andere Pflichten wahrnehmen.
„Herzlich willkommen auf Brockland!“ sagte er, und reichte jedem, mit Godley beginnend, mit Gustav endend, auf eine Weise die Hand, wie es nur Bürgermeister vermögen.
„Ich bin Urban Axon!“
Jedes weitere Wort hätte die Wirkung der Erklärung verwässert.
„Ich hoffe, Gustav Halmstedt hat Ihnen nicht zu viel Unsinn über uns und unsere Insel erzählt. Dass es ihm bei uns gefällt, ist das einzig Gute, was man über ihn sagen kann!“
Godley antwortete:
„Seien Sie überzeugt, Sir, Mister Halmstedt hat kein Wort zu viel gesagt.“
Während Pastor Finn am Bett der Mutter stand, die Hände auf die messingfarbene Querstange des Bettgestells gestützt, saß Una neben der alten Frau, dem Bruder den Rücken zuwendend, und streichelte ihr fürsorglich den mageren Arm. Die Mutter atmete ruhig und gleichmäßig durch den geöffneten Mund. Ihre Nase stach leicht gekrümmt hervor, ebenso wie die Wangenknochen unter der dünnen, wächsernen Haut. Die halb geöffneten Augen lagen wie zu klein geraten in tiefen Höhlen. Der Mund bewegte sich, als bereite er sich darauf vor, etwas mitzuteilen. Die Stirn war, wie unter der Last großer Sorge, in Falten gelegt.
„Geht es wieder?“, fragte Una und hörte nicht auf, den Arm der Greisin zu liebkosen.
„Was ist geschehen?“, fragte die Mutter benommen und erstaunt.
„Ich kann mich nicht erinnern! Mir ist so …!
Das Wort, das sie suchte, schien es nicht zu geben.
„Darf ich nicht noch ein wenig liegen bleiben?“
„So lange du willst“, sagte Finn, an den die Frage nicht gerichtet war.
„Danke! Ich danke vielmals! Ich werde die Arbeit bestimmt nachholen.“
„Welche Arbeit?“, fragte Una.
Kapriziös und plötzlich energisch, und indem sie ihrer Tochter ihren Arm entzog, stützte sich die Mutter auf ihre Ellenbogen und versuchte, sich aufzurichten.
„Und der Stall? Und das Vieh? Und wer sammelt die Eier ein? Und das Essen muss auf dem Tisch stehen, wenn mein Mann heim kommt. Ha! Mein Mann! Das ist kein guter … Mit anderen Weibern treibt er’s, dieser …“
Das Wort, das folgte, hatten Una und Finn nie zuvor aus dem Mund der Mutter vernommen, und nicht gewusst, dass sie solche Worte kannte.
„Mutter!“, entfuhr es Una erschrocken.
„Sechs Kinder hat er mir gemacht. Sechs Stück. Die fressen einem die Haare vom Kopf. Wo stecken die überhaupt? Herumtreiber, wie ihr Vater!“
Die Mutter legte sich wieder, erschöpft von der anstrengenden Rede. Sechs Kinder! Das stimmte. Doch die ältesten vier waren gestorben. Zwei davon im Kindbett.
„Wir sind doch hier, Mutter!“, sagte Finn.
Die Mutter sah ihn verdutzt an. Dann lachte sie plötzlich freudlos:
„Ihr? Ihr wollt meine Kinder sein? Pfui, Teufel! Eine arme Frau zu foppen! Ich werde es dem Pastor sagen.“
„Aber ich bin doch…“, sagte Finn und brach ab, als er sah, wie Una den Kopf schüttelte.
„Wir sind Finn und Una, Mutter!“, sagte Una.
„Pah!“, rief die Mutter, als hielte sie jetzt den Beweis in Händen, der Licht ins Dunkle bringen, und die Scharlatane, die sich über sie lustig machten, überführen würde.
„So klein sind die! So klein …“
Die zitterige Hand über dem Fußboden bezeichnete eine Höhe von weniger als einem Meter.
Kurz darauf wurde die Mutter still und sprach nicht mehr. Una, die ab und zu herein sah, fand sie meist ruhig schlafend und tief atmend in dem inzwischen abgedunkelten Zimmer. Doch dann war es ihr plötzlich, als träume die Mutter und spreche dabei im Schlaf. Die Worte waren unverständlich, nicht mehr als gehauchte Laute aus der Tiefe der Brust, und nur vage von sich bewegenden Lippen begleitet. Una trat näher. Schlief die Mutter am Ende gar nicht, und verlangte nach etwas? Hatte sie vielleicht Durst? Oder Hunger? Sie legte das Ohr an die Lippen, und jetzt… Ja. Jetzt war es sogar sehr deutlich zu verstehen.
„Feuer! Ein kleines Feuer …!“
„Wo brennt es, Mutter? Wo?“
„Ein kleines Feuer…“, wiederholte die Mutter.
Was war auf Träume zu geben? Alle Menschen träumten, und viele erinnerten sich nicht einmal am nächsten Morgen daran, was sie nachts heimgesucht hatte. Sie selbst träumte auch. Oft von Simon, der etwas anstellte, selten von Oscarson. Inzwischen! Träume waren Schäume! Sie rührten in der Vergangenheit und spiegelten die kleinen und großen Ängste. Sie waren …
Da sprach die Mutter wieder:
„Dann ein großes Feuer!“
Una verzichtete auf eine erneute Nachfrage, wandte sich um und trat leise auf die Tür zu. Da hörte sie:
„Die Delfine sind wieder da! Die Delfine… Sie sprechen mit mir! Zwischen den Feuern.“
Una stürzte zum Bett und rüttelte die Mutter unsanft, bis sie die Augen öffnete.
„Wer bin ich, Mutter?“, rief sie ein wenig zu laut.
Doch die Mutter schien sie nicht zu hören.
„Zwischen den Feuern … Etwas Böses!“
Wieder rüttelte Una die Mutter, und jetzt endlich: „Kind! Una! Was ist denn? Ich habe geträumt von …“
Matt schloss sie die Augen.
„Ich weiß es nicht mehr! Lass mich heute im Bett bleiben, ja?“
„Ja, Mutter! Ja!“
Es war Una nicht möglich, die Tränen zurückzuhalten.
Kapitel 2
„Adieu, mon Corporal, du dreckiger Scheißefresser!“
Der kleine, dunkelhaarige Südeuropäer sah den jungen hellhäutigen Soldaten, der ihn ansprach, hasserfüllt an. Auf Fahnenflucht gab es nur eine Antwort: Eine Kugel in den Kopf. Auch hier und jetzt noch! Daran würde sich nie etwas ändern. Doch er hatte seit Wochen keinen Offizier gesehen, allenfalls deren Rücken, wie sie auf ausgemergelten Kleppern vor ihnen hergeflohen waren. Auch glaubte er nicht daran, er sah es in den verrückten Augen des Soldaten, dass er den Griff an sein Gewehr überleben würde, selbst wenn es geladen wäre. Und so spuckte er dem Deserteur zur Antwort vor die Füße, drehte sich um und ging weiter.
Als einer der wenigen von vielen tausend Nichtfranzosen kehrte Jens Jakob Walter aus Russland zurück. Es war im Frühjahr 1813. Die ‚große Armee’ des kleinen Korsen hatte sich selbst geschlagen, wie sich große Armeen nur selbst schlagen können. Fast 700.000 Mann, die wenigsten von ihnen Franzosen, waren vor etwa einem Jahr, im Juli 1812 ausgezogen, um die Werte der Revolution ins Zarenreich zu tragen. Kurz vor dem Winter hatten sie das von den Russen verlassene, brennende Moskau geplündert, und sich auf den Rückweg nach Westen gemacht, denn es gab keinen Proviant, keine Winterkleidung, keinen Feind und keinen Sieg. Zu bleiben bedeutete den Tod aller, und so wählten sie die Katastrophe: Kosaken, Partisanen, die vereiste Steppe, dreißig Grad unter null. Was der Mensch erträgt und wozu er fähig ist, so oder so … Das Jahr 1813 legte Zeugnis davon ab.
Jetzt begann sich die Schlinge, um Frankreich und um Paris aus der Ferne zuzuziehen, und führte zum Rücktritt Napoleons und zu seiner Verbannung nach Elba im April 1814. Die Völkerschlacht von Leipzig kurz zuvor, gegen die nachrückende russische Armee und ihre Verbündeten, darunter Österreich und Preußen, hatte das Kriegsglück des Korsen nicht restaurieren können. Der Vollständigkeit halber … Der ‚Kaiser’ kehrte noch einmal für die Zeit von einhundert Tage zurück, wurde aber im Juni 1815 von den vom Herzog von Wellington geführten alliierten Armeen bei Waterloo vernichtend geschlagen. Er starb auf St. Helena, einer einsamen Insel im Südatlantik, als englischer Gefangener derjenigen, die er sein Leben lang als einzige Feinde betrachtet hatte.
Drei Monate lang trieb sich Jens Jakob Walter in Hamburg und in der Umgebung herum. Ein desertierter Landsknecht, keine zwanzig Jahre alt, und Söldner einer geschlagenen Armee, dessen ehemalige Kameraden gerade aus der Hansestadt vertrieben wurden. Die sogenannte Franzosenzeit ging zu Ende, die Kontinentalsperre wurde aufgehoben, und Wirtschaft und Handel blühten auf. Immer noch den blauen Rock am Leib, und den Säbel an der Seite, verzichtete Jens Jakob, der niemandem traute, auf die wahrheitsgemäße Wiedergabe seiner Vita, hurte, stahl, soff, raubte, und machte sich, mit all seinen Erfahrungen, die für ein Dutzend Leben genug gewesen wären, mit dem schlimmsten Abschaum der Stadt gemein. Wie leicht war es, zu töten! Wie einfach die Gewalt! Wie angenehm die Rohheit, die nichts verlangt, als mitzutun! Der Karriere als Krimineller, die im Kerker enden musste, eher noch am Galgen, war Tür und Tor weit geöffnet.
Eines Tages begann er nordwärts zu wandern und stand ein paar Tage später wieder auf dem Land, das er vor mehr als drei Jahren verlassen hatte. Fortgelaufen über Nacht ohne Erlaubnis und Abschied. Würde die Mutter noch leben?
Es war nicht schwer, nach der erteilten Auskunft das Grab zu finden, in das sie hinein gescharrt war. Mit den Fingern rechnete er die Zahlen nach, die jemand in das Holzkreuz, Bretter, die der Ofen verschmähte, hinein geschnitten hatte. Dreißig Jahre alt war die Mutter geworden und hatte Jens Jakob Walter mit zwölf Jahren auf die Welt gebracht. Das Schicksal einer unfreien Magd ohne Schutz und Rechte!
Mit höhnischen Worten begrüßte ihn der Gutsherr, der, das war kein Geheimnis, auch Jens Jakobs Erzeuger war. Selten habe er, meinte er, eine so abgerissene Vogelscheuche zu Gesicht bekommen. Ein Hundsfott sei er. Ein undankbarer Aufrührer, der nicht annehmen wolle, dass er, Jens, nun mal zum Knecht bestimmt sei. So wie seine Mutter zur Magd, diese Hexe, mit der man wenigstens ab und zu seinen Spaß hatte haben können. Jedoch sei ihr Arsch und auch ihre Titten zuletzt, na ja, er könne es sich ja wohl denken.
Jens Jakob spielte die untertänige Haltung wie ein Komödiant, was seinem Erzeuger nicht auffiel. Er sprach den Gutsherren mit ‚Herr Vater’ an, als stünde alles zum Besten zwischen ihnen. Doch dann plauderte er plötzlich beiläufig und ein wenig zerstreut über sein Erbe, das in Empfang zu nehmen er gekommen sei.
Der Gutsherr prustete nach einem Augenblick der Überraschung los. Er wies mit dem Zeigefinger anklagend auf seinen unverschämten Bastard, und appellierte händeringend an die Gerechtigkeit des Himmels. Spott, Häme und Herabsetzung prasselten wortreich auf den Ruhestörer und Eindringling, wie er Jens Jakob nannte, herab. Speichel floss ihm geifernd aus dem aufgerissenen Mund. Dann schlug er sich laut tönend auf die Knie und vollführte einen Veitstanz, bis ihm der Atem knapp wurde. Schließlich gelang es ihm, Ordnung in sein Temperament zu bringen.
„Du Hund! Du elendes Schwein! Du dreckiges Tier! Du Nachgeburt einer Sau!“
Jens Jakob bemerkte jetzt eine Bewegung in einer Ecke des Raumes. Dort stand ein großes Bett. Das Mädchen war nackt und zog sich angesichts der Schimpftiraden des fetten, im besten Mannesalter stehenden, kräftigen Gutsbesitzers die Decke über den Kopf. Seine Mutter und ihr Schicksal vor Augen kam es Jens Jakob nicht in den Sinn, es könne sich um eine einvernehmliche Situation handeln. Die Gegenwart des Mädchens, der Geruch von Schweiß und, wie er dachte, Wolllust und Gewalt, brachte ihn an einen gefährlichen Punkt der Erregung. Sein Plan, kühl und mit Bedacht vorgehen zu wollen, war jetzt aufs äußerste gefährdet. Es musste jetzt schnell gehen, um nicht die Kontrolle zu verlieren.
Mit einem einzigen, geschickten Säbelhieb schlitzte Jens Jakob das Nachthemd seines Erzeugers auf, und die Spitze der Waffe suchte unter dessen Bauch nach seinem Geschlechtsteil und begann damit vermeintlich ungeschickt zu spielen, sodass ein paar Blutstropfen auf die landadeligen Füße tropften:
„Wie beliebt es Ihnen, Herr Vater? Im Stück oder in Scheiben?“
Als er das dicke Bündel Banknoten in seiner Rocktasche spürte und es allmählich Zeit wurde, den Spaß zu beenden, verharrte er noch einen Moment:
„He! Du da!“ rief er zu dem Bett hinüber.
„Komm schon! Worauf wartest du?“
Adele und Jens Jakob waren nach Süden geflohen und in Hamburg untergetaucht. Eine Zeit lang lebten sie sparsam von dem ‚Erbe’ und achteten darauf, nicht aufzufallen oder einen verdächtigen Eindruck zu machen. In der nachnapoleonischen Zeit strömten aber Menschen aus allen Himmelsrichtungen in die befreite Stadt. Sie blieben unbehelligt und nachdem sie stillschweigend übereingekommen waren, zusammenzubleiben, nahmen sie ihr gemeinsames Leben in die Hand. Adele war vierzehn Jahre alt und erwies sich als klar denkend und zielstrebig. Sie habe sich, begann sie eines Tages, Gedanken über ihre Zukunft gemacht. Ihr Geld, meinte sie, werde nicht für immer reichen.
„So? In Schleswig kann ich mich aber nicht blicken lassen, um meinem Vater noch einen Besuch abzustatten.“
„Unsinn!“
Adele fand die Bemerkung nicht lustig. Sie hatte nicht vergessen, wie kaltblütig er seinem Vater das kleine Vermögen abgepresst, und die Macht über ihn genossen hatte; wie nah er der Gewalt war, dass sie manchmal fror, aber es sie auch erregte, wenn er sie berührte.
„Wir gründen ein Geschäft. Ein Fuhrgeschäft. Es ist noch genug Geld übrig für den Anfang. Vorher verwischen wir unsere Spuren.“
„Und wie machen wir das?“, wollte er wissen.
Adele schien auf die Frage gewartet zu haben.
„Du brauchst einen neuen Namen!“
Ein Fuhrgeschäft und ein neuer Name! Das klang gut, aber auch verwegen. Der Bedarf an Transportmitteln im Hafen und darüber hinaus war enorm. Das wusste jeder. Nur konnte man als steckbrieflich gesuchter Verbrecher keine Geschäfte machen, ohne sich zu verraten. Adele hatte erkannt, dass ein neuer Name die Voraussetzung für einen neuen Anfang war.
„Wie soll ich mich nennen?“, fragte er.
Den Mädchennamen ihrer Mutter kenne niemand. Wirklich niemand! schlug sie vor. Dann sagte sie:
„Diesen Namen wird auch mein Kind tragen. Nicht meinen und nicht deinen.“
„Kind? Wir kriegen ein …?“
Sie waren inzwischen so lange zusammen, dass nur er für die Vaterschaft infrage kam.
„Sollten wir dann nicht alle drei diesen neuen Namen tragen?“, überlegte Jens Jakob.
Sie hatten bisher nie über Gefühle gesprochen, und taten es auch jetzt nicht.
„Du meinst, wir heiraten!“, fragte sie.
„Ja! Warum nicht!“
„Das wäre eine noch bessere Tarnung!“
„Ja“, sagte er.
„Gut! Ich bin einverstanden!“ willigte sie ein.
Jens Jakob kratzte sich die Nase:
„Und wie heißen wir ab heute?“
Sie kam zu ihm herüber und setzte sich auf seinen Schoß. Sie war, fand er, leicht wie eine Feder. Jens Jakob hatte schönere Frauen in seinem Leben gesehen. Doch Adele hatte etwas, dass sich mit Worten nicht sagen ließ. Sie war deutlich und fest in ihrem Wesen, mutig und konsequent. Außerdem roch ihr Haar gut.
„Sag schon: Wie heißen wir drei ab heute?“
„Halmstedt!“, sagte Adele.
Mit seinen zwei jungen, kräftigen Zugpferden und dem Leiterwagen, anfangs ohne Spriegel und Plane, fuhr Jakob Halmstedt täglich früh morgens in den Hafen. Dutzende von Fuhrwerken wie seines fuhren hinein und heraus, voll mit Ladung. Doch für ihn schien es keine Arbeit, keine Fracht zu geben. Schon hatte er geglaubt, kaum jemand könne ihm über die Hansestadt, und wie die Dinge hier zusammen hingen, etwas erzählen. Jetzt wurde er eines Besseren belehrt.
Die Zuteilung von Frachten und der Zugang zu Lösch- und Ladeplätzen befanden sich in den Händen organisierter Kreise. Bestechungs- und Schutzgelder listeten sich als Einnahmen und Ausgaben in den imaginären Bilanzen. Das Fernhalten von „nicht zugehörigen“ wurde systematisch und mit rücksichtsloser Brutalität betrieben. Jakob, der zwar gelernt hatte, sich seiner Haut zu wehren, auf sich selbst gestellt jedoch ohne Chance war, irgendetwas zu verändern, mied schließlich den Hafen. Es widerstrebte ihm, einen Teil seines Gewinnes herzugeben für etwas, das nichts anderes als Erpressung war. Außerdem fahndeten die dänischen Behörden als Hoheitsmacht über das Herzogtum Schleswig immer noch nach einem gewissen Jens Jakob Walter. Er durfte nicht auffallen.
Die Lösung des Problems konnte, wie so oft, Adele zugeschrieben werden. Die hanseatischen Patrizier beschäftigten Generationen von Bediensteten. Eine Plebs mit eigenen Moralbegriffen und Strukturen, die der Konservativität ihrer Herren in nichts nachstand. Diese mehr oder weniger bescheidene Klientel, dieser vielfach unterschätzte Markt wurde zum Grundstein für den Aufstieg der Firma Halmstedt, und wie von Zauberhand öffneten sich jetzt auch die Tore in den Hafen zu vernünftigen Konditionen.
Das Kind wurde tot geboren und beide Eltern trauerten für sich und auf eigene Weise. Eines jedoch war ihnen gemeinsam: Über die Arbeit, den Aufbau der Firma, glaubten sie, den Verlust überwinden zu können. Eines Tages begannen sie mit Getreide und Futtermittel zu handeln. Als das funktionierte, machten sie sich klar, dass der Fuhrbetrieb für sie beide nur ein Anfang, ein Einstieg gewesen war. Jetzt musste es weitergehen. Die Firma trat an die Stelle des Kindes, dem sie beim Wachsen hatten zusehen wollen.
Im Lauf der folgenden Jahre wurden Pferde und Wagen abgeschafft, das Fuhrgeschäft gänzlich eingestellt, ein neues Haus bezogen, Kontor und Lagerhäuser angemietet und nach und nach Mitarbeiter eingestellt. Dienstboten im Haus zu beschäftigen, war eine Frage des Prestiges. Sie kosteten nicht viel, und Adele war die Seele des Betriebes, die die Hausarbeit anderen überließ.
Auch das zweite und das dritte Kind starben. Keines wurde älter als zwei Jahre. Die tiefe Kluft zwischen dem geschäftlichen Erfolg und dem damit verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg einerseits, und der Tragödie, drei tote Kinder in den Armen gehalten zu haben, andererseits, versuchten sie, durch die Suche nach Trost, im Glauben zu überwinden. Anfangs frömmlerisch, später vereinnahmt von Predigern und Propheten, denen sie Türen und Tore öffneten. So erlebten sie, dass sie in ihrer Not emotional und finanziell ausgenutzt wurden, auch wenn sie solche Gedanken nie an sich heranließen.
Als Adele im Jahr 1829 einen Sohn zur Welt brachte, der am Leben blieb, führten sie dieses Ereignis auf ihre Hinwendung zu Gott und ihren christlichen Lebenswandel zurück. Der Sohn erhielt den Namen Walter.
Adele zog sich jetzt aus der Leitung der Firma zurück. Sie wollte nur für ihren Sohn da sein, vertraute weder Ammen noch Kinderfrauen und glaubte, nur sie allein könne ermessen, was das ‚Geschenk Gottes’ brauche und was gut für es sei.
Nicht einmal sich selbst gestand Jakob ein, wie befreit er sich fühlte. Endlich konnte er zeigen, dass er mehr vom Geschäft verstand als auf dem Bock zu sitzen, Tagelöhner zu beaufsichtigen, und ihnen beizubringen, wie mit Kisten und Säcken umzugehen sei. Natürlich hatte Adele ‚ein Händchen’ gehabt, das gab er zu. Aber die Zeiten waren günstig gewesen und glückliche Umstände waren hinzugekommen. Er, Jakob, würde jetzt endlich beweisen können, dass er nicht die zweite Besetzung hinter seiner Frau war, all die jahrelang. Durch die Geburt des Sohnes waren die Dinge in die rechte, gottgewollte Ordnung gekommen. Auf lange Sicht hatten Frauen im Geschäftsleben nichts verloren.
Und wirklich machte Jakob seine Sache nicht schlecht. Seine Transaktionen und Planungen ließen Adeles Glanz zwar vermissen, waren aber durchdacht und in die Zukunft gerichtet. Er erreichte, dass sich ‚Halmstedt’ mehr und mehr als Handelshaus etablieren konnte, wagte überseeische Handelsbeziehungen, investierte in Schiffsbau und Werften und begann, sich für die Möglichkeiten des Ostseehandels zu interessieren. Zwischen 1830 und 1845 betrieb er diese Politik konsequent und ohne an deren Richtigkeit zu zweifeln. Dann jedoch, als sich all sein Trachten und Bemühen nicht in ‚schwarzen Zahlen’ widerspiegelte, der Profit stagnierte und die Zuwachsraten, unter denen der Zeit Adeles blieben, er sich also im direkten Vergleich mit ihr im Nachteil sah, fragte er sich, ob er wirklich alles ihm Mögliche zum Wohle seiner Familie und seiner Firma getan hatte.
Walter war das einzige Kind der Halmstedts geblieben. Er genoss eine gute, solide Schulbildung und trat mit vierzehn Jahren in die Firma ein. Er arbeitete in den Lagerhäusern, belud und entlud Fuhrwerke, schleppte, stapelte, stellte Lieferungen zusammen und vieles andere mehr, und erst nach Jahren des Buckelns, und dem Vergießen von ungezählten Litern Schweißes, erhielt er endlich seinen Platz, ein Stehpult im Kontor von Esbjerg, der im Jahre 1845 eröffnet worden war. Es war die erste Filiale der Firma Halmstedt überhaupt, und nicht mehr als eine Baracke im Hafen. Jakob hatte sich als stiller Teilhaber bei einer kleinen Werft eingekauft, um einen ersten Schritt in Richtung Schiffsbau zu tun, und um zu lernen. Das Kontor, anfangs Nebensache, entwickelte sich später gut. In diesen Jahren wurde Jakob auf eine merkwürdige Insel in der Nordsee aufmerksam, und er stieg vorsichtig in das Geschäft mit dem Fischmehl ein.
Wie bei einem Schwelbrand, den man erst zur Kenntnis nimmt, wenn es zu spät ist, nahmen die Dinge in Schleswig ihren Lauf.
Für Jakob war es keine Frage, dass Krieg die Geschäfte störte. Angebot und Nachfrage regelten den Preis. Im Krieg jedoch änderte sich die Nachfrage. Neue und andere Bedürfnisse entstanden. Jakob gab seinen Gedanken freien Lauf. Neue Bedürfnisse? Andere Bedürfnisse? Was braucht man im Krieg, was man im Frieden nicht braucht? Niemand konnte die Frage besser beantworten als er, Jakob. Waffen! lautete die Antwort. Er dachte an seinen alten Säbel, den er immer noch verwahrte und scharf hielt. Nein! Wenn schon, dann Gewehre, Pistolen, Pulver und Blei. Er überlegte weiter. England! Dorthin etwas zu verkaufen, war wegen der hohen Zölle, die den Gewinn auffraßen, sinnlos. Aber kaufen konnte man dort viel. Nein! Alles, wenn der Preis stimmte. Und dann fragte er sich: Was würde Adele an seiner Stelle tun? Doch er wusste es nicht. Was würde Walter tun? Er war zu jung und zu unerfahren, entschied Jakob. Und was war mit Gott? Ja, Gott war so eine Sache. Die Firma? Die Familie? Musste man nicht alles, alles tun um …? Dann traf er eine Entscheidung. Nein! Halmstedt würde keine Waffen anbieten. Niemandem! Unter keinen Umständen.
Das Interesse der dänischen Könige, dem dänischen Staatsgebiet Schleswig fest einzuverleiben, war ungebrochen, und erhielt nach und nach, und stärker werdend, neue Impulse und Schärfe. Schleswig und Holstein waren Herzogtümer, deren politische und gesellschaftliche Verbindung zu Dänemark niemand bestritt. Auch wenn Schleswig nicht, im Gegensatz zu Holstein, Mitglied im Deutschen Bund war, bestanden von keiner Seite her berechtigte, territoriale Ansprüche auf die Herzogtümer. Zudem galt, als fest auf die schleswigschen und holsteinischen Fahnen geschrieben, dass eine Teilung niemals infrage komme.
Frederik VII., der Nachfolger Christian VIII. auf dem dänischen Thron nach dessen Tod Anfang 1848, bewies höchste Entschlusskraft, als er, nach einer entsprechenden Verlautbarung, dänische Truppen in Schleswig einmarschieren ließ. Der dänische Norden jubelte, der deutsche Süden begehrte auf, Holstein fühlte sich bedroht. Es kam zu Aufständen, Barrikadenkämpfen und schließlich zum Bürgerkrieg, der auf den Schultern konträrer Nationalismen getragen wurde, und ohne den Geist der Revolution, den Rufen nach Freiheit und Gleichheit, nicht denkbar gewesen wäre.
Deutschland, revolutionäre wie restaurative Kräfte, empörte sich über das dänische Vorgehen. Das Spektrum der Forderungen, wie sollte es anders sein, reichte von politischen Interventionen bis hin zur militärischen Expedition. Und dann zeigte sich, wie virtuos Preußen am politischen Dirigentenpult des Deutschen Bundes stand. Schleswig – nicht ehemaliger Teil des alten Kaiserreichs – wurde jetzt im April 1848 Mitglied im Deutschen Bund. Der Herzog von Augustenburg, der die ‚Aufständischen’ unterstützte, und sich deutsch und liberal gab, leistete den entscheidenden Hilferuf, auf den Berlin gewartet hatte. Jetzt konnten preußische Truppen in Schleswig einmarschieren und eroberten schließlich Jütland.
Das Ausland, vor allem England und Russland, traten nun auf den Plan und verhinderten, dass Preußen ganz Dänemark eroberte, und zwangen die Kontrahenten zum Waffenstillstand vom August 1848. Die anschließenden Verhandlungen werden überschattet von deutschnationaler Enttäuschung und dänischer Sturheit. Wissen die einen nicht, warum sie überhaupt verhandeln sollen, beharren die anderen, obwohl militärisch besiegt, auf ihren Forderungen. So kämpfte man weiter bis Juli 1849.
Danach folgen ein neuer Waffenstillstand und endlich der Friede von Berlin vom Juli 1850. Hiernach erhielt Dänemark Schleswig und setzte sich damit durch. Holstein wird von Dänemark gelöst und bleibt von preußischen Truppen ‚besetzt’.
Innerhalb Schleswigs kämpfte man jedoch weiter bis 1851. Noch heute gedenkt man des dänischen Sieges bei Idstein vom Juli 1850.
Nach dem Vertrag von Olmütz räumte Preußen auf internationalen Druck hin Holstein. In deutschen Kreisen sprach man von Verrat und Preisgabe. Dänemark besetzte jetzt auch Holstein, und die Annalen erwähnen Strafgerichte.
Der vorläufig letzte Akt: das Londoner Protokoll.
Die Verhandlungen ab 1852 bestätigten Schleswig und Holstein unter der Krone Dänemarks. Allerdings zu verbesserten Bedingungen in administrativen Bereichen, was mehr Rechte und mehr Eigenständigkeit bedeutete. Gleichzeitig wurde die Glücksburger Linie des Hauses Oldenburg zur dänischen Thronfolge bestimmt, und die Konkurrenz, die Augustenburger, entschädigt.
Der schleswigsche Bürgerkrieg brachte Gruppen, nördliche wie südliche, hervor, die teils gegeneinander kämpften, teils wie Partisanen vorgingen und teils vor Übergriffen auf zivile Einrichtungen und Personen nicht zurückschreckten. Je radikaler und fanatischer diese Gruppen waren, desto weniger Unterstützung fanden sie bei denen, für deren Sache sie zu kämpfen glaubten. Die Gruppen griffen häufig auf intellektuelle und bürgerliche Kreise zurück, deren Unterstützung durch Wort und Geld für sie lebenswichtig war. Die öffentliche Meinung, die Universitäten, die Kirchen, die Wirtschaft und andere Bereiche des Lebens waren und wurden involviert, bis über die Grenzen Schleswigs und Holsteins hinaus.
Kapitel 3
Enid hatte schon als junges Mädchen die Angewohnheit gehabt, ein paar Minuten des Tages für sich zu reservieren. Der Vorwurf, sie träume, traf sie zwar, änderte aber nichts. Diese Augenblicke waren kostbar: Ein Hören in sich selbst hinein, wie das Blut rauscht, und wie der Atem die Lungen füllt. Ohne zu wissen, wie es funktionierte, konnte sie Wärme in ihre Hände und Arme, ja, sogar in ihre Beine und Füße leiten. Nicht einfach nur so, sondern genau, wohin und wann sie es wollte. Ein Zaubertrick, den ihr niemand beigebracht hatte. Besser man sprach nicht darüber, um die Gabe, das Geschenk, nicht zu verlieren.
Sie bemerkte nicht, dass sie beobachtet wurde, entledigte sich ihrer Kleider bis zur Hüfte und betrachtete sich kurz im Spiegel. Abgesehen von ein paar kleinen Fältchen, fand sie, war noch alles in Ordnung. Das Wasser in der Schüssel war lauwarm und der weiche Schwamm schmeichelte ihrer Haut und ließ sie prickeln. Im Haus war es still. Von draußen, aus dem Garten mit den hohen Obstbäumen, drang frische Frühlingsluft in das Zimmer und blähte leicht die dünne Gardine. Sie trocknete sich ab, zog sich an und bürstete sich schnell mit wenigen energischen Strichen das rötlichblonde, lockige Haar, das sie, seitdem sie in Hamburg gewesen war, deutlich kürzer trug als in ihrer Kindheit.
Enid war Mitte dreißig und hatte während ihrer zehnjährigen Ehe mit Urban Axon drei Kinder geboren und vier großgezogen. Die beiden älteren Kinder aus Urbans erster Ehe waren von Anfang an wie jüngere Geschwister gewesen. Ein Glücksfall! Dietz, der ältere, ernst und höflich, die rechte Hand seines Vaters; Fay, zwei Jahre jünger als dieser, eine Freundin, der nichts zu viel zu werden schien, die im Gegenzug aber Aufmerksamkeit verlangte, wenn sie selbst Hilfe brauchte. Beide waren verheiratet und hatten bereits selbst Kinder. Dietz bewohnte mit seiner Familie einen abgetrennten Bereich des Axonschen Anwesens; Fay lebte im Norden Brocklands bei der Familie ihres Mannes.
Ja! Und dann war da noch Bo. Das Herz war ihr übergelaufen, als der kleine Kerl auf wackligen, speckigen Beinchen auf sie zugelaufen kam, sie einen Moment prüfend angesehen, und sich dann auf ihren Schoß gesetzt und sich an sie geschmiegt hatte. Prüfung mit Auszeichnung bestanden! erinnerte sich Enid. Jetzt konnte geheiratet werden. Jedermann sah es Urban nach, dass er nur ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau wieder heiratete. Auch die alten Axons, Urbans Eltern, die damals noch lebten und es ihr anfangs nicht leicht gemacht hatten. Aber letztlich … Nein! Kein böser Gedanke!