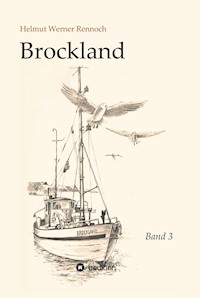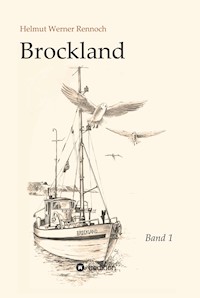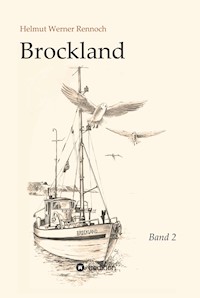
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Brockland
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt in drei Bänden die Geschichte der deutsch-dänischen Kaufmannsfamilie Halmstedt, von ihren Beziehungen zu Brockland, einer Insel in der Nordsee, und ihren Bewohnern. Dargestellt werden der Krieg von 1914-1918, Aufstieg und Niedergang eines Imperiums, die Revolution, ein zerbrechlicher Frieden, bevor sich die Katastrophe des Krieges während des Nationalsozialismus fortsetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über den Autor
Helmut Werner Rennoch wurde ziemlich genau 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges – wie das Ereignis in den Geschichtsbüchern genannt wird – am 02. Mai 1955 in Damme im südlichen Oldenburg, einer katholischen Enklave im südlichen Niedersachsen als Kind evangelischer Eltern geboren, deren Wurzeln und Erfahrungen zurückreichen in die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Vertreibung, Flucht, Neubeginn und schließlich Ankommen in einer Gesellschaft, die, zunächst fremd, dann Heimat, zu einer der vielen Paten dieses Buches wurde.
Helmut Werner Rennoch begann jenseits der vierzig, nach Ende seiner beruflichen Laufbahn, zu schreiben.
BROCKLANDBAND 2
Helmut Werner Rennoch
© 2021 Helmut Werner Rennoch
Verlag & Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-22761-3
Hardcover
978-3-347-22762-0
e-Book
978-3-347-22763-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Meinen Eltern
Vorwort des Autors
Wenn ein geplagter Schulmeister oder eine gepeinigte Schulmeisterin feststellt, dass einer seiner oder ihrer Schüler das neue Geschichtsbuch bereits während der ersten Tage von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen hat, fühlt er oder sie sich geschmeichelt. Dem Schüler entstehen dadurch postwendend Vorteile, die nicht hoch genug einzuschätzen sind.
Ich war ein solcher Schüler und genoss sowohl die Sympathie meiner Lehrer, wie den Wissensvorsprung vor meinen Mitschülern. In Wahrheit ging es mir jedoch nur darum, spannende und anregende Geschichten zu lesen, wobei es mir an entsprechender Lektüre keineswegs mangelte.
Besonders angetan hatten es mir die alten Germanen: Die Männer wilde Kerle mit Keulen und schartigen Schwertern, die ihre Heimat mit Todesverachtung gegen die eindringenden Römer verteidigten, die Frauen sanfte Wesen mit langem, braunem Haar, deren anmutige Körper in selbstgefertigten Wollkleidern steckten, ihrem Manne eine treue Begleiterin. So stand es da! So zeigten es die Illustrationen! Und wer war ich, dass ich am Gedruckten zweifeln durfte?
Heute ist so gut wie alles, was seinerzeit Kindern über unsere Vorfahren in die Geschichtsbücher geschrieben wurde, widerlegt. Wir stammen nicht von einem einheitlichen Volk ab, das sich mit einem Indianerstamm aus den Büchern eines Karl May verwechseln ließe. Doch so wenig es die Indianer des sächsischen, so fantasiebegabten, Autors gegeben hat, so prosaisch ist die Vergangenheit, unsere Geschichte. Aber warum erzähle ich das?
Die Insel Brockland, meine Insel Brockland, ist Fiktion. Es gibt sie nicht, und gab sie nie. Sie ist Erfindung, Legende, Lüge! Man kann in der südöstlichen Nordsee herumkreuzen wie und so lange man will. Man wird nichts finden! Brockland entspricht nicht der Wahrheit. Die Insel ist nicht Realität! Aber ist das wirklich so?
Was ist Realität, was Fiktion? Was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass SMS, WhatsApp und E-Mails beim Empfänger ankommen. Aber wie? Warum verschafft uns diese Unwissenheit kein mulmiges Gefühl? Wir spüren die Allmacht des Internets. Aber was ist das überhaupt, von Kabeln und Drähten abgesehen? Wir alle schalten täglich Lampen und Geräte an und wieder aus. Aber hat jemals ein Mensch den elektrischen Strom gesehen? Wie, wenn man nicht daran zu glauben vermag, dass Gott die Menschen schuf, erklärt sich das Lächeln eines Kindes? Aus Kosmos und Ursuppe? Welchen Wert besitzt unser Wissen, wenn es von unserer Bereitschaft und vom Alltag geforderter Umstände abhängig ist, zu glauben?
Nein! Brockland existiert nicht nur, samt allen Menschen und Geschichten. Die Fiktion ist die Sprache der Erklärung und des Beispiels. Niemand würde ein biblisches Gleichnis als Lüge bezeichnen, und längst akzeptieren wir zerfliessende Uhren als Mittel des Ausdrucks.
Wenn es darüber hinaus stimmt, dass Geschichte immer die Geschichte des Siegers ist, und vieles spricht dafür, dann müssen wir skeptisch sein und uns Erklärungen schaffen. Vielleicht gibt es in einzelnen Fällen auch mehr als nur eine einzige Wahrheit. Vielleicht gibt es neben Wahrheiten, die sich messen lassen, solche, die nur fühlbar sind. Vielleicht fehlt uns in unseren Sprachen ein Wort für all die Räume, Ebenen und Dimensionen der Wahrheit. Mein Vorschlag; Brockland!
Danksagung
Ich habe all denen zu danken, die mir durch Kritik und Zuspruch halfen, weiterzumachen. Über die lange Zeit, die die Arbeit in Anspruch nahm, waren es derer nicht wenige. Ungenannt heißt nicht vergessen.
Mein besonderer Dank gebührt Eva-Maria Braun, die mit großer Klarheit und Geduld das Manuskript durchsah und es dahin führte, wo es sich heute befindet.
Ferner danke ich Alenca Herlet, die sich um die Gestaltung kümmerte. Und nicht zuletzt bin ich Herrn Ernst J. Herlet etwas schuldig, der die wunderbaren Illustrationen beisteuerte.
Dezember 2020
ERSTER TEIL:
MENSCHENJAGD
Kapitel 1
Zehn Tage und Nächte wartete Ada ab ohne zu klagen, oder ein Wort der Sorge zu äußern. In der kurzen Zeit, die sie mit Dietz verheiratet war, hatte sie ihm drei Kinder geboren, eines nach dem anderen mit bedenklich kurzen Zwischenräumen. Auch darüber hatte sie sich nicht beklagt. Sie war jung und gesund und würde sich schon erholen, dachte sie. Lesen und schreiben hatte sie nicht gelernt, doch sie wusste, wann ihr Geburtstag war. Im Herbst würde sie neunzehn Jahre alt werden, ein Tag, den sie vielleicht als Witwe erlebte.
Ihre Ehe mit dem Sohn des reichsten Fischers auf der Insel war ein Glücksfall für die junge Tagelöhnerin. Er, Dietz, war auf die schönen Augen, die sie ihm gemacht hatte, hereingefallen, und da sie nach dem ersten stürmischen sexuellen Aufeinanderprallen mit blauen Flecken übersät war, fiel es ihr nicht schwer ihm zurückhaltend zu suggerieren, er habe sie vergewaltigt. Natürlich ohne einen Vorwurf anklingen zu lassen. Ihre Rechnung ging auf, und schon bald hielt Dietz um ihre Hand an. Kurz darauf wurde Ada zum ersten Mal schwanger. Beide Eheleute hielten es für unnötig, über Gefühle zu sprechen.
Die Tatsache, dass auch Pontus und sein jüngerer Bruder Thies seit zehn Tagen verschwunden waren, sprach für sich. Sie waren tot. Alle drei. Wer konnte daran zweifeln?
Ada setzte sich nieder auf einen Stuhl und weinte ein paar ehrliche Tränen. Dann nahm sie ihre Kinder und ging zu den Axons hinüber, ihren Schwiegereltern. Wortlos drückte sie sich an Enid vorbei, die ihr entgegengekommen war, und die sie eigentlich nur deshalb mochte, weil sie meist mild nach Seife roch. Enid nahm Ada’s ältestes Kind, das sich an ihr Bein klammerte, auf den Arm, und alle fünf betraten sie zusammen die Küche.
Am Tisch saßen Urban, Koba, Bo und Ayslynn, deren Gegenwart Ada missbilligte, war sie doch eine Außenstehende. Sie setzte sich zu den anderen an den Tisch, nachdem sie sich ihrer Kinder in die Obhut Enids ältester Tochter entledigt hatte. Jetzt saßen sie zu sechst um den Tisch herum verteilt, schwiegen und warteten darauf, dass Urban begann.
„Ada!“, sagte Urban schließlich. „Ada!“
Aus der blassen Iris seines linken Auges nässte es. Er machte keinen Hehl aus seiner Niedergeschlagenheit, doch vielleicht trug gerade das dazu bei, dass keiner der anwesenden daran zweifelte, dass er den Kampf gegen das Schicksal als nicht entschieden ansah, und sich nicht unterkriegen lassen würde. Unbewusst half er damit den anderen, mit ihrer Trauer umzugehen.
„Dietz kommt nicht mehr.“
Sie senkte den Kopf zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, und um anzudeuten, dass sie sich seiner Güte und Gnade unterwarf. Urban fuhr fort:
„So wie Pontus und Thies nicht zurückkehren werden.“
Alle sahen zu Koba hinüber, als sie leise zu schluchzen begann. Ayslynn wollte sich ihr tröstend zuwenden, doch ein Blick Bos warnte sie.
„Wir sind jetzt eine Familie!“, erklärte Urban.
„Wir werden als solche handeln. Niemand soll Not leiden!“
Die Worte waren in ihrer Form nicht vorgeschrieben, konnten aber erwartet werden. Ada atmete, ohne dass es jemand bemerkte, erleichtert auf, während Koba Urbans ernste, ja feierliche Bemerkung ohne Regung aufnahm. Von jetzt an waren beide junge Frauen leiblichen Töchtern des Fischers gleichgestellt.
Der halb leere Krug, das fehlende Boot, die Seeschlacht vor der Küste Dänemarks, von der jeder Brockländer eigene Details zu kennen glaubte, und seine eigene Geschichte erzählte … Urban, der seinen Sohn und die anderen beiden kannte, musste nur eins und eins zusammenzählen. Trotzdem hatte er bis zu dem Moment Zuversicht verbreitet, bis das nicht mehr möglich war. Er hatte bei seinem eigenen Fleisch und Blut nicht anders gehandelt, als er es bei irgendjemand sonst getan hätte. Nur Enid hatte gespürt, wie schwer ihm das gefallen war. Endlich hatte Urban eingeräumt, dass man nun nicht mehr warten würde. Es war die Stunde der Umkehr gewesen, und es war genug Zeit vergangen. Erleichterung verbreitete sich.
Die Leichtigkeit der ersten Zeit stellte sich nicht mehr ein. Doch irgendwann sah man Bo und Ayslynn wieder Hand in Hand herumspazieren und leidenschaftlich über irgendetwas sprechen. Ayslynns Angst, Bo könne ihr ihren Fehltritt mit Haller nicht ganz und gar verzeihen, bestätigte sich scheinbar von Zeit zu Zeit. Ihre Versuche, ihm noch mehr zu gefallen als früher, schlugen ins Gegenteil um, und sie ließ es schließlich sein, und bemühte sich stattdessen um ein Verhältnis ohne Koketterien. Erst als die Trauer über den Tod des Bruders und der Freunde sein Herz ausfüllte, trat seine schwach aber stets glimmende Eifersucht spürbar zurück. Manchmal, wenn jetzt Urban seine Gesellschaft suchte, um mit ihm, dem jetzt ältesten Sohn zusammenzusitzen, befiel ihn ein warmes Gefühl des Stolzes. Es war, als wären sie jetzt mehr als Vater und Sohn. Dies stärkte sein Selbstwertgefühl ein wenig bis er glaubte, auch Ayslynn in einem anderen Licht sehen zu können.
„Koba!“
Urban wandte sich an die jüngere seiner neuen Töchter.
„Du wirst ab sofort hier bei uns wohnen. Du und …“
Er unterbrach sich. Ihre Schwangerschaft war irgendwie inoffiziell, und er wollte das Thema nicht offiziell machen, indem er es ansprach. Doch es entging ihm nicht, wie Ada neugierig aufsah.
„Für dich, Ada!“ fuhr er fort.
„Ändert sich nichts. Für dich und deine Kinder wird gesorgt sein, bis du dich entscheidest, dich neu zu verheiraten. Wenn du in das Haus deines neuen Ehemannes ziehst, werde ich für die Mitgift sorgen. Du bist jung und hast dein Leben noch vor dir.“
Jetzt machte er eine kleine Pause und sagte dann:
„Was ich hier verspreche, geht bei meinem Tod auf meinen Sohn Bo über.“
Bo senkte den Kopf, denn niemand sollte sehen, wie sein Gesicht ´glühend und rot wurde. Unter dem Tisch suchte Ayslynns Hand die seine. Er zögerte nicht, sie zu nehmen.
Der Tod ihrer Brüder traf Koba wie ein Keulenschlag. Sie war jetzt Vollwaise, dachte sie, und in ihrem Bauch wuchs etwas heran, auf das sie sich nicht mehr wie anfangs freuen konnte. Wozu ein Kind in eine solch ungerechte und grausame Welt hineingebären? Alle ihre Gefühle verkehrten sich, und fast hätte sie sogar ihren Hass auf Una Oskarson vergessen, die sie ohne Erklärung einfach vor die Tür gesetzt hatte. Doch eines Tages, schon sehr bald, musste die Wahrheit ans Licht treten, und dann würde man vor ihr den Kopf neigen. Niemals wieder würde sie sich herumstoßen lassen.
Koba hatte den Vater ihres Kindes nicht mehr getroffen, geschweige denn mit ihm geschlafen. Hatte er das Interesse an ihr verloren? Hatte er eine andere gefunden? Wie egal das plötzlich war! Pontus und Thies waren auf See geblieben. Was kümmerten sie andere Menschen? Dabei ängstigte sie sich nicht um das nötige zum Leben. Sie, Koba, würde für sich selbst sorgen, und das Kind in ihrem Bauch war der Schlüssel dazu. Ihre neue Familie? Die Axons taten doch nur, was die alten Bräuche verlangten. Es ging um ihr eigenes Ansehen. Sie taten das nicht für sie. Enid ging ihr mit ihrer mütterlichen Art auf die Nerven, und Bo glaubte, seit er mit Ayslynn zusammen war, etwas Besonderes zu sein. Zugegeben, Thies war nicht der hellste gewesen. Ein Hans Dampf in allen Gassen, für den es kein Morgen gegeben hatte. Aber du, Pontus, warst der beste Mann, den Brockland gesehen hat. Ja, das warst du! Wie ich euch vermisse, euch beide! dachte sie jetzt gefasst und bedacht darauf, dass ihr niemand ins Herz hinein sah.
Als Ada in ihr Haus zurückgekehrt war, dachte sie erleichtert daran, dass sie jetzt mindestens ein Jahr lang nicht das Bett mit einem Mann teilen, und vielleicht zwei Jahre lang kein Kind gebären musste.
In einem der letzten Briefe, den Alrun von Brockland an Simon schrieb, und wie seine Vorgänger nicht abschickte, notierte sie, dies sei der zweitglücklichste Tag ihres Lebens. Denn endlich habe sie die Erlaubnis bekommen, in die Vereinigten Staaten reisen zu dürfen, um dort zur Schule gehen zu können. Wie selbstverständlich ließ sie offen, was an dem glücklichsten Tag ihres Lebens geschehen würde.
Stolz schrieb sie, dass sie alle Koffer selbst gepackt habe, ohne die Hilfe einer anderen Person, die der Mutter, der Schwester oder die einer Bediensteten in Anspruch zu nehmen. Simon sollte wissen, dass sie jetzt endgültig eine Frau geworden war. Dann brach sie das Wort, das sie Koba gegeben hatte, und berichtete dem fernen Geliebten, der noch immer nichts von der Gunst ahnte, die ihm entgegengebracht wurde, von der ungewollten Schwangerschaft der Freundin und deren Liebe zu jenem Mann. Bitte, flehte Alrun. Bitte, bitte, Simon! Du darfst niemandem etwas davon erzählen!
In Groß-Britannien prügelte die öffentliche Meinung wegen der Schlacht vor der jütländischen Küste auf ihre Marine ein. Ein mögliches Remis zählte nichts für die Briten. Alles andere als die vollständige Vernichtung der deutschen Hochseeflotte galt als Versagen. Von Schmach und nationaler Schande war die Rede, nach Konsequenzen wurde gerufen, Köpfe sollten rollen, und, wie könnte es anders sein, die politische Opposition sah sich in ihrer Haltung bestätigt, wie diese auch aussehen mochte.
Auch die Deutschen sahen keinen Grund zum Feiern über den Ausgang der Skagerrak-Schlacht. Unter dem wankenden Schutzdach des sogenannten Burgfriedens und der Hand, die der Kaiser als sei nichts gewesen über seine Marine hielt, blieb die deutsche Admiralität weitgehend vor öffentlicher Kritik verschont. Doch sie machten sich nichts mehr vor. So wie sie es vor Jütland versucht hatten, würden sie die Briten nicht in die Knie zwingen. Auch wenn beim Gegner nicht alles rund gelaufen war, dank ihrer Abgebrühtheit hatten sie der technisch besser ausgerüsteten aber kleineren deutschen Kriegsmarine eine Lektion erteilt, wenn auch unter großen Verlusten. Doch was zählte das, wenn sie immer noch in der Lage waren, die Abriegelung der deutschen Häfen aufrechtzuerhalten? Und war es realistisch, auf eine zweite Chance zu hoffen, bei der man alles richtig machen konnte …?
In diesen Tagen befasste sich die deutsche Außenpolitik mit einer anderen Frage, in deren Mittelpunkt die Vereinigten Staaten von Amerika standen. Dort laufe die Mobilmachung inzwischen auf Hochtouren, und es sei nur eine Frage der Zeit, bis die USA in den Krieg eintreten würden, meldeten die Berichte.
Niemand im Deutschen Reich, der einen Waffenrock trug, und von wirtschaftlichen Zusammenhängen nichts verstand, oder diese eben darum hochmütig ignorierte, betrachtete Amerika als ernsthaften militärischen Gegner. Im abgelaufenen Jahrhundert hatten die Amerikaner wiederholt erfolgreich gegen Mexiko Kriege geführt. Dabei war es um Kalifornien und Texas gegangen, sowie um die Frage der regionalen Vorherrschaft. Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 war jedoch das bedeutendste militärische Ereignis gewesen, vor mehr als fünfzig Jahren. Danach hatte die amerikanische Kavallerie bei der Erschließung des Westens Ureinwohner gejagt. Nein! Sie besaßen keinerlei soldatische Tradition, die sich mit der der Preußen vergleichen ließe, lautete die Einschätzung. Man hielt die Amerikaner für Geschäftemacher, Bankiers, Farmer und Cowboys. Ein Mischvolk, Nachfahren von Einwanderern, die es in der alten Welt zu nichts gebracht hatten, und sich jetzt mit Juden … Negern und ähnlichen Elementen auf eine Stufe stellten.
Weit verbreitet in Deutschland war die Meinung, dass Amerika niemals tatsächlich neutral gewesen war. Waffen-, Munitions- und Ausrüstungslieferungen an die Entente galten als gesicherte Erkenntnis. Amerikanische Politiker verurteilten öffentlich die deutsche Kriegführung, insbesondere die Verletzung der belgischen Neutralität, etwas, worauf man im Deutschen Reich nicht stolz war, doch was als unausweichlich galt, da Deutschland ein Krieg an zwei Fronten aufgezwungen worden war. Außerdem unterstützten die USA Briten und Franzosen finanziell, und an der Börse in New York wurden Kriegsanleihen der Entente gehandelt.
Dennoch, denn auch andere Stimmen hatten sich Gehör zu verschaffen gewusst, reichte die deutsche Diplomatie den Amerikanern die Hand über den Atlantik hinweg zu einem separaten Frieden. Zum Zeichen des guten Willens werde man den U-Bootkrieg im Atlantik bis auf Weiteres aussetzen. Daran hielten sich die Deutschen fortan und ließen ihr Angebot in aller Herren Länder verkünden, ein kluger Schachzug, der es nicht nur fertigbrachte, dass Alrun endlich ihre Koffer packen konnte, sondern der die Amerikaner zwang, sich mit dem deutschen Angebot auseinanderzusetzen.
Ebenso gespalten in ihrer Meinung über den anderen waren die Amerikaner. Unter ihnen befanden sich viele deutschstämmige, und solche Menschen, die offen ihre Sympathie für Deutschland bekundeten, wenn auch nicht für das Krieg führende Deutschland und den preußischen Militarismus. Die deutsche Kultur in all ihren Ausprägungen hatte viele Freunde in der ganzen Welt und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. So vergingen die Monate, während derer die deutschen Hoffnungen schwanden, und die Amerikaner ihre Mobilmachung fortsetzten, ohne einem Staat der Mittelmächte den Krieg zu erklären.
Gustav erhielt die Nachricht vom dänischen Engagement für Brockland in Amsterdam. Unverzüglich ließ er alle Mitarbeiter zusammenrufen, und verkündete die gute Nachricht. Stöße von Papier wurden gegen die Decke geworfen und lauthals feierte man das Ereignis als Sieg des Trusts. Da an Arbeit an diesem Tag nicht mehr zu denken war, organisierte sich wie von selbst eine Party, und der Champagner floss schon bald in Strömen. Auch Gustav trank ein paar Gläser, rauchte eine Zigarre und schüttelte Hände von Journalisten, Vertretern anderer Organisationen und Leuten, die der Wind hereingeweht zu haben schien. Nicht alle teilten die optimistische Freude, die sich in den Büroräumen des Trusts breitzumachen begann. Doch Gustav hatte sich längst daran gewöhnt, dass Politik keine Funktion der eigenen Überzeugung war, sondern von Interessen bestimmt wurde. Damit war es ihm auch gelungen, über die vergleichsweise wenigen mürrischen oder besorgten Gesichter derer hinwegzusehen, die – wenigstens bis hier her – dem Trust nahe gestanden hatten.
Als die Feier ihrem Höhepunkt entgegen schritt, stahl sich Gustav fort, und setzte sich an seinen Schreibtisch. Hier war es angenehm ruhig, auch wenn manchmal Lachen oder Musik von unten zu ihm herauf drang. Er dachte einen Moment lang an Una und fragte sich, ob sie nicht längst geheiratet hätten, wenn nicht Krieg wäre. Unas Entscheidung, auf Brockland zu bleiben, hatte er akzeptieren müssen. Doch er sorgte sich um sie. Was war nur mit diesem verdammten Kerl, Finn, Unas Bruder, dem Pastor, los? Und Iliana? Wenn Ehen dahin gerieten, wo sich die der Schwester befand, war es besser, niemals zu heiraten. Oswin, dieser gottverdammte Pirat, der sicher seit Kriegsbeginn kein ehrenwertes Geschäft mehr abgewickelt hatte, trieb sich überall auf der Welt herum und zog an zweifelhaften Fäden. Auf Brockland war er nur selten anzutreffen.
Dafür war Frederik in Sicherheit auf Brockland, auch wenn er sich auf der Insel noch eingewöhnen musste. Doch der Krieg konnte nicht ewig dauern. Danach musste man abwarten und sehen, wie und wann eine Rückkehr nach Deutschland möglich war.
Gustav machte sich über die Post auf seinem Schreibtisch her und arbeitete zielstrebig und mit klarem Kopf. Dann fiel ihm der Brief Conradsons in die Hand. Rücktritt von allen Ämtern! Sagte er leise, und verspürte einen körperlichen Schmerz. Was hast du erwartet? fragte die innere Stimme. Ja was! Der Brief bedeutete nicht nur, dass sich fortan ihre Wege trennten. Er bedeutete Gegnerschaft, vielleicht Feindschaft. Gebe es Gott, dachte Gustav, dass es nur in der Sache ist, und nichts Persönliches daraus entsteht. Gebe es Gott, dass wir beide, jetzt jeder für sich, das richtige Ziel verfolgen.
Der nächste Brief war unterschrieben mit ‚die Freunde Belgiens’ und enthielt nicht mehr und nicht weniger als eine Morddrohung gegen ihn …
In Ilianas Tagebuch entstand eine Lücke. Wie sollte sie die Ereignisse jenes Abends beschreiben? Es war, als weigerte sich ihre Feder, das weiße Blatt zu berühren. Dabei schien auf den ersten Blick alles so einfach und klar.
Finn, der ihr in den letzten Wochen fast ein Freund geworden war, hatte plötzlich ihren Bruder Frederik angegriffen und niederträchtig beleidigt. Ein unmögliches Betragen! Dabei spielte es natürlich überhaupt keine Rolle, ob Finn in der Sache recht oder Unrecht gehabt hatte. Sie wusste über die deutschen Sozialisten, um die es gegangen war, und deren politische Absichten nur das, was man als fleißige Zeitungsleserin, die sie als eine Halmstedt war, wusste. Wenn aber Frederik, der doch wahrhaftig ein Christ war, diese Menschen nicht verurteilte, dann würde sie, dabei folgte sie ihrem Instinkt, das auch nicht tun. Der Pastor mochte denken, was er wollte.
Doch auf der anderen Seite waren Finn und sie sich in den letzten Wochen geistig sehr nahe gekommen. Trotz seiner konservativen politischen und gesellschaftlichen Haltung schien er sich für ihre Meinung zu interessieren. Oft wich diese von der seinen ab, was ihn aber überhaupt nicht zu stören schien. Das gefiel Iliana gut. Sie genoss es, wenn sie beide ihre Argumente wie Florettsäbel führten, und fühlte sich frei und tollkühn und wie eine Frau, deren unverrückbarer Platz nicht Heim und Herd war. Ja, vor allem wenn es bei diesen Waffengängen um die Rolle der Frau in dieser, wie sie zu sagen pflegte, Männerwelt ging, focht sie unermüdlich. Finn schmunzelte über die Metaphern, die ihr mühelos einfielen. Die Frau als Hüterin des Feuers, das der Mann angezündet hatte, und so weiter. Die sexuelle Komponente des Themas umschiffte sie jedoch. Es wäre unschicklich gewesen. Unumwunden stellte sie ihm allerdings dann und wann Fragen wie, warum die Politik ausschließlich eine Domäne der Männer sei. Hielten sich diese etwa für klüger als Frauen?
Finn antwortete dann stets in der Weise, er könne sich im Prinzip Frauen als Subjekte der Politik durchaus vorstellen. Es müsse ja nicht so weit gehen, dass diesen das Wahlrecht eingeräumt werde. Einhergehend damit, dass sie Aussagen wie diese zunehmend als unbefriedigend empfand, entwickelte sich aus der anfangs vielleicht spielerischen und theoretischen Haltung ein ernsthaftes Anliegen und ein innerer Drang, nicht nur darüber zu sprechen, sondern etwas tun zu wollen. Zwar würde keine Himmelsmacht aus einer Halmstedt eine Sozialistin machen, aber … dachte Iliana, während sie über der noch immer leeren Seite ihres Tagebuches brütete, wenn nur diese Leute, die Sozialisten, die Gleichstellung der Frau betonten, dann musste man sich eben mit ihren Ansichten und Argumenten befassen. Aber wo anfangen? Sie nahm sich vor, sich in den nächsten Tagen bei Frederik über Rosa Luxemburg zu erkundigen. Diese Frau begann sie zu interessieren. Und dann gab es da noch jemand. Wie war doch noch gleich der Name? Jetzt fiel es ihr wieder ein: Clara Zetkin.
Erst als ihre Empörung über Finns Verhalten langsam und allmählich verrauchte, konnte Iliana ein wenig Mitgefühl zulassen. Es muss sich um irgendeine Krankheit handeln, die den Pastor, den Freund, befallen hat, konstatierte sie endlich. Im Neuen Testament, natürlich auch anderswo, war die Rede von Dämonen, die man austreiben müsse, und von plötzlichen Anfällen, die durch irgendetwas ausgelöst werden, wie ein Schock, eine Erregung oder ein sich plötzlich lösender innerer Stau. Natürlich waren die betroffenen an solchen Vorgängen vollkommen unschuldig. Was könnte Finns Anfall an diesem Abend ausgelöst haben, fragte sie sich. Und dann nahmen ihre Gedanken rasante Fahrt in eine unvermutete und abenteuerliche Richtung auf.
Der Gedanke, er könne sich in sie verliebt haben, schmeichelte ihr. Zum ersten Mal sah sie in ihm jetzt den Mann. Er war zwar nicht sehr groß, ließ aber unter der Schale des Geistlichen eine körperliche Männlichkeit ahnen, die sie an irgendjemand erinnerte. An wen nur? Sie mochte die Melancholie in seinen dunklen Augen, und die sanfte aber bestimmte Art, mit der er sprach. Sie schätzte seine Reinlichkeit und Gepflegtheit. Niemals war er ihr mit Stoppeln im Gesicht unter die Augen gekommen. Sie mochte die Art, wie er sie ansah, und erschrak gleichzeitig über diese Feststellung. Dabei wusste sie nicht, ob Begehren oder Bewunderung in seinen Blicken lag. Sie wusste nur, dass es viel zu lange her war, dass jemand sie so angesehen hatte.
Nach ungewöhnlich kurzer Abwesenheit war Oswin von irgendwoher zurückgekehrt. Iliana kannte ihren Mann gut und vermutete, dass die Dinge nicht so gelaufen waren, wie er es sich vorgestellt hatte. Doch sie hatte nach einem unausgesprochenen Kontrakt kein Recht ihn darauf anzusprechen, und, sie gestand es sich selbst ein, es interessierte sie auch nicht. Er schloss sich in seine Räume ein und erschien unregelmäßig zu den Mahlzeiten, und schien sich große Mühe zu geben, nicht durch gesteigerte Wortkargheit aufzufallen. Was er sagte, war jedoch meist belanglos und klang abgestanden, und Iliana tat es ihm gleich.
Ayslynn hatte sich Gottlob wieder mit Bo vertragen, nachdem sie sich gestritten hatten. Worüber wusste Iliana nicht, und Ayslynn konnte schweigen. Es tat ihr gut, Bo wieder regelmäßig zu sehen. Was für ein feiner, sensibler und kluger Junge er doch war. Nur der Sohn eines Fischers? Nein, nein! Es steckte viel mehr in ihm. Sie war sich nicht ganz sicher, glaubte aber, dass Oswin ähnlich dachte. Der Schwiegersohn und Nachfolger in der Firma! Sie würde keine Kinder mehr bekommen. Sie war zweiundvierzig Jahre alt, und …schlief seit Jahren allein!
Alrun war jetzt endlich zufrieden und auch wieder umgänglich. Aber Iliana sorgte sich vom Tag der Zustimmung zu ihrer Reise an um die Tochter mit milder mütterlicher Hysterie. Doch sie und Oswin wollten ihr Wort nicht brechen. Wenn sie, Alrun, einmal drüben war, musste sie ebenso lange dort bleiben, in Sicherheit, bis der Krieg vorüber war. Auch Oswin dachte so. Sie stellten sich nicht die Frage, ob dem deutschen Versprechen, auf den Einsatz ihrer U-Boote zu verzichten, zu trauen war. Sie trauten niemandem, der Krieg führte. Aber der konnte ja nicht ewig dauern …
In der Nacht, nachdem ihr Urban alles über den geheimnisvollen, verschwundenen Jungen und dessen Identität erzählt hatte, lag Enid noch lange neben ihrem zufrieden schnarchenden Mann wach. Oswin Broderson! Dachte sie immer wieder. Oswin Broderson!
Später dann, als der Tod der drei jungen Männer die letzten Reste der Erinnerung an den doppelten Leichenfund überschattete, schien sie auf Brockland die letzte, der die seltsame Geschichte noch im Kopf herumging, ohne das dadurch ihre Trauer über den Verlust, den ihre Familie erlitten hatte, geschmälert wurde. Immer wieder erinnerte sie sich dann auch wieder an die große Liebe, die sie einst in Hamburg als junges Mädchen erlebt hatte, und die jetzt doch allmählich zu verblassen und zurückzutreten begann, wie die flüchtige Zuneigung zu Hans Reimar längst verblasst und erloschen war. Und dann schien alles klar vor ihr zu liegen. Doch nein! Etwas wusste sie noch immer nicht. Wer war die männliche Leiche, der, aller Wahrscheinlichkeit nach, von Oswin getötete Mann? Es musste jemand gewesen sein, der im Haus der Frau, der anderen Leiche und Mutter Oswins, ein und ausgegangen war. Aber wie sollte sie auf den Namen dieser Person kommen?
Doch dann war sie eines Tages bereit für den Gedanken. Mein Gott! dachte sie. Er hat seinen Vater getötet …
Die Bilder gingen um die Welt. Der alte Kommandant des Forts, dass die Deutschen nach langer Belagerung gerade eingenommen hatten, war im Begriff, seinen Säbel zu zerbrechen und damit dem vor ihm stehenden Kronprinzen die Kapitulation zu erklären. Wilhelm hinderte ihn jedoch daran, und reichte dem kleinen, grauhaarigen Mann die Waffe zurück, streckte ihm die Hand entgegen und senkte respektvoll den Kopf zu einer angedeuteten Verbeugung. Der Beifall der anwesenden französischen Offiziere über die ritterliche Geste erschien dem Kronprinzen ein wenig unangenehm.
Von Knobelsdorff schob die Zeitung, die er mit der Feldpost erhalten hatte, angewidert zur Seite, und starrte auf das Telefon auf seinem Schreibtisch. Mit diesem Wunder der Technik konnte man binnen Minuten mit Berlin telefonieren oder von dort angerufen werden. Stets war er auf dem neuesten Stand der Dinge und hätte sich dies etwas kosten lassen. Doch der Mann, der mit ihm in Verbindung getreten war, sich Mars nannte, und sich durch ein Wissen um Namen und Zusammenhänge legitimiert hatte, die mehr als überzeugten, sorgte für alles. Diesen Mars, auch wenn von Knobelsdorf ihm bisher nicht persönlich begegnet war, umgab nicht nur eine Aura der Gewalt, sondern eine, die den verführerischen Geruch schier unerschöpflicher finanzieller Mittel repräsentierte.
Durch das Fenster sah von Knobelsdorf draußen in der klaren Nacht vereinzelt Sterne funkeln, und goß sein Glas noch einmal nach. Der Cognac, den irgendwer irgendwo erbeutet hatte war besser als das Zeug, dass man ihm schickte. Sein Plan, nein, seine Bestimmung, Chef der Obersten Heeresleitung zu werden, nach der Ablösung Falkenhayns, war abhängig vom Ausgang vor Verdun. Er wusste, dass nicht allein der Sieg zählte, sondern wie dieser zustande kam und welche nachhaltigen Folgen dieser haben würde. Dabei gab es keinen Zweifel darüber, wie diese Folgen auszusehen hatten. Die Kapitulation der französischen Armee und das Ende des Krieges im Westen. Dazu musste dieser Coup auf ihn, Generalmajor Konstantin Schmidt von Knobelsdorff, zurückgeführt werden können, und sei es so inoffiziell, wie die Rolle, die er hier an dieser Front in Frankreich spielte. Soweit der Plan! Doch die Dinge standen schlecht. Die Maschine, die er täglich als kommandierender General bediente, verschlang enorme Mengen von Munition, Material und Soldaten, ohne dem Ziel, sei es die Eroberung der Festung Verdun oder die Vernichtung der Franzosen, näherzukommen. Aber noch trug Falkenhayn die Verantwortung für das Schlamassel. Gott sei Dank! Doch sollte sich das Blatt wenden, es musste … musste! Dann hatte er zur richtigen Stunde am richtigen Ort zu sein. Wieder füllte von Knobelsdorf sein Glas und schob die Zeitung mit den widerwärtigen Fotos noch ein Stück weiter von sich fort. Da klingelte das Telefon. Endlich!
„Ja! Hier …“
Er reagierte sofort, und lauschte der jungen Stimme.
„Danke, Leutnant Ich habe verstanden. Gute Nacht!“
Es war nur eine Routinesache gewesen.
Als Frederik den Raum, den Ingelis als Atelier benutzte betrat, das weiche Licht wahrnahm und den Geruch der Farben und Terpentine einatmete, war ihm, als beträte er eine andere Welt. Diese Welt war neu und fremd, aber auch erregend, und er war froh darüber, dass er ihrem Drängen, sie zu besuchen, nachgegeben hatte.
„Nun? Wie finden Sie es?“ fragte Ingelis auf eine Weise, die nur eine einzige Art von Antwort erlaubte.
„Hübsch!“, sagte Frederik und wusste, dass die Antwort sie ärgerte, wenn auch nur ein klein wenig, und sie diesen Ärger nicht offenbaren würde.
Ingelis betrachtete den Rücken des großen, schlanken Mannes und verspürte das Bedürfnis, ihren Kopf an seine Schulter zu legen.
„Stört es Sie, dass ich keinen Büstenhalter trage?“
Er wandte sich ihr zu.
„Ach! Tun Sie das nicht?“
Sie lächelte.
„Wie wäre es mit einem Schluck Wein?“
Frederik sagte:
„Ein Kommilitone von mir malte ebenfalls. Natürlich ganz anders und in seiner Freizeit.“
„Warum setzen wir uns nicht nach draußen auf die Veranda? Ich habe auch Kaffee!“
„Wirklich? Kaffee?“
Seine Rückfrage kam so schnell und fast ein wenig gierig, dass Ingelis innerlich triumphierend, äußerlich aber regungslos seinen ersten schwachen Punkt feststellte und nie wieder vergessen wollte.
Als der Abend kam, saßen sie immer noch da und sprachen über Dinge, die ein heimlicher Zuhörer als belanglos abgetan hätte. Doch ihnen kam es vor, als hätten sie jemanden gefunden, der ihre Sprache sprach. Schließlich, es war dunkel geworden, tranken sie doch noch Wein, boten sich das ‚du’ an, und begannen, Freunde zu werden.
Finn mied das Haus der Brodersons auf der Halbinsel intuitiv. Er vermisste Iliana und die Gespräche mit ihr. Sie war eine wunderbare, kultivierte Frau, die er von ganzem Herzen verehrte und deren Freundschaft, so zart diese gedieh, ihm wichtig war. Ihr Mann Oswin, den er seit vielen Jahren kannte, war ein Glückspilz. Dazu hatten die beiden zwei hübsche und gesunde Töchter, eine Idylle, in die einzudringen er niemals wagen durfte. Und doch! Die Frau, die er vielleicht eines Tages selbst heiraten würde, müsste sich an Iliana Broderson messen lassen.
Allerdings war jetzt alles anders geworden. Was war nur an jenem Abend, auf den er sich gefreut hatte, geschehen? Alle hatten ihn plötzlich so merkwürdig angesehen, vor allem Iliana, als habe er ihnen etwas angetan. Die Feier zur Begrüßung des einstigen Bischofs Frederik Halmstedt auf Brockland, den er persönlich schätzte und mochte, dessen politischer Weg jedoch Anlass zur Kritik gab, hatte anschließend zwar kein jähes Ende gefunden, doch aber ein verkürztes, und in dieser Weise nicht vorgesehenes. Er selbst, Finn, war danach von Una und Gustav wie ein Betrunkener nach Hause gebracht worden. Was war nur geschehen? Danach die Erschöpfung, die ihn tagelang nicht hatte loslassen wollen, und die jede Bewegung und jeden Gedanken zur Qual werden ließ.
Una hatte Gustav ein paar Tage später allein reisen lassen. Das hatte sich Finn zwar insgeheim gewünscht, wenn er ehrlich war. Doch sie sollte es nicht für ihn tun, und schon gar nicht ihrem eigenen Glück entgegen.
Die Verwirrung der Sinne, die ihn abschätzenden und ihn verfolgenden Augen, das kalte Gefühl, beobachtetes Objekt zu sein, isoliert und ausgestoßen, der Abgrund, der die Freunde und ihn auseinander gerissen zu haben schien … Nein! Finn brachte es nicht fertig, auf jemand zuzugehen, als habe er nicht das Recht dazu. Selbst Una, die Schwester, glaubte er nicht behelligen zu dürfen. Vielleicht später, sagte er sich. Vielleicht später!
Jeder Schritt, der ihn von Iliana entfernte, indem er an ihrem Haus vorüber nach Norden gehend sich der Steilküste näherte, schien seiner Niedergeschlagenheit Raum zum Wachsen zu geben. Was war nur mit ihm los? O du gütiger Gott! Was ist mit mir? Wenn es eine Prüfung ist, die du mir auferlegst, betete er, dann gib mir auch die Kraft, sie zu bestehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe!
Auf dem Stein saß ein Mann. Er war unrasiert und das Haar hing ihm strähnig in die Stirn. Seine nur mäßig saubere Kleidung, ein zu großes Hemd und eine von Hosenträgern gehaltene Hose, dazu ein Paar alte Stiefel, bestand zum Teil aus Resten einer deutschen Felduniform. Er hatte den Pastor noch nicht bemerkt, denn seine Aufmerksamkeit galt der Flasche, die er in der Hand hielt, und aus der er von Zeit zu Zeit einen Schluck nahm.
Finn grüßte mechanisch und in sich gekehrt im Vorübergehen, und dann fiel ihm ein, dass auch er selbst vor Kurzem erst am helllichten Tag Schnaps getrunken hatte. Doch wieso? Und dann war da plötzlich das Bild eines jungen, blonden Mannes in ihm, der ihm frech ins Gesicht lachte, und der …
Finn blieb stehen, legte kurz und leidvoll die Hände aufs Gesicht, als müsse er sein Antlitz verbergen, und spürte nur noch Schmerz und ein nie gekanntes Gefühl des Abscheus vor sich selbst. Doch dann, als sei dies das einzige, was er in diesem Augenblick tun konnte, trat er auf den auf dem Stein sitzenden Mann zu.
Wie um sich zu schützen, griff der Mann hastig nach seiner Krücke, die bisher achtlos hingeworfen auf dem Boden gelegen hatte. Überrascht hob Finn die Hände und sagte auf Hochdeutsch, denn der Mann vor ihm war kein Brockländer:
„Langsam, langsam! Ich tue Ihnen doch nichts.“
Hans Reimar war nicht überzeugt. Im Norden tuschelte man hinter vorgehaltener Hand, der Pastor sei verrückt geworden, und gewalttätig obendrein. Vielleicht war ja etwas daran. Vielleicht fühlte der Pastor sich zum Racheengel Gottes berufen, der mit Feuer und Schwert der Sünde und dem Sünder auf den Pelz zu rücken habe. Er, Hans Reimar, war jedenfalls an diesem frühen Nachmittag schon wieder ziemlich betrunken. Das ließ sich nicht leugnen.
„Ich bin nicht betrunken!“, stammelte Hans, wobei er darauf achtete, dass seine Stimme nicht ängstlich klang.
Trotz seiner Not musste Finn jetzt schmunzeln und Hans ließ darauf die Krücke sinken.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen? Nur einen Moment lang!“
Hans rückte ein Stück beiseite, obwohl das nicht nötig gewesen wäre, denn der Stein war groß genug für sie beide.
„Es ist heiß!“, sagte Finn und betrachtete Hans vorsichtig aus den Augenwinkeln, um nicht unhöflich zu erscheinen.
„Waren Sie im Krieg?“
„Ostpreußen!“, sagte Hans, und schlug sich auf sein immer noch taubes, den Dienst noch immer verweigerndes Bein.
„Wird wohl nichts mehr damit!“
„Gottes Wille ist …“
Hans unterbrach den Pastor scharf, aber immer noch freundlich:
„Wenn Sie mit dem lieben Gott anfangen, Pastor, stehe ich auf und gehe meiner Wege!“
Finn senkte den Kopf, nicht demütig, sondern um nachzudenken. Der Mann war nicht so betrunken, nicht nach der Art zu sprechen, wie es zunächst ausgesehen hatte. Jedenfalls waren seine Worte klarer als seine Augen, in denen ein paar kleine Adern geplatzt zu sein schienen, und die blutunterlaufen Tränenflüssigkeit produzierten. Wie ein dünner Film lag der ausgeschwitzte Schnaps auf seinem Gesicht, und unter seinen Achseln hatten sich große, auswuchernde Schweißflecken gebildet.
Finn sagte:
„Tannenberg war ein großartiger Sieg, nicht wahr?“
„Pah!“, stieß Hans hervor, und lachte trocken und freudlos.
„Ich habe es mir anders überlegt, Pastor. Lieber höre ich mir Ihre Predigt an, als über Ostpreußen zu sprechen.“
Doch dann, als habe er Mitleid mit seinem Gegenüber, fügte er hinzu:
„Überhaupt glaube ich kaum, dass je ein deutscher Soldat in diesem Krieg in der Nähe Tannenbergs war.“
„Aber …“, machte Finn, und verstummte nachdenklich. Hatte Hindenburg die Russen denn nicht bei Tannenberg geschlagen? Dann sagte er:
„Mein Neffe Simon dient in der U-Bootflotte.“
Hans sah interessiert auf:
„Das sind tollkühne Burschen. Mich kriegten da keine zehn Pferde rein.“
Der Wahrheit entsprechend sagte Finn jetzt:
„Auch ich habe schon einmal darüber nachgedacht, mich freiwillig zu melden.“
„Als Brockländer? Wo man Sie nicht zwingen kann?“
„Na ja!“, sagte Finn nur, wie er seine Verehrung für den Kaiser und seine Liebe zu Deutschland selten auf der Zunge trug.
„Ich habe ja darauf verzichtet. Vielleicht war ich zu feige. Oder nicht mutig genug.“
Hans spürte ein wenig Übelkeit aufsteigen. Von Begriffen wie Mut und Feigheit, Ehre und Tapferkeit wurde ihm immer noch schlecht.
„Mein Name ist Hans Reimar!“, sagte er jetzt.
„Ich bin Schriftsteller.“
„Worüber schreiben Sie?“, wollte Finn wissen.
„Über den Krieg und das Leben danach.“
Finn erkannte die Lüge sofort. Doch nein! Es war ja keine Lüge. Dieser Mann war sein eigenes lebendiges Manuskript. Vielleicht würde er die Worte eines Tages aufs Papier schreiben.
‚Für mich sind Sie ein Held’, lag es Finn auf der Zunge zu sagen. Doch er sah die Schnapsflasche, roch den Schweiß des anderen und schwieg zunächst. Dann:
„Reimar? Dann haben wir eine gemeinsame kleine Freundin.“
„So? Wirklich?“
„Aber sicher! Koba. Sie arbeitet doch für uns beide.“
„Koba! Ja, ein famoses Geschöpf. Kümmert sich perfekt um alles. Kann ich mir eigentlich gar nicht leisten? Eine Freundin bezahlt sie … “
Aus irgendeinem Grund stellte Hans dieser Bemerkung sein trockenes Lachen nach.
„Auch eine Form des Patriotismus!“, stellte Finn fest. Doch Hans antwortete ihm, wie er einem Schwachsinnigen geantwortet hätte:
„Ganz sicher nicht!“
„Ich verstehe!“, sagte Finn traurig. Dann erhob er
sich.
„Ich glaube, es wird Zeit für mich.“
Hans sagte:
„Wenn Sie mal wieder vorbeikommen … Ich wohne dahinten in der armseligsten Hütte auf dieser Insel. Würde mich freuen, Pastor.“
„Ich komme bestimmt!“, sagte Finn.
Urban, fand Oswin, war nicht mehr der alte. Erst recht nicht mehr nach dem Tod seines Sohnes Dietz und der beiden anderen jungen Männer, Pontus und Thies, die ihm wie Söhne nahe gestanden hatten. Er würde es nicht zugeben, aber seit Langem tat er alles, um Nestor Oberland, seinen Schwiegersohn, zu unterstützen, auch wenn er dabei auf eigenen Profit verzichten musste. Von Urbans Leuten, stolze Fischer, jetzt Blockadebrecher, hatte sich, soviel Oswin wusste, noch niemand beschwert. Aber sie hatten ja auch noch nie so gute Geschäfte gemacht.
Blut ist dicker als Wasser! Das hatte schon der alte Halmstedt, Oswins vergötterter Ziehvater und Vater seiner Ehefrau Iliana gesagt. Dieser hatte auch stets vor Maßlosigkeit gewarnt, und damit recht gehabt. Ach was! Oswin gönnte Nestor seinen Erfolg, der sich ohne Zweifel die dickste Scheibe am Handel mit Deutschland abgeschnitten hatte. Er selbst, Oswin Broderson konnte sich auch nicht beklagen. Die Herstellung und der Vertrieb von Konserven hatten sich während des Krieges, trotz Einfuhrverbot in England und britischer Seeblockade deutlich gesteigert. Der Unterschied zu Nestor bestand nur darin, dass Oswin seine Erfolge im Stillen feierte, und keine neuen Mühlen und Herrensitze bauen ließ.
Ganz Brockland war inzwischen bepflanzte Agrarfläche. Weizen, Roggen und Gerste für den Schmuggel nach Deutschland, und es war nicht leicht gewesen, zwischen den Feldern neue Parzellen zu organisieren, wo Bohnen, Erdbeeren, süßer Mais und anderes angebaut werden konnte. Doch für Oswin Broderson gab es das Wort ‚nicht möglich’ nicht. Fisch in Dosen dagegen war immer noch ein Renner. Dieses Geschäft erledigte sich fast wie von selbst. Sein Handelsraum erstreckte sich inzwischen von der britischen Ostküste, über Holland, Belgien, nach Island und ganz Skandinavien, und sogar bis tief in die Ostsee hinein. Die Fabrik und seine Schiffe waren ausgelastet, die Möglichkeit, neue Arbeitskräfte auf Brockland zu rekrutieren, erschöpft. Die ‚Iliana’, das Flaggschiff seiner Flotte wartete allerdings immer noch im Dock auf den Frieden. Sie wäre ein zu leichtes Opfer kriegerischer Handlungen geworden. Nur seine Töchter Ayslynn und Alrun liebte Oswin mehr als dieses Schiff.
In diese heile Welt hinein, denn es störte ihn nicht, dass er von den Briten per Steckbrief gesucht wurde, ein Akt der Provokation, war auf Brockland das Grab gefunden worden. Er hatte kein Wort dazu gesagt, sondern sich zurückgezogen, um sich in der Stille zu erinnern und seine Gedanken zu ordnen. Nach all den Jahren, dachte er. Nach all den vielen Jahren!
Was wäre, wenn er sich vor sie hinstellte und sagte, so ist es damals gewesen. Ich bin der, den ihr sucht. Ich würde es wieder tun, denn ich wollte von diesem Mann nicht mehr geschlagen werden. Ich wollte nicht mehr zusehen müssen, wie er meine Mutter schlägt, und auch nicht damit aufhörte, als sie nur noch kurze Zeit zu leben hatte. Dieser Mann war kein Mensch. Ein Mensch weiß doch, was er tut. Diese Kreatur wusste es nicht. Ich musste ihn aufhalten, egal wie. Ich bedaure nur, dass es am Ende doch zu spät war.
Nein! Ich werde mich nicht vor die Brockländer hinstellen. Ich schulde ihnen nichts. Sie würden mir nicht glauben. Jedem anderen vielleicht, doch nicht mir. Denn was hat sich in all den vielen Jahren geändert? Nicht viel! Ich bin immer noch Oswin Broderson, der Außenseiter, der Fremde, der, der nicht dazu gehört. Nein! Sie würden mich mit Freuden verurteilen. Mit dem Finger würden sie auf mich zeigen und rufen: Da steht Oswin Broderson, der seinen Vater getötet hat. Und sie würden nicht zögern, den ersten Stein zu werfen.
Dass Finn seit Monaten in seinem Haus ein und ausging und Iliana, seine Frau, besuchte, störte Oswin nicht. Er mochte den Pastor und fand, dass er besser zu Iliana passte, als er selbst, der, sobald er Brockland den Rücken gekehrt hatte, sich Frauen nahm, und nicht selten mehreren Geliebten gleichzeitig an verschiedenen Orten der Welt luxuriöse Leben ermöglichte. Blieben diese Verbindungen nicht ohne Folgen, so entzog sich Oswin seiner Verantwortung nicht, und sorgte großzügig, aber diskret für Mutter und Kind. Die Scheidung von Iliana, an die er zuweilen dachte, wäre vielleicht das Beste und ehrlichste gewesen. Doch Oswin fürchtete, die Liebe seiner Töchter zu verlieren, etwas, das ohne Vergleich war, ohne die er sich das Leben nicht denken konnte.
Als Oswin von Finns Anfällen erfuhr, früher als die meisten anderen, erschrak er zutiefst und sorgte sich um seine Familie. Heimlich beauftragte er einen seiner Arbeiter, den Pastor nicht aus den Augen zu lassen, sobald dieser das Broderson’sche Anwesen betrat. Doch seit dem Geschwistertreffen, bei dem es auch zu einem Zwischenfall gekommen war, Einzelheiten waren Oswin nicht zugetragen worden, hatte sich Finn nicht mehr blicken lassen, eine Nachricht, die Oswin mit Erleichterung aufnahm.
Kapitel 2
Obwohl die Schlacht um Verdun für die Deutschen, trotz der Eroberung der Forts Douaumont und Vaux, alles andere als Erfolg versprechend verlief, gab ihr Oberbefehlshaber, Erich von Falkenhayn, am 15. Juni 1916 den Befehl zum Abzug von vier Divisionen. Was war geschehen? Der Eintritt Italiens in den Krieg auf der Seite der Entente und seine Kriegserklärung an Österreich-Ungarn vor rund einem Jahr, begann sich nun auf der europäischen Kriegslandkarte bemerkbar zu machen und auszuzahlen. Conrad von Hötzendorf, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der k.u.k.-Monarchie, glaubte nun, der Bedrohung aus dem Süden den Vorrang vor den Zielen und Verpflichtungen im Osten geben zu müssen. Der Schneekrieg in den Alpen und die Front am Isonzo hatten bisher keinerlei Entscheidung gebracht. Das sollte sich nun durch eine Offensive gegen Italien ändern. Im Übrigen war von Hötzendorf unzufrieden mit den Deutschen. In den Alpen hatten sie nicht die Hilfe geleistet, die er sich von ihnen erhofft hatte. Stattdessen führten sie eine aufwendige Schlacht um eine Stadt in Lothringen. Wie dem auch war! Er, von Hötzendorf, hatte zunächst an Österreich zu denken, war er überzeugt.
Für seinen mit dem deutschen Bündnispartner nicht abgestimmten Feldzug gegen Italien zog Österreich von der galizischen Front eine stattliche Anzahl k.u.k.-Regimente ab. Geplant war ein schneller Krieg mit einem eindeutigen Sieg, um den Rücken freizubekommen für die Auseinandersetzung mit dem gefährlicheren Feind im Osten, den Russen.
Diese trauten Ohren und Augen nicht. So leicht würde man es ihnen so schnell nicht wieder machen. Es war wie eine Einladung ins Kaffeehaus. Gleichzeitig war dies die Gelegenheit für Russland, seinen Beitrag zu dem Abkommen zu leisten, dass für das Jahr 1916 in der nordfranzösischen Stadt Chantilly zwischen den Staaten der Entente beschlossen worden war.
Am 4. Juni brach die Front auf einer Länge von 75 Kilometern ein, und die Russen eroberten einen Streifen, der eine Tiefe von bis zu zwanzig Kilometern aufwies. Dabei nahmen sie rund zweihunderttausend Gefangene. Eine Katastrophe für die gemeinsame Ostfront der Mittelmächte. Bis Ende September dauerte der russische Vorstoß an und ging in die Geschichte ein unter der Bezeichnung Brussilow-Offensive, benannt nach dem verantwortlichen russischen General Alexej Alexejewitsch Brussilow.
Falkenhayn beschwor Hötzendorf, seine Politik zu ändern und die entsprechenden Frontabschnitte zu verstärken. Vergeblich! Seine Armee bleibe in Italien, ließ Hötzendorf wissen. Auch durch das Angebot einer deutschen Verstärkung aus dem Norden ließ er sich nicht erweichen, seine Entscheidung wenigstens teilweise zurückzunehmen.
Jetzt musste sich Falkenhayn entscheiden. Soldaten von Ober-Ost abzuziehen, auch wenn dies den Österreichern angeboten worden war, hieße, Russland zu unterschätzen, und das war deshalb nur in begrenztem Umfang möglich. Hindenburg und Ludendorf hatten ihre Sache dort gut gemacht. Zu gut! Sie waren die Helden der Nation geworden. Es war schlechterdings nicht möglich, Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg zu treffen.
Sein Projekt dagegen, Verdun und das „Weißbluten“ der französischen Armee, der Versuch also, es Hindenburg gleichzutun und einen ähnlichen, den Krieg entscheidenden, Erfolg zu erzielen, lag in weiter Ferne. Wenn man es genau betrachtete, waren die Deutschen von einem Erfolg vor Verdun nie weiter entfernt als jetzt. Denn Petain, dieser kleine, tüchtige General, dem Falkenhayn ehrlichen Respekt zollte, hatte dafür gesorgt, dass die Franzosen den Deutschen in nichts mehr nachstanden. Ebenbürtig in der Truppenstärke hatten Waffen, Munition und Ausrüstung inzwischen das gleiche Niveau erreicht, wie das ihrer Gegner. Eine angreifende Armee in einem fremden Land, ohne quantitative Vorteile, musste aber scheitern, da die Verteidiger durch ihre Ortskenntnis, die kürzeren Versorgungswege und weiterer Umstände im Vorteil waren.
Wenn es nach dem Willen des Oberbefehlshabers über die 5. Deutsche Armee, des Kronprinzen Wilhelm von Preußen, ging, würde keine deutsche Kugel den Lauf eines deutschen Gewehres vor Verdun mehr verlassen, wusste Falkenhayn. Und, in drei Teufels Namen, der Kronprinz hatte recht damit. Vielleicht war er, wie manchmal gesagt wurde, ja ein Hasenfuß. Doch hier stimmte seine Analyse. Es gab vor Verdun, wenigstens im Augenblick, nichts mehr zu gewinnen, erst recht nicht, wenn einige Divisionen an die Ostfront verlegt werden mussten, um die Arbeit der verfluchten Österreicher zu tun, dachte Falkenhayn.
Einen Moment lang fragte sich Falkenhayn, ob es ein Fehler gewesen war, den Befehl für eine neue Offensive zu geben. Immerhin hätte man sich auch verschanzen und abwarten können. Doch nein, das war ja Unsinn! Die Zeit stand eindeutig auf der Seite der Franzosen, wie man sah. Die Alternative lautete Angriff oder Kapitulation, und letzteres kam nicht infrage. Da konnte er gleich seinen Hut nehmen. Dass Hötzendorf ihnen ins Kontor schießen würde, war ja nicht vorauszusehen gewesen.
Bisher war es ein Glück, dass der Kronprinz nur offiziell die Befehle gab und ein Mann wie von Knobelsdorf das Ruder fest in der Hand hielt. Doch genau das konnte zum Problem werden, wenn er, Falkenhayn, sich auf die Seite des Kronprinzen stellen musste. Die gegenseitige persönliche Abneigung und die ständig schwelenden Streitereien zwischen den beiden, als seien sie Kontrahenten, waren jedermann im Generalstab und jedem Offizier an der Front bekannt. Doch mit entsprechenden Kommentaren hielt man sich aus gutem Grund zurück. Knobelsdorf war ein alter Soldat, ehrgeizig, kaisertreu, eine ideale zweite Besetzung, aber kein Diplomat, der sich um ein besseres Einvernehmen mit dem Kronprinzen bemüht hätte. Dazu war Knobelsdorf ein schlechter Verlierer. Vielleicht ist das der wichtigste Unterschied zwischen ihm und mir, dachte Falkenhayn weiter. Dann unterschrieb er den Befehl, der vier deutsche Divisionen in Richtung Osten in Marsch setzte.
Ernst verfolgte der Kronprinz die Erläuterungen des Adjutanten, während er spürte, dass ihn von Knobelsdorf keine Sekunde aus den Augen ließ. Das also war der Plan, den der General und sein Stab gemäß den Befehlen Falkenhayns ausgearbeitet hatten. Wie erwartet lautete das Etappenziel Fort de Souville. Offensive um jeden Preis; koste es was es wolle! Das war es, was Wilhelm befürchtet hatte, wenn auch bis zuletzt mit einem Funken Hoffnung auf die Vernunft vermischt.
Es gab für Wilhelm jetzt genau zwei Möglichkeiten, doch dieses Mal würde er den Kopf nicht mehr in den Sand stecken, wie er es zuvor, nach eigener Meinung, zu oft getan hatte. Er sah jetzt, wie sich Knobelsdorf mit gewölbter Brust über dem Leibriemen an die Schar Offiziere wendete, die neben dem Kronprinzen und von Knobelsdorf die dritte Fraktion in dem Raum bildete. Fast ohne Ausnahme waren es junge Männer, die meisten jünger als Wilhelm.
„Gibt es hierzu Fragen, meine Herren? Oder möchte jemand etwas bemerken?“
Der Kronprinz wusste, dass diese Fragen nur für ihn allein bestimmt waren. Eine Herausforderung! Mit trockener Stimme antwortete er:
„Herr General! Ich würde gern etwas anmerken.“
Wilhelm erkannte im Gesicht seines Gegenübers, dass er den richtigen Ton getroffen hatte. Eine bedächtige und allgemein gehaltene Einleitung, und keine, wie es ihm dann und wann geschehen war, Demonstration seines Temperaments.
„Bitte, Hoheit!“ forderte ihn Knobelsdorf genauso höflich auf.
Wilhelm räusperte sich, und ähnelte in diesem Augenblick stark seinem Vater, dem Kaiser. Er sagte:
„Der Plan, über den wir hier sprechen, ist entwickelt worden, bevor Falkenhayn vier Divisionen an die Ostfront verlegen musste, nicht wahr? Sagen Sie es mir, Herr General, wenn ich mich irre, aber ich kann mich nicht erinnern gehört zu haben, dass dieser Umstand berücksichtigt worden wäre.“
Knobelsdorf zeigte keinerlei Regung.
„Das ist auch nicht nötig, Hoheit! Wir werden den Angriff mit rund dreißigtausend Mann führen, darunter einer stattlichen Zahl frischer Kräfte.“
Wilhelm nickte. Er hatte nicht erwartet, dass Knobelsdorf neue Argumente anführen würde, um seine Bedenken zu zerstreuen.
„Wie ich den Berichten entnehme, leisten die Franzosen immenses, was den Nachschub angeht. Allerdings hindert sie auch kaum jemand daran.“
Knobelsdorf quittierte die Kritik mit einem dünnen Lächeln.
„Wir sprachen bereits über diese, Ihre Ansicht, Hoheit!“
„In der Tat!“, sagte Wilhelm wie beiläufig, und fügte hinzu:
„Nicht nur nach meiner Einschätzung dürfte der Feind uns inzwischen, was die Artillerie angeht, überlegen sein. Denken Sie nicht, Herr General?“
Knobelsdorf seufzte, und einen Augenblick lang schien er besorgt.
„Ja; durchaus möglich. Wenigstens für den Moment.“
Es gab keinen anwesenden, der die letzte Bemerkung als gelungen bezeichnet hätte, und Knobelsdorf, dem dies nicht entging, polterte los, als wollte er damit jeden Zweifel an sich selbst und seiner Kompetenz im Keim ersticken.
„Zum Teufel mit der Artillerie! Wir sind endlich in der Lage, die neue Waffe einzusetzen.“
Jeder wusste, wovon er sprach. Phosgen- oder Grünkreuz-Granaten! Sie waren die neueste Perversion im Gaskrieg. Seit der ersten Verwendung von Giftgas im Mai 1915 in Ypern war an der Zusammensetzung des sogenannten Lungenkampfstoffes gearbeitet worden. Herkömmliche Gasmasken, wie sie inzwischen bei Franzosen und Deutschen zur Grundausrüstung gehörten oder gehören sollten, boten gegen die neue Chemikalie keinen Schutz. Wen es erwischte, dem stand ein unvorstellbarer, langsamer und grausamer Tod bevor. Oft detonierten diese neuen Granaten, auch ihre Reichweite war inzwischen verbessert worden, erst später, nachdem sie zunächst vom Feind für Blindgänger gehalten worden waren. Die Bezeichnung Grünkreuz stammte daher, dass diese Granaten mit grüner Farbe gekennzeichnet waren.
„Grünkreuz!“, stieß Wilhelm hervor und gab sich nicht die Mühe, seinen Abscheu zu zeigen.
Knobelsdorf setzte eine schulmeisterliche Miene auf:
„Es ist nicht die Zeit, wählerisch zu sein, Hoheit! Niemand ist glücklich über den Einsatz solcher Waffen. Aber wenn wir nicht siegen, verlieren wir alles.“
Der Kronprinz dachte über die Worte nach. Stimmten sie? Er war sich nicht sicher. War es nicht besser, den Krieg als die Ehre zu verlieren? Dann kehrten seine Gedanken zu den neuen Giftgasgranaten zurück, und ihm fiel ein, dass es noch nie eine Waffe gegeben hatte, über die der Gegner nicht binnen kurzem ebenfalls verfügt hätte. Vor seinem geistigen Auge sah er Männer, Deutsche und Franzosen, wie sie innerlich verbrannten, und ihm war, als könne er hören, wie sie vor Schmerz schrieen, bevor sie den Verstand verloren. Nein! Er war sich sicher: Dieser Krieg hatte mit Ritterlichkeit nichts zu tun. Es war ein Abschlachten auf höchstem, technischem Niveau. Er selbst jedoch, Wilhelm von Preußen, wollte dabei nicht länger zusehen. Er hatte genug vom Krieg und seinen gefälschten Idealen und hohlen Phrasen.
„Herr General!“, begann er.
„Aufgrund der allgemeinen Lage, insbesondere der Schwächung unserer Defensive durch den Abzug besagter vier Divisionen, bitte ich Folgendes zur Kenntnis zu nehmen: Ich, Wilhelm von Preußen, spreche mich hiermit gegen die geplante Offensive aus. Ich halte sie für einen Fehler, der unnötig Menschenleben aufs Spiel setzt.“
Knobelsdorf traute seinen Ohren nicht. Irritiert sah er sich um und blickte in verdutzte, ratlose und irritierte Gesichter. Ein paar der Offiziere blickten verlegen zu Boden. Die Stille eines Vakuums verbreitete sich. Endlich gelang es Knobelsdorf, den größten Teil seiner Fassung zurückzugewinnen.
„Hoheit! Hoheit!“
Er musste achtgeben, nicht zu stottern.
„Es ist nicht vorgesehen, dass Sie …“
Jeder wusste, was Knobelsdorf nicht offen auszusprechen wagte.
„Ich weiß das, Herr General! Glauben Sie mir!“ sagte Wilhelm.
„Doch das spielt jetzt keine Rolle. Ich werde meine Unterschrift für keine neue Offensive hergeben. Und … Ich werde den Kaiser selbst darüber in Kenntnis setzen.“
Knobelsdorf griff nach einem Strohhalm, und es war ihm gleichgültig, wie unverschämt seine Worte klingen mussten:
„Es würde mich interessieren, Hoheit, wie Sie Ihre Haltung begründen wollen.“
Da war sie wieder, diese herablassende Arroganz, die Wilhelm in einen Zustand versetzen konnte, der nur schwer beherrschbar war. Doch er durfte jetzt nicht die Nerven verlieren.
„Ich werde den Kaiser davon überzeugen, dass Ihr Angriffsplan alles bisher Erreichte leichtfertig aufs Spiel setzt …“
Knobelsdorf unterbrach ihn barsch:
„Mit welchem Recht, verdammt noch Mal, erlauben Sie sich …“
Wilhelm schien die Anfeindung nicht zu hören und zog jetzt einen zusammengefalteten Bogen Papier hervor.
„Lesen Sie!“, sagte er, und hielt Knobelsdorf den Brief hin. Dieser griff überrascht danach und erkannte auf Anhieb Falkenhayns Handschrift. Es war ein nicht sehr langes, in erster Linie privates, Schreiben. Es enthielt keine Befehle und erteilte auch keine Ratschläge, bestimmte Befehle zu geben.
„Nun? Was sagen Sie, Herr General?“
Knobelsdorf reichte den Brief zurück. Dabei zitterte seine Hand vor Erregung.
„Dies scheint mir doch eher eine private Meinung zu sein!“, sagte er hart.
„In der Lage, in der wir uns befinden, sehe ich keinen Raum für private Meinungen!“ hielt Wilhelm energisch dagegen.
Die Belehrung traf Knobelsdorf wie eine Ohrfeige. Doch schlimmer, als vor seinem eigenen Stab vom Kronprinzen bloßgestellt zu werden, war die offensichtliche Tatsache, dass Falkenhayn eingeknickt war. Auch er, so hatte er dem Kronprinzen mitgeteilt, hielt einen Angriff zum jetzigen Zeitpunkt für nicht ratsam. Doch wie es für Falkenhayn typisch war, hatte er die letzte Entscheidung darüber von sich geschoben und betont, es komme auf die Beurteilung vor Ort an. Ein Feigling und Opportunist, der sich alle Wege offen hielt. Wie erbärmlich!
Knobelsdorf spürte den Druck der Front, die sich gegen ihn aufzubauen schien. Was sollte er tun? Noch war es Zeit, die Offensive abzublasen. Damit konnte er nichts falsch machen. Doch nein! Ganz im Gegenteil! Vielleicht war dies sogar die Chance, die er brauchte. Als ‚Held von Verdun’ war es nur noch ein kleiner Schritt, Falkenhayn als Chef der OHL abzulösen. Er dachte an den Mann, der sich Mars nannte und an die geheimnisvolle Organisation, die dieser repräsentierte. Wenn es ihm, Knobelsdorf, gelang, aus eigener Kraft sein Ziel zu erreichen, würde er diese Leute nicht mehr brauchen, ja, könnte sogar gegen ihre verschwörerischen Pläne, sofern sich diese als solche erwiesen, vorgehen. Damit wäre sein Name aus den Geschichtsbüchern nicht mehr zu tilgen. Ein Hochgefühl nahm von ihm Besitz. Nein! Der Angriff musste durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden. Er war der Schlüssel zu allem.
„Hoheit!“, sagte er jetzt sehr gelassen.
„Ich nehme Ihren Einwand zur Kenntnis. Die hier anwesenden Offiziere sind Zeugen.“
Wilhelm hörte die leidenschaftslosen Worte seines Stabschefs, die das Ende der Unterredung einzuleiten schienen. Noch einmal sammelte er all seine Entschlossenheit und sagte beschwörend:
„Herr General! Ich bitte Sie inständig. Verzichten Sie auf die neue Offensive. Der Gegenangriff der Franzosen könnte uns alle überrollen.“
Knobelsdorf blieb ungerührt. Eine Sekunde lang dachte er darüber nach, den Kronprinzen als den Feigling zu bezeichnen, für den er ihn hielt. Doch er sagte:
„Hoheit! Ich muss Sie Kraft der mir vom Kaiser gewährten Vollmachten bitten, vom Oberkommando der 5. Armee zurückzutreten.“
Der Kronprinz schüttelte den Kopf. Sie wussten beide, dass nur eine Person für die Nachfolge in Betracht käme.
„Ich bedaure, Herr General! Das werde ich nicht tun!“
Knobelsdorf schien damit gerechnet zu haben.
„In diesem Fall wird die Offensive unter meiner persönlichen Verantwortung stattfinden!“
„Ist das Ihr letztes Wort?“
„Das ist es, Hoheit!“
„Dann erlauben Sie mir, Ihnen und uns allen Glück zu wünschen!“, sagte Wilhelm, eine Verbeugung andeutend.
„Gott stehe uns bei!“
Das zwischen Fort Douaumont und Verdun gelegene Fort Souville war das geografische Ziel des Angriffs. Am 21. Juni 1916 begannen die Deutschen, das karge Hügelland von Norden her unter Artilleriefeuer zu nehmen. Hier befanden sich die Ouvrages Thiaumont und Morphin, letzteres von den Deutschen Filzlaus genannt. Die wichtigsten Höhenzüge waren der Côte-de-Froide-terre und der Côte-de-Lorraine, von dem aus, so glaubten die Deutschen, man Verdun sehen könne.
Mit mehr als einhunderttausend Granaten wurde das Terrain bestrichen. Schließlich, morgens früh am 23. Juni, als die Sturmtruppen angriffen, kamen Grünkreuz-Granaten zum Einsatz. Diese, und die aus allen Richtungen kommenden Artillerie-Granaten, waren für die deutschen Angreifer die größte Gefahr, denn auf französischen Widerstand stießen sie nur noch in geringem Maß. Sehr schnell eroberten sie das Städtchen Fleury, das im Laufe des Krieges sechzehnmal den Besitzer wechseln sollte, dabei völlig zerstört und nicht wieder aufgebaut wurde, und das dennoch bis auf den heutigen Tag als Mahnmal existiert, für das eine Postleitzahl vergeben ist und das einen Bürgermeister hat.
Am rechten Hang des Côte-de-Froide-terre befand sich das Zwischenwerk Thiaumont mit seinen Verteidigungsanlagen, Bunkern, Stollen und Depots. Nur sechzig französische Verteidiger der Anlage überlebten den Angriff. Kurz nach der Einnahme Thiaumonts durch die Deutschen rückten vier ebenfalls stark dezimierte bayrische Regimente zum Côte-de-Lorraine vor. Von hier aus ging es bergab, bis hinunter in das Tal der Maas, in dem die deutschen Landkarten Verdun vermuteten. Doch die Soldaten waren viel zu geschwächt, und nicht zahlreich genug, um den Vorstoß wagen zu dürfen. Zu ihren Einheiten zurückgekehrt, berichteten sie enttäuscht, sie hätten Verdun nicht sehen können.
Südlich von Fleury fiel das Ouvrage de Morphin, die Filzlaus, in deutsche Hand. Doch die Beute, ein paar Gefangene, ein wenig Verpflegung, Waffen und Munition, wurden ihnen von dem französischen Gegenangriff, der auf dem Fuße folgte, wieder abgejagt. Dann richteten sich die Deutschen in Fleury ein, wohin sie schleunigst zurückkehrten, und bezogen dort Stellungen. Dem Angriff auf Fort Souville schien der Atem ausgegangen.
Während des heißen Sommers 1916 versuchten die Deutschen ihre neuen Stellungen auszubauen und zu verteidigen. Die vom modernen Krieg gezeichnete Landschaft, Mondkrater, keine Spur von Vegetation, zu Asche geschmolzenes Mineral, genügte, um den Betrachter erschauern zu lassen. Doch damit nicht genug. Das Erdreich, ein friedloser und unwürdiger Friedhof, war vollgestopft mit Leichen, die in der Hitze verwesten und einen unbeschreiblichen Gestank verbreiteten, der sich den noch Lebenden als dauerhafte Erinnerung einbrannte. Längst vorüber schienen die Tage nennenswerter, kriegerischer Taten, die sich ungeschönt für Propagandazwecke eigneten. Die Toten – mehr als die Verluste zu melden konnte man für sie nicht tun – und die Verwundeten auf beiden Seiten, deren Schreie nie zu verstummen