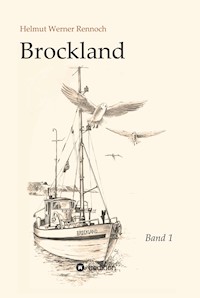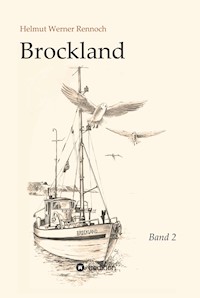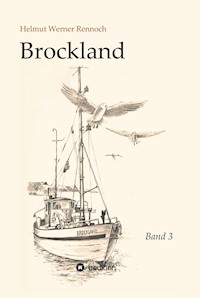
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Brockland
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt in drei Bänden die Geschichte der deutsch-dänischen Kaufmannsfamilie Halmstedt, von ihren Beziehungen zu Brockland, einer Insel in der Nordsee, und ihren Bewohnern. Dargestellt werden der Krieg von 1914-1918, Aufstieg und Niedergang eines Imperiums, die Revolution, ein zerbrechlicher Frieden, bevor sich die Katastrophe des Krieges während des Nationalsozialismus fortsetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über den Autor:
Helmut Werner Rennoch wurde ziemlich genau 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges – wie das Ereignis in den Geschichtsbüchern genannt wird – am 02. Mai 1955 in Damme im südlichen Oldenburg, einer katholischen Enklave im südlichen Niedersachsen, als Kind evangelischer Eltern geboren, deren Wurzeln und Erfahrungen zurückreichen in die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen des 20. Jahrhunderts. Vertreibung, Flucht, Neubeginn und schließlich Ankommen in einer Gesellschaft, die, zunächst fremd, dann Heimat, zu einer der vielen Paten dieses Buches wurde.
Helmut Werner Rennoch begann jenseits der vierzig, nach Ende seiner beruflichen Laufbahn, zu schreiben.
BROCKLAND
BAND 3
Helmut Werner Rennoch
© 2021 Helmut Werner Rennoch
Verlag & Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-22764-4
Hardcover
978-3-347-22765-1
e-Book
978-3-347-22766-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Meinen Eltern
Vorwort des Autors
Wenn ein geplagter Schulmeister oder eine gepeinigte Schulmeisterin feststellt, dass einer seiner oder ihrer Schüler das neue Geschichtsbuch bereits während der ersten Tage von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen hat, fühlt er oder sie sich geschmeichelt. Dem Schüler entstehen dadurch postwendend Vorteile, die nicht hoch genug einzuschätzen sind.
Ich war ein solcher Schüler und genoss sowohl die Sympathie meiner Lehrer, wie den Wissensvorsprung vor meinen Mitschülern. In Wahrheit ging es mir jedoch nur darum, spannende und anregende Geschichten zu lesen, wobei es mir an entsprechender Lektüre keineswegs mangelte.
Besonders angetan hatten es mir die alten Germanen: Die Männer wilde Kerle mit Keulen und schartigen Schwertern, die ihre Heimat mit Todesverachtung gegen die eindringenden Römer verteidigten, die Frauen sanfte Wesen mit langem, braunem Haar, deren anmutige Körper in selbstgefertigten Wollkleidern steckten, ihrem Manne eine treue Begleiterin. So stand es da! So zeigten es die Illustrationen! Und wer war ich, dass ich am Gedruckten zweifeln durfte?
Heute ist so gut wie alles, was seinerzeit Kindern über unsere Vorfahren in die Geschichtsbücher geschrieben wurde, widerlegt. Wir stammen nicht von einem einheitlichen Volk ab, das sich mit einem Indianerstamm aus den Büchern eines Karl May verwechseln ließe. Doch so wenig es die Indianer des sächsischen, so fantasiebegabten, Autors gegeben hat, so prosaisch ist die Vergangenheit, unsere Geschichte. Aber warum erzähle ich das?
Die Insel Brockland, meine Insel Brockland, ist Fiktion. Es gibt sie nicht, und gab sie nie. Sie ist Erfindung, Legende, Lüge! Man kann in der südöstlichen Nordsee herumkreuzen wie und so lange man will. Man wird nichts finden! Brockland entspricht nicht der Wahrheit. Die Insel ist nicht Realität! Aber ist das wirklich so?
Was ist Realität, was Fiktion? Was wissen wir wirklich? Wir wissen, dass SMS, WhatsApp und E-Mails beim Empfänger ankommen. Aber wie? Warum verschafft uns diese Unwissenheit kein mulmiges Gefühl? Wir spüren die Allmacht des Internets. Aber was ist das überhaupt, von Kabeln und Drähten abgesehen? Wir alle schalten täglich Lampen und Geräte an und wieder aus. Aber hat jemals ein Mensch den elektrischen Strom gesehen? Wie, wenn man nicht daran zu glauben vermag, dass Gott die Menschen schuf, erklärt sich das Lächeln eines Kindes? Aus Kosmos und Ursuppe? Welchen Wert besitzt unser Wissen, wenn es von unserer Bereitschaft und vom Alltag geforderter Umstände abhängig ist, zu glauben?
Nein! Brockland existiert nicht nur, samt allen Menschen und Geschichten. Die Fiktion ist die Sprache der Erklärung und des Beispiels. Niemand würde ein biblisches Gleichnis als Lüge bezeichnen, und längst akzeptieren wir zerfliessende Uhren als Mittel des Ausdrucks.
Wenn es darüber hinaus stimmt, dass Geschichte immer die Geschichte des Siegers ist, und vieles spricht dafür, dann müssen wir skeptisch sein und uns Erklärungen schaffen. Vielleicht gibt es in einzelnen Fällen auch mehr als nur eine einzige Wahrheit. Vielleicht gibt es neben Wahrheiten, die sich messen lassen, solche, die nur fühlbar sind. Vielleicht fehlt uns in unseren Sprachen ein Wort für all die Räume, Ebenen und Dimensionen der Wahrheit. Mein Vorschlag; Brockland!
Danksagung
Ich habe all denen zu danken, die mir durch Kritik und Zuspruch halfen, weiter zu machen. Über die lange Zeit, die die Arbeit in Anspruch nahm, waren es derer nicht wenige.Ungenannt heißt nicht vergessen.
Mein besonderer Dank gebührt Eva-Maria Braun, die mit großer Klarheit und Geduld das Manuskript durchsah und es dahin führte, wo es sich heute befindet.
Nicht zuletzt bin ich Herrn Ernst J. Herlet etwas schuldig, der die wunderbaren Illustrationen beisteuerte.
Dezember 2020
Erster Teil
SPARTAKUS
Kapitel 1
Eine militärische Meisterleistung auf der Grundlage eines weitblickenden, strategischen Konzepts war nicht erforderlich. Von Süden und Westen her drangen die Schiffe auf Brockland vor, und beide Gruppen erreichten die Insel zur selben Zeit. Das war es im Wesentlichen! Mit Gegenwehr rechneten die Eroberer nicht, nicht an Ort und Stelle und nicht durch die Inselbewohner.
Fröhlich flatterten die Hakenkreuzfahnen in den Masten der kleinen, der Truppenbeförderung dienenden Kriegsschiffe im sanften Wind des Sommertages. Die Vorhut, die den Pionieren und anderen Truppenteilen voranging, zwei Kompanien Marinesoldaten, marschierte wenig später schneidig und eigentlich gar nicht martialisch über die Mole. Das Flaggschiff der Armada, das sich in der Hafeneinfahrt von seiner Bedeckung abgesetzt hatte, nahm, einen kleinen Bogen beschreibend, Kurs auf den Kai und die dort dicht an dicht liegenden Kutter. Nur noch einen Steinwurf von der Hafenkante entfernt stoppten die Maschinen scheinbar plötzlich, und die Fregatte verharrte in der Dünung dümpelnd. An Bord sah man keine Waffen, und weil keiner der Fischer jetzt in der Hitze des Tages ans Auslaufen dachte, nahmen die Inselbewohner die Abriegelung ihres Hafens nicht als solche, und nicht als Akt der Aggression wahr. Nur einige wenige befiel ein unbestimmbares Gefühl von Enge. Daneben verbreitete sich die Nachricht, dass auch an der Spitze der Halbinsel, die sich wie zur Vereinigung mit Helgoland südwestlich in die Nordsee streckte, deutsche Soldaten gelandet waren, wenn auch ohne viel Aufhebens von sich zu machen.
Den Häusern, welche die Hafenstrasse säumten, entströmten Menschen, die sich das bunte Schauspiel nicht entgehen lassen wollten. Kantige Kommandos im soldatischen Jargon, breiten Brüsten entsprungen, ertönten, und die Matrosen befolgten die Befehle wie ein Mann, wie eine gut geschmierte Maschine, die funktionierte, als bedürfe sie keiner Anweisungen oder Befehle. Stiefel knallten auf das Pflaster, Karabiner wurden präsentiert und auf die Schultern zurückgeworfen, Köpfe flogen seitwärts, und keiner der in tadellose, blau-weiße Gleichheit Gekleideten gab sich die Blöße, eine Miene zu verziehen. Selbst die Mützen erschienen wie mit der Wasserwaage auf die Köpfe gepflanzt. Die Haare waren kurz, sehr kurz, geschnitten, und alle waren makellos rasiert, wobei nicht wenige der Männer so jung erschienen, dass ihre Rasiermesser nur wenig Arbeit gehabt haben mochten und kaum der Schärfung am nächsten Morgen bedürften. Alle Soldaten wirkten frisch, gesund und wie von beeindruckender Vitalität. Beifall und Rufe der Anerkennung wurden hörbar. Offene Münder und im Takt des Marsches wippende Stiefelspitzen dokumentierten, wie beeindruckt man war. Die Deutschen aber fühlten sich willkommen geheißen. Dass sie auch bleiben würden, ließ sich erst am anderen Tag erahnen, als sie immer noch da waren, sie sich einrichteten, und ihre Zahl sich weiter und weiter vergrößerte.
Von nun an hieß es in deutschen Geschichtsbüchern, die Insel Brockland, die nach dem Weltkrieg von den sogenannten Siegermächten teils aufgrund unzutreffender geschichtlicher Zusammenhänge, teils willkürlich Dänemark zugeschlagen worden sei, gelte von nun an als befreit und ins Deutsche Reich heimgeholt. Dem offiziellen Protest Dänemarks erteilte Deutschland einen Bescheid, in dem Genugtuung und Sarkasmus unverhüllt zutage traten. Man habe sich der notwendigen Korrektur eines geschichtlichen Fehlers angenommen, hieß es.
Kurz darauf, nur ein paar Tage später, eröffnete der deutsche Reichskanzler Adolf Hitler in Berlin die Olympischen Sommerspiele, an denen auch Dänemark teilnahm, so wie die ganze Welt. Man stieß die Deutschen nicht vor den Kopf. Nicht mehr! Es war besser, sich nicht zu weit aus dem diplomatischen Fenster zu lehnen, und schon gar nicht für eine lausige Nordseeinsel namens Brockland, auf der eine Handvoll Menschen, mehr Schmuggler und Piraten als irgendetwas sonst, ein kümmerliches und trostloses Dasein fristeten.
„Wissen Sie, General!“, sagte von Stein zu dem Amerikaner, der ihm gegenüber saß:
„Ihr Präsident Woodrow Wilson war seinerzeit der Einzige, der sich dagegen aussprach, Deutschland Reparationszahlungen im allseits geforderten Umfang aufzuerlegen. Das haben wir nicht vergessen.“
Beide Männer waren etwa gleich alt, und das angesprochene Ereignis datierte etwa in eine Zeit zurück, als beide der gleichen Armee angehört hatten, der deutschen. Das war kein Geheimnis. Dank einer effizienten Aufklärung gab es keine Geheimnisse, weder auf deutscher, noch auf amerikanischer Seite. Im Übrigen bestimmte allein das Reichspropagandaministerium, wer willkommen war und wer nicht, wem in Deutschland Türen, Arme und Herzen zu öffnen waren. Außerdem pflegten die Vereinigten Staaten von Amerika und das Deutsche Reich gute diplomatische Beziehungen zueinander, getragen von jener Oberschicht auf amerikanischer Seite, so bürgerlich wie liberal, so weiß wie konservativ und nur wenig auf gesellschaftliche Veränderung bedacht, die im Sowjetkommunismus des Josef Stalin den Feind und Gegner ausgemacht hatte, so weit Amerika, fest in seinen moralischen, presbyterianischen Grundsätzen und militärisch unbesiegbar überhaupt, Feinde haben konnte. Die Russen waren Königsmörder, deren einzige Ideologie es war, ihre schmutzigen, kommunistischen, vor allem aber atheistischen Finger nach der ganzen Welt zu strecken. Mit großer Besorgnis registrierte jene Klasse, dass bereits überall in den Vereinigten Staaten linke Parteien und Gewerkschaften entstanden.
In weiten Teilen Deutschlands dachte man ganz ähnlich über Russland, die Sowjetunion und den Bolschewismus. Die Einstellung zu Amerika aber ging über das schlichte: Der Feind meines Feindes ist mein Freund hinaus. Für viele Deutsche war das amerikanische, weiße Bürgertum das tatsächliche, das einzige Amerika. Menschen, die aus dem Herzen Europas stammten, Anhänger der Reformation, die sich ihrer tadellosen ethnischen Abkunft bewusst waren. Leute, die im Schatten der Freiheitsstatue, ein Geschenk der ersten Französischen Republik, der Bostoner Teaparty und der Mayflower gedachten; Verbündete gegen alle gesellschaftlichen Perversionen, dem Judentum und den Kommunismus. Noch war das auch die offizielle deutsche Wahrheit, und die Propaganda stützte sich dabei weder auf Statistik noch auf historische Fakten, sondern stellte die politischen Ziele in den Vordergrund.
„Wilson war nicht unumstritten!“, antwortete der General.
Der General, dessen Rang ein Zierdegen war, stellte er doch eine dem preußisch-deutschen Geschmack eine eher unzumutbare Zwittergestalt dar, halb Militär, halb Zivilist, war geladener Gast der Reichsregierung und ein Mann, der im öffentlichen Licht stand. Sein Name ging Technikern in Fachkreisen wie Honig über die Zunge. Ein Held des Fortschritts, titelten die Gazetten, ein amerikanisches Aushängeschild, kommentierte respektlos der Boulevard. Unbestritten jedoch war er ein Weltbürger, dem in jedem Land der Erde, das begonnen hatte, sich vom Boden zu erheben, begeistert der rote Teppich ausgerollt wurde. Ein Ingenieur, der Flugzeuge gebaut und andere sicherer, schneller und effizienter gemacht hatte, einer, der Trends und Standards repräsentierte und an dem man sich zu messen hatte. Niemand, der Flugzeuge baute, und keine Luftwaffe der Welt konnte es sich leisten, auf die Nutzung und Inanspruchnahme seiner geistigen Arbeit zu verzichten. Er war ein Dutzend Generäle und zwei Dutzend Intellektuelle wert, wie es in einem Papier des Ministeriums für Propaganda hieß.
„Das sind große Männer immer!“, sagte von Stein und verbeugte sich leicht um anzudeuten, dass er den Amerikaner, der ihm gegenüber saß, ebenfalls für einen großen Mann hielt. Es war ein Kompliment, wie es im diplomatischen Verkehr nicht unüblich war, und beeindruckte den so gelobten nicht über Gebühr.
„Wir Amerikaner errichten gern Statuen, lehnen es aber ab, selbst für eine gehalten zu werden. Wenigstens die meisten von uns.“
Er lächelte gekonnt bescheiden, jetzt selbst ganz Diplomat, und fuhr fort, die Worte wie alte Werkzeuge benutzend, die gut in der Hand liegen.
„In meiner Lebensgeschichte, wie sie von Presse und Publizisten gesehen wird, ist vieles übertrieben worden, und anderes, das mir bedeutsam und nennenswert erscheint, findet kaum und gar nicht Beachtung. Die Menschen suchen nach Helden, nach Idolen und Göttern. Und in ihrem Bedürfnis nach Einfachheit erklären sie den Olymp zum Gefängnis, und sprechen Protagonisten und zum Handeln gedrängte das Recht auf Mittelmaß ab.“
Von Stein lachte distinguiert, und seine Heiterkeit war nicht vorgeschoben.
Das Gespräch irrte planvoll wie eine manipulierte Bowlingkugel durch Kegel und Themen hindurch, streifte hier und da ein Objekt, und hütete sich, eines umzustoßen. Der Small-Talk, wie die Amerikaner sagten, war eine Kunst. Antrag und Annahme. Schmeichelei und Werbung. Erhören und Grenzen ziehen. Doch schließlich wurde von Stein konkret:
„Hat Ihnen die Abschlussfeier unserer Spiele in Berlin zugesagt, Herr General?“
Die Frage wurde auf Deutsch gestellt, und sie wurde auf Deutsch beantwortet.
„Ausgezeichnet! Wunderbar! Hervorragend! Verzeihen Sie, Herr von Stein…“
Der General hob die Hände in Schulterhöhe, als ergäbe er sich, und fügte beinahe demütig und mit überschwänglicher Anerkennung hinzu:
„..ich gerate ins Schwärmen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen! Wahrhaftig!“
„Zu gütig, Herr General!“, sagte von Stein bescheiden. Er hatte keine andere Antwort erwartet.
Kaum jemand wäre für die Aufgabe, die Gäste des Ministeriums zu betreuen, geeigneter gewesen als Roland von Stein. In anderen Ländern überließ man solche Dinge häufig in Würden ergrauten Regierungsbeamten ohne Portefeuille und Budget. Sie wurden von Kritikern als Frühstücksdirektoren oder ähnlich bezeichnet. Diesen Fehler begingen die Deutschen nicht.
Auf besonderes Betreiben von Joseph Goebbels war von Stein das geworden, was er heute war: Diplomat und Repräsentant im Stab des Ministers. Nicht weil er ein knappes Dutzend Sprachen fließend beherrschte oder ein Nationalsozialist reinsten Wassers war, die Welt bereist hatte und mit so vielen wichtigen Männern persönlich bekannt war, sondern vor allem, weil er in strengem Sinn undeutsch erschien, nicht provinziell, sondern weltmännisch, Lebensart besaß und trotzdem vollkommen integer war und zu den wenigen und handverlesenen zählte, denen Goebbels vertraute, soweit es das für die große Sache schlagende Herz des Ministers erlaubte. Nach Goebbels Urteil war von Stein ein Mann, der nicht durch Stumpfsinn langweilte, ein todeswürdiges Vergehen, sondern einer, der frisch, anregend und stets gut unterrichtet und auf dem Laufenden zu unterhalten wusste, dabei belesen und von Bildung war. Omnipotent interessiert an Musik, Literatur, Malerei, Philosophie, den Naturwissenschaften und anderem mehr, galt seine besondere Vorliebe der alten Kunst der Astrologie mit all ihrem Facettenreichtum, sowie den Künsten, die man die geheimen nannte, dem magischen und okkulten. Er war nach Goebbels Einschätzung ein Adliger und Führer, wie er sein sollte. Ein nationalsozialistischer Ritter. Von Steins viel gefächerte Sexualpräferenz war nach Goebbels Urteil ganz etwas anderes als die primitive und verachtenswerte Homosexualität und Sodomie wie sie Freigeister, sogenannte Künstler, Schreiberlinge und Schmierfinken an den Tag legten und in ihrer Entartung das reine deutsche Blut bedrohten. Im Gegenteil: Die Vorsehung zeichnete die großen Männer, die ihrer Rasse voranschritten, in der Antike Sokrates, Platon, Aristoteles, Alexander, Julius Cäsar, Augustus, und Adolf Hitler, der Führer, in der Gegenwart, sowie einige wenige andere, zu denen Goebbels sich selbst, aber auch von Stein zählte, mit Privilegien aus, die auf Naturgesetzen fußten. Für sie, die großen Geister, waren Moral und Ethik aufgehoben, umgedeutet. Es war ihnen gestattet, weil sie dazu befähigt waren, Grenzen zu verschieben und zu überschreiten. Sie waren keine Götter, denn es gab keine. Sie führten die Rasse an, die das Salz der Erde war: Die germanische Rasse, in deren Adern arisches Blut floss. Eine Rasse, die sich treu geblieben war, und sich nicht vermischte mit semitischem oder anderem minderwertigem Erbgut. Es wäre ihr Untergang.
Es war nach Goebbels Meinung einfach, jetzt, da die Welt damit begonnen hatte, zu Deutschland aufzusehen, Nationalsozialist zu sein. Männer, denen vor vier Jahren nicht das Schwarze unterm Nagel gehörte, hatten begonnen, sich wie Maden in den Speck zu bohren, den eigenen Vorteil, den eigenen Wanst im Sinn. Solche Männer waren Gesindel, Abschaum. Aber es gab sie und würde sie geben, solange man ihrer bedurfte. Schmutzige Arbeit für schmutzige Hände gab es genug.
Er, Goebbels, litt darunter, dass sich so wenige Intellektuelle, so wenige Männer mit innerer Kompetenz der Bewegung, dem Nationalsozialismus – das war so viel mehr als nur eine Partei – angeschlossen hatten. Schuld daran, fand der Mann, dessen Protegé von Stein war, waren die Männer in den Hemdsärmeln und mit den schlechten Manieren, die zu laut lachten und Fisch mit dem Messer teilten. Eines Tages musste man das in Ordnung bringen. Zurück mit ihnen, den Schweinen, in die Gosse, woher sie gekommen waren, und den Gestank ihrer Kloake nie verloren hatten. Eines Tages, wenn er, Joseph Goebbels, sicher im Sattel saß und das uneingeschränkte Vertrauen des Führers genoss, das ihm längst gebührte. Auch dafür, dass er immer noch für dieses Vertrauen kämpfen musste, würde jemand, Dummköpfe, Denunzianten, Neider, bezahlen müssen. Dass es ein ‚wieder kämpfen’ nach Eskapaden mit jungen, nicht nur blonden Damen aus der Filmbranche war und dass Hitler ihn, Goebbels, bedrängt hatte, endlich zu heiraten – die passende Frau, eine intime Anhängerin des Führers, stehe bereit, ihre Pflicht zu erfüllen – hatte Goebbels zwar nicht verdrängt, aber war es denn seine Schuld, wenn die Damen seine Nähe suchten, und seinem Charme nicht zu widerstehen wussten? Auch der Führer hatte seine Affären. Doch, das gab Goebbels zu, er war sehr diskret.
Selbst im engsten Kreis um Hitler, den Paladinen, hatte Goebbels Kretins, wie er seinem Tagebuch anvertraute, ausgemacht. Speichellecker und Schwätzer, die zu nichts weiter fähig waren, als dem Führer nach dem Mund zu reden. Goebbels hasste diese Emporkömmlinge und Opportunisten nicht weniger als alle die Volksverräter, Kommunisten, Schwule und vor allem … Juden! Aber man musste ein Problem nach dem anderen lösen, wollte man nicht scheitern. Männer wie Roland von Stein jedenfalls waren rar gesät. Mit ihnen, das wusste Goebbels, war Staat zu machen. Mit Männern wie Roland von Stein konnte man sich sehen lassen. Man war wer, mit solchen Leuten im Gefolge!
„Ich habe vor den Spielen, wie Sie wissen, meine alte Heimat bereist.“, sagte der General jetzt.
„Und habe mir damit einen lang gehegten Wunsch erfüllt.“
„Ja! Deutschland ist schön!“ sagte von Stein konziliant und ein wenig mechanisch.
„Wir sind stolz darauf, dass Deutschland Ihr Geburtsland ist und Sie, lieber Herr General, unter anderem auch ein großer Sohn Deutschlands sind!“
Von Stein bemühte sich, Verkettung und Schlussfolgerung in sanftes Licht zu hüllen.
„Danke!“, sagte der General schlicht, und betonte, er habe sich stets als Amerikaner deutschen Ursprungs gefühlt. Dann fügte er hinzu:
„Vor meiner Rückreise in die Staaten würde ich gern in den Norden reisen, um meinen Vater zu sehen.“
Selbstverständlich beschränkte das Ministerium nicht die Reisefreiheit seiner Gäste. Doch inoffiziell und unter dem Siegel der Fürsorge wurde höflich um Abstimmung gebeten. Als Gegenleistung standen Annehmlichkeiten und Unterstützung unbegrenzt zur Verfügung. Den Gästen des Ministeriums wurden von zahlreichen Bediensteten die Wünsche von den Augen abgelesen.
„Selbstverständlich!“, sagte von Stein leichthin und fern des Anscheins, eine Erlaubnis zu erteilen.
„Wie geht es Ihrem Vater?“
Ein Gefühl der Beklemmung ließ den General tief atmen. Er konnte die einfache Frage nicht beantworten.
„Ich habe ihn achtzehn Jahre lang nicht gesehen. Wenigstens.“ gab er zu.
Von Stein schwieg, und der Blick seiner Augen, die ihr gegenüber festhalten oder durchdringen konnten, wurde für einen kurzen Moment unstet und nachdenklich, als streife ihn die eigene Vergangenheit, die eigene Geschichte. Dann sagte er mild und einfühlsam:
„Das kann eine lange Zeit sein.“
Das ist eine lange Zeit, dachte der General.
„Sie kennen meinen Vater, Herr von Stein?“
Später konnte der General nicht mehr sagen, warum er dem Diplomaten an dieser Stelle diese Frage gestellt hatte.
„Jeder in Deutschland kennt Ihren Vater, Herr General,“ sagte von Stein plötzlich aufgeräumt, als spräche er über einen Filmschauspieler oder einen berühmten Varietékünstler.
„Tatsächlich?“
Der General war verblüfft.
„Ihr Vater ist ein Mann, um den sich Legenden wie Efeu ranken!“ erläuterte von Stein und schien seine Metapher zu genießen.
„Sie meinen ein neuer Münchhausen? Soweit ich weiß, hat mein Vater nie auch nur ein Wort über sein Leben verlautbart.“
Das war mehr Hoffnung als Gewissheit.
„…oder jemandem davon erzählt.“
Natürlich nicht, dachte von Stein. Der Herr Vater ist kein Dummkopf. Aber er sagte:
„Sie erwähnten eingangs selbst, Herr General, die Menschen machen sich ihre Helden selbst.“
Als sei eine Erklärung nötig fuhr von Stein fort und bediente sich eines beiläufig klingenden Plaudertons.
„Jemand erzählt etwas, ein anderer erinnert sich daraufhin, und ein Dritter, der nicht dabei war, legt noch etwas obendrauf. Ein weiterer verpackt alles den Augen und Ohren wohlgefällig und serviert dem Publikum, das es kaum erwarten kann, mundgerechte Portionen.“
Der General staunte, und hielt nun seine Gedanken nicht mehr zurück:
„Mein Vater, Wolf von Kramnitz, Kapitän a. D., Anwalt der Rechte, ein deutscher Buffalo Bill?“
Von Stein schmunzelte, jetzt herzlich amüsiert:
„Jedenfalls kein zweiter Münchhausen. Ganz und gar nicht!“
Der General, dessen Name einst Wilhelm von Kramnitz gewesen war, und der jetzt William Cravitz hieß – es ließ sich nicht entscheiden wegen der Gehörlosigkeit oder der Liebe zur Vereinfachung eines amerikanischen Urkundsbeamten – schien ein wenig erleichtert. Wolf war nicht der Vater gewesen, den er sich als junger Mann gewünscht hatte, kaum mehr als ein biologischer Erzeuger, und ein Versager als der Mann an der Seite seiner Mutter. Doch zum Gespött in der Öffentlichkeit gemacht zu werden, hatte er nicht verdient. Was konnte man einem Mann, der aus einer alten Offiziersfamilie stammte, schlimmeres antun, als ihn am Bart über den Marktplatz zu führen?
„Roland!“
William wechselte die Sprache. Er wusste, dass von Stein ebenso gut Englisch sprach wie er selbst. Das von ihm inzwischen als ein wenig steif empfundene Deutsch hatte zwar seine Vorteile, vor allem dann, wenn man Distanzen schaffen oder aufrechterhalten wollte. Doch die Alternative erschien William, der den Wunsch ins Detail zu gehen verspürte, einen Versuch wert. Die Benutzung des Vornamens war darüber hinaus eine besondere Qualität, die das Einverständnis des Gegenübers voraussetzte.
„Sie kennen meinen Vater persönlich!“
Es schien von Stein angenehm, nicht auf Deutsch antworten zu müssen.
„Ja, William! Ich kenne und schätze Ihren Vater, und ich habe viel von ihm gelernt.“
Ein Schuss ins Schwarze! Viel gelernt! Das konnte eine Floskel sein, aber auch etwas Konkretes bedeuten.
„Wollen Sie mir davon erzählen, Roland?“
Von Stein verdrehte die Augen wie ein Kind, das von seinen stolzen Eltern nach Tisch aufgefordert wird, den Gästen etwas auf dem Klavier vorzutragen, dazu keinerlei Lust verspürt, sich aber schlussendlich, allen Gefahren trotzend, in sein Schicksal fügt.
„Also gut, also schön!“
Ein Augenblick der Sammlung, dann die Vorbereitung:
„Ich hoffe, ich rede mich nicht um Kopf und Kragen, oder langweile Sie, William, was auch immer schlimmer sein mag.“
Er dachte noch kurz nach und sagte dann, etwa wie ein Zirkusdirektor, der seine Attraktion ankündigt:
„Prolog!“
Vergeblich erwartete William den Tusch, der aber ausblieb.
Dann:
„Über das Leben Ihres Vaters wurde ein Film gedreht, auf der Grundlage der Biografie, die fleißige Hände schrieben.“
Damit schien der Prolog auch schon beendet.
„Ein Film? Sie meinen … Ein Kinofilm?“
„Selbstverständlich!“
William konnte es nicht glauben, doch bevor er eine Frage zu stellen imstande war, sagte von Stein:
„Dr. Goebbels hat das Drehbuch in eigener Person genehmigt.“
„Dr. Goebbels genehmigt Drehbücher?“
„Ja!“, sagte von Stein.
„Warum nicht? Es handelt sich dabei selbstverständlich nicht um Zensur. Die Entfaltung des kreativen Impetus ist uns heilig. Wir sind ein freies Land, William! Eine Genehmigung durch Dr. Goebbels ist stets Auszeichnung und Ansporn nicht nur für die Filmproduktion.“
Goebbels, den William kennengelernt hatte, und der nach seiner, Williams Einschätzung, mit tausend Augen nicht genug gehabt hätte, tat, bei aller Versicherung über Freizügigkeit, nichts ohne Grund. Doch etwas anderes interessierte William mehr.
„Um was geht es in diesem Film?“
„Um einen deutschen Kriegshelden. Einen deutschen Kapitän! Und dessen Kampf gegen die hegemonialen Interessen Groß-Britanniens während der preußischen Kaiserzeit und während des Weltkriegs.“ sagte von Stein.
William schmunzelte säuerlich:
„Mein Vater verlor kurz nach Kriegsbeginn sein letztes Kommando über ein Boot, Roland! Er betrachtete sich selbst als Papiertiger, und er litt darunter, den Krieg am Schreibtisch verbringen zu müssen.“
Ein seltsamer, kaum zu deutender Blick streifte William.
„Tat er das denn, den Krieg am Schreibtisch verbringen?“
Abgesehen von Offizierscasinos, Bordellen und den Schlafzimmern willfähriger Damen … Ja, dachte William, und was ihn früher aufgebracht und hilflos gemacht, ja, gedemütigt hatte, ließ ihn jetzt – sollte er darüber staunen? - kalt.
„Ich denke schon!“, sagte William, aber so, als ließe er sich gern eines Besseren belehren.
Wieder so ein Blick. Was wusste von Stein?
„Meinen Sie? Denken Sie das wirklich?“
Von Stein machte es spannend.
„Ich war U-Bootfahrer!“, sagte William. Es klang wie eine Entschuldigung.
„Außerdem lebten wir, mein Vater und ich, nur wenige Jahre zusammen, als ich sehr jung war. Später sahen wir uns von Zeit zu Zeit.“
William entschied, dass diese Familienimpression für einen Außenstehenden genügen müsse.
„Wie auch immer, William!“ meinte von Stein.
„Es kommt nicht darauf an. Es ist niemals wichtig, was ein Einzelner wirklich tut oder getan hat.“
Jedes Wort betonend, entgegnete William:
„Worauf kommt es dann an, Roland?“
Von Stein bemühte sich um ein jungenhaftes, unschuldiges Lächeln. Dabei ließ er sich ein wenig von einem inneren Schelm verführen, der sich nur bei besonderen Gelegenheiten zu Wort meldete.
„Es ist wie in den Evangelien, William! Wie in den Geschichten aus der griechischen Mythologie. Wie bei Zarathustra! Allegorie! Wahrheit und Überwahrheit! Verstehen Sie?“
William brummte unbewusst ein paar brummbare Konsonanten. Überwahrheit! grübelte er in all seinen Ressourcen kramend, und gerade als er sich zu fragen begann, ob von Stein ihn auf den Arm nehmen wolle, eröffnete sich ihm die erlösende Erkenntnis:
„Sie meinen Propaganda, Roland!“
„Mir gefällt das Wort Information weitaus besser!“, erwiderte von Stein wie ein Lehrer, der eine korrekte Antwort auf seine Frage erhalten hatte.
William sagte:
„Wie stellte sich mein Vater zu allem?“
„Er ist ein Mann von Welt!“
William stutzte. Hielt ihn von Stein, trotz aller Lobhudelei, trotz des großen Bahnhofs, der ihm in Deutschland bereitet worden war, für einen Gimpel?
„Nun, ich bin auch kein Dummkopf, aber ich würde mich doch ein wenig, nun, Sie werden mir verzeihen, Roland, benutzt fühlen. Wir Amerikaner …“
Er brach ab, als habe er vergessen, was er zu sagen beabsichtigte. Doch das war nicht der Grund.
„Ja?“, drängte von Stein, und signalisierte kämpferische Bereitschaft, das Wort ‚benutzt werden’ zu diskutieren.
„Frei heraus damit, William!“
Aber William versank einen Moment in Betrachtungen, die für fremde Ohren nicht bestimmt waren.
Wer waren denn die Meister der Propaganda, oder wie man die Sache nennen wollte, fragte sich William, wenn nicht sie, die Amerikaner? Die Deutschen waren gute, vortreffliche Schüler. Musterschüler! Aber die Virtuosen und Vorbilder waren sie, die Eroberer eines Kontinents – ein Terminus aus der Fliegersprache geriet in seine Gedanken – in Überschallgeschwindigkeit. Das Zauberwort hieß: Hollywood, die deutsche Übersetzung: Babelsberg! Zwei Orte von höchster politischer Brisanz. Zwei Orte, an denen Werte und Kultur industriell entstanden.
Buffalo Bill! Wie treffend, allegorisch und informativ. Die Eroberung des Westens, ein amerikanisches Thema, das, je öfter es benutzt wurde, frischer, glänzender und jünger anmutete. Nicht sich ähnelnde Geschichten, nein; es war immer dieselbe. Wieder und wieder, und für ein Publikum bestimmt, dass unersättlich war wie Minotaurus und alles verschlang, was ihm vorgesetzt wurde, und das Gefühl genoss, Teil einer neuen Geschichte, einer neuen Wertegemeinschaft zu sein, deren lange Wurzeln in der Genesis verankert schienen.
Gute Pioniere dringen nach Westen vor und böse Rothäute versuchen, sie daran zu hindern. Fortschrittsfeindliche Rothäute mit vehementen Bedenken gegen Ackerbau und Viehzucht und mit unüberbrückbaren Vorbehalten gegen die Eisenbahn. Dazu Liebe, Hass, Pathos, ein einsamer Sheriff und viel freie Fläche, die Prärie. Zum Finale tritt, man könnte eine Uhr danach stellen, die Kavallerie auf, eingeleitet durch das nicht mehr aus dem Kopf zu bekommende, zur Stimme des Heils erhobene Signal des Hornisten. Angriff, Attacke, die Säbel hoch über die Köpfe, die Sporen den Pferden in die Weichen. Deren Hufschlag nehmen Kesselpauken auf und werden kontrastiert von Posaunen und allen aus Blech gefertigten Instrumenten, in die sich blasen lässt. Darüber, hoch in den Wolken, hölzerne Hörner, wie von Engeln intoniert.
Die Rothaut blickt erschrocken auf und lässt den schaurig blutigen Tomahawk sinken. Die Mutter und ihr Kind, das sie schützend an die Brust gedrückt hält, sind gerettet. Die Rothaut schwingt sich in panischer Flucht vom Planwagen herab und springt von hinten auf den ungesattelten Rücken des fleckigen Mustangs. Den Lippen, Teil eines schrecklich bemalten Gesichtes, barbarische Symbole zeugen vom Dienst an unchristlichen Gottheiten, entfährt ein letzter kapitulierender Aufschrei, bevor ihr Weg sie nach Norden oder in die Reservation oder sonst wo hinführt. Das Gute hat gesiegt, woraufhin Geigen süßlich wabernde Akkorde bilden, und eine Melodie, klar und frisch wie Quellwasser, zum Ende führt. Fast möchte man sagen, zum Ende hinauf führt. Dann doch noch der vielstimmige Männerchor, der in einer Art Reitermarsch noch einmal den blau gewandeten, berittenen Soldaten huldigt, den Rettern einer ganzen Nation.
Doch die Rothaut ist selbst schuld und hat nichts anderes verdient. Damit sie die Lektion nicht vergisst, werden ihre Büffel zum Abschuss freigegeben. Die Zivilisation verlangt nach Weideland und Ackerboden, denn Amerika ist hungrig.
Der Weg der Pioniere aber führt nach Westen, jetzt ungestört und unbedroht ins verheißene Land Gottes. Kalifornien! Das Land, das Gott dem alten Abraham zeigte, Palästina, hatte nur einen vorläufigen und vorübergehenden Status. Kalifornien ist das Land, in dem Milch und Honig fließen, das heilige Land, von dem die Schrift Kunde tut, das Land der Auferstehung und Neugeburt, und sie, die Amerikaner, sind das wahre Volk Gottes, die auserwählten.
Nach der Weltwirtschaftskrise, die Hunderttausende Amerikaner obdachlos gemacht hatte, schlimmer als es jeder Wirbelsturm, jedes Erdbeben, jede Überschwemmung vermocht hätte, folgten die Menschen dem Ruf, den Flugblättern und Handzetteln aus dem Westen. Kommt zu uns; hier findet ihr Arbeit und Brot und eine neue Heimat. Hier werden eure Gebete erhört; hier findet ihr den Schutz, den eure Kinder brauchen, um zu selbstbewussten Amerikanern heranzuwachsen. Hier ist das Paradies, der Garten Eden!
Doch als sie eintrafen, erfuhren sie, dass sie nicht die Einzigen waren, und dass die Arbeit nicht für alle reichte. Der Lohn war niedrig, und die Preise für Lebensmittel waren hoch. Doch damit nicht genug: Die Löhne fielen weiter, weil und während immer mehr Menschen aus dem Osten eintrafen. Angebot und Nachfrage verregelten den Markt, und das Wiegeergebnis. Die Höhe des Lohns kannte keine Menschen. Geld und Macht waren die Souveräne in dem vom Paradies abgeteilten Terrain, der Hölle, und sie, die Mächtigen ohne Gesichter und Gewissen, Maschinen und Systeme haben weder das eine noch das andere, sprachen Todesurteile. Die Schwachen starben zuerst.
Die Regierung stand fest hinter den Landbesitzern und Anteilseignern, deren Ahnen Gott einst ins Gelobte Land geführt hatte. Ein Gott, der nicht müde geworden war, im gerechten Kampf gegen die Philister, in diesem Fall Mexikaner, fest an ihrer Seite zu stehen. Die philistrischen Mexikaner hatten das Land zuvor den Rothäuten abgenommen, die, soviel dürfte klar geworden sein, an ihrem Schicksal selbst schuld waren.
Dann traten Menschen hinzu mit offenen Augen und Herzen, und machten sich zum Sprachrohr der Unglücklichen. Sie wurden als Kommunisten beschimpft, verunglimpft, ruiniert und getötet. Das war die Strafe für die Störung der Ordnung und der Ruhe im gelobten Land Gottes.
Und während Kinder verhungern, ihre Väter Krieg gegen die Behörden führen, dreht Hollywood Western. Buffalo Bill und die Eisenbahn! Die Kavallerie in den blauen Hemden, dem Signal des Hornisten folgend, siegt und siegt. Amerika siegt.
Aber Amerika … Das waren doch auch die anderen, wusste William nur zu gut. Die Landarbeiter, die Rothäute, die Latino, die braunen und schwarzen mit all ihren Schattierungen, die Schwulen, die Kommunisten, Araber, Juden, Japaner, Chinesen, viele andere und die, die wie er selbst, gegen Amerika Krieg geführt hatten. Amerika beugte das Knie vor Christus, folgte dem Propheten Mohammed, und verehrte Buddha. Amerika heiligte den Sabbat, diente Göttern und Verkündern, ein einziger, gigantischer Pantheon, oder glaubte nicht, oder bestritt das alles, oder leugnete Teile, Bücher und Kapitel. Nichts von dem, was jemand glaubte und dachte, führte dazu, dass Amerika ihn fortschickte. Das war göttlich! Das war Amerika! Übrig blieb ein kleiner Rest, der sich nicht traute, vom Planwagen herabzusteigen, eine Minderheit, die in ihrer Wagenburg fest saß, und einen Verteidigungskrieg führte. Zu ihren subtilen Waffen – es gab auch andere – zählte die Propaganda, die Information, oder wie man die Sache nennen wollte. Das waren Leute von Welt, dachte William plötzlich ein wenig bitter.
„Wir Amerikaner …“, sagte William endlich.
„Verstehen ja auch einiges von Propaganda.“
„Das will ich meinen!“, gab von Stein zurück. Dann sagte er:
„Jedenfalls … Hier nun in aller Kürze der Film und seine Handlung …“
Von Stein lieferte ein perfektes Exposé:
Zunächst der Aufstieg des unschuldig und unglücklich verarmten jungen Adligen-Treue und Glauben triumphieren über Hinterlist und Verrat – zum Kapitän, dessen Ernennung persönlich durch den Kaiser per Handschlag erfolgt. Die wagnerische Klangkulisse während dieser Szene, so von Stein, entlarve die Gegenwart eines preußischen Herzens in jedermanns Brust, einer preußischen Seele in jedermanns heiligstem Gefühl.
Nach erneutem Weh und Ach, Liebe, Leid und Lust, endlich der Krieg. Der Höhepunkt: Skagerrak! Pulverdampf und Kriegsgeschepper über hohem Wellengang. Gischt spritzt. Wagner, ohne den nur schwer Auskommen ist, läuft zur Hochform auf. Möwen kreischen über brennenden, im Wasser treibenden, demolierten Planken und anderen Wrackteilen. Eine stummelige Tabakspfeife wird in ein Paar bartumrankter Lippen gesteckt. Die Tabakswolke zeichnet sich gegen den bleigrauen Himmel ab. Es knallt und tönt immer noch, und jemand sagt: So’n Schiet! Dann: glückliches Ende und wehende Fahnen. Die Pioniere haben Kalifornien erreicht.
„Mein Vater hatte mit Skagerrak nichts zu tun!“, sagte William.
„Natürlich nicht“, sagte von Stein.
„Er hätte dem Kaiser und seinen Admirälen ins Gesicht gesagt, dass die Zeit der Seeschlachten vorbei ist, dass sich die Kräfteverhältnisse durch ein paar Boote und Kanonen mehr oder weniger nicht ändern und dass man nur gewinnt, wenn der Gegner grobe Fehler begeht, womit man aber nicht rechnen darf. Er hätte ihnen deutlich gemacht, dass die größte Heldentat auf See das Abhören des Feindes ist, effektiv, aber eben nicht sehr spektakulär.“
Von Stein schloss, als befände er seine Ausführung als zu lang geraten.
William sagte:
„Ohne Spektakel keine Propaganda!“
Von Stein nickte:
„Wenn man so will … Ja! So einfach kann Wahrheit sein.“
Einige wenige Minuten vergingen, in denen sich ein Kellner oder Ober an ihrem Tisch betätigte und ein schattenhafter Mitarbeiter von Steins seinem Chef etwas ins Ohr flüsterte, worauf sich dieser entschuldigte, und William Buffalo Bill, dem Namensvetter, einen letzten Gedanken nachsandte.
„Herr von Stein!“
William wechselte ins Deutsche zurück.
„Wann und wie haben Sie meinen Vater kennengelernt?“
Von Stein korrigierte den Sitz seiner Krawatte, der nicht vorbildlicher hätte sein können.
„Das ist nicht schnell erzählt“, antwortete von Stein.
„Ihr Vater befand sich seit November 1918 in Berlin. Ich kam im Dezember dorthin. Eine Zeit voller Dramatik und Widersprüche, Angst, Hoffnung, Schmerz und … Wie soll ich es nennen? Gier nach Leben? Noch immer litt Deutschland unter der Handelsblockade. Wer Geld hatte, konnte kaum das Nötigste dafür kaufen. Es wurde gebettelt und gefroren. Eine graue, eine harte Zeit, und doch …“
Die letzten Worte schienen dem Wachrütteln von Erinnerung zu dienen, und William spürte, dass Unterbrechungen und Fragen jetzt keinen Platz hatten. So wartete er geduldig, bis von Stein fortfuhr.
„Während der letzten Kriegsmonate war ich Oberleutnant im letzten kaiserlichen Kavallerieregiment. Doch um Sie nicht auf die Folter zu spannen: Es gab in dieser Einheit nicht ein einziges Pferd. Es handelte sich um eine spezielle Akademie, auf der die Kunst der Diplomatie gelehrt wurde, also Dinge, die im Frieden notwendig, im Krieg unerlässlich sind. Ein höchst komplexes Betätigungsfeld, das, so scheint es mir, alle wissenschaftlichen Disziplinen streift und miteinander verbindet. Ich darf hinzufügen: Ein Berufsbild, das seines gleichen sucht. Mit einem Wort: Ich wurde Spion!“
„Spion?“
Das Wort verursachte William Hustenreiz, war aber gleichzeitig für eine gewisse Erheiterung verantwortlich. Doch von Stein schien diesen Teil seiner Erzählung als erledigt zu betrachten und schloss, scheinbar ohne Williams Reaktion zu bemerken, mit den Worten:
„Ich ging, wie man sagt, meinen Weg.“
„Ich verstehe!“, sagte William, als er sich wieder fest im Griff hatte, war sich seiner Behauptung aber nicht sicher.
Der Weg, von dem von Stein zu berichten nicht für nötig hielt, zeichnete sich dennoch durch bemerkenswerte Etappen aus. Der kleine Roland war bei seinem Onkel, Bruder des Vaters und Alleinerben des pommerschen Grundbesitzes aufgewachsen, nachdem dessen jüngster Bruder, eben Rolands Vater, ein schneidiger Ulanenrittmeister, bei einem Duell – wieder einmal war es, wie gesagt wurde, um ein Weibsbild gegangen – ums Leben gekommen war. Hernach hatte es die Mutter des Knaben, nun verwitwet, gewagt, sich erneut zu vermählen, und zwar unter ihrem Stand. Das war Grund genug gewesen, ihr den Sohn zu entziehen. Mit ihrer unerhörten Entscheidung, gegen Tradition und Gutdünken der Familie, die jetzt das Recht gehabt hatte, sie wie eine Bettlerin von der Türschwelle zu weisen, ohne ihr ein trockenes Stück Brot zu überlassen, hatte sie alle Rechte, und waren es noch so wenige und unbedeutende, verwirkt.
Rolands Onkel, der so alt war, dass er dessen Großvater hätte sein können, ein eifriger Tagebuchschreiber, Rechtfertiger seines Standes und begeisterter Sammler von Bonmonts und Anekdoten, war seinem König und dem eisernen Kanzler, Bismarck, dem er äußerlich ähnelte und das nötige und mögliche dazu beitrug, ohne Murren in alle Kriege und auf alle Schlachtfelder gefolgt. Dies ohne größere Blessuren davon zu tragen, was ihn zu berechtigen schien, stets zu erklären, es sei alles nicht so schlimm gewesen. Holstein, Königsgrätz, Frankreich… Man habe eben seine Pflicht getan, lautete das Credo.
Was Gefahr und Gemetzel vergeblich versucht hatten, dem Onkel das Leben zu nehmen, versuchte dieser mit Essen, Trinken und jenem sündhaften Treiben nachzuholen, das bereits seinem jüngeren Bruder, jener weniger diskret, das Leben gekostet hatte. Kurz nachdem Roland mit der Ausbildung zum Kadetten begonnen hatte, segnete der Onkel das Zeitliche in den drallen Armen einer jungen Magd. Der letzte Gedanke des Onkels fand nicht mehr Eingang in seine Journale. Der letzte Gegner sei der süßeste gewesen, aber auch der unüberwindlichste.
Die Mutter sah Roland niemals wieder. Er gestattete es sich nicht. Er fragte nicht nach ihrem Schicksal, und schließlich verblassten Gesicht und Erinnerungen, verdrängt von einer Erziehung, die Herzenswärme durch Pflichterfüllung ersetzte und durch Drill den jungen Leib stählte, der nun imstande war, alle Gefühle fest zu verschließen.
Von Stein fuhr fort:
„Es war die sogenannte Revolution, die Ihren Vater und mich zusammen führte, William. Eine rote Orgie der Verblendung und … des Verrats. Es war der Krieg nach dem Krieg. Die Aussicht auf Waffenstillstand und Friedensverhandlungen waren nötig, damit auf deutschen Straßen der erste Schuss des Krieges fiel und Blut floss. Paradox, nicht wahr?“
William wusste nur zu genau, welche Bedeutung das Wort Verrat in preußischen Militär- und Adelskreisen hatte. Die Ehre war ein Gut, das über dem Leben stand. Ein Verräter besaß keine Ehre. Er war vogelfrei. Und er entehrte nicht nur sich selbst, sein eigenes, armseliges Dasein, sondern zerstörte die Reputation seiner Familie. Eine gesellschaftliche Katastrophe mit möglichen, weitreichenden Folgen.
„Ich habe in amerikanischen Zeitungen über die Revolution in Deutschland gelesen.“
Von Steins Augen betrachteten William mit einem Ausdruck von Mitleid. Und als hätte er nicht recht verstanden, vielleicht um die amerikanische Presselandschaft nicht kritisieren zu müssen, sagte er ein wenig zerstreut:
„Sie befanden sich damals in den Vereinigten Staaten, William! Daher können Sie nicht wissen, was los war. Was wirklich los war!“
William sagte:
„Vielleicht wird es Zeit, mich dafür zu interessieren.“
„Vielleicht“, sagte von Stein bedeutungsvoll. „Vielleicht.“
„Ich erwähnte die letzten Kriegsmonate und das Kriegsende. Ehrlich gesagt …“
Von Stein lächelte entwaffnend:
„Es rebellieren meine innersten Gefühle gegen diese Bezeichnungen. Nicht, dass sie ganz und gar unzutreffend wären, aber sie bedürfen der historischen Erläuterung.“
Von Stein sprach Deutsch und benutzte dennoch den Vornamen seines Gegenübers, wobei er bis auf Weiteres blieb, und woran sich auch William hielt.
„Nach den Verhandlungen von Brest-Litowsk über die Kapitulation Russlands, an denen Ihr Vater auf Wunsch Lenins teilnahm, William …“
Zwei Augenpaare trafen sich und kommunizierten stumm eine Zeitspanne lang, die sich nicht messen lassen wollte. Doch bevor William etwas sagen konnte, hob von Stein sanft aber bestimmt und Einhalt gebietend die Hand, als sei es besser, später über diesen Punkt, falls nötig, zu sprechen. Er, William, möge mit der Information einstweilen zufrieden sein, die ohnehin schwer genug wiege.
„…kam es zur Verstärkung der französischen Front durch mehr als eine Million Soldaten aus dem Osten. Der Erfolg, den sich die Verantwortlichen versprachen, eine schnelle Wende des Kriegsgeschehens, stellte sich jedoch nicht ein. Die Männer kamen von einer Front, nicht aus der Heimat oder der Etappe. Sie waren müde. Dass sie einen Krieg gewonnen hatten, änderte daran nichts. Die Folge: Enttäuschung auf deutscher und Triumph auf alliierter Seite. Nun ja, der Kurs fiel halt ein wenig.
Davon abgesehen und nach den Tatsachen, war im Westen alles wie gehabt und unverändert, in diesem, das sei zugestanden, zähen Krieg mit seinen zermürbenden Pattsituationen. Das Jahr achtzehn war, abgesehen von der Gegenwart der Amerikaner in Frankreich, kaum anders als das Jahr siebzehn, als sechzehn und fünfzehn. Doch der Vorteil durch die Verstärkungen aus dem Osten über kurz oder lang lag klar auf deutscher, auf unserer Seite. Nur eine Frage der Zeit bis zum Sieg, der sich übrigens, so Experten, auch ohne die Verbände aus Russland eingestellt hätte. Die Argumente dafür wie, Deutschland habe über die besseren Soldaten, die besseren Offiziere, letztlich über die reicheren Reserven verfügt, müssen wir hier und jetzt nicht diskutieren. Denn es kommt nicht darauf an, was wir heute wissen.“
In diesem Moment bedauerte es William, sich während seiner amerikanischen Jahre kaum für Geschichte, am wenigsten für die deutsche, interessiert zu haben. Es hieß jedoch im allgemeinen, Deutschland habe im Herbst 1918 kapituliert. Wer aber gab einen Schritt vor dem Ziel, wenn alle Vorteile auf seiner Seite lagen, das Rennen verloren? Und was waren das für Experten, die heute Planspiele spielten? Doch immerhin deutsche, mutmaßte William. Wo waren sie im Herbst 1918 gewesen? Was hatte es tatsächlich mit den letzten Kriegsmonaten auf sich?
Von Stein fuhr fort und sagte:
„Das Hauptquartier der Obersten Heeresleitung befand sich in Spa in Belgien. An ihrer Spitze standen die Generäle Hindenburg und Ludendorff. Hindenburg gab seinen guten Namen, Ludendorff diente mit seinem Sachverstand und seinem militärischen Können. Der Kaiser war Oberbefehlshaber über alle Streitkräfte, und sein Kanzle Georg von Hertling war mit der Führung des Reiches betraut. Tatsächlich aber hatte sich so etwas wie eine Regentschaft der Vernunft ergeben.“
Von Stein lächelte über seine Formulierung.
„Seit 1916 unterstanden neben der Armee auch die Wirtschaft und die Verwaltung des Deutschen Reiches der Obersten Heeresleitung. Alles Tun und Trachten sollte in denselben Strom münden. Jeder Einzelne hatte sich dem einen Ziel zu unterwerfen, der einen Aufgabe zu dienen. Und das Gros der Deutschen war damit nicht nur zufrieden, sondern erfüllte mit Begeisterung und unter großer Opferbereitschaft seine Pflicht, unabhängig von der politischen Gesinnung. Der Reichstag stand hinter der OHL, und es waren die Parteien, die die subversiven Elemente in ihren Reihen in Schach hielten, aussonderten und auch der Justiz überlieferten. Das blieb so bis Ende 1917. Doch dann, nach der Entmachtung der zaristischen Regierung und der Kapitulation Russlands unter den Bolschewiki, strömte die feindliche Agitation ins Reich, und viele gingen ihr auf den Leim. Waren früher vereinzelt Forderungen nach der Beendigung des Krieges, ja, nach Abdankung der Regierung laut geworden, so forderte die Straße jetzt eine Revolution nach russischem Vorbild.“
William glaubte etwas wie Abscheu in von Steins Worten zu erkennen, doch der sprach beherrscht weiter:
„Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hatte sich in verschiedenen Reden darüber ausgebreitet, unter welchen Bedingungen die Kapitulation Deutschlands annehmbar sei. Später sprach man von den vierzehn Punkten. Wesentlich dabei waren die Demokratisierung Deutschlands nach amerikanischem Muster und Vorbild sowie die Abdankung des Kaisers und die Zerschlagung der Monarchie. Damals gab es Stimmen, dass gerade angesichts solcher Forderungen der deutsche Schulterschluss den Sieg im Westen zur Formsache machen müsse. Jetzt erst recht, solle die Parole lauten.“
Von Stein dachte kurz nach, bevor er weitersprach:
„Wilson kann man keinen Vorwurf machen. Er war Diplomat, ein Rhetoriker, der mit Worten, statt mit Kanonen schoss. Seit Amerika in den Krieg eingetreten war, bombardierte die internationale Presse – Hut ab vor dieser Artillerie – Deutschland mit Kampagnen des gleichen zersetzenden Inhalts, und es ist wohl so, dass ein guter Deutscher glaubt, was in der Zeitung steht.“
Von Stein schmunzelte über die eigene Ironie.
„Natürlich hat sich im Juli 1914 niemand vorstellen können, wie lang dieser Krieg dauern und welche Opfer er fordern würde. Und natürlich gab es Klagen über Versorgungsengpässe der Zivilbevölkerung. Die gab es in Frankreich und England auch, von Russland ganz zu schweigen. Aber ein Soldat kann nicht heimgehen, wenn er keine Lust mehr hat, und die Menschen in der Heimat, Zivilisten, können nicht den Krieg beenden, während die Soldaten draußen in den Gräben liegen und ihre Haut riskieren.“
Von Steins Gesicht nahm einen ernsten Zug an:
„Genau das geschah aber. Am 4. Oktober unterbreiteten Reichsregierung und Reichstag, zweifelhaft in ihrer Legitimation, den Alliierten das Angebot, Waffenstillstandsverhandlungen führen zu wollen. Damit brach sie los, die sogenannte Revolution, jedem Gesetz, jedem Vertrag, jeder Verantwortung, jeder Anständigkeit entgegen.
Friedrich Ebert, Vorsitzender der SPD, welche die größte Fraktion im Reichstag bildete, und seine Genossen, schlossen sich mit den Chefs der liberalen und bürgerlichen Parteien zusammen, und baten den Kaiser höflich um Abdankung, damit dieser Teil der Bedingungen der Alliierten erfüllt werde. Gleichzeitig wurden Hindenburg und Ludendorff abgesetzt. Kurz: ein Putsch! Blanke Anarchie! Ludendorff wurde sogar mit Verhaftung gedroht, und er setzte sich nach Skandinavien ab. An seine Stelle trat nun General Wilhelm Groener, von dem noch zu sprechen sein wird. Hindenburg dagegen genoß eine gewisse Duldung, deren Form und Hintergrund sich erst Jahre später abzeichnen sollte.
Der Kaiser reagierte nur insoweit auf die Forderungen Eberts und seiner Handlanger, indem er Prinz Max von Baden als neuen Reichskanzler einsetzte, als Ersatz für den aus tiefem Protest und Abscheu über den Verrat zurückgetretenen Reichskanzler von Hertling, doch der Prinz, ein Liberaler, machte von der ersten Stunde an gemeinsame Sache mit Ebert. Man muss konstatieren, dass Wilhelm schon bessere Personalentscheidungen getroffen hatte. So, wie er zuletzt, vielleicht insgesamt während des Krieges, eine beklagenswerte Figur abgab. Ein Mann, der bestenfalls reagierte und sich schmollend und beleidigt in die schützenden Arme seiner Garde zurückzog. Er, der Urheber eines neuen Monarchieverständnisses sah sich jetzt persönlich angegriffen. Das war er nicht gewohnt. Abdankung? Als Deutscher Kaiser? Nun gut! Warum nicht? Doch als preußischer König? Nein, da sah Wilhelm keine Möglichkeit!
Die Oberste Heeresleitung unter den Generalen Hindenburg, den man nicht gehen lassen wollte, und Groener– wenn man so will, ihrer Macht beraubt – lehnte die Antwort der Alliierten, neue unannehmbare Bedingungen, ab. Nicht so der Reichstag, der sich inzwischen durch Änderung der Verfassung des Oberbefehls über die Streitkräfte bemächtigt hatte.
Am 24. Oktober erging ein Flottenbefehl der Admiralität in Kiel. Der Angriff auf die Royal Navy sollte deutlich machen, dass der Krieg nicht verloren sei und vonseiten der kaiserlichen Marine weiter geführt werde. Niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass jemand, auch nicht eine sozialdemokratische Regierung, die neuen Bedingungen der Alliierten akzeptieren würde. Auch zeigte die provisorische Reichsregierung von eigener Gnade oder der Reichstag keinerlei Präsenz in Kiel oder Wilhelmshaven. Die neuen Herrschaftsverhältnisse waren nicht spürbar. Die Genossen wagten es womöglich nicht, ihre sicheren Unterkünfte in Berlin zu verlassen. Es war, als hätte man dort vergessen, dass Deutschland über eine Marine verfügte. Doch gleich werden Sie sehen, William, dass dies nicht der Fall war.“
Trotz der Ironie und der kantigen Worte erschien von Stein nicht erregt. William gewann den Eindruck, dass der Berichterstatter die Vorgänge so schilderte, wie er sie tatsächlich sah und in Erinnerung hatte. Nicht das Geringste deutete auf den Versuch einer Beeinflussung hin. Im Gegenteil erschien von Stein um Objektivität bemüht. Die komödiantischen Ergänzungen änderten daran nichts. Er fuhr fort:
„Am Abend des 30. Oktober begannen die ersten Matrosen zu meutern. Von der einfachen Befehlsverweigerung, über die Niederlegung des Dienstes, bis hin zur Sabotage und Angriffe auf Vorgesetzte reichte die unrühmliche Palette. An diesem Tag lag der für den Kampfeinsatz vorgesehene Flottenteil in Wilhelmshaven auf der Reede. Doch während die Admiräle über Tag und Stunde des Angriffs berieten, geriet die Situation außer Kontrolle. Die Meuterer, die nach Kriegsrecht alle an die Wand gestellt werden konnten, genossen enormen Zulauf. Es entstand eine Lage, die kein deutscher Marineoffizier je für möglich gehalten hätte. Befehlsverweigerung, Meuterei-Differenzierung und Definition können wir uns an dieser Stelle schenken – hatte es einfach nicht zu geben, war den Herren Offizieren nicht bekannt, war in den Handbüchern nicht abgehandelt. Dantes Höllenkreise! Das Ende der Zeiten.“
Von Stein schüttelte den Kopf. Offensichtlich maß er den Offizieren, wenn schon keine Mitschuld an den Vorgängen, doch aber ein gewisses Versagen zu. William erinnerte sich an seine eigene Zeit bei der Marine. Viele Vorgesetzte waren Junker gewesen, Offiziere seit Generationen, oft stur und borniert, die Mannschaften wie Halbfreie, ja, wie Rechtlose behandelten, als Menschen zweiter Klasse. War es das, oder etwas Ähnliches, woran von Stein dachte? Deckten sich hier Erfahrungen?
Von Stein dachte nach und sagte dann:
„Niemals hat es etwas Vergleichbares, in dieser Größenordnung, den Sturm auf die Bastille eingeschlossen, gegeben, mit einer Ausnahme: die bolschewistische Revolution in Russland, ein Jahr zuvor. Unterstellt man darüber hinaus, dass ein solcher, nennen wir ihn ruhig Aufstand, nicht aus heiterem Himmel fällt, sondern Köpfen entspringt, begleitet und durchgeführt werden muss, dann wird klar, welche Büchse sich geöffnet hatte. Und wohin sollten die Spuren anders führen als in die Hauptstadt, nach Berlin. Tatsache ist, dass die deutsche Linke in diesen Tagen ein weitverzweigtes System von Parteien, Gewerkschaften, Gruppen und Bündnissen war. Von der SPD Eberts bis hin zu den Spartakisten, über Sozialisten und Marxisten, den Gesandten Lenins und die Götter mögen wissen, wer noch am Werke war.“
Erneut hatte von Stein die Vorgänge des Novembers 1918 mit der russischen Revolution in Verbindung gebracht, und ohne sich Sorgen über Beweise zu machen, ließ er sich nun zu einer Art Resümee herab, das William wegen seiner Kürze überraschte:
„Ich denke, dass alles, was von jetzt an und bis dahin geschah, eine bolschewistische, aus Russland gesteuerte Aktion war, von deutschen Helfershelfern und Verrätern ausgeführt. Hinter allem der rote Zar: Wladimir Illjitsch Uljanow, genannt Lenin!“
Lenin! Wieder dieser Name, diese nebelhafte Gestalt, die nur aus einer Silhouette zu bestehen schien, inzwischen längst verstorben und von Stalin beerbt. Lenin, der zum Inbegriff des Bösen geworden war. Der schwarze Mann, mit dem man Kinder disziplinierte. Der Königsmörder. Der neue Unchrist. Der darauf bestanden hatte, dass Wolf in Brest-Litowsk dabei war. Welche Verbindung bestand zwischen diesem Mann und dem Vater? Und wie hatte es zu solch einer Verbindung kommen können? William wurde sich klar darüber, dass er Deutschland nicht verlassen konnte, ohne noch eine Menge Fragen zu stellen.
„Denken Sie das tatsächlich, Roland? Lenin?“ fragte William.
„Es gibt kaum eine andere, nein, keine andere Erklärung!“ lautete die Antwort, die eine Spur zu sicher klang und zu einfach.
„Aber lassen Sie mich weiter erzählen, William:
„Nachdem sich die Marineleitung unter Admiral Franz von Hipper ihrer Mannschaften nicht mehr sicher war, wurde der Angriff auf die Royal Navy abgesagt. Stattdessen befahlen die Kommandierenden ein Manöver in der Nordsee, das die zum Zerreißen gespannte Situation entzerren sollte und das auch tatsächlich durchgeführt wurde. Daran schloss sich die Verhaftung der Rädelsführer des Aufstands an.“
William ahnte, dass das nur der Schluss eines Kapitels war.
„Und damit gossen sie Öl ins Feuer!“
Von Stein blickte überrascht auf:
„Was hätten sie machen sollen? Amnestie gewähren? Warum? Weil sie, die Aufrührer, so zahlreich waren?“
„Natürlich nicht!“, sagte William.
Für Befehlsverweigerung und Meuterei war keine Gnade zu erwarten. Nirgendwo auf der Welt und in keinem politischen System. Gründe spielten keine Rolle. Ohne den prompten, bedingungslosen Gehorsam des Untergebenen brach das Gebäude zusammen, löste sich die Struktur auf. Über Disziplin durfte nicht diskutiert werden. Sie war unumstößliches Grundgesetz. Der Soldat, der Matrose, hatte zu schweigen und hinzunehmen, kommentarlos, um was es auch immer gehen mochte. William war froh, das hinter sich gelassen zu haben. Für alle Zeit! Er sagte:
„Aber jetzt ging es erst richtig los, oder?“
Von Stein nickte.
„Es floss Blut auf beiden Seiten, und ein paar Tage später befand sich Kiel in den Händen von mehr als vierzigtausend Matrosen und Arbeitern, die sich ihnen angeschlossen hatten. Die Rädelsführer wurden befreit, der Gouverneur der Militärbasis zum Teufel gejagt. Die Truppen, die dieser zuvor noch zu Hilfe gerufen hatte, schlossen sich in großer Zahl den aufständischen an. Kein Offizier war sich seines Lebens mehr sicher. Eine perfekte Katastrophe! Eine grandiose Schweinerei!“
Es schien, als hätte von Stein den kleinen verbalen Ausrutscher nötig gehabt. Bedauern darüber ließ der Mann, dessen Ausdruck und Wortwahl bis dahin ohne Makel gewesen war, nicht spüren. Er fuhr fort:
„Ein paar Tage später erschien Gustav Noske in Kiel.“
Der Blick von Steins schien zu sagen: Merk dir diesen Namen gut, William. Er ist von Bedeutung.
„Gustav Noske, ein alter SPD-Kämpe, Reichstagsabgeordneter und Eberts Hagen von Tronje und Mann für alle Fälle, stellte sich an die Spitze der Aufständischen, die von der Marineleitung längst nichts mehr zu befürchten hatten. Hipper und seine Leute hatten den Schwanz eingezogen, und sich damit selbst in den Dunstkreis von Verrat gebracht. Aber das ist meine persönliche Meinung, William.
Noske ließ sich von den Meuterern und ihren Komplizen zum Vorsitzenden des Revolutionsrates wählen und wurde kurz darauf von der Regierung in Berlin zum Gouverneur der Marinebasis Kiel ernannt. Mit diesem Titel konnten die Herren Politiker mehr anfangen, als mit dem anderen, der für sie in diesen Stunden vielleicht kaum mehr war, als der eines Räuberhauptmannes. Wie auch immer.
Wichtig ist nur, dass sich der Aufstand jetzt ausbreiten konnte. Manche sagten Lauffeuer, andere sprachen von Flächenbrand. Ich denke, das hängt ein bisschen von der Perspektive ab, nicht wahr? Und während sich die rote Welle über das Reichsgebiet ergoss und ausbreitete, akzeptierten Ebert und seine Freunde die Bedingungen der Alliierten: Einstellung aller Kampfhandlungen, Rücktritt des Kaisers, Zerschlagung der Monarchien, Räumung der eroberten Gebiete, einschließlich der im Osten, das hieß Annullierung von Brest-Litowsk, Reparationszahlungen an die Alliierten, wie es Geschlagenen obliegt, die wir nicht waren und anderes abscheuliches mehr.“
Von Stein strich sich über das Kinn, als streiche er einen imaginären Bart glatt.
„Solche Forderungen …“, sagte er mild, … „können Basis von Verhandlungen sein. Das war hier nicht der Fall. Es kann um Schadenersatz gehen. Das war hier ebenfalls nicht der Fall. Es ging um Bereicherung und Demütigung, denn die Summen und Preise standen nicht zur Verhandlung. Entweder, oder! Die einen verlangten unsere Haut, die anderen gaben sie bereitwillig und ohne Not her.“
William schwieg und von Stein setzte seinen Bericht fort:
„Ich muss nicht erwähnen, das jetzt der Druck auf den Kaiser, auf Wilhelm II. wuchs. Immer lauter, immer eindeutiger, jedenfalls ohne den schuldigen Respekt, allzumal würdelos, prasselten die Worte, gesprochen, geschrieben, wenn man so will, von allen Seiten, auf den Kaiser ein. Ich weiß nicht genau …“
Auf von Steins Gesicht legte sich ein Lächeln, das man peinlich berührt nennen konnte.
„..ob Wilhelm standhaft und charakterfest war, in diesen letzten Tagen seiner Regentschaft, oder ob phlegmatisch, ignorant und schlecht beraten, wie ihm vorgeworfen wird. Jedenfalls: Er tat das, was er seit annähernd drei Jahren getan hatte: nichts! Dann standen die roten Garden endlich auch vor den Mauern Berlins, nachdem sie viele andere große und kleine Städte des Reiches eingenommen hatten. Jetzt erklärte Max von Baden eigenmächtig und wider besseres Wissen, den Rücktritt des Kaisers und seinen eigenen, vielleicht das schlechte Gewissen, gleich dazu. Zweifel an der Richtigkeit der Meldung über die Abdankung Wilhelms kamen nicht auf. Man glaubte, was man glauben wollte. Der Kaiser allerdings, überrascht und überfordert, floh nach Spa und später nach Holland. Dort lebt er heute noch und hat nie aufgehört, an seine Rückkehr, oder die seines Sohnes Wilhelm auf den Kaiserthron zu glauben. Und er hat auch nie aufgehört, sich als preußischer König zu fühlen. Nun gut, es wird gesagt, er verbringe seine Zeit damit, Holz zu hacken.“
Den Genuss an der eigenen Ironie ließ sich von Stein jetzt nicht anmerken. Vielleicht empfand er es auch nicht so, denn das Folgende trug er mit großem Ernst vor:
„Damit war der Weg frei für das Unerhörte, der Schlag ins Gesicht, die Demütigung, die nicht verzeihbar ist. Unbesiegt im Felde, den Heldentod gestorben, den Mann, den Vater, den Bruder geopfert, heldenhaft den Kampf in der Heimat geführt, in Fabriken und Werkstätten … Und dann: Während der Sieg nur noch eine Frage der Zeit ist, kapitulieren Männer, die in bequemen Sesseln sitzen und nach Posten und Pöstchen, nach Ämtern und Pfründen gieren.“
Dann nach einer kurzen Pause erneut sehr ernst:
„Vielen guten Männern drehte sich der Magen um. Ich darf das sagen, denn nun trete ich selbst in meinen Bericht ein. In diesen Tagen kam ich nach Spa, um im Stabe General Groeners Dienst zu tun. Von der ersten Minute an spürte und vernahm ich die Bereitschaft eines jeden Mannes und Offiziers dort, mit der Waffe in der Hand gegen die sogenannte Revolution vorzugehen, und sich ihr in den Weg zu stellen. Ich wusste, das waren keine leeren Worte! Keine Phrasen! Wir standen mit dem Rücken zur Wand und hatten nichts zu verlieren. Hass auf Franzosen und Engländer habe ich nicht gespürt. Umso mehr dagegen auf die Verräter in Berlin.“
Von Stein schien seine Erinnerung zu beleben, der eigenen Person, die er ins Spiel gebracht hatte, ein Gewicht zu geben, und seine Gedanken zu ordnen.
„Kommen wir zum 9. November, William! Es war der Samstag vor Beginn der Waffenstillstandsverhandlung in Compiégne, ein Wochenende, an dem sich die Ereignisse überschlugen, und ein Stück bittere deutsche Geschichte geschrieben wurde. Gleich dreimal wurde die Republik ausgerufen.“
Von Stein unterdrückte mit mäßigem Erfolg ein höhnisches Lächeln.
„Drei Mal?“
William staunte.
„Zuerst Scheidemann, dann Liebknecht, schließlich Ebert selbst, der sich nun nach dem Rücktritt des Prinzen von Baden Reichskanzler nannte.“
„Also die Führer der verschiedenen Lager?“, mutmaßte William.
„Mitnichten!“, stellte von Stein richtig.
„Philipp Scheidemann war der Mann gleich nach Ebert. Zweifellos verärgerte er seinen Chef durch sein Vorpreschen. Doch er handelte wohl im guten Glauben, womit gemeint ist, er wollte den Spartakisten und Liebknecht zuvor kommen, die so etwas wie eine Sowjetrepublik nach russischem Vorbild auszurufen gedachten.“
An dieser Stelle glaubte von Stein etwas erklären zu müssen:
„Während dieser ganzen Zeit, bis Ende Januar 1919 und darüber hinaus, bespitzelten sich alle Parteiungen gegenseitig. Denunziation, Korruption, Bestechung, Erpressung, Totschlag … Sie können sich etwas aussuchen, William, und Sie würden immer richtig liegen. Es war nichts anderes als Krieg. Bürgerkrieg! Niemand traute dem anderen.
Als die SPD erfuhr, was die Spartakisten vorhatten, handelte sie eben. Wo Ebert selbst in diesem Moment steckte, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie gesagt: Es war ein turbulenter Tag dieser 9. November 1918.“
„Warum beließ es Ebert nicht dabei?“
„Chefsache ist Chefsache!“, sagte von Stein.
„Schon in Grimms Märchen hatte der Held stets das letzte Wort. Erst danach das: Und wenn sie nicht gestorben sind …“
„Okay!“, sagte William, diesen Punkt akzeptierend.
„Aber sagen Sie mir noch ein Wort über die Gruppen und ihre Rivalität untereinander, Roland. Von Zusammenarbeit kann ja wohl nicht gesprochen werden?“
Von Stein winkte ab:
„Ja und nein!“, sagte er.
„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Streit über den Weg, nicht über das Ziel! Und wenn es etwas einbringt …“
Damit war für den Mitarbeiter des Ministeriums die Frage erschöpfend beantwortet.
„Und die Spartakisten und Spartakus?“
Ohne den anfänglichen Hohn in seiner Stimme zu verbergen, antwortete der Gefragte:
„Ein Befreier der Sklaven im alten Rom, der selbst ein Sklave war, aber auch ein Gladiator. Vergessen wir das nicht! Einer, der am Kreuz endete. Vielleicht ein Märtyrer! Die Leute, die sich nach ihm benannten, hatten Sinn für große Bilder.“
„Erzählen Sie mir von diesen Leuten, Roland“, forderte William.
Es war von Stein anzumerken, dass er seinen Bericht lieber in eine andere Richtung getragen hätte. Doch er verschloß sich nicht und hütete sich davor, den Schulmeister zu spielen.
„Dieser Karl Liebknecht war unter all den Aufrührern derjenige, der das Zeug hatte, in die Fußstapfen Lenins zu treten. An seinen Lippen hingen die Massen. Für ihn waren sie bereit, die Waffe in die Hand zu nehmen. Ein gefährlicher Mann unter Biedermännern. Natürlich war alles, was er sagte eine Mischung aus Theorie und heißer Luft, Demagogie und Hochverrat, und er hatte bis zum Ausbruch der Unruhen genau wegen diesem Verbrechen eingesessen. Die Revolution hatte seine Gefängnistür geöffnet. Explizit hineingebracht hatte ihn seine Rede vom 1. Mai 1916, in der er offen und vor großer Kulisse den Kaiser und die Regierung angriff und das Ende des Krieges forderte. Aber wie er das tat … Wie er die Menschen berührte… Respekt! Wahrhaftig ein Führer.“