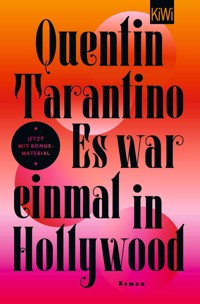12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Quentin Tarantino gehört nicht nur zu den berühmtesten Filmemachern der Gegenwart, sondern ist wohl auch der mitreißendste Filmliebhaber der Welt. Jahrelang hat er in Interviews davon gesprochen, dass er eines Tages Bücher über Filme schreiben wird. Jetzt, mit CINEMA SPECULATION, ist es soweit, und das Ergebnis ist alles, was sich seine Fans und alle Filmliebhaber erhofft haben. Dieses Buch, das sich um die wichtigsten amerikanischen Filme der 1970er Jahre dreht, die er alle zum ersten Mal als junger Kinobesucher gesehen hat, ist durchwoben von überraschenden Erzählungen aus erster Hand über Tarantinos Leben als junger Mann in L.A – ein Blick auf das Hollywood der Siebziger, so nah und doch so fern. Dies sind die ersten Jahre der berühmten Tarantino-Ursprungsgeschichte, die uns der Mann selbst erzählt. Es ist zugleich Filmkritik, Filmtheorie, ein Meisterwerk der Reportage und eine wunderbare persönliche Geschichte, geschrieben mit der einzigartigen Stimme, die man sofort als die von Quentin Tarantino erkennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Quentin Tarantino
Cinema Speculation
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Quentin Tarantino
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Quentin Tarantino
Quentin Tarantino, 1963 geboren, zweifacher Oscarpreisträger, ist einer der bekanntesten Regisseure der Welt. Seine Werke wie »Pulp Fiction«, »Kill Bill«, »Inglourious Basterds« oder »Django Unchained« prägen unser kulturelles Gedächtnis. Sein jüngster Film »Once upon a Time in Hollywood« wurde allein in Deutschland von fast zwei Millionen Kinobesuchern gesehen.
Stephan Kleiner, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u.a. Geoff Dyer, Michel Houellebecq, Gabriel Talent und Hanya Yanagihara ins Deutsche.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Dieses Buch, das die wichtigsten amerikanischen Filme der 1970er durchleuchtet, die Quentin Tarantino zum ersten Mal als junger Kinobesucher gesehen hat, ist durchwoben von überraschenden Erzählungen aus erster Hand über Tarantinos Leben als junger Mann in L.A. – ein Blick auf das Hollywood der Siebziger, so nah und doch so fern. Dies sind die ersten Jahre der berühmten Tarantino-Ursprungsgeschichte, die er uns selbst erzählt. Das lang erwartete Memoir des größten Filmnerds unserer Zeit.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Cinema Speculation« bei HarperCollins Publishers, New York
Copyright © 2022 by Visiona Romantica, Inc.
All Rights Reserved
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
© 2022, 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten.
Covergestaltung und -motiv: © Marion Blomeyer / Lowlypaper
ISBN978-3-462-31136-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der kleine Q guckt die großen Filme
Bullitt
Dirty Harry
Deliverance
The Getaway
The Outfit
Samurai der zweiten Garde
New Hollywood in den Siebzigern
Sisters (dt. Die Schwestern des Bösen)
Daisy Miller
Taxi Driver
Cinema Speculation
Rolling Thunder
Paradise Alley
Escape from Alcatraz
Hardcore
The Funhouse (dt. Das Kabinett des Schreckens)
*Floyd-Fußnote
Rechtenachweis
Der kleine Q guckt die großen Filme
Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger verfügte das Tiffany Theater über einen gewissen kulturellen Nimbus, durch den es sich von den anderen großen Kinos in Hollywood abhob. Zum einen lag es nicht am Hollywood Boulevard. Mit Ausnahme von Pacifics Cinerama Dome, das allein an der Ecke Sunset Boulevard und Vine Street prangte, lagen die anderen großen Lichtspielhäuser alle an Old Hollywoods letzter Touristen-Zuflucht – dem Hollywood Boulevard.
Tagsüber sah man noch Touristen den Boulevard entlanggehen, das Hollywood Wax Museum besuchen, zu ihren Füßen hinunterschauen und die Namen auf dem Walk of Fame lesen (»Guck mal, Marge, Eddie Cantor«). Zum Hollywood Boulevard zog es sie wegen der weltberühmten Kinos (dem Grauman’s Chinese Theatre, dem Egyptian, dem Paramount, dem Pantages, dem Vogue). Aber sobald die Sonne unterging und die Touristen in ihre Holiday Inns zurückkehrten, kaperten die Nachtmenschen den Hollywood Boulevard und machten ihn zu Hollyweird.
Doch das Tiffany lag nicht bloß am Sunset Boulevard, es lag am Sunset Boulevard westlich der La Brea Avenue, weshalb die offizielle Adresse Sunset Strip lautete.
Was das für einen Unterschied macht?
Einen ziemlichen Unterschied.
In dieser Zeit herrschte eine große Nostalgie für alles, was mit Old Hollywood zu tun hatte. Auf Schritt und Tritt sah man Fotos, Gemälde und Wandbilder von Laurel und Hardy, W.C. Fields, Charlie Chaplin, Boris Karloffs Frankenstein, King Kong, Jean Harlow und Humphrey Bogart (es war die Zeit der berühmten psychedelischen Plakate von Elaine Havelock). Besonders im eigentlichen Hollywood (also östlich der La Brea Avenue). Aber überquerte man auf dem Sunset die La Brea, wurde der Boulevard zum Strip, das vom Film dominierte alte Hollywood löste sich auf, und an seine Stelle trat Hollywood als Zuhause der Hippie-Nachtclubs und der Jugendkultur. Der Sunset Strip war berühmt für seine Rockclubs (das Whisky a Go-Go, das London Fog, das Pandora’s Box).[1]
Und zwischen den Rockclubs und gegenüber von Ben Frank’s Coffee Shop lag das Tiffany Theater.
Im Tiffany liefen keine Filme wie Oliver! (dt. Oliver); Airport; Goodbye, Mr. Chips (dt. Auf Wiedersehen, Mr. Chips); Chitty Chitty Bang Bang (dt. Tschitti Tschitti Bäng Bäng); The Love Bug (dt. Ein toller Käfer); ja nicht einmal Thunderball (dt. Feuerball). Das Tiffany war die Heimat von Woodstock, Gimme Shelter, Yellow Submarine, Alice’s Restaurant, Andy Warhols Trash, Andy Warhols Frankenstein und Robert Downeys Pound.
Das waren die Filme, die im Tiffany liefen. Und auch wenn das Tiffany nicht das erste Kino in Los Angeles war, das The Rocky Horror Picture Show zeigte, oder auch nur das erste mit regelmäßigen Mitternachtsvorstellungen, war es die erste Spielzeit, die der Legende, zu der der Film heranreifen sollte, den Boden bereitete und in der vieles von dem aufkam, was das Rocky-Horror-Phänomen ausmachte – kostümierte Besucher, Shadowcasts, Callbacks, Themenabende usw. Das Tiffany würde die gesamten Siebziger hindurch die gegenkulturelle Heimat der Kifferfilme bleiben. Manche davon erfolgreich (Frank Zappas 200 Motels), manche nicht (Freddy Francis’ Son of Dracula mit Harry Nilsson und Ringo Starr).
Die gegenkulturellen Filme von 1968 bis 1971 waren nicht alle gut, aber sie waren in jedem Fall aufregend. Und man musste sie in einem vollen Kino sehen, vorzugsweise bekifft. Das Tiffany würde bald deutlich weniger angesagt sein, weil die nach 1972 erschienenen Kifferstreifen eher die Nachlese eines Nischenmarkts waren.
Aber wenn das Tiffany ein großes Jahr hatte, dann 1970.
Im selben Jahr saß ich als Siebenjähriger zum ersten Mal im Tiffany, wo meine Mutter (Connie) und mein Stiefvater (Curt) mit mir eine Doppelvorstellung anschauten: John Alvidsons Joe (dt. Joe – Rache für Amerika) und Carl Reiners Where’s Poppa? (dt. Wo is’ Papa?)
Moment mal, du warst mit acht in einer Doppelvorstellung von Joe und Where’s Poppa?
Allerdings.
Und das war zwar eine unvergessliche Vorstellung, weshalb ich jetzt auch darüber schreibe, aber für mich seinerzeit kein großer Kulturschock. Der Zeitleiste des Autors Mark Harris zufolge begann die New-Hollywood-Revolution im Jahr 1967. Damit fielen meine ersten Kinojahre (ich bin Jahrgang ’63) in die Anfänge der Revolution (’67), den kinematografischen Revolutionskrieg (’68/’69 und das Jahr, in dem der Revolutionskrieg gewonnen wurde (’70). Das auch das Jahr war, in dem aus New Hollywood das Hollywood wurde.
Alvidens Joe machte ziemlich Furore, als er 1970 erschien (sein Einfluss auf Taxi Driver ist unbestreitbar). Leider ist dieses Pulverfass von einem Spielfilm in den letzten fünfzig Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten. Der Film erzählt die Geschichte eines verzweifelten Vaters aus der oberen Mittelschicht (gespielt von Dennis Patrick), der seine Tochter (Susan Sarandon in ihrem Spielfilmdebüt) an die Hippie-Drogenkultur der Ära verliert.
Bei einem Besuch in der widerlichen Wohnung, in der seine Tochter mit ihrem Freund, einem Dreckskerl und Junkie, haust, schlägt Patrick diesem den Schädel ein (sie selbst ist zu dem Zeitpunkt nicht da). Als er in einer Kneipe sitzt und sowohl mit dem Gewaltausbruch als auch mit seinem Verbrechen zurande zu kommen versucht, begegnet er einem rassistischen, großmäuligen Bauarbeiter namens Joe (gespielt von Peter Boyle, dem die Rolle den Durchbruch bescherte). Joe trinkt in der Bar sein Feierabendbier und lässt eine »Amerika – love it or leave it«-Tirade über Hippies, Schwarze und die Gesellschaft anno 1970 im Allgemeinen vom Stapel. Keiner in der Arbeiterspelunke hört ihm zu (der Barkeeper sagt ihm sogar, offensichtlich nicht zum ersten Mal: »Gönn uns mal ’ne Ruhepause.«).
Joes Hetzrede endet mit der Einschätzung, jemand müsse sie alle umbringen (die Hippies). Tja, Patrick hat es gerade getan und legt in einem unbedachten Augenblick eine biergeschwängerte Beichte ab, die nur Joe hört.
Im Folgenden wird die merkwürdig antagonistische und doch symbiotische Beziehung zwischen den beiden unterschiedlichen Männern aus unterschiedlichen Schichten dargestellt. Sie sind eigentlich keine Freunde (Joe erpresst den gepeinigten Vater im Grunde), aber auf eine verdrehte, schwarzhumorige Art werden sie zu Kumpanen. Der angesehene leitende Angestellte aus der Mittelschicht hat die faschistischen Wutreden dieses großmäuligen Fieslings aus der Arbeiterklasse wahr werden lassen.
Indem er Patrick durch Erpressung zu einer Art Bündnis zwingt, teilt Joe mit dem Mörder sowohl sein dunkles Geheimnis als auch bis zu einem gewissen Grad die Verantwortung für den Mord. Diese Dynamik entfesselt die Begierden und die Hemmungen des proletarischen Sprücheklopfers. Und begräbt die Schuld des kultivierten Mannes, an deren Stelle ein Gefühl von Sinnhaftigkeit und Rechtschaffenheit tritt. Bis die beiden Männer, mit Maschinengewehren bewaffnet, die Bewohner einer Hippie-Kommune hinrichten. Und der Vater in einem tragischen, ironischen Standbild schließlich seine eigene Tochter exekutiert.
Ganz schön starker Tobak? Allerdings.
Aber was in dieser Zusammenfassung nicht einmal andeutungsweise klar wird, ist, wie scheißwitzig dieser Film ist.
So derb, hässlich und brutal der Film Joe auch sein mag, im Herzen ist er doch eine rabenschwarze Komödie über das amerikanische Klassensystem. Er ist aufs Heftigste brutal und grenzt dabei zugleich an Satire. Arbeiterklasse, obere Mittelschicht und Jugendkultur werden durch ihre übelsten Vertreter verkörpert (jede männliche Figur in dem Film ist ein verabscheuungswürdiger Schwachkopf).
Heutzutage gilt es vielleicht als kontrovers, Joe als schwarze Komödie zu bezeichnen. Doch als der Film herauskam, war es das ganz sicher nicht. Als ich Joe sah, war es mit Leichtigkeit der hässlichste Film, den ich kannte (diese Position hielt er, bis ich vier Jahre später The Last House on the Left ((dt. Das letzte Haus links)) sah). Am gruseligsten fand ich ehrlich gesagt den erbärmlichen Zustand der Wohnung, in der die beiden Junkies am Anfang lebten. Mir wurde sogar ein bisschen schlecht (selbst die gezeichnete Wohnung in der Filmparodie der Zeitschrift Mad bereitete mir ein wenig Übelkeit). Und die Zuschauer im Tiffany Theater des Jahres 1970 verfolgten den ersten Teil des Films schweigend.
Aber sobald Dennis Patrick die Kneipe betritt und Peter Boyles Joe im Film erscheint, fingen die Zuschauer an zu lachen. Und im Handumdrehen verwandelte sich das angewiderte Schweigen des erwachsenen Publikums in unverhohlene Heiterkeit. Ich weiß noch, dass über so ziemlich alles gelacht wurde, was Joe sagte. Es war ein überlegenes Gelächter; sie lachten über Joe. Aber sie lachten mit Peter Boyle, der wie eine Naturgewalt über den Film kommt. Und der begabte Drehbuchautor Norman Wexler liefert ihm einen Haufen unfassbarer Sätze. Boyles komödiantische Darbietung entschärft die einförmige Hässlichkeit des Films.
Sie macht Joe nicht sympathisch, aber doch irgendwie unterhaltsam.
Indem er Peter Boyles bravouröse komische Darbietung mit diesem finsteren Machwerk kombiniert, rührt Avildsen einen mit Pisse versetzten Cocktail an, der verstörend gut schmeckt.
Wenn Joe durchgeknalltes Zeug erzählt, ist das zum Totlachen. Wie bei Freebie and the Bean (dt. Die Superschnüffler) hatten die Zuschauer beim Lachen vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber gelacht haben sie, das kann ich euch sagen. Sogar der achtjährige kleine Quentin musste lachen. Nicht weil ich verstand, was Joe sagte, oder Norman Wexlers Dialoge zu schätzen gewusst hätte. Ich lachte aus drei Gründen. Erstens lachte der ganze Saal voller Erwachsener. Zweitens nahm selbst ich die komische Note in Boyles Schauspiel wahr. Und drittens, weil Joe pausenlos fluchte und es für Kinder kaum etwas Lustigeres gibt als einen witzigen Typen, der flucht wie ein Bierkutscher. Ich weiß noch, wie Joe, gerade als während der Kneipenszene das Gelächter abzuebben schien, vom Barhocker aufsteht und zur Jukebox geht, um ein paar Münzen einzuwerfen. Und sobald er die ganze (mutmaßliche) Soul-Musik auf der Titelliste der Jukebox zu sehen bekommt, ruft er: »Die ganze Musik haben sie umgefickt!« Und die Zuschauer im Tiffany Theater lachten noch lauter los als vorher.
Aber als die Barszene vorbei war und irgendwann nachdem Dennis Patrick und seine Frau bei Joe zu Abend essen, schlief ich ein. Also verpasste ich die ganze Szene, in der Joe und sein neu gewonnener Gefolgsmann auf blutige Hippiejagd gehen. Wofür meine Mutter dankbar war.
Ich weiß noch, wie meine Mutter an diesem Abend auf der Heimfahrt zu Curt sagte: »Ich bin bloß froh, dass Quint vor dem Schluss eingeschlafen ist. Das Ende brauchte er wirklich nicht zu sehen.«
Vom Rücksitz aus fragte ich: »Was ist denn passiert?«
Curt klärte mich auf, was ich verpasst hatte: »Na ja, Joe und der Vater haben ein paar Hippies über den Haufen geschossen. Und in dem ganzen Durcheinander hat der Vater dann seine Tochter erschossen.«
»Das Hippiemädchen vom Anfang?«, fragte ich.
»Ja.«
»Wieso hat er sie denn erschossen?«, fragte ich.
»Na ja, er wollte sie ja nicht erschießen«, erklärte er mir.
Dann fragte ich: »War er traurig?«
Und meine Mutter sagte: »Ja, Quentin, er war sehr traurig.«
Gut, die zweite Hälfte von Joe hatte ich vielleicht verpennt, aber als der Film zu Ende war und die Lichter angingen, wachte ich auf. Und im Handumdrehen begann der zweite Film der Doppelvorstellung im Tiffany, der auf eher vordergründige Komik angelegte Where’s Poppa?
Und sobald George Segal am Anfang ein Gorillakostüm anzieht und Ruth Gordon ihm in die Eier haut, hatte mich dieser Film im Sack. In diesem Alter war ein Typ im Gorillakostüm der Gipfel der Komik, und noch witziger war nur ein Typ, dem in die Eier gehauen wird. Ein Typ im Gorillakostüm, dem in die Eier gehauen wird, war also die absolute Krönung. Dieser Film würde zweifellos zum Totlachen sein. So spät es auch sein mochte, diesen Film würde ich von Anfang bis Ende schauen.
Seit dieser Vorführung habe ich Where’s Poppa? nie wieder von Anfang bis Ende gesehen. Aber in mein Gehirn sind so viele visuelle Momente eingebrannt, ob ich sie damals verstand oder nicht.
Ron Leibman als Segals Bruder, der von den schwarzen Straßenräubern durch den Central Park gejagt wird.
Ron nackt im Aufzug mit der weinenden Frau.
Und natürlich der für mich, der Reaktion des Publikums nach zu urteilen, aber auch für alle anderen schockierende Augenblick, in dem Ruth Gordon George Segal in den Hintern beißt.
Ich weiß noch, wie ich meine Mutter bei der Verfolgungsjagd durch den Park fragte:
»Warum verfolgen ihn die schwarzen Männer?«
»Weil sie ihn ausgeraubt haben«, sagte sie.
»Und warum haben sie ihn ausgeraubt?«, fragte ich.
Und dann sagte sie: »Weil es eine Komödie ist, die sich über alles Mögliche lustig macht.«
Und in diesem Augenblick wurde mir das Konzept der Satire erläutert.
Meine jungen Eltern gingen zu dieser Zeit sehr oft ins Kino, und meist nahmen sie mich mit. Ganz bestimmt hätten sie mich irgendwem unterschieben können (meine Großmutter Dorothy war dafür eigentlich immer zu haben), doch stattdessen durfte ich mitkommen. Aber ich durfte unter anderem auch mitkommen, weil ich wusste, wann ich den Mund zu halten hatte.
Tagsüber durfte ich ein normales (nerviges) Kind sein. Blöde Fragen stellen, kindisch sein, egoistisch sein, so wie die meisten Kinder eben. Aber wenn sie mich abends mitnahmen, in ein hübsches Restaurant, eine Bar (was sie manchmal taten, weil Curt Barpianist war), einen Nachtclub (was auch hin und wieder vorkam), ins Kino oder sogar zu einer Verabredung mit irgendeinem anderen Paar, wusste ich, das war Erwachsenenzeit. Wollte ich bei der Erwachsenenzeit dabei sein, sah ich besser zu, dass mein kleiner Arsch verdammt cool blieb. Was im Grunde bedeutete, keine blöden Fragen zu stellen und nicht zu glauben, der Abend würde sich um mich drehen (tat er nicht). Die Erwachsenen wollten sich unterhalten und lachen und herumwitzeln. Meine Aufgabe war, den Mund zu halten und sie machen zu lassen, ohne ständige kindische Unterbrechungen. Ich wusste, dass sich eigentlich niemand für meine Bemerkungen zu dem Film oder dem Abend an sich interessierte (es sei denn, sie waren niedlich). Nicht dass ich grob angefasst worden wäre, hätte ich diese Regeln gebrochen. Aber es war ratsam, mich reif und gesittet zu verhalten. Denn hätte ich mich kindisch und nervtötend verhalten, wäre ich beim nächsten Mal mit einem Babysitter zu Hause geblieben, während sie ausgingen und Spaß hatten. Ich wollte aber nicht zu Hause bleiben! Ich wollte mit ihnen ausgehen! Ich wollte an der Erwachsenenzeit teilhaben!
In gewisser Weise war ich wie eine kindliche Version des Grizzly Man, der die Erwachsenen nachts in ihrer natürlichen Umgebung beobachten konnte. Es war in meinem eigenen Interesse, den Mund geschlossen und die Augen und Ohren offen zu halten.
Das machten Erwachsene also, wenn sie ohne Kinder unterwegs waren.
So gingen sie also miteinander um.
Darüber unterhielten sie sich also.
So was machten sie also gern.
So was fanden sie also witzig.
Ich weiß nicht, ob das die Absicht meiner Mutter war oder nicht, aber sie brachten mir tatsächlich bei, wie Erwachsene untereinander verkehrten.
Wenn sie mich ins Kino mitnahmen, hatte ich die Aufgabe, dazusitzen und den Film zu schauen, ob er mir gefiel oder nicht.
Ja, manche dieser Filme für Erwachsene waren verdammt noch mal großartig!
M*A*S*H, die Dollar-Trilogie, Where Eagles Dare (dt. Agenten sterben einsam), The Godfather (dt. Der Pate), Dirty Harry, The French Connection (dt. Brennpunkt Brooklyn), The Owl and the Pussycat (dt. Die Eule und das Kätzchen), Bullitt. Und manche waren für einen Acht- oder Neunjährigen scheißlangweilig. Carnal Knowledge (dt. Die Kunst zu lieben)? The Fox? Isadora? Sunday, Bloody Sunday? Klute? Goodbye, Columbus (dt. Zum Teufel mit der Unschuld)? The Model Shop (dt. Das Fotomodell)? Diary of a Mad Housewife (dt. Tagebuch eines Ehebruchs)?
Aber ich wusste, während sie diese Filme schauen, schert sich keiner darum, ob ich Spaß habe oder nicht.
Ich bin mir sicher, dass ich dabei schon ziemlich früh irgendetwas wie He, Mom, mir ist langweilig gesagt haben muss. Und ich bin mir sicher, sie hat geantwortet: Hör zu, Quentin, wenn wir dich abends mitnehmen, und du gehst uns auf die Nerven, bleibst du nächstes Mal zu Hause [mit einem Babysitter]. Wenn du lieber zu Hause bleiben und fernsehen willst, während dein Vater und ich Spaß haben, okay, dann machen wir das nächstes Mal so. Deine Entscheidung.
Also entschied ich mich. Ich wollte mit ihnen ausgehen.
Und die erste Regel lautete: Nicht nerven.
Die zweite Regel lautete: Während des Films keine blöden Fragen stellen.
Vielleicht eine oder zwei am Anfang des Films, aber danach war ich auf mich allein gestellt. Alle weiteren Fragen mussten warten, bis der Film vorbei war. Und größtenteils konnte ich diese Regel befolgen. Auch wenn es einige Ausnahmen gab. Meine Mom gab vor Freunden gern die Geschichte zum Besten, wie sie mich einmal in Carnal Knowledge mitgenommen hatten. Art Garfunkel versucht Candice Bergen ins Bett zu quatschen. Zwischen den beiden ging es ungefähr so hin und her: »Komm, lass es uns machen. – Ich will aber nicht. – Du hast doch gesagt, wir können es machen. – Ich will aber nicht. – Alle anderen machen es doch auch.«
Und offenbar fragte ich mit meiner piepsigen Neunjährigenstimme: »Was wollen sie denn machen, Mom?« Woraufhin laut meiner Mutter der ganze Kinosaal voller Erwachsener in Gelächter ausbrach.
Außerdem fand ich das ikonische Standbild am Schluss von Butch Cassidy and the Sundance Kid (dt. Zwei Banditen) wohl zu unklar.
Ich weiß noch, wie ich fragte: »Was ist denn passiert?«
»Sie sind gestorben«, teilte mir meine Mutter mit.
»Sie sind gestorben?«, jaulte ich auf.
»Ja, Quentin, sie sind gestorben«, versicherte mir meine Mutter.
»Woher weißt du das denn?«, fragte ich gewitzt.
»Weil das damit gesagt werden soll, dass das Bild einfriert«, antwortete sie geduldig.
Ich fragte noch einmal: »Woher weißt du das?«
»Ich weiß es eben«, lautete die unbefriedigende Antwort.
»Wieso haben sie es denn nicht gezeigt?«, fragte ich geradezu entrüstet.
Dann verlor sie offenbar die Geduld und blaffte: »Weil sie nicht wollten!«
Dann murmelte ich vor mich hin: »Sie hätten’s aber zeigen sollen.«
Und auch wenn dieses Bild so ikonisch geworden ist, gebe ich mir noch immer recht. »Sie hätten’s aber zeigen sollen.«
Meist aber war ich schlau genug, um Mom und Dad während des Films nicht mit Fragen zu bombardieren. Ich wusste, dass ich Filme für Erwachsene schaute und manches nicht verstehen würde. Aber es kam nicht darauf an, ob ich die lesbische Beziehung zwischen Sandy Dennis und Anne Haywood in The Fox verstand oder nicht. Dass sich meine Eltern amüsierten und dass ich mit ihnen zusammen sein konnte, wenn sie abends ausgingen, das zählte. Ich wusste auch, dass die Zeit für Fragen während der Heimfahrt kam, nach dem Ende des Films.
Wenn ein Kind ein Buch für Erwachsene liest, dann wird es bestimmte Wörter nicht verstehen. Aber abhängig vom Zusammenhang, in dem der Satz steht, wird es sich die Bedeutung vielleicht erschließen können. Genauso ist es, wenn ein Kind einen Film für Erwachsene sieht.
Bei manchen Sachen ist es deinen Eltern natürlich lieber, wenn du sie nicht begreifst. Aber bei manchen Sachen wusste ich vielleicht nicht genau, was sie bedeuten, konnte es mir aber einigermaßen zusammenreimen.
Vor allem bei Witzen, die den ganzen Kinosaal voller Erwachsener zum Lachen brachten. Es war verdammt aufregend, als einziges Kind in einem Raum voller Erwachsener einen Film für Erwachsene zu schauen und zu hören, wie sie alle über etwas lachten, von dem ich (meist) wusste, dass es wohl unanständig war. Und auch ohne es zu kapieren, kapierte ich es manchmal.
Auch wenn ich nicht genau wusste, was ein Gummi war, konnte ich es mir in der Szene mit Hermie und dem Drogerieverkäufer in The Summer of ’42 (dt. Sommer ’42) durch das Gelächter im Publikum grob vorstellen. So war es auch mit den meisten Sexwitzen in The Owl and the Pussycat. Ich lachte von Anfang bis Ende zusammen mit den erwachsenen Zuschauern (der Spruch mit dem »Bomben los« ließ die verdammten Wände wackeln).
Aber bei den gerade erwähnten Filmen schwang in der Reaktion des Publikums noch etwas mit, was ich damals nicht hätte benennen können, was mir jetzt aber bewusst wird. Wenn man Kindern einen Film mit einem lustig herumfluchenden Typen oder einem Pupswitz zeigt, dann kichern sie normalerweise. Und wenn sie ein bisschen älter sind, und man zeigt ihnen einen Film mit einem Sexwitz, dann bringt der sie zum Kichern. Aber es ist ein unanständiges Lachen. Sie wissen, es gehört sich nicht, und sie wissen, eigentlich sollten sie das gerade nicht hören oder sehen. Und an ihrem Lachen hört man, dass es ihnen ein leicht unanständiges Gefühl gibt, Zeuge davon zu werden.
Nun, wenn die erwachsenen Zuschauer 1970 oder 1971 auf den sexuellen Humor in Filmen wie Where’s Poppa?, The Owl and the Pussycat, M*A*S*H, Pretty Maids All in a Row (dt. Eine nach der anderen) und Bob & Carol & Ted & Alice reagierten oder auf die Szene mit den Gras-Brownies in I Love You, Alice B. Toklas (dt. Lass mich küssen deinen Schmetterling) oder darauf, dass die Football-Spieler in M*A*S*H auf der Bank einen Joint rauchten, oder auf Szenen, die eine komödiantische Schärfe hatten, die so nur ein oder zwei Jahre vorher nicht möglich gewesen wären, wie die Szene, in der Joe eingeführt wird, oder Popeye Doyles Kneipenrazzia in The French Connection – dann klang das Gelächter der Erwachsenen ähnlich unanständig. Was im Rückblick nicht verwundert. Denn diese Erwachsenen waren es nicht gewohnt, solche Sachen zu sehen. Es waren die ersten Jahre des New Hollywood. Diese Zuschauer waren mit den Filmen der Fünfziger und Sechziger groß geworden. Sie waren das Versteckspiel gewohnt, Andeutungen, Mehrdeutigkeiten, Wortspiele (bis 1968 war der Name von Honor Blackmans Figur Pussy Galore in Goldfinger ((dt. James Bond 007 – Goldfinger)) der expliziteste Witz, der je in einem großen kommerziellen Film gemacht worden war).
Auf eine merkwürdige Art saßen die Erwachsenen und ich also gewissermaßen im selben Boot. Aber anzügliches Gekicher war nicht das Einzige, was ich aus dem Publikum hörte. Schwule Figuren wurden permanent ausgelacht. Und ja, manchmal wurden diese Figuren auch als Comedy-Kanonenfutter präsentiert wie in Diamonds Are Forever (dt. Diamantenfieber) und The French Connection.
Aber nicht immer.
Manchmal kam dabei eine richtig hässliche Seite des Publikums zum Vorschein.
Im Jahr 1971, als auch Diamonds Are Forever und The French Connection erschienen, saß ich mit meinen Eltern im Kino und schaute Dirty Harry.
Auf der Leinwand stand Scorpio (Andy Robinson), der filmische Stellvertreter des tatsächlichen Zodiac-Killers, in San Francisco auf einem Hausdach und richtete ein durchschlagkräftiges Scharfschützengewehr auf den Stadtpark. Im Visier von Scorpios Gewehr ist ein schwuler Schwarzer in einem extravaganten violetten Poncho zu sehen. Die Darstellung wird dadurch so eindrücklich, dass wir die ganze Szene durch das Visier von Scorpios Gewehr verfolgen. Der Mann im Poncho hat ein Date mit einem hippiemäßigen Cowboy-Typen mit schwarzem Schnäuzer, der verdammt stark an Dennis Hoppers Figur in Easy Rider erinnert. Im Film bekommen wir einen ziemlich guten Eindruck davon, was da gerade abläuft. Sie wirken nicht wie ein Paar; die beiden Männer haben eindeutig ein Date. Der Cowboy hat dem Poncho-Mann gerade ein Vanilleeis gekauft. Und ohne körperliche Berührungen zwischen ihnen und obwohl sich alles völlig geräuschlos abspielt, merken wir, dass das Date ziemlich gut läuft.
Wir merken, dass der Poncho-Mann Spaß hat und dass der Dennis-Hopper-Typ ihn gut findet. Diese stumme Szene könnte eine der unvoreingenommensten Darstellungen von schwulem Balzverhalten sein, die es bis zu diesem Zeitpunkt je in einem Hollywood-Studiofilm gegeben hatte.
Und trotzdem sehen wir zugleich alles durch das Visier von Scorpios Gewehr, und das Fadenkreuz ist direkt auf den Poncho-Mann gerichtet. Aber wie konnte ich als kleiner Junge wissen, dass der Kerl im lila Poncho schwul war? Weil mindestens fünf Kinogäste es lachend ausriefen: Das ist eine Schwuchtel! Darunter mein Stiefvater Curt. Und sie lachten über sein Verhalten, obwohl sie ihn nur durch das Visier eines brutalen Mörders sehen konnten, während Lalo Schifrins unheimliche Der-Mörder-hat-ein-Opfer-im-Visier-Musik die Bilder auf der Tonspur begleitete. Aber ich erspürte in diesem Kino voller Erwachsener etwas anderes. Im Gegensatz zu den anderen Opfern kam es mir nicht so vor, als würden die erwachsenen Zuschauer am Schicksal des Poncho-Manns besonders viel Anteil nehmen. Ich würde sogar sagen, ein paar der Kinogänger hofften, dass Scorpio ihn erschoss.[2]
Auch wenn ich keine Fragen hatte, redeten meine Eltern auf der Heimfahrt immer über den Film, den wir gerade gesehen hatten. Diese Autofahrten gehören zu meinen schönsten Erinnerungen. Mal hatte ihnen der Film gefallen und mal nicht, aber meist war ich überrascht, wie wohlüberlegt ihre Beurteilung ausfiel. Und es war interessant, den Film gleich noch einmal aus ihrem Blickwinkel zu sehen.
Patton (dt. Patton – Rebell in Uniform) mochten meine Eltern beide, aber auf dem Weg nach Hause kreiste die ganze Diskussion um ihre Bewunderung für George C. Scotts Schauspielkunst.
Pretty Maids All in a Row von Roger Vadim mochten sie beide nicht, wobei ich nicht genau weiß, warum. Die meisten Filme mit sexueller Ausrichtung, in die sie mich mitnahmen, langweilten mich zu Tode. Aber Pretty Maids All in a Row hatte so eine unverfälschte Lebhaftigkeit, die meine Aufmerksamkeit erregte und aufrechterhielt. So wie Rock Hudsons Geschmeidigkeit, die selbst einem Achtjährigen nicht entging. Natürlich ließ mein Stiefvater während der gesamten Autofahrt schwulenfeindliche Bemerkungen über Rock Hudson fallen, aber ich weiß noch, wie meine Mutter sich für Mr Hudson in die Bresche warf (»Na ja, wenn er homosexuell ist, beweist das doch nur, wie toll er schauspielern kann.«). Ich weiß noch, dass Airport im Jahr 1970 bei meiner Familie sehr gut ankam. Vor allem wegen der Überraschung, als Van Heflins Bombe hochging. Der Augenblick, in dem die Bombe an Bord des Flugzeugs explodiert, war zu diesem Zeitpunkt einer der schockierendsten Momente in einem Hollywoodfilm. Wie Curt auf dem Heimweg sagte: »Ich dachte, Dean Martin kann den Typen bequatschen«, womit er unterschwellig zum Ausdruck brachte, wie ein Dean-Martin-Film von 1964 oder 1965 im Vergleich zu einem – sogar eher altmodischen – Film von 1970 abgelaufen wäre.
Und die Szene danach – das Loch im Flugzeug, durch das die Leute nach draußen gesaugt werden – war die krasseste groß angelegte Paradeszene, die ich je im Kino gesehen hatte. Aber 1970 sah ich einen Haufen krasses Zeug.
Der Initiationsritus mit den durch die Brust gesteckten Adlerklauen in A Man Called Horse (dt. Ein Mann, den sie Pferd nannten) haute mich völlig um. Genauso wie die Szene in House of Dark Shadows (dt. Das Schloss der Vampire), als Barnabas Collins in Zeitlupe von dem Holzpflock durchbohrt wird und das Blut nur so spritzt. Ich weiß noch, wie ich beide Male mit offenem Mund auf die Leinwand starrte und kaum glauben konnte, dass so etwas im Film möglich war. An diesen Abenden war auf der Heimfahrt im Auto mit Sicherheit ich der Gesprächigste (ich fand diese Filme unfassbar).
Am 15. April 1971 (kurz nach meinem achten Geburtstag) wurden im Dorothy Chandler Pavilion die Academy Awards für die Filme des Jahres 1970 vergeben. Die fünf Nominierten in der Kategorie Bester Film waren Patton, M*A*S*H, Five Easy Pieces (dt. Five Easy Pieces – Ein Mann sucht sich selbst), Airport und Love Story. Zum Zeitpunkt der Oscars hatte ich alle fünf gesehen (natürlich im Kino). Und den Film, dem ich die Daumen drückte, M*A*S*H, hatte ich dreimal gesehen. Ich kannte so gut wie alle großen Filme aus diesem Jahr. Die einzigen beiden, die ich verpasst hatte, waren Ryan’s Daughter (dt. Ryans Tochter) und Nicholas and Alexandra (dt. Nikolaus und Alexandra), denen ich nicht hinterherweinte. Außerdem hatte ich beide Trailer so oft gesehen, dass ich das Gefühl hatte, die Filme zu kennen (na gut, Duck, You Sucker! ((dt. Todesmelodie)) hatte ich auch nicht gesehen, weil Curt den Titel albern fand. Das Gleiche galt für Two Mules for Sister Sara ((dt. Ein Fressen für die Geier))).
Meine zwei anderen Lieblingsfilme aus diesem Jahr waren A Man Called Horse und wahrscheinlich Kelly’s Heroes (dt. Stoßtrupp Gold). Um zu verdeutlichen, wie geschmacksbildend diese Filme auf mich wirkten: Mein Lieblingsfilm von 1968 war The Love Bug. Mein Lieblingsfilm von 1969 war Butch Cassidy and the Sundance Kid. Aber mein Lieblingsfilm von 1970 war M*A*S*H, eine anarchistische Militärkomödie mit reichlich Sex.
Das hieß nicht, dass ich keine Disney-Filme mehr mochte. Die beiden großen Disney-Filme dieses Jahres waren The Aristocats (dt. Aristocats) und The Boatniks (dt. Die Bruchschiffer), und ich kannte und mochte beide. Aber nichts brachte mich mehr zum Lachen als »Hot Lips« O’Houlihan (Sally Kellerman), der beim Duschen das Zelt weggerissen wurde. Oder »Radar« O’Reilly (Gary Burghoff), der das Mikrofon unter dem Bett platzierte, als Hot Lips und Frank Burns vögelten, und »Trapper John« McIntyre (Elliott Gould), der die Vögelei ins gesamte Camp übertrug (wobei mir der ganze Mittelteil, in dem der Camp-Zahnarzt »Painless Pole« Waldowski Panik schiebt, schwul zu sein, nie etwas bedeutete. Natürlich nicht, es ist der mieseste Teil des Films).
Und wieder war es so, dass ich M*A*S*H zwar richtig gut fand, aber unter anderem auch so viel Spaß hatte, weil ich in einem Kino voller lauthals lachender Erwachsener saß, die sich alle über ihre eigene Unanständigkeit freuten. Ganz zu schweigen von dem Spaß, den es mir bereitete, den anderen in meiner Schulklasse diese Szenen zu beschreiben, die sich nicht im Traum erhoffen konnten, einen Film wie M*A*S*H, The French Connection, The Godfather, The Wild Bunch (dt. The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz) oder Deliverance (dt. Beim Sterben ist jeder der Erste) zu Gesicht zu bekommen (meist gab es einen anderen in meinem Alter, der ein paar von den krassen Sachen gucken durfte, die ich schaute).
Weil ich Sachen sehen durfte, die sie nicht zu sehen bekamen, hielten mich meine Klassenkameraden für mondän. Und weil ich die anspruchsvollsten Filme der größten Ära in der Geschichte Hollywoods schaute, hatten sie damit ganz recht.
Als mir irgendwann klar wurde, dass ich Filme sehen durfte, die andere Eltern ihre Kinder nicht schauen ließen, sprach ich meine Mutter darauf an.
Sie sagte: »Quentin, mir macht es mehr Sorgen, wenn du die Nachrichten schaust. Ein Film wird dir nicht wehtun.«
Genau so sieht’s verdammt noch mal aus, Connie!
Hatten mich irgendwelche der Bilder, denen ich ausgesetzt war, verstört? Natürlich, manche schon! Aber das hieß nicht, dass mir der Film nicht gefiel.
Als in Dirty Harry das nackte tote Mädchen aus dem Loch gezogen wird, war das total verstörend. Aber ich verstand es.
Scorpio war durch und durch unmenschlich. Umso besser, wenn Harry ihn mit der stärksten Handfeuerwaffe der Welt über den Haufen schoss.
Ja, es war verstörend, in dem Vincent-Price-Film Cry of the Banshee (dt. Der Todesschrei der Hexen) zu sehen, wie eine Frau unter Todesqualen von den Dorfbewohnern durch die Straße geschleift und ausgepeitscht wird, nachdem sie als Hexe angeklagt wurde. Den Film sah ich in einer Doppelvorstellung zusammen mit dem großartigen spanischen Horrorfilm The House That Screamed (dt. Das Versteck – Angst und Mord im Mädcheninternat). Was für ein Abend!
Schon eine Auflistung der heftig brutalen Bilder, die ich zwischen 1971 und 1972 sah, würde die meisten Leser entsetzen. Ob nun James Caan, der in The Godfather am Mauthäuschen zusammengeschossen, oder Moe Greene, dem ins Auge geballert wurde. Der Typ, der in Catch-22 (dt. Catch-22 – Der böse Trick) von dem Flugzeugpropeller zerteilt wird. Stacy Keachs wilder Ritt an der Außenseite eines Autos in The New Centurions (dt. Polizeirevier Los Angeles-Ost). Oder Don Stroud, der sich in Bloody Mama selbst mit einer Maschinenpistole ins Gesicht schießt. Aber einfach nur diese grotesken Momente aufzulisten – aus dem Filmzusammenhang gerissen – ist den jeweiligen Filmen gegenüber nicht ganz fair. Und der Sichtweise meiner Mutter zufolge – die sie mir später auseinandersetzte –, kam es immer auf den Zusammenhang an. Bei den genannten Filmen kam ich mit den Bildern zurecht, weil ich die Geschichte verstand.
Eine der früheren Filmsequenzen, die mich ernsthaft verstörten, war allerdings die, in der Vanessa Redgrave als Isadora Duncan in Isadora von ihrem Seidenschal erwürgt wird, der sich im Rad eines Sportwagens verfängt. Dieses Ende nahm mich wohl so sehr mit, weil ich von allem, was davor kam, so wahnsinnig gelangweilt war. Auf der Heimfahrt hatte ich an diesem Abend so viele Fragen zur Gefahr des Unfalltods durch einen im Rad seines Autos verhedderten Schal. Meine Mutter versicherte mir, ich hätte nichts zu befürchten. Sie würde mir niemals erlauben, in einem offenen Sportwagen einen langen, wallenden Seidenschal zu tragen.
Eins der schrecklichsten Dinge, die ich zu dieser Zeit in einem Film sah, war jedoch kein Akt filmischer Brutalität. Es war die Darstellung der Pest in James Clavells The Last Valley (dt. Das vergessene Tal). Und als der Film vorbei war, standen mir bei der historischen Schilderung meines Stiefvaters die Haare zu Berge.
Für einige meiner intensivsten Erlebnisse im Kino sorgten nicht einmal die Filme selbst. Es waren die Trailer.
Der mit Abstand furchterregendste Film, den ich als Kind sah, war nicht irgendeiner der Horrorfilme. Es war der Trailer für Wait Until Dark (dt. Warte, bis es dunkel ist).
Bevor ich überhaupt wusste, was Homosexualität ist, sah ich die Sexszene zwischen Peter Finch und Murray Head in Sunday, Bloody Sunday. Ich war nicht schockiert, ich war verwirrt. Schockiert war ich nach dem nackten Ringkampf vor dem Kamin zwischen Alan Bates und Oliver Reed im Trailer zu Ken Russells Women in Love (dt. Liebende Frauen). Auch die erschreckenden Konsequenzen, die es hat, wenn Männer unterjocht werden, erschloss ich mir aus dem Trailer des Gefängnisdramas Fortune and Men’s Eyes (dt. Menschen hinter Gittern). Und aus irgendeinem Grund fand ich den trippigen Trailer zu Frank Zappas 200 Motels angsteinflößend.
Gab es damals irgendeinen Film, den ich nicht ertragen konnte?
Ja.
Bambi.
Wie Bambi von seiner Mutter getrennt wird, wie sie von dem Jäger erschossen wird und dann dieser entsetzliche Waldbrand – das alles regte mich mehr auf als irgendein anderer Kinofilm. Bis ich 1974 Wes Cravens The Last House on the Left sah, kam nichts auch nur annähernd heran. Nun haben diese Szenen in Bambi jahrzehntelang Kinder fertiggemacht. Aber ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, warum Bambi mich so traumatisiert hat. Natürlich trifft es jedes Kind ins Herz, wenn Bambi seine Mutter verliert. Aber ich glaube, noch weit mehr als die psychologische Dimension der Geschichte setzte mir der Schock zu, dass der Film eine so unerwartete Wendung ins Tragische nahm. Die Fernsehspots machten einem die wahre Natur des Films überhaupt nicht bewusst und konzentrierten sich stattdessen auf die drolligen Possen von Bambi und Klopfer. Nichts bereitete mich auf die erschütternde Schicksalswende vor. Ich weiß noch, wie mein kleines Gehirn die Fünfjährigenversion von Was zur Hölle geht denn hier ab? schrie. Wäre ich besser darauf vorbereitet gewesen, was auf mich zukam, hätte ich es vielleicht anders verarbeiten können.
An einem Abend gingen meine Eltern allerdings ohne mich ins Kino. Es war eine Doppelvorstellung von Melvin Van Peebles’ Sweet Sweetback (dt. Sweet Sweetbacks Lied) und Robert Altmans Brewster McCloud (dt. Nur Fliegen ist schöner).
Sie gingen zusammen mit Roger hin, dem jüngeren Bruder meiner Mutter, der gerade aus Vietnam zurückgekehrt war und eine lose Beziehung mit meiner Babysitterin Robin hatte, einem netten rothaarigen Mädchen aus unserer Straße.
Es war kein gelungener Abend.
Nicht nur, dass ihnen die beiden Filme nicht gefielen, mein Stiefvater und mein Onkel ließen sich noch tagelang darüber aus. Brewster McCloud ist einer der schlechtesten Filme, die je das Logo eines Studios trugen, und mir ist bewusst, dass Altmans Quintet (dt. Quintett) auch im Auftrag eines Studios gedreht wurde. Quintet ist einfach nur fürchterlich, langweilig und sinnlos. Aber Brewster McCloud ist das filmische Äquivalent zu einem Vogel, der dir auf den Kopf scheißt. Trotzdem ist es eine irgendwie amüsante Vorstellung, wie sich meine Eltern, mein junger Onkel und meine siebzehnjährige Babysitterin Karten für Brewster McCloud kaufen und glauben, sie würden einen richtigen Film zu sehen bekommen. Sie waren völlig baff (vor allem mein Onkel).
Aber der Altman-Film war ja nur die zweite Hälfte der Doppelvorstellung. Der Film, für den sie eigentlich bezahlt hatten, war Sweet Sweetback.
Dass ich bei dieser Vorstellung nicht dabei war, lag daran, dass ich es nicht konnte, denn der Film war (»laut einem komplett weißen Prüfungsausschuss!«) nicht für Jugendliche geeignet. Ich bin mir sicher, dass Curt, Onkel Roger und Robin Melvin Van Peebles’ gellendem Aufschrei des schwarzen Empowerments ebenso ratlos gegenüberstanden wie Brewster McCloud. Aber auch wenn sie ganz sicher nicht verstanden, warum jemand so einen Murks wie Altman verbrechen sollte, war Van Peebles’ Film etwas.
Etwas, was sie nicht verstanden.
Etwas, was sie nicht begreifen konnten (und das machte sie wütend).
Etwas, was nicht für sie bestimmt war (nachdem es sie verschmäht hatte, verschmähten sie es), aber etwas, was sie im Gegensatz zu Brewster McCloud nicht ignorieren konnten.
Der interessante Teil meiner Erinnerung war, dass sie ihn nur wegen meiner Mutter gesehen hatten. Ich bezweifle, dass einer von den anderen je davon gehört hatte (sie erzählte ihnen davon). Außerdem verwendete meine Mutter nie die Kurzfassung des Filmtitels. Sie nannte ihn immer bei seinem kompletten, soulmäßigen Namen Sweet Sweetback’s Baadasssss Song. Und auch wenn ich mich erinnere, dass die Männer sich zu Hause über den Film beklagten (tagelang), sagte meine Mutter nicht viel dazu. Sie verteidigte ihn nicht, aber sie beteiligte sich auch nicht an den Schmähreden. Sie schwieg sich (was ungewöhnlich war) zu dem Thema aus.
Kein Jahr darauf würde sie Curt verlassen und drei Jahre lang nur noch mit Schwarzen ausgehen.
In dieser Zeit sahen meine Mom und ich weniger Kinofilme zusammen, denn sie ging nun eher auf Dates ins Kino. Und während dieser Verabredungen sah sie einige der frühen Vertreter des Blaxploitation-Genres. Einer dieser Filme war Super Fly.
Nun wusste ich von Super Fly, weil sie schon das mordserfolgreiche Soundtrack-Album besaß und es pausenlos in der Wohnung lief. Außerdem wurde der Film in der Musiksendung Soul Train heftig beworben. Und in unserer Wohnung wurde jeden Samstag Soul Train geschaut. Zu dieser Zeit lebte ich mit meiner Mutter in einem ziemlich hippen Apartmenthaus, das sie sich mit zwei Cocktailkellnerinnen teilte, die seinerzeit ihre besten Freundinnen waren, Jackie (eine Schwarze) und Lilian (eine Mexikanerin).
Alle drei waren sie junge, hippe, gut aussehende Frauen in den funky Siebzigern, die gern mit sportlichen Typen ausgingen. Drei sexy Frauen (meine Mutter sah damals aus wie eine Mischung aus Cher und Barbara Steele), eine Weiße, eine Schwarze, eine Mexikanerin, die sich eine Wohnung mit dem zehnjährigen Sohn der Weißen teilten: Wir waren quasi eine Sitcom.
Das Urteil meiner Mutter über Super Fly? Sie fand ihn etwas amateurhaft. Aber die Badewannenszene hielt sie für eine der heißesten Szenen, die sie je gesehen hatte.
Ein weiterer Blaxploitation-Film, von dem sie mir erzählte, war Melinda mit Calvin Lockhart in der Hauptrolle (in Soul Train ebenfalls heftig beworben). Viele Jahre später sah ich den Film selbst. Er ist ganz in Ordnung (es ist eine Art Blaxploitation-Version des Noir-Films Laura mit ein paar Kung-Fu-Kämpfen am Ende). Meine Mutter fand ihn richtig gut. Und ich sagte ihr, dass ich ihn auch sehen wollte. Aber diesmal sagte sie mir, das würde nicht gehen. Das sagte sie nicht oft (die einzigen beiden Filme, die ich nicht hatte schauen dürfen, waren The Exorcist ((dt. Der Exorzist)) und Andy Warhols Frankenstein). Also fragte ich sie, warum. Und wenngleich der Film Melinda nicht sehr einprägsam war, habe ich ihre Antwort auf meine Frage nie vergessen.
Sie sagte: »Na ja, Quentin, er ist sehr brutal. Nicht dass ich damit grundsätzlich ein Problem hätte. Aber du würdest nicht verstehen, worum es in der Geschichte geht. Und weil du den Zusammenhang nicht verstehen würdest, in dem die Brutalität stattfindet, würdest du nur Gewalt um der Gewalt willen sehen. Und das will ich nicht.«
Man muss bedenken, dass ich dieses Gespräch mein ganzes Leben lang immer wieder führen würde, aber ich habe niemals gehört, dass es jemand so gut auf den Punkt gebracht hätte. Dabei war es nicht so, dass ich die verwirrenden Drehungen und Wendungen in The French Connection verstanden hätte, abgesehen davon, dass die Cops hinter dem bärtigen Franzosen her waren. Aber nach Ansicht meiner Mutter genügte das wohl.
Zu dieser Zeit ging meine Mutter mit einem Profi-Footballspieler namens Reggie aus. Und um bei ihr zu punkten, wollte Reggie auch mit mir abhängen.
Da er Footballspieler war, fragte er sie: Mag er Football?
Sie sagte ihm: Nein, er mag Filme.
Und wie es der Zufall wollte, tat Reggie das ebenfalls. Und er schaute offenbar jeden Blaxploitation-Film, der herauskam. Eines späten Samstagnachmittags kam Reggie (den ich nie zuvor gesehen hatte) also vorbei, holte mich ab, und wir gingen ins Kino. Er fuhr mit mir in einen Stadtteil, in dem ich noch nie gewesen war. Ich war in den Vierteln mit den ganzen Kinos in Hollywood und Westwood gewesen. Aber das hier war anders. Hier gab es auf beiden Straßenseiten riesige Kinos, und die Straße zog sich über acht Häuserblocks hin (als ich älter war, wurde mir bewusst, dass Reggie mit mir ins Kinoviertel in Downtown Los Angeles gefahren war, das am Broadway Boulevard lag und zu dem unter anderem das Orpheum, das State, das Los Angeles, das Million Dollar Theatre und das Tower zählten). Nicht nur waren die Kinos alle groß, mit breiten Schrifttafeln über den Eingängen, über den Schrifttafeln prangten auch noch riesenhafte (auf mich wirkten sie wie sechs Meter hoch) gemalte Versionen der Filmplakate. Und mit Ausnahme des Martial-Arts-Klassikers Five Fingers of Death (dt. Zhao – Der Unbesiegbare) und (seltsamerweise) My Fair Lady waren alle Filme in dieser Straße Blaxploitation-Filme. Filme, die ich nie gesehen hatte, aber entweder von den Fernsehspots (vor allem in Soul Train) oder aus der Radiowerbung auf 1580 KDay – dem Soul-Sender von Los Angeles – kannte oder weil ich die aufregenden und expliziten Filmanzeigen im Veranstaltungskalender der Los Angeles Times gesehen hatte.
Die Sonne ging allmählich unter, und in den protzigen bunten Schrifttafeln wurden die summenden Neonlampen eingeschaltet. Mein neuer Freund sagte mir, ich könnte mir jeden Film aussuchen (außer My Fair Lady). An diesem Samstagabend liefen in der Straße Hit Man (dt. Hit Man – Todsicher) mit Bernie Casey, ein schwarzes Remake des britischen Films Get Carter (dt. Jack rechnet ab), und der künftige Klassiker The Mack (dt. Straßen zur Hölle) mit Max Julien und Richard Pryor. »Wie wär’s mit The Mack?«, fragte ich.
»Tja, den kenn ich schon«, erklärte er.
»Ist er denn gut?«, fragte ich.
»Er ist sensationell!«, sagte er zu mir. »Und wenn du den unbedingt sehen willst, dann schau ich ihn mir auch noch mal an, aber lass uns erst mal noch ein bisschen weitergucken.«
Außerdem liefen noch Super Fly, Trouble Man, Cool Breeze, ein schwarzes Remake von The Asphalt Jungle (dt. Asphalt-Dschungel) und Come Back, Charleston Blue (dt. Wenn es dunkel wird in Harlem), ein Sequel zu Cotton Comes to Harlem (dt. Wenn es Nacht wird in Manhattan), die ich alle schon kannte. Aber der neue Film am Broadway, der erst seit letztem Mittwoch lief, war der neue Spielfilm von Blaxploitation-Superstar Jim Brown mit dem Titel Black Gunn (dt. Visum für die Hölle). Da dieser Film frisch angelaufen war, hatte ich die Woche über viele Fernsehspots gesehen, und er wirkte richtig spannend. Ich weiß sogar noch, dass es in der Radiowerbung hieß: »Jim Brown’s gonna git the mutha who killed his brutha.«
Tja, Black Gunn war auf jeden Fall der Film, den Reggie sehen wollte. Erstens hatte er als offensichtlicher Connaisseur diesen als einzigen noch nicht gesehen. Und außerdem war verdammt noch mal unübersehbar, dass er auf Jim Brown stand.
Ich fragte ihn nach seinen Lieblingsschauspielern. Er nannte Jim Brown, Max Julien, Richard Roundtree, Charles Bronson und Lee Van Cleef.
Er erkundigte sich nach meinem Lieblingsschauspieler, und ich sagte: »Robert Preston.«
»Wer ist denn Robert Preston?«
»Das ist der Music Man!« (Ich war damals ein großer Fan von The Music Man (dt. Music Man)).
Weil es der erste Samstag war, an dem der brandneue Jim Brown lief, war der riesige Kinosaal (es gab bestimmt 1400 Plätze) vielleicht nicht randvoll, aber doch sehr gut besucht, und die Spannung war mit Händen zu greifen.
Mein kleines Gesicht war das einzige weiße im Raum.
Dies sollte mein erster Film in einem (abgesehen von mir) nur mit Schwarzen besetzten Kinosaal in einem schwarzen Viertel sein. Es war 1972. Vier Jahre später würde ich öfter allein in ein vor allem von Schwarzen besuchtes Kino namens Carson Twin Cinema im kalifornischen Carson gehen, wo ich sämtliche Blaxploitation- und Kung-Fu-Klassiker nachholte, die mir in der ersten Hälfte des Jahrzehnts entgangen waren: Coffy (dt. Coffy – Die Raubkatze); The Mack; Foxy Brown; J.D.‘s Revenge (dt. Rache aus dem Jenseits); Cornbread, Earl and Me; The Watts Monster (dt. Das Monster von London); Five Fingers of Death; Lady Kung Fu (dt. Hapkido); The Chinese Connection (dt. Bruce Lee – Todesgrüße aus Schanghai). Dazu schaute ich all die anderen Exploitation-Filme, die zu dieser Zeit herauskamen. Und Anfang der Achtziger kehrte ich in diese Kinozeile am Broadway zurück. Wobei das Viertel inzwischen viel stärker mexikanisch als schwarz dominiert war und die 35-Millimeter-Filmkopien, die dort gezeigt wurden, meist spanisch untertitelt waren.
Außerdem verbrachte ich in den Siebzigern oft das Wochenende bei Jackie (ihr erinnert euch an die ehemalige Mitbewohnerin meiner Mutter?), die in Compton wohnte. Jackie war inzwischen wie eine zweite Mutter für mich, ihre Tochter Nikki (die vier Jahre älter war als ich) wie eine Schwester und Jackies Bruder Don (wir nannten ihn Big D) wie ein Onkel.
Und Nikki und ihre Freundinnen nahmen mich in Compton mit ins Kino, wo ich Mahogany (dt. Mahagoni), Let’s Do It Again (dt. Drehn wir noch’n Ding), A Piece of the Action (dt. Ausgetrickst) und Adiós Amigo sah (wir schauten nicht nur schwarze Filme, Airport 1975 ((dt. Giganten am Himmel)) und Foul Play ((dt. Eine ganz krumme Tour)) waren auch dabei). Als ich vierzehn war, gingen Nikki und eine ihrer Freundinnen auch mit mir ins Pussycat Theatre am Hollywood Boulevard, wo ich zum ersten Mal einen Porno sah: die klassische Doppelvorstellung von Deep Throat und The Devil in Miss Jones, die in diesem Kino acht Jahre lang lief. (Den Wirbel um Deep Throat verstanden wir nicht. Aber The Devil in Miss Jones fanden wir ziemlich gut.)
Wie ich da mit 14 reinkam?
Zum einen war ich ziemlich groß. Nur meine Piepsstimme hätte mich verraten. Also überließ ich Nikki das Reden.
Zum anderen war das Kino die ganze Nacht geöffnet. Also kamen wir um zwei Uhr morgens. Ich glaube nicht, dass jemals einer Frau um zwei Uhr morgens der Eintritt ins Pussycat Theatre verweigert wurde.
Später, mit sechzehn, fing ich an, als Platzanweiser im Pussycat Theatre in Torrance zu arbeiten.
Aber zurück zu mir, Reggie und Jim Brown:
Black Gunn lief im Tower Theatre in einer Doppelvorstellung mit einem anderen Film, einem amateurhaften Gesellschaftsdrama, das schwarze Themen verhandelte, mit dem Titel The Bus Is Coming.
Wir betraten den Kinosaal etwa fünfundvierzig Minuten vor dem Schluss von The Bus Is Coming. Wenn es darum ging, als Kind inmitten eines erwachsenen Publikums anspruchsvolle Filme zu schauen, war ich wie gesagt einiges gewohnt. Ich hatte die Reaktion aller möglichen erwachsenen Zuschauer auf alle möglichen Filme miterlebt. Und ich hatte sogar erlebt, wie sich ein Publikum gegen einen Film wendet und ihn ausbuht (das war bei einem Crown-International-Film mit dem Titel The Young Graduates passiert). Aber ich hatte noch nie etwas Vergleichbares erlebt wie die Reaktion dieser Zuschauer auf The Bus Is Coming.
Sie fanden ihn absolut beschissen.
Und während der verbleibenden fünfundvierzig Minuten schleuderten sie der Leinwand pausenlos wüste Beschimpfungen entgegen. Den Ausdruck Lutsch mir den Schwanz! hörte ich zum ersten Mal im Leben, als ihn einer der Zuschauer einer Figur auf der Leinwand entgegenschrie. Da ich so etwas noch nie erlebt hatte, wusste ich zuerst nicht damit umzugehen. Aber sie beleidigten die Figuren auf immer derbere Art und Weise, und je länger der Film dauerte, desto tiefer schienen ihn die Zuschauer zu verachten und desto lustiger wurden ihre Beleidigungen. Bis ich zu kichern anfing. Und bald kicherte ich völlig hemmungslos. Meine Reaktion und das ungehemmte Gekicher meiner piepsigen Zehnjährigenstimme mussten den Footballspieler neben mir genauso belustigen, wie das Publikum mich belustigte.
»Hast du Spaß, Q?«, fragte er.
»Die sind so was von lustig«, sagte ich und meinte nicht den Film.
Er lächelte mich an und klopfte mir mit seiner Riesenhand auf die Schulter. »Du bist ein cooler Typ, Q.«
Und dann fühlte ich mich ermutigt, mitzumachen. Also schrie ich etwas in Richtung Leinwand. Und überprüfte kurz mit einem Seitenblick zu Reggie, ob das in Ordnung war. Aber Reggie lachte, weil ich mich wohl genug fühlte, um mitzumachen. Und ich machte mit. Ich schrie der Leinwand sogar meinen neuen Lieblingsausdruck entgegen: »Lutsch mir den Schwanz!«
Und das ließ Reggie und ein paar andere ältere Typen in unserer Nähe in Gelächter ausbrechen.
Wow! Was für ein Abend.
Aber die Nacht hatte erst begonnen.
Meine letzte Erinnerung an The Bus Is Coming ist, wie am Schluss der zwölfjährige schwarze Junge, der den ganzen Film über auf den Bus gewartet hat (der Bus sollte wohl eine Metapher sein), immer wieder den titelgebenden Satz ruft, als der Bus endlich auftaucht. In dem Moment schrie einer im Publikum zurück: »Dann steig halt ein, und fick dich ins Knie!«
Als in dem riesigen Kinosaal die Lichter angingen, wischte ich mir Lachtränen aus den Augen. Mir war aufgegangen, dass Reggie sich wegen meiner Mutter mit mir gut stellen wollte. Also fragte ich ihn, ob ich eine Cola und ein paar Süßigkeiten von der Snackbar haben könnte. Aber statt mit mir zum Getränkestand zu gehen, kramte er einfach seinen Geldbeutel hervor, zog einen Zwanzigdollarschein heraus und sagte: »Hol dir, was du willst.«
Wenn es nach mir ging, konnte Mom den Typen ruhig heiraten.
Ich bahnte mir also den Weg durch das riesige Kino, das quasi die Größe des Metropolitan Opera House hatte, zur Snackbar und kehrte mit ungesundem Zeug im Wert von zehn Dollar auf meinen Platz zurück, als es im Saal gerade wieder dunkel wurde. Dann begann in einer Downtown Saturday Night Jim Browns neuer Film Black Gunn durch den Verschluss des Projektors zu flattern, zur Freude eines hochbegeisterten Publikums aus etwa achthundertfünfzig Schwarzen, achthundert davon männlich.
Und ehrlich gesagt war ich danach nicht mehr derselbe.
In gewisser Weise habe ich danach mein Leben lang, ob ich nun Filme geschaut oder gedreht habe, die Erfahrung, an einem Samstagabend des Jahres 1972 in einem schwarzen Kino einen brandneuen Jim-Brown-Film zu schauen, nachzuahmen versucht. Das Einzige, was dem bis zu diesem Zeitpunkt nahegekommen war, war mein erster James-Bond-Film Diamonds Are Forever im Jahr zuvor, bei dem die Zuschauer jeden launigen Spruch von Sean Connery mit wissendem Gelächter quittiert hatten. Und die Reaktion des Publikums auf Clint Eastwood als Dirty Harry würde ich vielleicht noch dazuzählen.
Trotzdem … es war kein Vergleich.
Als Jim Brown sich an seinen Schreibtisch setzt und Bruce Glover (Crispins Vater) und seine anderen weißen Spießgesellen den von Brown gespielten Gunn bedrohen, und Gunn drückt einen Knopf unter dem Tisch, und eine abgesägte Schrotflinte fällt ihm in den Schoß … da johlte der ganze riesenhafte Kinosaal voller Schwarzer, wie es der kleine zehnjährige Quentin noch nie in einem Kino erlebt hatte. Seinerzeit – als Sohn einer alleinerziehenden Mutter – war das wohl die maskulinste Erfahrung meines Lebens.
Und als der Film mit einem Standbild von Jim Brown als Gunn endete, rief der Typ hinter Reggie und mir aus: »Das nenn ich mal einen Film über einen bösen schwarzen Mann!«[3]
Leider sah ich Reggie nach diesem ersten Abend niemals wieder. Und bis heute habe ich keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Hin und wieder fragte ich meine Mom: »Was ist denn aus Reggie geworden?«
Sie zuckte dann bloß mit den Schultern und sagte: »Ach, der treibt sich noch irgendwo rum.«
Bullitt
(1968)
Neben Paul Newman und Warren Beatty war Steve McQueen der größte unter den jüngeren männlichen Filmstars der Sechziger. In England gab es einige aufregende junge Hauptdarsteller wie Michael Caine, Sean Connery, Albert Finney und Terence Stamp, aber bei den jungen sexy Typen in Amerika – die zugleich echte Filmstars waren – belief es sich auf McQueen, Newman und Beatty. In der zweiten Reihe folgten dann James Garner, George Peppard und James Coburn. Aber wenn einer von ihnen eine Rolle bekam, dann meist weil die oberen drei sie abgelehnt hatten. Die Produzenten wollten Newman oder McQueen und begnügten sich mit George Peppard. Sie wollten McQueen und begnügten sich mit James Coburn. Sie wollten Beatty und begnügten sich mit George Hamilton. James Garner war sogar populär genug, um hin und wieder ein Drehbuch abzukriegen, auf dem nicht schon die Fingerabdrücke der oberen drei waren, aber nicht oft.
Eine Stufe darunter kamen die aufstrebenden jungen Hauptdarsteller wie Robert Redford, George Segal und George Maharis und Popstars wie Pat Boone und Bobby Darin, die in den Sechzigern tatsächlich richtige Filmkarrieren hatten. In der Tat war der einzige junge Filmstar, der es mit den drei Schauspielern an der Spitze hätte aufnehmen können, hätte er seine Filmkarriere nur ernst genommen, Elvis Presley. Aber Elvis war nicht nur ein Sklave von Col. Tom Parker, sondern auch seines eigenen Ruhms. Er drehte zwei Filme im Jahr, und keiner machte je Verlust. Und diese Elvis-Filme waren nicht alle schlecht. Es gab bessere und schlechtere. Aber man kann guten Gewissens sagen, dass es keine echten Filme waren. Es waren einfach »Elvis-Filme«.
Doch neben seiner King-of-Cool-Persönlichkeit und seinem nicht von der Hand zu weisenden Charme war Steve McQueen in den Sechzigern so populär, weil er von den drei Top-Schauspielern (Newman, McQueen und Beatty) die besten Filme drehte.
Nachdem McQueen mit The Great Escape (dt. Gesprengte Ketten) zum Filmstar geworden war, drehte er eine Reihe von Filmen, die alle verdammt gut waren. Der einzige echte Flop in seiner Filmografie nach The Great Escape war in den Sechzigern Baby, the Rain Must Fall (dt. Die Lady und der Tramp). Und das lag hauptsächlich am lächerlichen Anblick von Steve McQueen, der einen Folk-Sänger zu spielen versuchte. Paul Newman dagegen hat während seiner Laufbahn eine unglaubliche Menge mieser Streifen und dazu ein paar Kultfilme gedreht. Ich meine, ein paar der Rollen, die Newman im Laufe der Jahre angenommen hat, sind wirklich erstaunlich. Wahrscheinlich war er einfach froh, aus dem Haus zu sein. Warren Beattys Filme nach Splendor in the Grass (dt. Fieber im Blut) taugen allesamt nichts, bis irgendwann Bonnie and Clyde (dt. Bonnie und Clyde) kam (Lilith ist wohl der beste vor Bonnie and Clyde, allerdings nicht wegen Beatty). Aber die Filme, die McQueen sich aussuchte, waren im Vergleich zu denen der anderen beiden durchgehend von höherer Qualität.
Doch die Überlegenheit von McQueens Filmen war nicht der Tatsache geschuldet, dass der Schauspieler alles sichtete, was der Markt hergab, und von seiner unheimlichen Begabung bei der Auswahl von Projekten Gebrauch machte. McQueen las nicht gern. Man darf bezweifeln, dass er jemals freiwillig ein Buch in die Hand nahm. Wahrscheinlich las er nicht mal die Zeitung, solange nichts über ihn drinstand. Und Drehbücher las er nur, wenn er musste. Es war nicht so, dass er nicht lesen konnte. Er hatte keine Leseschwäche, verriet mir seine erste Frau Neile McQueen: »Er las Autozeitschriften.«
Und es war auch nicht so, dass er nicht klug gewesen wäre. Er konnte dir alles über Motorhubraum erzählen, dir erklären, wie man bei einem Motorrad den Vergaser wechselt, oder über Waffen reden, bis es einem zu den Ohren herauskam.
Er las bloß nicht gern.
Wer las also die Drehbücher?
Neile McQueen.
Neile McQueens Bedeutung für Steves Erfolg als Filmstar kann gar nicht überschätzt werden.
Es war Neile, die die Bücher las. Es war Neile, die die Stoffe aussiebte. Es war Neile, die die Projekte auswählte, die für Steve am besten waren. Steves Agent Stan Kamen las zehn angebotene Drehbücher. Dann suchte er fünf davon aus und schickte sie Neile. Sie las diese fünf Bücher, fasste sie schriftlich zusammen, pickte die zwei heraus, die sie am besten fand, und dann erzählte sie Steve den Inhalt und erklärte ihm, weshalb sie sie für passend hielt. Was meist damit endete, dass er das Buch las, das Neile am besten fand.[4] Natürlich kam es auch auf den Regisseur an, es kam auf die anderen Schauspieler an, darauf, wie viel man ihm zahlte, auf den Drehort – auf all das kam es an. Aber eben auch auf Neiles Meinung. Regisseure, mit denen Steve schon zusammengearbeitet hatte – und die er mochte –, wurden natürlich bevorzugt behandelt. Aber wenn Neile das Drehbuch nicht gefiel, kämpften sie gegen große Widerstände. Und mithilfe ihres guten Geschmacks und ihres Wissens um die Fähigkeiten und die ikonische Persönlichkeit ihres Mannes konnte Neile ihn von The Cincinnati Kid (dt. Cincinnati Kid) an auf die größte Siegesstraße der zweiten Hälfte der Sechziger führen (Elvis hätte so eine Neile McQueen gebraucht).
Neile war auch etwas bewusst, was mir der meisterliche Actionfilm-Regisseur Walter Hill einmal über McQueen verriet. Hill arbeitete zweimal als Zweiter Regieassistent mit Steve zusammen, bei The Thomas Crown Affair (dt. Thomas Crown ist nicht zu fassen) und Bullitt, und als er später Drehbuchautor war, verfasste er das Buch für The Getaway (dt. Getaway).
Hill sagte zu mir: »Quentin, an Steve hätte dir unter anderem gefallen, dass er zwar ein guter Schauspieler war, sich aber nicht als bloßen Schauspieler betrachtete.[5] Er sah sich als FILMSTAR. Das war einer seiner charmantesten Wesenszüge. Er wusste, was er gut konnte. Er wusste, was die Zuschauer an ihm mochten, und das wollte er ihnen geben.«
Walter sagte weiter: »Ich habe Steve wirklich bewundert. Er war der letzte wahre Filmstar.«
Und es stimmt, McQueen wollte sich nicht unter vielen Schichten von Charakterzeichnung verbergen oder angeklebte Bärte tragen, die sein Aussehen veränderten (so wie Paul Newman in The Life and Times of Judge Roy Bean ((dt. Das war Roy Bean)) oder Robert Redford in Jeremiah Johnson). Wenn er einen Film drehte, wollte er darin cooles Filmstarzeug machen. Er wollte keine Filme drehen, in denen irgendein anderer eine bessere Rolle hatte als er. Er wollte die Leinwand mit niemandem teilen, und er wollte immer die Oberhand behalten. McQueen kannte sein Publikum, und er wusste, es zahlte dafür, ihn siegen zu sehen.
Ich fragte Neile, wie der Film Bullitt zustande kam. Sie erzählte mir, dass Steve gerade einen Deal mit Warner Bros.-Seven Arts für die Finanzierung seiner Produktionsfirma Solar Productions abgeschlossen hatte. Und dass es ihr Projekt war, mit dem Warner den Startschuss für die Zusammenarbeit geben wollte. Auch Neile wollte, dass Steve Bullitt machte. Bullitt folgte auf Steves größten Erfolg, The Thomas Crown Affair, und Neile dachte sich: Das wäre ein schöner Richtungswechsel. In Thomas Crown