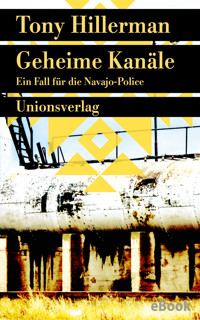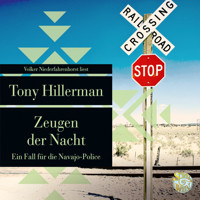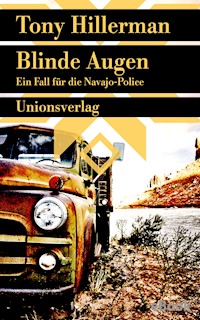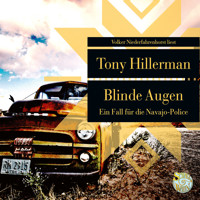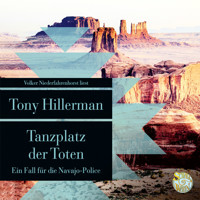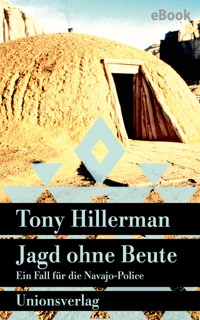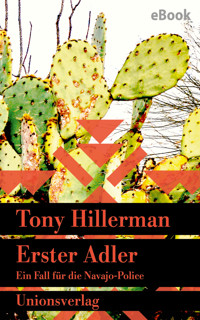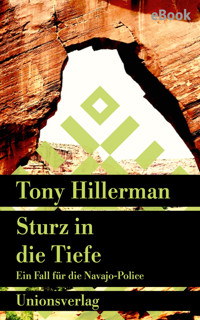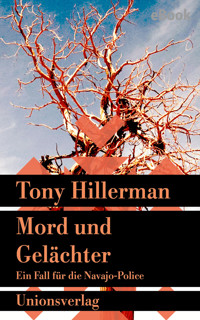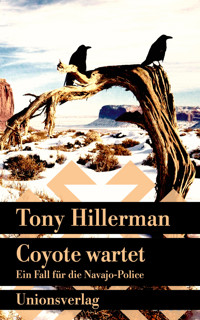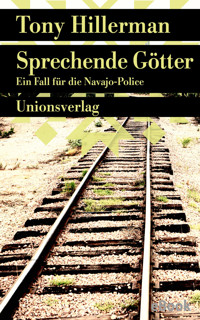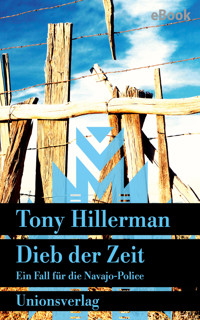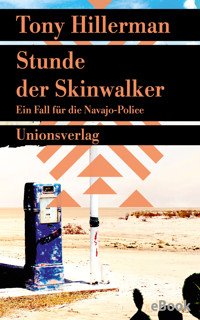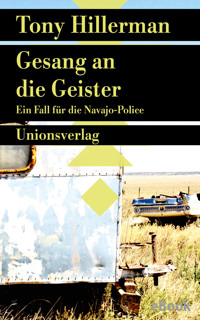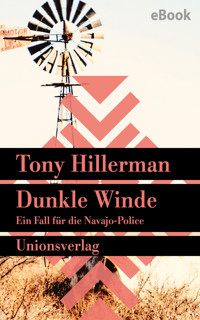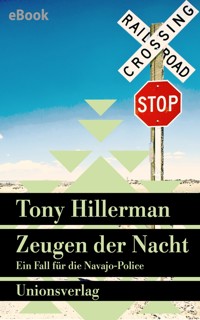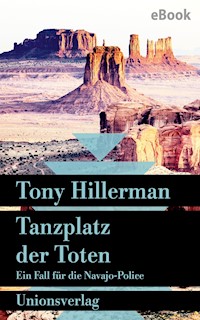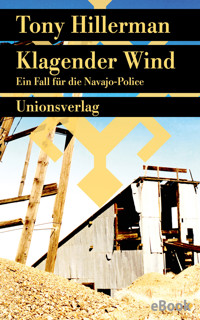
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem ausgetrockneten Flussbett im Navajo-Reservat steht ein Pick-up, darin ein Toter, die tödliche Kugel noch im Rücken. Kein Verdächtiger, kein Tatmotiv, und Sergeant Jim Chee gerät unter Druck, weil seine Assistentin unzureichend Spuren gesichert hat. Doch Karten im Wagen und bestimmte Pflanzensamen an den Socken des Toten deuten darauf hin, dass der Tote womöglich auf der Suche nach der legendären Golden-Calf-Mine war – ein Ort, der bisher mehr Unheil als Reichtum schuf und Joe Leaphorn an ein altes Verbrechen erinnert: Vor fünf Jahren wurde ein Goldsucher ermordet, und die Ehefrau des Täters verschwand spurlos. Erzählt man sich nicht noch heute, wie der Wind in der Mordnacht Klageschreie davontrug?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein Mord in den Chuska Mountains liefert neue Erkenntnisse zu einem alten Fall, der Leaphorn keine Ruhe lässt: Ein Betrug um die legendäre Golden-Calf-Mine endete tödlich, und ein klagender Wind soll die Schreie einer Frau durch die Luft getragen haben. Chees und Leaphorns Ermittlungen führen in dunkle Abgründe, den Spuren des Goldes nach.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Fried Eickhoff ist Übersetzer aus dem Englischen, er hat u. a. Werke von Tony Hillerman, Paula Gosling und Philip Kerr ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Fried Eickhoff.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Klagender Wind
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Fried Eickhoff
Ein Fall für die Navajo-Police (14)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Frank Schmitter nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 2002 bei HarperCollinsPublishers, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel Das Goldene Kalb im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: The Wailing Wind
© by Tony Hillerman 2002
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Fried Eickhoff beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Robert Paul van Beets (Alamy Stock Photo); Symbol - Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31172-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 12.05.2025, 12:02h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KLAGENDER WIND
Vorbemerkung des Autors1 – Es war ein arbeitsreicher Tag für Officer Bernadette …2 – Joe Leaphorn brauchte seine Zeit, um sich an …3 – Sergeant Jim Chee verließ die Zentrale der Navajo-Police …4 – Officer Bernadette Manuelito war in aller Herrgottsfrühe aufgestanden …5 – Der Streifenwagen, neben dem Leaphorn seinen Pick-up stoppte …6 – Leaphorn erwachte wie immer kurz nach Anbruch der …7 – Die erste Person auf Leaphorns alter Liste war …8 – Bevor Leaphorn sich von Mrs Hano verabschiedete …9 – Genau wie Leaphorn hatte auch Officer Bernadette Manuelito …10 – Bernie brauchte nur den Bruchteil einer Sekunde …11 – Zum ersten Mal seit den peinvollen Pubertätsjahren an …12 – Chee holte tief Luft, gab sich einen Ruck …13 – Joe Leaphorn saß vor seinem Hamburger mit Pommes …14 – Officer Bernadette Manuelito hatte einen Teil der Zeit …15 – Deputy Sheriff Ozzie Price war fast im selben …16 – Leaphorn hatte versucht, Professor Louisa Bourebonette die Verwirrung …17 – Zu Leaphorns Leidwesen hatte sich Denton das Aufnahmegerät …18 – Wiley Denton kam wieder zurück, doch eine große …19 – Ich weiß, dass du einem methodischen, wissenschaftlichen Vorgehen …20 – Streng genommen hätte sich Chee diesen Tag gar …21 – Normalerweise hatte Chee gute Laune, wenn er am …22 – Wann immer das Telefon klingelte, ließ Joe Leaphorn …23 – Die Farbe von McKays Wagen herauszubekommen, erwies sich …24 – Als Erstes übergab Leaphorn Peggy das Kleingeld …25 – Nach dem Gespräch mit Louisa rief Leaphorn sofort …26 – Als Leaphorn in die Straße einbog, in der …27 – Wenn Chee mit Vertretern der Bundesbehörden zu tun …28 – Während er den Pick-up auf dem Parkplatz langsam …29 – Unterwegs nach Fort Wingate erzählte Chee Bernie von …Anmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Fried Eickhoff
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Vorbemerkung des Autors
Die Ereignisse in Klagender Wind sind Fiktion, aber das Army-Munitionsdepot Fort Wingate gibt es tatsächlich. Es erstreckt sich östlich von Gallup über eine Fläche von fast hundert Quadratmeilen, an die Gleise der transkontinentalen Eisenbahnstrecke, den alten Highway 66 und die Interstate 40 grenzend, und hat schon Generationen von Touristen über seine gigantischen Bunkeranlagen staunen lassen. Einst beherbergten sie Tausende Tonnen Bomben, Raketen und Sprengköpfe, aber heute sind sie größtenteils leer. Antilopen weiden entlang dem verlassenen Gelände – ebenso einige Büffel, die von einem Zuchtversuch übrig geblieben sind, und das Vieh der benachbarten Rancher, denen zuweilen vorgeworfen wird, ihren Tieren dies zu erleichtern, indem sie den einen oder anderen Zaun kurzerhand durchschneiden. Die Technologie-Firma TPL Inc. nutzt einige der Bunker für die Verarbeitung von Raketentreibstoff zu Plastiksprengsätzen, und ich möchte mich bei ihren Angestellten Paul Bryan, Brenda Winter und Jim Chee1 bedanken, die mich bei der Arbeit an diesem Buch unterstützt haben.
Fort Wingate wurde im Jahr 1850 gegründet, seit 1862 befindet es sich auf dem heutigen Gelände. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde es als Depot für immense Mengen von Sprengstoff genutzt, während des Zweiten Weltkriegs und des Koreakriegs erfuhr es jeweils beträchtliche Erweiterungen, und zur Zeit des Vietnamkriegs fungierte es schließlich als zentrales Munitionsdepot. Heute ist es nicht mehr in Betrieb, aber die Army feuert manchmal von hier aus Zielflugkörper ab in Richtung der Flugabwehrbasis White Sands, und einige Bunker und andere Gebäude beherbergen Regierungsbüros.
Mein Dank gilt auch meinem alten Freund James Peshlakai, Navajo-Schamane, Singer wichtiger Heilungszeremonien und Direktor der Peshlakai Cultural Foundation, der mir gestattete, dem fiktiven Medizinmann vom Coyote Canyon seinen Namen zu geben, sowie Lori Megan Gallagher und Teresa Hicks, die mir zur Seite standen, als ich über die alten Legenden recherchierte, die sich um die Minen ranken.
1
Es war ein arbeitsreicher Tag für Officer Bernadette Manuelito, aber sie genoss ihn, denn jede erledigte Aufgabe gab ihr erneut das Gefühl, nun keine blutige Anfängerin mehr bei der Navajo-Police zu sein.
Unangenehme Dinge zuerst, war das Prinzip ihrer Kollegen, und so war sie gleich am Morgen zum Chapter House von Cudai gefahren, um Desmond Nakai einen Haftbefehl zu überbringen. Sie hatte nicht ernsthaft damit gerechnet, ihn anzutreffen, doch zu ihrer Überraschung erwartete er sie schon und ersparte ihr, eine Fahndung nach ihm einzuleiten. Ihr Chef, Captain Largo, hatte sie gewarnt, Nakai könne unangenehm werden, doch der schien geradezu erleichtert.
Anschließend war sie nach Beclabito gefahren. Die Schule dort hatte einen Einbruch gemeldet. Das Ganze stellte sich jedoch bald als harmlos heraus. Ein Aushilfstechniker hatte bei seiner Wochenendzechtour zu tief ins Glas geschaut und wollte sich seine Jacke holen, die er am Freitag nach der Arbeit hatte liegen lassen. Also hatte er kurzerhand im Erdgeschoss eine Scheibe eingeschlagen. Er war jedoch bereit, für den entstandenen Schaden aufzukommen. Dann meldete sich die Funkleitzentrale und teilte mit, die Fahrt zum Gemeindehaus in Sweetwater habe sich erledigt. Das bedeutete, ihr nächstes Ziel war Red Valley.
»Und, Bernie«, fuhr der Kollege fort, »wenn du mit Red Valley fertig bist, hab ich gleich einen neuen Job für dich. Wir haben einen Anruf bekommen, dass in einer Schlucht abseits der Sandpiste, die zur Schule von Cove führt, ein verlassener Wagen stehen soll. Blassblauer Pick-up mit Doppelkabine. Sieh mal nach und gib uns das Kennzeichen durch. Wahrscheinlich ist er als gestohlen gemeldet.«
»Wieso hast du dir das Kennzeichen nicht gleich von dem Anrufer geben lassen?«
»Weil der Anrufer ein Pilot von El Paso Natural Gas war, der den Wagen gestern Nachmittag und heute Morgen beim Überfliegen des Gebiets dort unten hat stehen sehen. Er sagte, er sei zu hoch gewesen, um das Nummernschild lesen zu können.«
»Aber nicht zu hoch, um zu erkennen, dass der Wagen verlassen war?«
»Ach komm schon, Bernie, wer lässt schon seinen Wagen über Nacht in einem Flussbett stehen, wenn er sich ihn nicht für eine Spritztour ausgeliehen hat?« Der Dispatcher präzisierte seine Beschreibung des Standorts noch um ein paar Details und entschuldigte sich dann, dass er ihr heute so viel Arbeit aufhalse.
»Geht in Ordnung. Und ich entschuldige mich für meinen gereizten Tonfall eben.«
Der Mann in der Zentrale war Rudolph Nez, einer der dienstältesten Kollegen. Er war der Erste gewesen, der sie, blutjung und dazu noch weiblich, als Cop akzeptiert hatte. Inzwischen betrachtete sie ihn fast als Freund und hatte den Verdacht, dass er ihr absichtlich besonders viele Aufträge zuschob, um ihr zu beweisen, dass er sie als ebenbürtige und vollwertige Kollegin betrachtete. Nach Cove zu fahren, kam ihr außerdem ganz gelegen. Sie würde die Möglichkeit nutzen, auf dem Weg dorthin einen Abstecher am Roof Butte zu machen, mit gut dreitausend Metern eine der höchsten Erhebungen in der Navajo Reservation. Dort oben war ein guter Platz, um eine Pause einzulegen. Den verlassenen Pick-up zu finden, hatte ja keine besondere Eile.
Sie setzte sich auf eine mächtige Sandsteinplatte im Schatten einiger Espen und Rottannen, öffnete ihr Lunchpaket, dachte an Sergeant Jim Chee und genoss die schöne Aussicht gen Norden. Pastora Peak und die Carrizo Mountains versperrten ihr zwar den Blick auf die Rockies von Colorado, und die Gipfel in Utah lagen hinter dichten Bergwäldern verborgen. Aber direkt unter ihr erstreckte sich die unermessliche Weite von New Mexico, und zur Linken konnte sie den nördlichen Teil von Arizona sehen. Die Weite des zu ihren Füßen liegenden Landes, das wie gefleckt aussah durch die Wolkenschatten, die darüber hinwegzogen, und der Anblick der majestätischen Berggipfel reichten aus, um den Geist zu beleben und die Seele friedlich zu stimmen. Wie auch die Erinnerung an jenen Tag, als sie zusammen mit Jim Chee hier oben gestanden hatte. Sie war damals neu im Polizeidienst gewesen, und Jim Chee war mit ihr auf diesen Gipfel gefahren, um ihr diese fantastische Aussicht auf die Navajo Nation zu zeigen. Nach Nordosten zu, über der Chaco Mesa, hatte sich eine Gewitterfront gebildet, und auch im Osten über dem Tsoodzill, dem Türkisberg, türmten sich drohend dunkle Wolkenberge. Doch das hügelige grüne Land ringsum hatte in hellem Sonnenschein gelegen. Chee hatte auf eine rotierende graue Säule aus Staub und Schmutz gedeutet, die sich jenseits des Highway 66 in schnellem Zickzackkurs auf sie zubewegte. »Eine Windhose«, hatte sie gesagt, und zum ersten Mal hatte sie in Chee den Menschen in der Polizeiuniform gespürt.
»Eine Windhose«, hatte er nachdenklich wiederholt, »ja, dasselbe habe ich eben auch gedacht. Seit meiner Kindheit fällt mir beim Anblick dieser tückischen Staubteufel immer die Geschichte vom Kampf der Hard Flint Boys mit den Wind Children ein. Die guten yei bringen uns kühle, frische Luft und Regen für unser Weideland, die schlechten geben dem Wind Unheil mit auf den Weg.«
Sie trank ihren Kaffee aus der Thermoskanne aus und überlegte, wie sie sich Chee gegenüber verhalten sollte. Sie war sich noch immer unschlüssig, was sie von ihm wollte. Ihre Mutter schien ihn ja als möglichen Kandidaten akzeptabel zu finden. »Dieser Mr Chee«, hatte sie ihr vor ein paar Tagen völlig unvermittelt gesagt, »stammt, wie ich gehört habe, mütterlicherseits von den Slow Talking Diné und väterlicherseits von den Bitter Water ab.« Mehr hatte sie dazu nicht gesagt, aber das war auch nicht nötig. Bernie wusste jetzt, dass ihre Mutter sich über Chee erkundigt und die erhaltene Auskunft etwaige Besorgnisse zerstreut hatte. Da Bernie von den Ashjjhi Diné abstammte, würde eine Verbindung zwischen ihr und Chee keines der Inzesttabus der traditionellen Navajo-Gesellschaft verletzen. Bernie durfte Chee also weiter zulächeln. Und vielleicht würde es auch beim Lächeln bleiben. Wie gesagt, sie wusste selbst nicht so genau, was sie von ihm wollte, und Jim Chee blieb verdammt schwer zu durchschauen.
Während sie auf der Suche nach dem verlassenen Wagen nun schon das dritte Flussbett hochfuhr, dachte sie noch immer an ihn. Plötzlich sah sie vor sich etwas hell aufleuchten. Sonnenlicht, das vom Rückfenster eines Pick-ups reflektiert wurde. Blassblau, mit Doppelkabine, wie beschrieben, den schmalen Weg blockierend.
Zugelassen in New Mexico, stellte sie fest und notierte das Kennzeichen. Dann stieg sie aus und ging langsam auf den Wagen zu. Beide Seitenfenster waren offen. Sie blieb stehen. In einer Halterung am Rückfenster steckte ein Gewehr. Wer würde sich aus dem Staub machen und es einfach zurücklassen als willkommene Beute für Diebe?
»Hallo«, rief sie und wartete. »Hey! Ist da jemand?«
Keine Antwort. Sie ließ das Holster aufschnappen, fasste mit ihrer Rechten nach der Pistole und näherte sich langsam der Beifahrertür.
Seitlich ausgestreckt, den Kopf Richtung Fahrertür, lag ein Mann auf den Vordersitzen. Er trug Jeansjacke und Jeans. Ein rotes Basecap verdeckte den größten Teil seines Gesichts.
Da schläft jemand seinen Rausch aus, dachte Bernie, die schon lange genug im Polizeidienst war, um mit diesen Fällen vertraut zu sein. Doch der übliche Whiskygestank fehlte. Und der Mann lag ein wenig zu still da. Regungslos, ohne sichtbare Atembewegung.
Sie holte tief Luft und trat einen halben Schritt näher. »Ya eeh teh«, sagte sie laut. Der Mann im Wagen rührte sich nicht. Sie spähte durch das Wagenfenster. Kein Zeichen von offener Gewaltanwendung, nirgendwo Verletzungen oder Blut. Unter dem Basecap lugten ein paar blonde Haarsträhnen hervor. Kleidung und Schuhe waren staubbedeckt. Der Mann muss bewusstlos sein oder tot, überlegte sie. Sie öffnete die Beifahrertür, griff mit ihrer Linken um den Türholm und schwang sich aufs Trittbrett. Dann beugte sie sich ins Wageninnere, schob eines der beiden Hosenbeine ein wenig hoch, umfasste mit Daumen und Zeigefinger das Fußgelenk des Mannes und suchte nach dem Puls. Der Knöchel fühlte sich kalt an, wie der eines Toten. Sie nahm keinen Puls wahr.
Der Kontakt mit dem leblosen Körper hatte schlagartig ihr Wissen, Polizistin zu sein, durch das Bewusstsein ihrer Herkunft ersetzt. Tausend Jahre, bevor die Diné etwas von Bakterien und Viren ahnen konnten, wussten sie um die Infektionsgefahr, die von frisch Verstorbenen und Sterbenden ausgeht. Die Älteren nannten es Chindi, einen bösen Geist, und lehrten, sich von solchen Toten vier Tage lang fernzuhalten, wenn der Tod im Freien eingetreten war. Andernfalls reichten vier Tage nicht aus, da ein Chindi sich, im Innern eines Hauses etwa, auch für längere Zeit festsetzen konnte. Bernie sprang vom Trittbrett hinunter, stand da und überlegte, was zu tun sei. Als Erstes musste sie Meldung machen. Sobald sie dann wieder zu Hause war, würde sie ihre Mutter anrufen und sie bitten, ihr einen Schamanen zu nennen für eine Reinigungszeremonie.
Sie ging zu ihrem Streifenwagen zurück und berichtete der Funkzentrale, was sie vorgefunden hatte.
»Natürlicher Tod also?«, fragte der Kollege. »Keine Schusswunden? Keine anderen Anzeichen für Gewaltanwendung? Kein Blut? Kein Pulvergestank?«
»Er sieht aus, als sei er einfach gestorben«, sagte Bernie. »Vermutlich eine Flasche zu viel.«
»Ich habe vorhin einen Krankenwagen nach Toadlena geschickt«, sagte der Funker. »Ich werde mal nachfragen, ob sie noch da sind. Bleib einen Moment dran, ich sag dir gleich Bescheid.«
Bernie wartete. Plötzlich bemerkte sie, dass ihre rechte Hand, mit der sie das Mikrofon hielt, ganz schmutzig war von feinem schwarzgrauem Ruß. Vermutlich vom Hosenbein des Toten, dachte sie. Sie verzog angewidert das Gesicht, legte das Mikrofon beiseite und wischte die Hand an ihrer Uniform ab.
»Geht klar, Bernie. Ich hab sie noch erwischt. Sie müssten in spätestens einer Stunde bei dir sein.«
Diese Schätzung erwies sich allerdings als reichlich optimistisch. Die Ambulanz brauchte fast zwanzig Minuten länger. Bernie kam die Zeit wie eine halbe Ewigkeit vor. Zuerst war sie im Streifenwagen sitzen geblieben und hatte überlegt, wer der Tote sein mochte. Dann war sie ausgestiegen und noch einmal um den Pick-up herumgegangen, um sich zu überzeugen, dass sie im ersten Schock nicht etwas Wichtiges übersehen hatte – eine Reihe von Einschusslöchern in der Windschutzscheibe etwa oder Blutspuren auf dem Fahrzeugboden, dem Lenkrad oder dem Gewehr im Rückfenster. Oder einen zerknüllten Zettel mit ein paar Abschiedsworten in der Hand des Toten.
Sie entdeckte nichts dergleichen, ihr fiel jedoch auf, dass an den Jeans des Toten unterhalb der Knie sowie an seinen Socken zahlreiche Pflanzensamen hafteten – Melde und Spitzklette waren am häufigsten vertreten, aber auch andere, ebenfalls mit Stacheln und Widerhaken bewehrte Samen, wie sie bei Pflanzen in extrem trockenen Landstrichen das Fortbestehen der Art sichern. Erst jetzt nahm sie bewusst wahr, dass in den Gummisohlen seiner Schnürschuhe etliche der starken, widerstandsfähigen Dornen von Erdsternen steckten, der Plage aller Motorradfahrer. Sie ging zu ihrem Wagen zurück und vertrieb sich die Zeit damit, zu überlegen, woher die Samen stammen mochten. Der Trockenbach hier lag in etwa dreitausend Metern Höhe, viel zu kühl für Melden. Kurz entschlossen stieg sie wieder aus und sah sich um. Ja, sie hatte recht gehabt. Hier gab es weder Melden noch Spitzkletten oder Erdsterne. Ganz in der Nähe entdeckte sie eine Gruppe von Astern. Sie hatten infolge der niedrigen Temperaturen in dieser Höhe bereits sehr früh Samen ausgebildet. Bernie beschloss, ein paar davon mitzunehmen. Sie wollte testen, ob diese auch in dem sehr viel milderen Klima bei ihr in Shiprock gedeihen würden. Und da sie schon einmal dabei war, holte sie sich auch noch die Samen von einer Akelei und ein paar Gräsern sowie einer grünen Kletterpflanze, die sie nicht identifizieren konnte. Ein Stück weiter hinten, halb verborgen unter Unkraut, sah sie den Deckel einer kleinen Metalldose hervorblitzen – wie passend, dachte Bernie. Die Dose hatte einmal Prince-Albert-Pfeifentabak enthalten. Etwas schmutzig, aber das war allemal besser, als die Samen lose in der Tasche zu transportieren.
2
Joe Leaphorn brauchte seine Zeit, um sich an den Ruhestand zu gewöhnen, aber er machte Fortschritte. Zum Beispiel hatte er gelernt, sich besser vorzubereiten, wenn er Louisa Bourebonette auf einer ihrer ethnologischen Exkursionen begleitete. Meistens führten diese in abgelegene Teile der Navajo-Reservate, wo sie sich mit den Alten des Stammes unterhielt und deren Erinnerungen als »oral history« mit dem Tonband aufnahm. Er hatte dann meistens mit im Hogan gesessen, der im Sommer heiß war wie ein Backofen, oder sich draußen in Louisas Wagen herumgedrückt. Bis er eines Tages auf die Idee gekommen war, sich einen komfortablen Klappsessel anzuschaffen. Seitdem machte er es sich, wenn Louisa wieder eins ihrer Interviews führte, in der schattigen Laube bequem, die zu jedem Hogan gehörte.
In diesem Klappsessel saß er auch jetzt, unter einem Baum neben dem Heuschober des Handelspostens Two Grey Hills. In einiger Entfernung, über der Bergkette der Lukachukai Mountains, türmten sich dunkle Kumuluswolken und ließen dann und wann ein verheißungsvolles Donnergrollen hören. Der Wind hatte aufgefrischt. Louisa wollte im Handelsposten einen Teppich kaufen. Er sollte das Hochzeitsgeschenk für eine ihrer zahlreichen Nichten sein, und der Laden hier war berühmt für seine gute Auswahl. Louisa pflegte auch auf den alltäglichen Lebensmitteleinkauf viel Zeit zu verwenden, und da dies ein Geschenk zu einem besonderen Anlass sein sollte, würde Leaphorn seinen Gedanken in aller Ruhe nachhängen können. Im Augenblick überlegte er, wer wohl schneller sein würde: Louisa mit ihrer Entscheidung für den vollkommenen Teppich oder das Gewitter. Es war natürlich auch möglich, dass er vergeblich wartete. Die Gewitterfront konnte sich in der trockenen Luft über der Prärie einfach auflösen und Louisa ohne Teppich aus dem Geschäft kommen. Es konnte aber auch passieren, dass die Wolken stiegen, höher und immer höher. An ihren Unterseiten würde das Weiß sich ins Blauschwarze verfärben, während sich oben glitzernde Eiskristalle bildeten. Dann sollte endlich der ersehnte Regen fallen. Auf der festgetretenen, bräunlichen Staubschicht des Parkplatzes von Two Grey Hills würden sich mit den ersten dicken Tropfen schnell dunkle Flecken ausbreiten, und Louisa würde in der Eingangstür erscheinen, unter dem Arm einen selten schönen Teppich. Und sie würde glücklich zu ihm herüberwinken, er solle mit dem Wagen unter dem Vordach halten, damit das gute Stück nicht nass wurde.
Über den Hang des Berges zuckte ein so greller Blitz, dass Leaphorn instinktiv die Augen zukniff, gefolgt von einem Donnerkrachen, das signalisierte, das Gewitter würde den Wettstreit gewinnen. In diesem Augenblick rollte ein Chevy auf den Parkplatz, mit der Aufschrift SHERIFF an der Seite. Der Wagen bremste zunächst ab, schien in der Nähe des Eingangs anzuhalten, fuhr dann aber in einer großen Kurve zu Leaphorn herüber.
»Lieutenant Leaphorn«, sagte der Fahrer, »bei Gewitter sollten Sie aber nicht unter einem Baum sitzen.«
Ein Gesicht aus vergangenen Zeiten. Deputy Sheriff Delo Bellman.
Leaphorn hob seine Hand zum Gruß, überlegte, ob er »Hallo, Delo« sagen sollte, entschied sich dann aber für »Delo, ya eeh teh«.
»Haben Sie heute schon Nachrichten gehört?«, fragte Delo.
»Nur ganz am Rande«, antwortete Leaphorn. Bellman brauchte kein Radio, um auf dem neuesten Stand zu sein, dachte er. Er war bekannt als die größte Plaudertasche der gesamten Polizei im Four-Corners-Gebiet.
»Die Nachricht von dem Toten. Jemand von deiner alten Truppe hat gestern in der Nähe von Cove einen Mann tot in seinem Pick-up gefunden. Es handelt sich um den Neffen vom alten Bart Hegarty. Sein Name war Thomas Doherty.«
Leaphorn versuchte, eine Miene zu machen, die zu der traurigen Nachricht passte. Doch seine Kontakte mit Sheriff Bart Hegarty waren weder zahlreich noch besonders erfreulich gewesen. Deshalb war er auch damals nicht zur Beerdigung gegangen. Der Sheriff war vor ein paar Jahren im Winter bei vereister Fahrbahn mit dem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt. »Und die Todesursache?«, wollte Leaphorn wissen. »Wenn er Hegartys Neffe war, wird er ja wohl kaum an Altersschwäche gestorben sein.«
»Ende zwanzig, schätze ich. Hatte eine Kugel im Rücken«, sagte er mit einem kaum verhohlenen Vergnügen an der Verbreitung dramatischer Nachrichten. »Der Schütze hat ein Gewehr benutzt.«
Das überraschte Leaphorn, bedeutete es doch, dass der Schuss den Mann vermutlich außerhalb des Wagens getroffen haben musste. Aber er fragte nicht weiter nach, sondern nickte nur. Er wollte nicht zu interessiert erscheinen, um von Bellman nicht noch weiter ins Gespräch gezogen zu werden. Leaphorn hatte bereits gestern Abend aus den Fernsehnachrichten erfahren, dass das FBI weder die Todesursache noch den Namen des Opfers genannt hatte. Aber allein aus der Tatsache, dass die Feds den Fall an sich gezogen hatten, hatte er geschlossen, dass es sich entweder um einen gewaltsamen Tod handelte oder das Opfer ein gesuchter Verbrecher war.
Bellman grinste: »Ist das nicht komisch? Da heiratet eine Frau namens Hegarty einen Mann namens Doherty …« Als Leaphorn nicht reagierte, schob er hinterher: »Na, ’ne -arty heiratet ’nen -erty!«
»Ja«, sagte Leaphorn obenhin.
»Wahrscheinlich eine Jagdwaffe«, fügte Bellman übergangslos hinzu. »Da hat einer aus ziemlicher Entfernung auf ihn angelegt, und dann: Bumm!«
Leaphorn nickte. Das hieß, die von der Spurensicherung waren zu dem Schluss gekommen, dass das Opfer erst nach dem tödlichen Schuss ins Auto gesetzt worden war. Interessant.
»Die Polizistin vor Ort hatte auf eine natürliche Todesursache getippt. Er lag auf der Seite, und so konnte sie die Schussverletzung im Rücken nicht sehen.«
»Eine Frau?«
»Ja«, antwortete Bellman, »die kleine Manuelito.«
Bernadette Manuelito also, dachte Leaphorn. Jung und smart. Zuletzt hatte er mit ihr zu tun gehabt, als er gemeinsam mit Jim Chee den Überfall auf das Spielkasino aufzuklären hatte. Wach und sehr umsichtig, aber ihr fehlte noch Erfahrung. »Na ja«, sagte er, »manchmal übersieht man eben etwas bei der Tatortsicherung, und sie ist noch relativ neu in diesem Metier. Ich kann ihren Irrtum schon nachvollziehen.«
Umso mehr, dachte er, als sie die Tochter einer ausgesprochen traditionellen Navajo-Familie war und man sie gelehrt hatte, gegenüber Verstorbenen auf Abstand zu achten, denn der Kontakt mit einem Toten barg die Gefahr spiritueller Verunreinigung, falls der Chindi den Leichnam noch nicht vollständig verlassen hatte. Manuelito war vermutlich davor zurückgeschreckt, den Toten zu berühren oder sich auch nur länger als unbedingt nötig in seiner Nähe aufzuhalten. Hatte nur bei ihm ausgeharrt, bis die Besatzung des Ambulanzwagens ihn übernahm …
»Soviel mir zu Ohren gekommen ist, haben die Feds nicht ganz so großes Verständnis. Angeblich haben sie sich bei Captain Largo beschwert, wie sie vorgegangen ist« – er ließ ein gehässiges kleines Lachen hören – »… oder auch nicht vorgegangen ist.«
»Was führt Sie eigentlich nach Two Grey Hills?«, fragte Leaphorn. Er wollte das Thema wechseln und hoffte, dass Bellman dann endlich verschwand, aber die Rechnung ging nicht auf.
»Wollte nur mal nach dem Rechten sehen«, antwortete der Deputy. »Schauen, was so anliegt.« Er startete den Motor, beugte sich dann aber noch einmal aus dem Fenster. »Ich möchte wetten, das FBI sorgt dafür, dass Jim Chee in der nächsten Zeit ’ne Menge Papierkram auf den Schreibtisch kriegt. Was meinen Sie?«
»Wer weiß«, sagte Leaphorn, obwohl er natürlich wusste, wie der Hase lief.
Bellman grinste, und obwohl ihm klar war, dass er Leaphorn damit nichts Neues erzählte, legte er seine Überlegungen ausführlich dar. Er nannte drei Gründe: erstens die allseits bekannten Spannungen zwischen Sergeant Chee und dem Federal Bureau of Investigation, die von der gesamten Polizei des Four-Corner-Gebiets mit großem Interesse beobachtet wurden; zweitens die Tatsache, dass Captain Largo, also derjenige, der gegenüber dem FBI den Kopf hinhalten musste, Aktenarbeit verabscheute und diese daher so schnell wie möglich an Sergeant Chee weiterreichen würde; und drittens das Gerücht, dass sich zwischen Chee und Officer Manuelito etwas anbahnte. Woraus folgte, dass Chee sich beim Abfassen des fälligen Berichts alle nur erdenkliche Mühe geben würde, sie gegen den Vorwurf, sie habe sich am Tatort nachlässig verhalten, zu verteidigen.
»Und noch was, Joe«, fuhr Bellman fort. »Ich hab das dumme Gefühl, dass dieser Fall auch Sie noch beschäftigen wird.«
Leaphorn öffnete den Mund, schloss ihn aber sofort wieder. Er wollte Bellman los sein, ehe Louisa auftauchte und auf ihn zugelaufen kam, ob mit oder ohne Teppich. Denn das hätte Bellmans Tratschsucht nur neues Material geliefert im Sinne von: »Ratet mal, mit wem ich den alten Joe Leaphorn am Two Grey Hills Handelsposten gesehen habe?« Doch seine Neugier war nun einmal geweckt, und so platzte es aus ihm heraus: »Wieso?«
»Wegen der Sachen in Dohertys Pick-up. Etliche Landkarten, einige Computerausdrucke mit geologischen und mineralogischen Daten und jede Menge Polaroidfotos, offenbar in irgendeinem Canyon aufgenommen.«
Leaphorn kommentierte das nicht.
»Und außerdem ein ganzer Ordner voll mit Fotokopien von Artikeln über die Golden-Calf-Mine«, fügte Bellman hinzu. »Ich wette, das erinnert Sie an den alten Wiley Denton und diesen … na, wie hieß er noch? Dieser Betrüger, den Wiley erschossen hat. McKay – war das nicht sein Name?«
»Marvin McKay«, sagte Leaphorn. Und ja – es rief Erinnerungen wach an den Fall Denton/McKay. Erinnerungen, die ihn so lang verfolgen würden, bis er endlich herausgefunden hatte, was mit Linda Denton, Wiley Dentons Frau, geschehen war.
3
Sergeant Jim Chee verließ die Zentrale der Navajo-Police durch den Seitenausgang, in einer Stimmung, die dem Wetter entsprach: mies. Der böige Westwind schlug die Tür hinter ihm ins Schloss und peitschte einen kleinen Schauer Sandkörner gegen seine Uniformhose. Chee war wütend auf sich selbst, weil er sich unklug verhalten hatte, auf den Chief, weil er den Feds nicht gesagt hatte, dass sie sich gefälligst um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten, und auf Captain Largo, weil der es anstelle des Chiefs hätte tun müssen.
In diesem Augenblick fuhr ein ziviler Pick-up auf den Teil des Parkplatzes, der klar und deutlich »Nur für Dienstfahrzeuge« reserviert war. Er kannte den Wagen. Blau, mit ein paar Beulen und einem Rostfleck auf dem rechten Kotflügel. Er gehörte Joe Leaphorn, bereits im Ruhestand, doch immer noch bekannt als der »Legendäre Lieutenant«.
Chee machte zwei Schritte auf das Auto zu und wurde im selben Augenblick eingeholt von dem ihm schon vertrauten inneren Chaos aus Bewunderung, Gereiztheit und einem Gefühl persönlicher Unzulänglichkeit seinem früheren Chef gegenüber. Er blieb unschlüssig stehen, aber Leaphorn hatte schon sein Fenster heruntergekurbelt und winkte ihn zu sich.
»Hallo, Jim«, rief er, »was führt Sie denn nach Window Rock?«
»Ach, nur ein kleines verwaltungstechnisches Problem«, antwortete Chee. »Und Sie, was machen Sie hier, ich meine, hier in der Zentrale?«
»Ich wollte mich gerade umsehen, ob mich vielleicht jemand zum Lunch einlädt«, sagte Leaphorn.
Sie fuhren zum Navajo Inn, setzten sich an einen der hinteren Tische und bestellten Kaffee. Chee wollte wie immer einen Hamburger mit Pommes frites essen, tat aber so, als müsse er erst gründlich die Speisekarte studieren, denn er brauchte noch ein wenig Zeit, um sich darüber klar zu werden, ob er sich einen Ruck geben und Leaphorn gegenüber seine Schwierigkeiten offenlegen sollte. Am Morgen war er vom Chief in die Zentrale bestellt worden, und die ganze lange Fahrt von seiner Dienststelle in Shiprock über den U. S. Highway 666 hatte er überlegt, ob er bei Leaphorn vorbeischauen und ihn um Rat fragen sollte. Er hatte den Gedanken dann aber doch fallen gelassen, weil ihm immer neue Einwände gekommen waren: Man dürfe den Lieutenant in seiner wohlverdienten Ruhe nicht stören; er, Chee, müsse mit dieser Sache doch eigentlich allein klarkommen, und ganz sicher würde er in Leaphorns Augen wie ein Trottel dastehen und so weiter und so fort. Aber nun war Leaphorn unverhofft auf dem Parkplatz aufgetaucht.
Er sah über den Rand seiner Speisekarte hinweg den Lieutenant an, der seine eigene noch nicht berührt hatte.
»Ich nehme hier immer eine Enchilada«, sagte Leaphorn. »Wenn man älter wird, entwickelt man so seine Gewohnheiten.«
Chee griff das Stichwort dankbar auf. »Ich hoffe, Sie haben auch noch die Gewohnheit, sich für merkwürdige Fälle zu interessieren.«
Leaphorn lächelte. »Ich nehme an, Sie sprechen von dem Mord an diesem Doherty. Der Fall interessiert mich durchaus.«
»Was haben Sie bis jetzt darüber erfahren?«, fragte Chee und dachte insgeheim: vermutlich alles, bis auf meine eigene unglückselige Verwicklung in die Geschichte.
»Was heute Morgen im Gallup Independent und in der Navajo Times stand, also die offizielle Pressemitteilung des FBI: Doherty wurde augenscheinlich außerhalb des Pick-ups erschossen und danach in den Wagen geschafft. Kein Verdächtiger und auch kein ersichtliches Tatmotiv. Das wars auch schon.«
»Und inoffiziell? Ist Ihnen da was zu Ohren gekommen?«
»Es heißt, das FBI sei nicht besonders glücklich, was die Sicherung des Fundortes angeht.« Leaphorn sah Chee an und grinste. »Wenn ich mich mit Wetten abgeben würde, dann würde ich darauf setzen, dass Sie genau aus diesem Grund heute beim Chief antreten mussten.«
»Die Wette hätten Sie gewonnen«, sagte Chee. »Der Kollege in der Funkleitzentrale hatte Officer Manuelito in die Gegend von Cove geschickt, um dort einen offenbar verlassenen Pick-up zu überprüfen. Bernie guckt in den Wagen rein und sieht drinnen einen Mann, der seitlich auf der vorderen Sitzbank liegt. Auf den ersten Blick keine Anzeichen von Gewaltanwendung, kein Blut, nichts. Er sieht aus wie einer von diesen Betrunkenen, mit denen man als Cop hier tagtäglich zu tun hat. Sie fahren irgendwo an den Straßenrand, um ihren Rausch auszuschlafen. Als der Mann auf ihren Anruf hin nicht reagiert, öffnet sie die Beifahrertür und greift nach seinem Fußgelenk, um den Puls zu fühlen. Er ist kalt, und es gibt keinen Puls. Also verständigt sie die Funkleitzentrale, und man schickt eine Ambulanz los.«
Chee hielt inne. Leaphorn sah ihn schweigend an und trank einen Schluck von seinem Kaffee.
Chee seufzte. »Sie sagt, sie hat sich die Zeit bis zum Eintreffen des Krankenwagens damit vertrieben, ein paar Samenkapseln einzusammeln. Bernie ist leidenschaftliche Hobby-Botanikerin und kennt sich sehr gut aus. Als die Besatzung der Ambulanz den Toten schließlich aus dem Wagen zieht und dabei die Schusswunde im Rücken entdeckt, ist sie bereits weg. Und wenn es dort irgendwelche Fußspuren des Täters gegeben haben sollte, dann waren die inzwischen natürlich alle zertrampelt. Aber wie hätte Bernie auch ahnen sollen …« Er schwieg. Leaphorn musste man nie irgendetwas erklären.
Leaphorn hätte darauf hinweisen können, dass Bernie genauer hinschauen oder die Fundstelle mit Absperrband hätte sichern sollen. Aber kein Wort. Der Lieutenant trank nur einen weiteren Schluck Kaffee und stellte die Tasse wieder hin.
»Gestern habe ich zufällig Delo Bellman in Two Grey Hills getroffen«, begann er. »Er sagte, in Dohertys Wagen sei eine ganze Menge schriftliches Material gefunden worden, darunter auch Fotokopien einiger Artikel über die legendäre Golden-Calf-Mine. Er meinte, das würde mich doch sicher an den Fall Denton erinnern. Sie wissen es vielleicht noch: Wiley Denton erschoss vor fünf Jahren einen gewissen Marvin McKay. Stimmt das mit dem überein, was Sie gehört haben?«
Chee nickte und verzog das Gesicht. »Sie kennen ja meine Probleme mit den Feds. Aber ich habe läuten hören, dass Doherty sich offenbar für die Sache Denton/McKay interessiert hat; denn ein Teil der Papiere, die die Feds in seiner Tasche fanden, muss aus den Ermittlungsakten zu diesem Fall fotokopiert worden sein.«
Leaphorn nickte. »Doherty war der Neffe des alten Bart Hegarty. Außerdem gilt der Fall Denton/McKay ja seit Langem als abgeschlossen. Doherty dürfte also keine großen Schwierigkeiten gehabt haben, an die Unterlagen zu kommen.«
»Ich frage mich, ob die Feds wohl wegen der alten Sache jetzt Denton in Verdacht haben«, sagte Chee.
Leaphorn nahm einen Schluck Kaffee und überlegte. Chee versuchte anscheinend, herauszufinden, ob er selbst auch eine Verbindung sah zwischen dem Fall Denton/McKay und dem Mord an Doherty. Und in der Tat: Er hatte daran gedacht, denn die Parallelen zwischen beiden Fällen waren bemerkenswert. Aber einen definitiven Beweis für einen Zusammenhang gab es nicht. Das nagte an ihm, denn er spürte, dass es Hinweise auf eine Verbindung gab. Er musste nur clever genug sein, sie zu finden.
»Was hätte Denton für ein Motiv haben sollen?«, wollte er von Chee wissen.
Der zuckte mit den Schultern. »Vielleicht wollte Doherty zu Ende bringen, was McKay begonnen hat. Mit anderen Worten: mit der Behauptung, er habe die Mine gefunden, kräftig abzusahnen.«
Leaphorn wiegte skeptisch den Kopf. »Klingt ziemlich weit hergeholt«, bemerkte er. »Doherty müsste ein ausgemachter Dummkopf gewesen sein oder aber lebensmüde.« Doch er wollte damit das Thema beenden. Chee sollte lieber endlich damit herausrücken, was ihn wirklich beschäftigte. Deshalb sagte er direkt heraus: »Bellman will gehört haben, dass die Feds sich bei Largo über Manuelito beschwert haben.«
Chee nickte. »Ja, das stimmt.«
Leaphorn hob beruhigend die Hand. »Ich würde mir deswegen keine allzu großen Sorgen machen. Wenn der Täter gefunden wird, sind sowieso alle Vorwürfe vom Tisch. Wenn sie es nicht schaffen und einen Sündenbock brauchen, dann wird Manuelito vermutlich vom Dienst suspendiert. Aber höchstens eine Woche und wahrscheinlich bei fortlaufenden Bezügen. Also keine große Sache.«
Chee holte tief Luft. »Das ist alles schön und gut, aber …«
Leaphorn wartete, ob Chee den Satz zu Ende bringen wollte, und trank einen Schluck Kaffee. Doch Chee schwieg. Nach einer Weile sagte Leaphorn: »Nach allem, was ich damals während der Ermittlungen nach dem Überfall auf das Spielkasino mitbekommen habe, scheint mir Ms Manuelito eine sehr tüchtige und engagierte Polizistin zu sein. Ich denke, sie wird gute Beurteilungen in ihrer Personalakte haben. Aber vielleicht gibt es da ja noch etwas, was ich nicht weiß.«
»Da gibt es tatsächlich etwas. Darf ich Sie bitten, über das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, Stillschweigen zu bewahren? Möglicherweise werde ich nämlich in ein paar Tagen denken, ich hätte besser den Mund gehalten.«
Die Bedienung brachte das Essen und schenkte Kaffee nach. Leaphorn tat Zucker in seine Tasse und rührte langsam um.
»Ich nehme an, Ihre Frage bedeutet, ob ich, falls es hart auf hart kommt, bereit wäre zu bestreiten, dass dieses Gespräch stattgefunden hat.«
»So in etwa«, sagte Chee. Man musste dem Legendären Lieutenant eben nie etwas ausbuchstabieren.
»Nun«, sagte Leaphorn lächelnd, »ich denke, ich kenne Sie lange genug, um zu wissen, dass Sie sich nicht mit einer solchen Bitte an mich wenden würden, ohne vorher gründlich darüber nachgedacht zu haben. Also schießen Sie los!«
Chee zog eine Ziploc-Tüte aus der Tasche seiner Uniformjacke und legte sie vor sich auf den Tisch. »Diese Dose hat Officer Manuelito am Fundort der Leiche aufgehoben. Sie lag halb versteckt unter Unkraut, ein paar Schritte von dem Pick-up entfernt, in dem sie den Toten entdeckt hatte. Manuelito wollte die Pflanzensamen darin aufbewahren, die sie eingesammelt hatte, während sie auf die Ambulanz wartete.«
»Eine alte Prince-Albert-Dose«, bemerkte Leaphorn und sah Chee fragend an.
Der zog ein zweites Plastiktütchen hervor und schob es Leaphorn über den Tisch zu.
»Als Manuelito die Dose zu Hause ausschüttete, fand sie außer ihren Samen noch das da.« Er deutete auf den Inhalt des Tütchens.
»Sieht aus wie Sand. Könnte aus einem Flussbett stammen«, sagte Leaphorn, nahm das Plastiktütchen und schüttelte es aufmerksam ein wenig hin und her. Überrascht hob er die Augenbrauen. »Nein, doch nicht. Ich habe mich geirrt. Für Sand ist die Farbe, genau betrachtet, nicht stumpf genug, und Sand wäre auch leichter.«
»Es ist ein Gemisch aus Sand und ausgewaschenem Goldstaub.«
»Verdammt!«, entfuhr es Leaphorn. Er öffnete das Plastiktütchen, rieb ein wenig von dem Gold-Sand-Gemisch zwischen Daumen und Zeigefinger und betrachtete dann prüfend den Goldstaub, der auf seiner Haut haften geblieben war. »Ich bin kein Fachmann«, bemerkte er, »aber ich denke, Sie haben recht.«
»Manuelito sagt, die Dose hätte im Unkraut wenige Meter links von dem Pick-up gelegen. Auf der Fahrerseite. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Doherty ermordet worden ist, war ihr natürlich sofort klar, dass sie da ein mögliches Beweisstück mit nach Hause genommen hat.« Er lachte, aber es war ein trauriges, grimmiges Lachen.
»Und Sie sollen dieses Beweisstück jetzt an die Feds übergeben?«
»Ja. Ich soll einfach meine Pflicht tun. Und ganz nebenbei mit hundertprozentiger Sicherheit dafür sorgen, dass sie tatsächlich vom Dienst suspendiert wird, und zwar mit einer dicken Rüge in ihrer Personalakte. Ich habe ihr erklärt, dass genau dies passieren wird, aber sie hat nur erwidert, dass sie das wohl verdient habe.« Chee schüttelte den Kopf und senkte den Blick in seine Tasse. Doch er sah Bernie vor seinem inneren Auge, wie sie vor ihm gestanden hatte, schmal, fast zerbrechlich, starr vor Anspannung, das lange schwarze Haar streng zusammengebunden, die Uniform, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit, ohne jedes Stäubchen und absolut korrekt. Zunächst war sie seinem Blick ausgewichen, hatte erst nach unten gesehen und dann zur Seite, hatte irgendetwas gemurmelt, was nach Bedauern und Entschuldigung klang. Dann war plötzlich ein kaum merklicher Ruck durch sie hindurchgegangen, sie schien noch ein wenig aufrechter zu stehen und hatte ihn angesehen wie eine Angeklagte, die gefasst auf ihr Urteil wartet. Ihr Gesicht hatte eine ruhige Würde ausgestrahlt, wie er sie so bei ihr noch nie gesehen hatte. Er hatte sie immer hübsch gefunden, jetzt sah er, dass sie schön war. Sie hatte gesagt: »Ich glaube, ich bin einfach zu achtlos für den Polizeidienst.« Und wie hatte er darauf geantwortet? Vermutlich mit irgendeinem dummen Spruch, da war er sich fast sicher.
Er merkte, dass Leaphorn ihn ansah, und hob den Kopf.
»Diese Dose könnte tatsächlich ein Beweisstück sein«, sagte der Lieutenant. Er wiegte den Kopf. »Dieses Gold könnte mit dem Verbrechen in Verbindung stehen.«
»Was raten Sie mir, Lieutenant? Wie soll ich mit der ganzen verfahrenen Geschichte umgehen? Ich glaube, im Grunde möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wie Sie an meiner Stelle handeln würden.«
Leaphorn lud sich etwas von seiner Enchilada auf die Gabel, führte sie langsam zum Mund, kaute, lud sich eine zweite Gabel voll, runzelte die Stirn. »Wissen Sie, wer bei den Feds die Ermittlungen leitet? Ist es derselbe, dem Sie damals in die Quere gekommen sind, als Sie hinter dem Hopi her waren, der junge Adler wilderte?«
»Nein, der wurde kurz darauf versetzt«, antwortete Chee. »Wenigstens ein Lichtblick in dieser ganzen unglückseligen Geschichte.«
Leaphorn nahm noch einen Bissen und sagte dann: »Aber so eine Geschichte bleibt lange im Gedächtnis der Feds. Seine Blamage hat ja auch ihr eigenes Ansehen beschädigt.«
Chee nickte.
»Ich denke«, fuhr Leaphorn fort, »wenn ich an Ihrer Stelle wäre und die fragliche Polizistin ihren Dienst bisher zufriedenstellend versehen hat, würde ich versuchen, das Ganze unter der Decke zu halten und intern zu regeln. Das Beste wäre natürlich, die Tabakdose wieder an die alte Stelle zurückzulegen. Anschließend müsste man dann einer vertrauenswürdigen Person, die offiziell mit dem Fall befasst ist, zu verstehen geben, dass es an der Fundstelle der Leiche noch ein Beweisstück gibt, das, nun, sagen wir mal, bisher übersehen wurde. Es wäre klug, möglichst wenig zu sagen und es bei Andeutungen zu belassen. Dann könnte diese Person die Feds von dem überraschenden Fund in Kenntnis setzen. Sind Ihre Leute aus Shiprock an den Ermittlungen beteiligt?«
»Nein, wir sind nicht zuständig«, antwortete Chee. Er kannte Leaphorn so lange, dass er nicht damit gerechnet hatte, irgendetwas, was der »Legendäre Lieutenant« sagte oder tat, könnte ihn wirklich überraschen. Doch offenbar hatte er sich geirrt. Wollte Leaphorn sich selbst ins Spiel bringen?
Leaphorn lächelte, aber eher nach innen. »Es ist zum Glück allgemein bekannt, dass ich mich für den Fall Denton/McKay interessiere, so wird es also niemanden wundern, wenn ich in dem Flussbett auftauche, um einen Blick auf den Pick-up zu werfen, in dem Doherty gefunden wurde. Schließlich mag zwischen dem Fall Denton und dem Mord an Doherty eine Verbindung bestehen.«
»Eine Verbindung. Klingt nicht wirklich zwingend.«
»Vielleicht sage ich ihnen ganz einfach, dass ich ein gelangweilter, alter Cop bin, der seine Zeit irgendwie totschlägt. Vielleicht haben sie mit dem Tatort auch schon längst abgeschlossen, und niemand fragt mich irgendwas.«
»Ich habe mich des Öfteren gefragt«, sagte Chee, »woher es kommt, dass der Fall Denton Ihnen bis heute keine Ruhe gelassen hat. Dentons Geschichte damals klang doch ganz plausibel. McKay hat versucht, ihn zu betrügen, und ihn bedroht, und er hat ihn in Notwehr erschossen.«
»Zum einen habe ich so meine Zweifel, ob hier wirklich ein echter Fall von Notwehr vorlag. Das Gericht war ja auch nicht so ganz davon überzeugt. Denton wurde schließlich zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, er kam dann allerdings wegen guter Führung schon nach ein paar Monaten wieder auf freien Fuß. Aber was mir wirklich schlaflose Nächte bereitet hat, war die Frage, was aus Linda Denton geworden ist.«
»Linda Denton? Wieso?«, fragte Chee überrascht. Er versuchte, sich die Ereignisse von damals wieder ins Gedächtnis zu rufen. »Soweit ich mich erinnere, war die vorherrschende Meinung, dass die junge Mrs Denton ihren um mehr als zwanzig Jahre älteren Ehemann loswerden wollte und sich mit McKay zusammengetan hat, um an Geld für eine gemeinsame Zukunft zu kommen. Als der Plan dann missglückte und alles in einer Katastrophe endete, habe sie das Weite gesucht. Ich fand das damals einleuchtend. Deshalb frage ich mich, warum Sie an dieser Version zu zweifeln scheinen.«