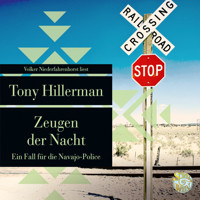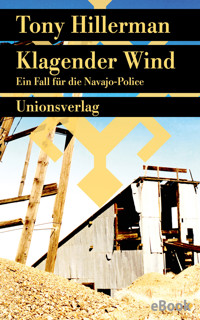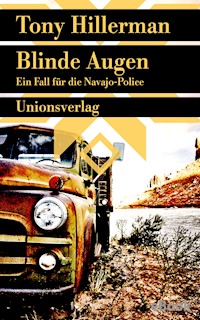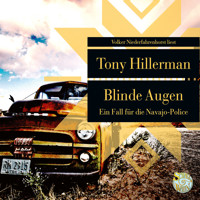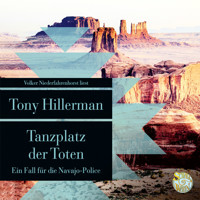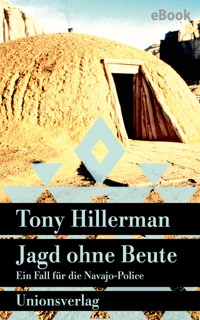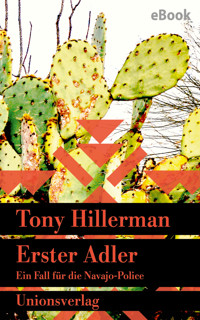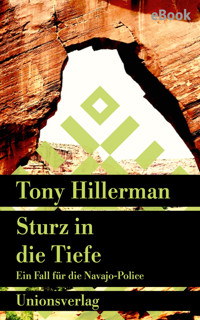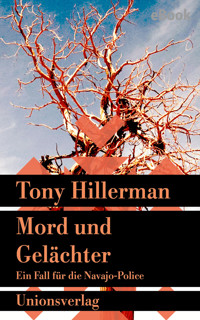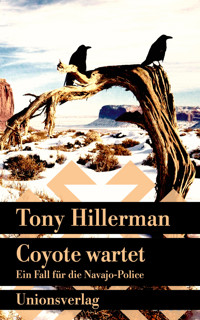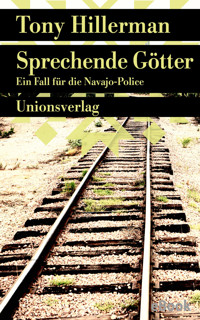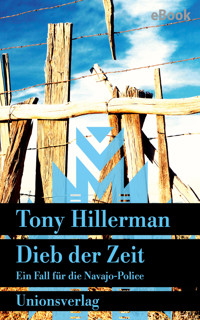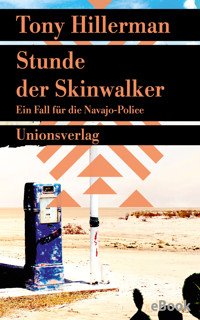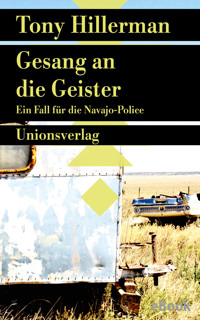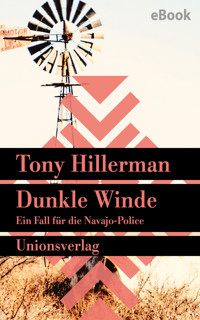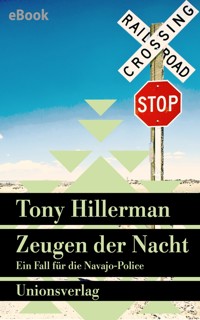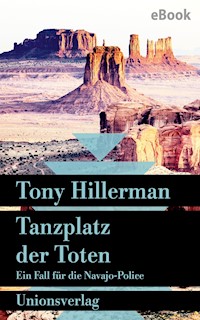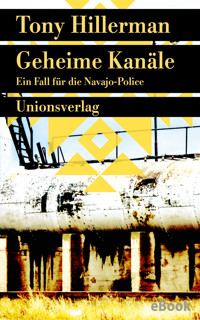
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein elegant gekleideter Toter wird in der Jicarilla Apache Reservation gefunden, am Rand eines Gasfelds. Sergeant Jim Chee nimmt die Ermittlungen auf und stößt gegen Mauern: Das FBI unterschlägt wichtige Informationen, und die Identität des Mannes bleibt zweifelhaft. Warum wurde er erschossen? Der pensionierte Joe Leaphorn vermutet hinter den rätselhaften Umständen nicht allein ein Verbrechen an der Navajo-Nation, sondern jenen Milliardenschwindel, der bis in die höchsten Kreise reichte und die amerikanische Justiz jahrzehntelang beschäftigte. Inmitten von Sandpisten, Bohrtürmen und Schmugglerrouten folgen Leaphorn und Chee flüchtigen Spuren – und bald droht Chee das zu verlieren, was ihm am meisten bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein elegant gekleideter Toter wird in der Jicarilla Apache Reservation gefunden, am Rand eines Gasfelds. Eigentlich der Zuständigkeitsbereich von Jim Chee, aber das FBI übernimmt die Ermittlungen und unterschlägt wichtige Informationen. Joe Leaphorn, im Ruhestand, vermutet nichts Geringeres als ein Staatsverbrechen an der Navajo-Nation.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Fried Eickhoff ist Übersetzer aus dem Englischen, er hat u. a. Werke von Tony Hillerman, Paula Gosling und Philip Kerr ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Fried Eickhoff.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Geheime Kanäle
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Fried Eickhoff
Ein Fall für die Navajo-Police (15)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Veronika Straaß-Lieckfeld nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 2003 bei HarperCollins Publishers, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 unter dem Titel Dunkle Kanäle im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: The Sinister Pig
© by Tony Hillerman 2003
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Fried Eickhoff beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Undersea Oleg Kovtun (Alamy Stock Photo); Symbol - LadadikArt (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31173-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 16.06.2025, 12:02h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Modernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GEHEIME KANÄLE
1 – David Slate reichte dem Mann mit dem grauen …2 – Nun schau dir das mal an«, sagte Cowboy …3 – Bernadette Manuelito hatte erst wenige Tage zuvor bei …4 – Rawley Winsor legte den Mailausdruck auf seinen Schreibtisch …5 – Wenn es um das Thema Kooperation mit dem …6 – Dieser windige Nachmittag war eine Art trauriger Gedenktag …7 – Der pensionierte Lieutenant Joe Leaphorn hatte sich für …8 – Professor Louisa Bourebonette war mehr oder weniger durch …9 – Als Ed Henry, der spätere District Supervisor von …10 – Customs Officer Bernadette Manuelito war auf dem Interstate …11 – Also fassen wir noch mal zusammen«, begann Captain …12 – Eleanda Garzas Stimme klang kühl und unpersönlich13 – Lieutenant Joe Leaphorn a. D. sah sich prüfend …14 – Grenzschutz-Beamtin Bernadette Manuelito stellte befriedigt fest, dass sie …15 – Butler George brachte Winsor die Postsendung in sein …16 – Eleanda Garza kam von der Nachtschicht nach Hause …17 – Leaphorn durchwühlte gerade draußen in der Einfahrt das …18 – Obwohl ein großer Teil der Reisevorbereitungen in den …19 – Die junge Polizistin, die Leaphorns Anruf in Chees …20 – Cowboy Dashee, Beamter des Bureau of Land Management …21 – Nach der Landung in El Paso ließ Budge …22 – Budge war früh aufgewacht, hatte sich statt einer …23 – Sergeant Jim Chee war schon vor dem Morgengrauen …24 – An diesem Morgen hatte Bernadette Manuelito, Officer bei …25 – Dashee ließ seinen Pick-up mit einer scharfen Bremsung …26 – Bernie hatte recht. Als Erstes kam ein Wagen …27 – Doch es dauerte noch einige Zeit, bis Customs …EpilogDankMehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Fried Eickhoff
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
1
David Slate reichte dem Mann mit dem grauen Bürstenhaarschnitt einen Umschlag über den winzigen Tisch im Bistro Bis.
»Ab heute heißen Sie Carl Mankin«, sagte er, »Sie waren Mitarbeiter der CIA und sind jetzt im Ruhestand. Carl, Sie arbeiten zurzeit als Berater für Seamless Weld. In diesem Umschlag finden Sie eine Reihe Papiere von Seamless Weld, die ziemlich echt aussehen: Visitenkarten, Formulare für die Spesenabrechnung und so weiter. Und natürlich Ihre Kreditkarte. Der Kreditrahmen sollte ausreichen, um alle anfallenden Kosten zu decken.«
»Carl Mankin«, sagte der Grauhaarige, öffnete den Umschlag und sah sich die Kreditkarte prüfend an. »Gut zu merken. Und ab nächsten Dienstag bin ich also der neue Ruheständler der CIA.« Er war schon über sechzig, aber wie er da saß, fit und sonnengebräunt, hätte man ihn für deutlich jünger gehalten. Er begann, die Unterlagen durchzublättern, stutzte und sah Slate lächelnd an. »Ich vermisse einen Vertrag«, sagte er.
Slate lachte. »Ich wette, den haben Sie auch nicht ernsthaft erwartet, oder? Der Senator ist von der alten Schule. Ihm reicht ein Gentlemen’s Agreement als Sicherheit. Sie wissen schon, ›ein Mann, ein Wort‹. Das klingt hier in Washington heutzutage vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ein paar von diesen ergrauten Veteranen tun gerne so, als gäbe es selbst unter Politikern noch so etwas wie einen Ehrenkodex.«
»Dann lassen Sie uns unsere Vereinbarung noch mal kurz durchsprechen«, sagte der Mann, der jetzt Carl Mankin hieß. »Wenn ich mich recht erinnere, bin ich dreißig Tage lang für Sie tätig, oder so lange, bis der Job erledigt ist. Falls das nicht machbar ist, informiere ich Sie. Unabhängig vom Erfolg erhalte ich einen Garantiebetrag von fünfzigtausend Dollar.«
Slate nickte. »Plus Spesen«, sagte er. »Ihre täglichen Ausgaben können Sie alle über die Kreditkarte begleichen, es sei denn, Sie müssen einen Informanten bezahlen, der keine Visa Cards akzeptiert.« Slate lachte in sich hinein.
Carl Mankin schob alles zurück in den Umschlag und legte ihn neben seinen Teller. »Wer kommt eigentlich am Ende für meine Kreditkartenrechnung auf?«, fragte er. »Wie ich gerade gesehen habe, wohnt Carl Mankin in El Paso, Texas.«
Slate nickte. »Ja, dort ist die Zentrale von Seamless Weld. Die Firma, für die Sie arbeiten.«
»Und Seamless Weld gehört dem Senator? Das klingt eher unwahrscheinlich.«
Slate schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Seamless Weld ist eines von vielen Tochterunternehmen der Searigs Corporation. A. G. H. Industries hält große Anteile an Searigs – und hat die totale Kontrolle darüber.«
»Searigs? Das ist doch der Konzern, der die Bohrinseln vor der Küste von Nigeria gebaut hat«, sagte Carl Mankin. »Richtig?«
»Ja, und einen Teil der Plattformen in der Nordsee«, nickte Slater, »für die Norweger …«, er überlegte, »oder waren es die Schweden?«
»Dann gehört Searigs also tatsächlich dem Senator?«
»Natürlich nicht, Searigs ist wie gesagt Teil der A. G. H. Industries. Aber worauf wollen Sie eigentlich hinaus?«
»Ich versuche zu verstehen, für wen ich arbeite«, antwortete Mankin.
Slate nippte an seinem Orangensaft, grinste Carl Mankin an und sagte: »Sie glauben doch nicht im Ernst, dass man mir das gesagt hat?«
Sein Gesprächspartner musterte ihn. »Nein, aber ich vermute, dass Sie es trotzdem wissen. Sie sind die rechte Hand des Senators. Sie sind derjenige, der die Leute aussucht, die vor den Ausschüssen auftreten, denen er vorsitzt, derjenige, der für ihn den Dreck unter den Teppich kehrt, derjenige, der mit den Lobbyisten Deals aushandelt …« Mankin lachte. »Und – überflüssig zu erwähnen – natürlich auch derjenige, der Leute wie mich auftreibt, wenn der Senator einen Job zu erledigen hat, für den dann wiederum jemand anders im Hintergrund die Kosten trägt.« Er sah Slate fest an. »Also gehe ich fest davon aus, dass Sie wissen, wer dieser Jemand ist. Die Frage ist nur: Würden Sie es mir sagen, wenn Sie es wüssten?«
Slate lächelte. »Wohl eher nicht. Und ich bin mir fast sicher, dass Sie mir sowieso nicht glauben würden.«
»Wenn das so ist, wäre es vielleicht besser, ich bekäme mein Honorar im Voraus.«
Slate nickte. »Das war ohnehin so vorgesehen. Wenn wir unser kleines Arbeitsessen beendet haben und Sie mit Ihrer neuen Visa-Karte die Rechnung beglichen haben, fahren wir gemeinsam zu meiner Bank. Ich werde dort 49 500 Dollar auf das Konto von Carl Mankin einzahlen und Ihnen dann den Einzahlungsbeleg aushändigen.«
»Und was ist mit den restlichen fünfhundert?«
Slate zog seine Brieftasche heraus, entnahm ihr eine Bankquittung und reichte sie Carl Mankin. Sie belegte, dass mit Datum vom Vortag ein Konto auf den Namen Carl Mankin mit 500 Dollar eröffnet worden war. Mankin steckte den Beleg zuerst in seine Hemdtasche, holte ihn dann wieder heraus und legte ihn vor sich auf den Tisch.
»Eine Kontoeröffnung für eine erfundene Person und ohne Unterschrift dieser Person«, bemerkte er. »Bis heute wusste ich nicht, dass so etwas überhaupt geht.«
Slate lachte. »Es geht alles. Da muss nur der richtige Vizepräsident aus der Chefetage runterrufen und die entsprechenden Anweisungen geben.«
Mankin nickte. »Okay. Dann würde ich jetzt gern noch einmal mit Ihnen über meinen Auftrag sprechen, damit auch wirklich alles klar ist. Sie wollen also, dass ich zu diesem riesigen Öl-Areal im Four-Corners-Gebiet in New Mexiko fahre, mich umsehe und versuche, herauszubekommen, ob man das Pipeline-System dort unten manipuliert hat oder noch immer manipuliert, sodass ein Großteil der vertraglich festgesetzten Abgaben auf das geförderte Öl, die von Rechts wegen an den Interior Department’s Trust Fund for the Indians abgeführt werden sollten, stattdessen in den Taschen irgendwelcher Betrüger landet. Ist das so korrekt?«
»Ja, das ist der größte Teil des Auftrags. Das Wichtigste ist, dass Sie die Namen der Leute herausfinden, die hinter diesen Manipulationen stecken und das Geld in die ›richtigen‹ Taschen umleiten. Und dass Sie erfahren, wem diese Taschen gehören.«
Mankin wiegte den Kopf. »Und dem Senator ist bewusst, dass die Chancen, diesen Riesenschwindel in allen Details aufzuklären, eher gering sind?« Er zuckte die Achseln. »Aber ich nehme an, dass mein Einsatz nur einer von vielen ist, um die Hintermänner dieser Betrügereien zu schnappen. Die Washington Post hat ja im vergangenen Monat fast täglich darüber berichtet. Demnach sind dem Tribal Trust Funds durch solche kriminellen Manipulationen zwischen vier und fünf Milliarden Dollar entgangen. Es heißt, dass das Innenministerium, das den Fonds verwaltet, und die Bosse vom Bureau of Indian Affairs ganz schön in der Klemme stecken.«
Slate grinste. »War das als Frage gemeint? Wie sagen Pressesprecher in solchen Situationen immer so schön?« Er setzte eine dienstliche Miene auf und sagte in missbilligendem Ton: »Spekulationen kommentieren wir grundsätzlich nicht.«
»Die Washington Post hat außerdem behauptet, dass diese ›Umleitung‹ der Tribal-Gelder schon seit über fünfzig Jahren praktiziert wird. Angeblich haben sie ihre Informationen von diesen Erbsenzählern von der Regierung. Stimmt’s? Ehrlich gesagt, habe ich wenig Hoffnung, etwas entscheidend Neues zu entdecken.«
»Es geht um viel mehr als bloß um vier Milliarden«, bemerkte Slate. »Die Rechnungsstelle der Regierung schätzt, dass sich die tatsächliche Fehlsumme auf bis zu vierzig Milliarden belaufen könnte. Und die Anwaltskanzlei, von der die Stammesinteressen vertreten werden, macht bei der Regierung Ansprüche auf eine Summe von 137 Milliarden Dollar geltend. Das soll die Summe sein, die dem Fonds rückwirkend seit 1887 entgangen ist. – Ich glaube, der Senator will vor allem wissen, ob diese Betrügereien immer noch weitergehen.«
»Und da macht er fünfzig Riesen aus irgendjemandes Portemonnaie locker, weil er glaubt, dass ausgerechnet ich ihm diese Information liefern könnte.«
»Seine Freunde im State Department haben ihm erzählt, wie geschickt Sie im Irak agiert haben. Dort haben Sie ja herausbekommen, wie die irakischen Ölmagnaten zwischen den Pipelines hin und her gewechselt haben, um die Export-Sanktionen der UNO zu unterlaufen. Der Senator hofft wahrscheinlich einfach, dass Ihnen im Four-Corners-Gebiet noch einmal so ein Kunststück gelingt.«
»Aber im Irak herrschten ganz andere Verhältnisse«, gab Mankin zu bedenken. »Auf den Ölfeldern im Nahen Osten haben Sie’s mit einer überschaubaren Zahl von aalglatten, alten britischen und amerikanischen Experten zu tun, und um die haben sich verschiedene arabische Gruppen versammelt. Die Araber haben zu diesem britisch-amerikanischen Ölklub nie wirklich Zugang gefunden. Ich dagegen schon. In dem kleinen Kreis der Pipeline-Fachleute wusste jeder über die Geschäfte des anderen Bescheid. Nachdem ich zwanzig Jahre lang immer wieder dort aufgetaucht bin, haben sie mich als einen der Ihren betrachtet. Sie waren mir gegenüber offen, haben mich in die Relaisstationen eingeschmuggelt, mir die Druckmesser und die ganze übrige technische Ausrüstung gezeigt. Es war also im Grunde ein Heimspiel. Für die in New Mexico dagegen bin ich nur irgendein fremder Schnüffler.«
Slate sah ihn prüfend an. Dann grinste er. »In New Mexico sind Sie Carl Mankin. Richtig? Diese ganzen vorweggenommenen Entschuldigungen dafür, dass Sie ja ohnehin nichts Brauchbares herausfinden werden, heißen doch nur, dass Sie tatsächlich für den Senator arbeiten wollen. Habe ich recht?«
»Wie? Oh, ja, ich denke schon«, antwortete Mankin. Er steckte den Einzahlungsbeleg in seine Brieftasche, holte die Carl-Mankin-Kreditkarte heraus und winkte der Bedienung. Als der Kellner mit der Rechnung an den Tisch kam, reichte er ihm die Karte.
»Ihre erste Handlung als Carl Mankin«, kommentierte Slate und lachte.
»Eins geht mir nicht aus dem Kopf, und darüber würde ich doch gerne noch mit Ihnen sprechen«, begann der Grauhaarige. »Wie schlecht auch immer meine Chancen stehen, da draußen an irgendwelche brauchbaren Informationen zu kommen: Meine Chancen stünden um ein Vielfaches besser, wenn ich eine bessere Vorstellung davon hätte, worum es dem Senator eigentlich geht.«
»Um die Wahrheit«, antwortete Slate schlicht. »Es geht ihm einzig und allein um die Wahrheit.«
»Soso«, antwortete sein Gegenüber. »Aber Sie werden sicher verstehen, dass ich mir meine Gedanken mache. Wieso zum Beispiel soll ich mich direkt als Berater von diesem Texas-Unternehmen, von Seamless Weld ausgeben? Dem Namen nach könnten die im Pipeline-Geschäft tätig sein. Ist vielleicht doch der Senator Eigentümer dieser Firma?«
»Nein, da sind Sie auf einer ganz falschen Fährte«, antwortete Slate. »Seamless Weld gehört zu einem großen Konzern, der wiederum Teil eines größeren Verbundes ist, an dem der Senator Beteiligungen hält. Wenn er tatsächlich, wie Sie annehmen, der offiziell eingetragene Eigentümer von Seamless Weld wäre, dann hätte er auf jeden Fall dafür gesorgt, sein Unternehmen aus einer solchen Operation vollständig herauszuhalten.«
Sie hatten das Bistro verlassen und standen an der Bordsteinkante, um nach einem Taxi Ausschau zu halten. Ein leichter, warmer Wind trieb Staub über die Straße, der Geruch von Regen lag in der Luft.
»Okay, aber damit ist meine Frage von vorhin noch nicht beantwortet. Warum werde ich als Berater bei Seamless Weld geführt? Und kommen Sie mir nicht damit, das hätte nur steuerliche Gründe. Also noch einmal: Wieso?«
Ein Taxi hielt vor ihnen. Slate öffnete die hintere Wagentür, ließ Mankin zuerst einsteigen und nahm dann neben ihm Platz. Er nannte dem Fahrer die Adresse der Bank, lehnte sich ins Polster zurück und sagte: »Sieht nach Regen aus.«
»Ich warte noch immer auf eine Antwort«, hakte Mankin nach. »Und ich frage nicht aus reiner Neugier. Ich werde in nächster Zeit vermutlich einer Menge Leute eine Menge Fragen stellen müssen, und das bedeutet, dass ich umgekehrt eine Menge Fragen werde beantworten müssen. Bei so einem Job kann ich es mir nicht leisten, als Lügner dazustehen.«
»Na schön«, sagte Slate. Er nahm ein schmales silbernes Zigarettenetui aus seiner Manteltasche, öffnete es, bot erst Mankin eine Zigarette an, nahm dann selbst eine, sah sie einen Moment an und legte sie dann wieder zurück. »Sie wissen sicher, dass jeder, der in dieser Stadt etwas Einfluss hat, sein Leben nach mindestens zwei Agenden ausrichtet: einer öffentlichen und einer zweiten, die sorgfältig abgeschirmt wird und bei der Verfolgung ganz persönlicher Ziele und Zwecke eine große Rolle spielt.«
Mankin nickte.
»Gut. Nehmen wir mal an, Sie rufen Ihren Börsenmakler an und fragen ihn, wer der Eigentümer von Seamless Weld ist. Ein paar Tage später ruft er Sie zurück und sagt Ihnen, die Firma sei ein Tochterunternehmen der Searigs Inc. Daraufhin fragen Sie, wer denn hinter Searigs steht, und Ihr Makler verspricht, es herauszufinden. Nach ein paar Tagen ruft er Sie wieder an, und Sie erfahren, dass A. G. H. Industries Inc. der Mehrheitsaktionär von Searigs ist. Die Antwort auf Ihre nächste Frage: Ihr Makler teilt Ihnen mit, dass die Aktienmehrheit von A. G. H. wiederum von einem Trust gehalten wird, dessen Interessen von einer Washingtoner Anwaltskanzlei vertreten werden, die aus vier Partnern besteht. Und einer dieser Partner ist ein gewisser Mr Rawley Winsor aus Washington, D. C., Ende der Antwort.«
»Den Namen habe ich schon mal gehört«, bemerkte Mankin. »Aber ich weiß nichts über ihn. Wer ist Rawley Winsor?«
»Kein waschechter Washingtoner Insider müsste das fragen«, sagte Slate, »und auch niemand, der viel an der Wall Street unterwegs ist. Rawley Winsor ist … wo fange ich am besten an?« Er hielt einen Moment inne und fuhr dann fort: »Am besten bei seiner Familie. Also, Winsor stammt aus einer Washingtoner Patrizierfamilie, die seit Generationen die Spitzen der Gesellschaft stellt. Er selbst hat die in diesen Kreisen übliche Ausbildung durchlaufen: zuerst Princeton, dann Harvard Law School. Er fädelt im Capitol die wichtigen Deals ein, organisiert alle möglichen Wohltätigkeitsveranstaltungen, steuert aus dem Hintergrund eine Menge einflussreicher Lobbyisten und stünde wahrscheinlich längst im Fortune ganz oben auf der Liste der Superreichen, wenn er seine finanziellen Beteiligungen und Transaktionen nicht so überaus sorgfältig geheim halten würde.«
»Lassen Sie mich mal spekulieren. Der Senator handelt also entweder im Auftrag von diesem Plutokraten Winsor, oder aber er sucht nach einer Möglichkeit, ihn bei etwas Ungesetzlichem zu erwischen. Vielleicht hofft er, diesem Winsor nachweisen zu können, dass auch er sich an dem indianischen Treuhandvermögen bereichern wollte. Oder ganz anders: Der Senator versucht, mit meiner Hilfe Mittel und Wege zu finden, um seinen Teil von dem profitablen Geschäft zu ergattern.«
Slate lachte. »Sie wissen doch: Spekulationen werden von uns grundsätzlich nicht kommentiert.«
»Aber wenn dieser Winsor so unglaublich reich ist«, fuhr Mankin fort, »warum nimmt er dann all diesen Aufwand und Stress überhaupt auf sich? Sie sagen doch, dass er auf zusätzliche Einkünfte gar nicht angewiesen ist.«
»Vielleicht ist er eine Spielernatur und liebt das Risiko«, sagte Slate. »Verdammt, ich weiß es nicht. Vielleicht kann er es auch einfach nicht mit ansehen, wie irgendein Washingtoner Zwischenhändler schnelles Geld macht, während er außen vor bleibt. Jetzt zum Beispiel zieht er gerade die Fäden bei der groß angelegten Kampagne gegen die Unterzeichnung des Gesetzes zur Legalisierung von Marihuana für medizinische Zwecke. Jeder weiß das. Warum mischt er sich da ein? Wahrscheinlich weil er befürchtet, dass früher oder später alle möglichen Drogen legalisiert werden; sie wären dann in behördlich konzessionierten Geschäften und hoch versteuert allgemein zugänglich. Eine Menge Leute sind gegen eine Legalisierung von Drogen, weil sich gezeigt hat, dass solche Maßnahmen nur eine Menge öffentlicher Gelder verschlingen, aber völlig kontraproduktiv sind. Aber das dürfte kaum der Grund sein, warum Winsor dagegen Sturm läuft. Niemand weiß mit Sicherheit, warum er sich in dieser Sache so engagiert, aber es gibt natürlich Vermutungen. Und wir Washingtoner Zyniker vermuten, dass er die Finger im Drogenimportgeschäft hat. Wenn Drogen legalisiert und lizenziert abgegeben werden, gehen die Profite natürlich runter. Wenn die Regierung den Anbau überwacht, den Preis festsetzt und den Vertrieb konzessioniert, ist es mit den Extraprofiten vorbei. Dann gibt es keine jugendlichen Dealer mehr, die ihre Kumpels anfixen, keine Messerstechereien oder Bandenkriege mehr, um die eigenen Absatzgebiete zu verteidigen.« Slate holte Luft. »Aber das ist ein anderes Thema.«
»Das klingt aber ganz schön gewagt«, sagte Mankin. »Der Typ ist mehrfacher Milliardär. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur so aus Spaß beim Drogenhandel mitmischt. Rauschgifthandel ist kein Kavaliersdelikt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie er so dämlich ist, sich darauf einzulassen.«
Slate zuckte die Schultern. »Vielleicht haben Sie recht. Aber vielleicht sind es psychologische Gründe, warum er in den Drogenhandel verwickelt ist. Meine Frau hat zu Hause drei Katzen. Eine der drei schlingt so viel in sich hinein, wie sie nur kann, und dann bewacht sie den Napf und hindert die beiden anderen am Fressen. Sie faucht und schlägt mit ausgefahrenen Krallen nach ihnen, obwohl sie doch längst satt ist. Sind Menschen wirklich klüger als Katzen?«
Mankin nickte. »Können Sie Französisch? Bauernhof-Französisch?«
»Nur ein bisschen«, antwortete Slate.
»Na ja, egal. Jedenfalls haben französische Bauern einen speziellen Ausdruck für das Oberschwein im Stall – das Schwein, das den Trog bewacht und jedes andere Tier angreift, das sich einen Bissen holen will. Die Franzosen nennen so ein Tier ›porc sinistre‹. In dem britisch-amerikanischen Ölklub, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe, war das der Spitzname für Saddam, weil er die Ölfelder des Iran annektieren wollte, obwohl er im eigenen Land mehr Öl hatte, als er tatsächlich nutzen konnte. Und ein paar Jahre später ist er aus demselben Grund in Kuwait einmarschiert.«
»›Porc sinistre‹ – das bedeutet ›teuflisches Schwein‹, oder?«, wiederholte Slate. »Aber müsste es nicht eher ›cochon sinistre‹ heißen? Ich glaube, das ist die bessere Beleidigung. Und es würde genau zu Rawley Winsor passen – nach dem, was ich über ihn gehört habe.«
Das Treffen der beiden Männer hatte an einem Montag stattgefunden. Unmittelbar danach hatte der Mann, der jetzt Carl Mankin hieß, seine Frau angerufen und ihr gesagt, dass er für ein paar Tage nach New Mexico fahren würde. Anschließend hatte er sich im Taxi zum Department of Energy bringen lassen, hatte dort bei dem richtigen Bekannten vorgesprochen und anstandslos alle gewünschten Informationen bekommen. Er wusste jetzt, welche Gesellschaften auf den ausgedehnten Ölfeldern im San-Juan-Becken welche Pipelines betrieben, war im Bilde über das Auf und Ab der Fördermengen, das Steigen und Sinken der Öl- und Gaspreise sowie über die Praktiken von Kauf und Weiterverkauf. Als er das Gebäude verließ, war sein Taschen-Aufnahmegerät bestens gefüllt mit Notizen über die Ölfelder des San-Juan-Beckens. Allein auf dem Gebiet von New Mexico wurde derzeit Öl und Gas aus mehr als 1900 Bohrlöchern gefördert, und Jahr für Jahr kamen Dutzende dazu. Geologen schätzten, dass unter dem Felsgestein nahezu drei Billionen Kubikmeter Gas lagerten. Und mehr als zwanzig Öl- und Gaskonzerne konkurrierten miteinander um neue Förderlizenzen. Doch seine Notizen bestätigten seine schlimmsten Befürchtungen: Die Aufzeichnungen, die das Innenministerium geführt hatte, waren unvollständig und völlig durcheinander. Und die Daten, die sein Informant bis zurück in die 1940er beschafft hatte, waren das reinste Chaos. Die ganze Sache war im Grunde hoffnungslos, dachte Mankin, aber 50 000 Dollar machten das Ganze immerhin finanziell interessant, selbst wenn er nichts erfahren sollte.
Seither waren genau zwei Wochen vergangen, und er saß jetzt knapp 1500 Meilen von dem eleganten Bistro Bis in Washingtons E-Street entfernt in seinem gemieteten Jeep Cherokee neben einer unbefestigten Straße am Rand des Bisti-Öl- und -Gasfeldes. Ganz in der Nähe mitten im San-Juan-Becken, Amerikas Gegenstück zum Persischen Golf, grenzt das Reservat der Jicarilla-Apache an das Gebiet der Navajo Nation.
Doch was viel wichtiger war: Kurz zuvor hatte er festgestellt, dass man ihm folgte – und das offenbar schon seit Tagen, genauer gesagt, seit dem Abend, als er in El Paso das Büro von Seamless Weld verlassen hatte und in seinem gemieteten Jeep weggefahren war. Carl Mankin überkam ein diffuses Unbehagen. Eigentlich hätte er es merken müssen, dachte er. Vor etwa dreißig Jahren, während seiner Zeit im Libanon, hatte ihm ein CIA-Veteran an der Botschaft in Beirut beigebracht, wie man einen Beschatter ausmacht, und auch, wie man ihn abschüttelt. In den Jahren danach hatte er reichlich Gelegenheit gehabt, diese Kunst des Unsichtbarwerdens zu üben. Zuerst im Irak, in der Zeit, als Saddam Hussein und seine Republikanischen Garden gegen den Iran Krieg führten – damals galt der Despot im Zweistromland den USA allerdings noch als Verbündeter im Kalten Krieg. Dann wieder 1990, als Saddam im Zweiten Golfkrieg zum Feind geworden war. Und im Jemen, wo die Al-Qaida-Leute einen Teil ihrer Terrorakte planten, hatte er diese Kunst schließlich zur Perfektion verfeinert. Damals hatte er in jedem Augenblick gewusst, wer gerade hinter ihm war.
Aber die beiden faulen Jahre in Washington hatten ihn offenbar sorglos und leichtsinnig gemacht. Der Mann, der ihm jetzt folgte, war ihm zum ersten Mal aufgefallen, als er ihn vor dem Firmensitz von Seamless Weld auf der anderen Straßenseite entdeckt hatte. Er war ihm nur deshalb aufgefallen, weil er einen merkwürdigen, in zwei lange Spitzen auslaufenden Vollbart trug, und nicht etwa, weil er sein Misstrauen geweckt hätte. Das zweite Mal hatte er den Mann gesehen, als er aus dem FBI-Büro in Gallup gekommen war. Er saß in einem Chevy auf einem Parkplatz schräg gegenüber. Und gerade eben hatte er ihn zum dritten Mal bemerkt. Im Rückspiegel seines Jeep Cherokee. Auf dem Beifahrersitz eines Dodge Pick-ups.
Drei Begegnungen an drei verschiedenen Orten – das konnte kein Zufall sein. Zum Glück war der Mann offenbar ein Amateur. Kein professioneller Beschatter würde riskieren, mit einem so unverwechselbaren Bart die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das bedeutete, dass von dem Mann wahrscheinlich keine Gefahr ausging. Vermutlich wollte er nur herausfinden, warum Mankin sich in einer so lukrativen und umkämpften Branche umsah, versuchte er sich zu beruhigen. Aber die alten Instinkte, die Mankin bei seiner Arbeit in Feindesland entwickelt hatte, waren plötzlich hellwach. Der Mann war ihm auf den Fersen, seit er das Firmengebäude von Seamless Weld in El Paso verlassen hatte. Wie hatte er das geschafft? Und warum folgte er ihm?
Wenn einen jemand beschattet, dann geschieht das nicht aus Liebe und Fürsorge. Vielleicht hatte der Senator oder der Jemand, in dessen Auftrag er tätig war, ihn deshalb auf die Gehaltsliste von Seamless Weld gesetzt, weil man vermutete, dass diese Firma irgendwie in den großen Ölschwindel verwickelt war. Dann wäre El Paso natürlich der Ort, an dem er mit seiner Suche nach Zusammenhängen beginnen musste.
Er beobachtete, wie der Pick-up auf der Sandpiste etwas unterhalb von ihm vorbeirollte. Den Bärtigen konnte er nicht sehen, er saß für ihn verdeckt. Der Mann am Steuer, ein junger Kerl mit blauer Baseballkappe, warf einen verstohlenen Blick zu seinem Cherokee herüber, ehe er schnell wieder vor sich auf die Piste sah. Stümper, dachte Mankin verächtlich. Kein Profi würde so etwas jemals tun.
Er horchte auf das allmählich leiser werdende Motorgeräusch des Pick-ups und fühlte, wie die vertraute Spannung allmählich von ihm wich. Jetzt hörte er auch wieder das Gekrächze der Krähen in den Kiefern und das leise Rauschen der Blätter im Wind. Er stieg aus. Die Krähen flogen schimpfend auf. Der leichte Wind hatte sich für einen Moment gelegt und es wurde plötzlich ungewöhnlich still. Wieso war der Pick-up so schnell außer Hörweite verschwunden? Fuhr er vielleicht gerade durch ein dichtes Waldstück oder einen Abhang hinunter?
Er spürte, wie die Anspannung zurückkehrte, aber er war zwei Stunden lang gefahren, um an diesen Ort zu kommen. Der Fahrer eines Halliburton-Wartungstrucks, mit dem er ins Gespräch gekommen war, hatte ihn auf diese Pipeline-Relaisstation am Rande der Jicarilla Reservation aufmerksam gemacht. »Als ich neulich dort vorbeikam, war da plötzlich unheimlich viel Betrieb«, hatte er gesagt. »Sah so aus, als würden sie dort neue Messinstrumente einbauen und einen größeren Kompressor. Aber warum zum Teufel sollten sie das tun? Ich habe keine Ahnung.«
Auch Mankin konnte sich keinen Reim darauf machen. Aber die »neuen Messgeräte« konnten doch ein Hinweis darauf sein, dass die alten Geräte ungenau gemessen hatten – was vielleicht durchaus beabsichtigt war, um Manipulationen an den Messungen der Durchflussmengen zu vertuschen. Das wäre vielleicht genau die Thematik, die er aufzuklären versuchte. Oder doch nicht? Aber nun war er schon mal da, und irgendwo musste er schließlich mit seinen Nachforschungen beginnen. Er beschloss, hinüberzugehen und sich die Relaisstation näher anzusehen.
Auf seinem kurzen Weg blieb er zweimal stehen, um zu lauschen. Er hörte wieder das leise Rauschen des Windes in den Kiefern und das Gezeter der Krähen in einiger Entfernung. Sonst war alles still. Das Gebäude war verschlossen. Er hatte nichts anderes erwartet, denn der Parkplatz davor war leer. Er spähte durch eine halb blinde Fensterscheibe ins Innere: ein Kompressor, Stahltanks, verschiedene Messgeräte, ein wuchtiger Arbeitstisch, mehrere Rohrleitungen von unterschiedlichem Durchmesser, Ventile. Nichts Ungewöhnliches, alles so, wie er es in vielen solcher Stationen auf der ganzen Welt gesehen hatte – vom Nahen Osten bis Alaska, von Indonesien bis Wyoming. Anders, als der Fahrer gesagt hatte, sah die Station allerdings nicht so aus, als wäre hier in letzter Zeit gearbeitet worden.
Achselzuckend machte er sich auf den Weg zurück zum Auto und war schon fast wieder an seinem Jeep, als er den Bärtigen zum vierten Mal sah. Er stand ein Stück hinter dem Cherokee im Schatten einiger Bäume, der Jüngere mit der blauen Baseballkappe dicht neben ihm. Beide Männer starrten ihn an. Der Kerl mit der Baseballkappe hielt ein Gewehr in den Händen. Jetzt hob er es langsam und richtete den Lauf auf ihn.
Carl Mankin duckte sich blitzschnell und rannte los. Für sein Alter war er überraschend schnell. Er schaffte noch gut ein Dutzend weit ausholende Schritte, ehe ihn die Kugel im Rücken traf, ziemlich weit oben zwischen den Schulterblättern. Mit dem Gesicht nach unten ging er zu Boden und schlug in den Sand.
2
Nun schau dir das mal an«, sagte Cowboy Dashee und sah grinsend zu Sergeant Jim Chee hoch. »Wie ich dich kenne, wirst du mich sicher gleich fragen, ob ich die Untersuchung des Toten nicht gleich ganz übernehmen will. Natürlich nur, um mir einen Gefallen zu tun. Damit ich mal ein bisschen üben kann, wie man ein Mordopfer untersucht. Könnte ja sein, dass ich das inzwischen verlernt habe.«
Dashee hockte vor der Leiche eines mittelgroßen, schlanken Mannes um die sechzig mit grauem Bürstenhaarschnitt, der mit dem Gesicht nach unten unter einem Gebüsch aus Bergmahagoni lag. Der Tote war locker mit Herbstlaub und Erde bedeckt – vielleicht vom Wind angeweht, vielleicht aber auch als Tarnung.
»Nur zu«, antwortete Chee. »Ein kleiner Auffrischungskurs in Sachen Tatortsicherung kann dir bestimmt nicht schaden. Jetzt, wo du sozusagen Bürokrat geworden bist.«
Dashee war ein Hopi und hatte, im Gegensatz zu Chee, der sich wie alle traditionell denkenden Navajo von Toten fernhielt, kein Problem damit, eine Leiche zu berühren. Dashee arbeitete in der Strafverfolgungsabteilung des Federal Bureau of Land Management und trug im Dienst gewöhnlich Uniform, aber heute an seinem freien Tag hatte er seine Freizeitkluft an: Jeans und ein schon ziemlich verblichenes T-Shirt. Er hatte Chee in seinem Büro der Navajo-Police in Shiprock besucht und gerade mit ihm Kaffee getrunken, als Chees Telefon summte. Ein Angestellter von El Paso Natural Gas hatte in einem Graben nordöstlich der Degladito Mesa, wo das Land der Navajo Nation an die Jicarilla Apache Reservation grenzt, einen Toten entdeckt.
»Ich bitte zu beachten, wie behutsam ich mit deinem Tatort umgehe«, bemerkte Dashee. »Hast du gesehen, wie sorgfältig ich darauf achte, nur ja nicht auf die Fußspuren des Menschen zu treten, der die Leiche dort hingeschleppt hat? Oder auch auf die Fußspuren des Toten, falls er auf eigenen Füßen hierhergekommen sein sollte, um sich hier erschießen zu lassen.«
»Ja, schon gut«, sagte Chee ungeduldig. »Mach ein bisschen schneller.«
»Ich bin durchaus nicht immer so sorgfältig«, fuhr Dashee ungerührt fort, »aber das hier ist vermutlich ein Mord, der auf eurem Stammesgebiet begangen worden ist. Du weißt ja, dass für Kapitalverbrechen in einem Reservat automatisch das FBI zuständig ist. Das heißt, sobald die Feds von dem Mord erfahren, werden sie hier auftauchen und den Fall übernehmen. Und wenn sich dann rausstellt, dass die Sache doch komplizierter ist, als man zuerst dachte, und die Feds die Ermittlungen in den Sand setzen, werden sie wie üblich nach einem Sündenbock suchen. Und der will Officer Cowboy Dashee nicht sein. Das habe ich während meiner Zeit als Deputy mal erlebt, und die Erfahrung möchte ich nicht wiederholen.«
»Bis jetzt hast du einwandfrei gearbeitet«, sagte Chee beruhigend, während er Dashee bei seiner Arbeit beobachtete.
»Er hat hinten in der Jacke ein Loch«, sagte Dashee. »Vermutlich der Eintritt einer Kugel. Aber ich kann weder Blut- noch Pulverspuren sehen. Ich mache noch ein paar Nahaufnahmen, bevor ich ihn umdrehe.«
»Dann geh ich jetzt und verständige die Zentrale«, sagte Chee.
»Es gibt noch einen Grund, warum ich heute nicht so nachlässig bin wie sonst. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie es deiner Freundin damals ergangen ist. Du weißt schon, als sie den Toten im Pick-up für einen Stockbesoffenen gehalten hat. In Wirklichkeit war es ein erschossener Stockbesoffener.« Dashee kicherte. »Und der Schuss ist nicht aus einem Whiskeyglas gekommen.«
Chee ignorierte Dashees Kalauer. »Ich nehme an, du sprichst von Officer Bernadette Manuelito«, sagte er mit unbewegter Miene. »Sie ist nicht meine Freundin, nur damit das klar ist.«
»Ach, stimmt ja«, antwortete Dashee, »ich habe gehört, dass sie dich verlassen hat. Dann also deine Ex-Freundin.«
»Sie ist erst recht nicht meine Ex-Freundin«, korrigierte Chee. »Sie hat für mich gearbeitet, sonst nichts. Du fängst keine Beziehung mit Frauen an, die für dich arbeiten.«
»Ach ja?«, fragte Dashee und tat überrascht. Doch Chee war schon auf dem Weg zu seinem Streifenwagen, um Meldung zu erstatten.
Er gab dem Diensthabenden in der Funkleitzentrale die Wegbeschreibung durch.
»Auf dem Highway 64 Richtung Osten bis Gobernador, dann durch den Vaqueros Canyon, nach neun Meilen links über einen Kälberrost Richtung Norden auf eine Sandpiste, die zu einem Erdgasfeld führt. Nach sieben Meilen kreuzt eine weitere Sandpiste, die zum Buzzard-Wash-Gasfeld führt, das El Paso Natural Gas gepachtet hat. Dort links. Mein Streifenwagen steht ein Stück die Piste runter. Ist nicht zu übersehen.«
»Ich schicke Special Agent Osborne«, sagte der Diensthabende. »Ich sage ihm, er soll Sie anrufen, wenn er sich verfährt.«
Dashee kam ihm vom Tatort entgegen. Er klopfte sich den Staub von den Händen und sagte grinsend: »Wie viel zahlst du eigentlich normalerweise dem Schamanen, wenn er die Ghost-Way-Zeremonie für dich abhält, damit der chindi des Toten keine Macht über dich bekommt? Ich finde, das Geld könntest du mir geben. Als angemessenes Dankeschön.«
»Ich werde es abziehen von dem Betrag, den du mir für die Nachhilfestunde in Spurensicherung schuldest«, antwortete Chee.
Dashee schüttelte bedauernd den Kopf. »Na, dann eben nicht. Der Typ dahinten dürfte dir übrigens noch eine Menge Arbeit machen. Er hat keine Brieftasche bei sich und auch sonst keine Papiere. Die Sachen, die er trägt, sehen ziemlich teuer aus. Jacken- und Hosentasche waren leer – bis auf die Autoschlüssel.«
Chee runzelte die Stirn. »Autoschlüssel ohne Auto?«
Dashee nickte. »Wie gesagt, du wirst eine Menge Arbeit mit ihm haben. Und jetzt hast du nicht mal mehr die hübsche kleine Bernie Manuelito, die du früher immer losschicken konntest«, fügte er mit gespieltem Bedauern hinzu. »Aber wer weiß, vielleicht leihen die Leute von der Border Patrol sie dir mal aus.«
3
Bernadette Manuelito hatte erst wenige Tage zuvor bei der Navajo-Police ihren Dienst quittiert und ihre Stelle bei der Patrouille der Zollbehörde angetreten, als ihr neuer Chef ihr vorschlug, sie könne doch nach Rodeo ziehen. Das kleine Dorf lag nicht weit von dem Grenzabschnitt entfernt, an dem sie Dienst tun würde. Zufällig sei im Haus der Kollegin Eleanda Garza, die ebenfalls dort wohne, gerade eines der beiden Zimmer frei geworden, weil Customs Officer Dezzie Soundso – der Familienname falle ihm im Moment nicht ein – geheiratet habe und zu ihrem Mann nach Tucson gezogen sei.
Mrs Garza war eine Angehörige der Tohono O’odham Nation, die lange Zeit »Papagos«, das heißt »Bohnenesser«, genannt worden waren. Diesen Spottnamen hatten ihnen die Spanier im 16. Jahrhundert gegeben. Doch 1980 hatten sie abgestimmt und mit überwältigender Mehrheit beschlossen, ihren ursprünglichen Namen wieder anzunehmen, der »Volk der Wüste« bedeutete. Mrs Garza war älter als Bernadette und deutlich stämmiger. Sie war in zweiter Ehe mit einem Mann verheiratet, der als Techniker bei einer Telefongesellschaft in Las Cruces arbeitete und dort auch wohnte. Ihr Sohn war gerade zum Militär eingerückt und machte als Rekrut der Marineinfanterie seine Grundausbildung in einem Ausbildungslager bei San Diego. Die Tochter lebte weit weg in Chicago, wo der Schwiegersohn im Vertrieb der Chicago Tribune arbeitete. Und so kam sich Eleanda Garza in ihrem Haus etwas einsam und übrig geblieben vor.
Obwohl man dem »Volk der Wüste« nachsagt, dass es den Navajo und Apache nicht gerade wohlgesonnen ist (und umgekehrt), hatte Mrs Garza schon nach einer Woche häuslicher Gemeinschaft Zuneigung zu Bernie gefasst.
Bernie erwiderte dieses Gefühl. Sie hatte Heimweh. Ihr geheimer Stammesname »Mädchen-das-lacht« schien nicht mehr recht zu ihr zu passen, denn in letzter Zeit hatte sie wenig Grund zum Lachen gehabt. Ihre Mutter fehlte ihr. Und die Kollegen von der Navajo-Police in Shiprock. Und ihre Freundinnen. Und obwohl sie es sich nur ungern eingestand: Ihr fehlte auch Sergeant Jim Chee.
Mrs Garza hatte das gleich am ersten Tag herausgehört, als sie sich miteinander unterhalten hatten und Bernie ihr erklärte, warum sie den Job gewechselt hatte. Sie hatte ihr von ihrem letzten Fall erzählt, von einem Mord, ihrem ersten Mord. Wie sie es versäumt hatte, den Tatort ordentlich zu sichern. Wie auf sie geschossen wurde – oder jedenfalls war es ihr so vorgekommen, als habe man auf sie geschossen. Sie beschrieb ihr Grauen, als sie in einem der vielen abgeschlossenen, fast leeren Munitionsbunker auf dem riesigen, verlassenen Army-Gelände von Fort Wingate die mumifizierte Leiche einer jungen Frau gefunden hatte, die vor ihrem Hungertod in der totenstillen Finsternis noch einen bewegenden Abschiedsbrief an ihren Mann geschrieben hatte.
»Ich habe das alles einfach nicht mehr ausgehalten«, hatte Bernie gesagt. Eleanda hatte sofort gespürt, dass mehr dahintersteckte als nur die Betroffenheit über den tragischen Tod der jungen Frau. Aber sie war zu klug und zu einfühlsam, um nachzufragen. Jedenfalls nicht gleich. Erst ein paar Tage später, als Eleanda mit Bernie die Staubpiste neben dem Sperrzaun an der mexikanischen Grenze entlangfuhr, schüttete Bernie ihr Herz aus.
Seit Stunden schon waren sie auf dieser Schlaglochstrecke am südlichsten Rand von New Mexicos sogenanntem Stiefelabsatz unterwegs. Bernie hatte die meiste Zeit geschwiegen. Außer den stählernen Pfosten und den drei, manchmal zwei Reihen Stacheldraht, die sich dazwischen spannten, waren keinerlei Anzeichen menschlicher Zivilisation zu entdecken. Richtung Süden, in Sonora, nichts als trockene, zerklüftete Berge, und hier im Norden auf der Seite von New Mexico genau dasselbe. Bernie hatte eine Schwäche für Botanik. An der Universität war Botanik ihr Hauptfach gewesen. Diese Landschaft hier empfand sie zwar als feindselig, sie spürte aber auch die Faszination, die von ihr ausging. Sie entdeckte verschiedene Kaktusarten, an deren Samenschoten sich kleine Herden von Halsbandpekaris gütlich taten, sie sah Horste von grauem und lohfarbenem Wüstengras, dessen samenschwere Rispen im Wind hin- und herschwangen, Kreosotbüsche, die in gleichmäßigen Abständen über die Fläche verteilt wuchsen, eine Art Mesquite-Baum, die sie noch nicht kannte und dessen nektarreiche Blüten Schwärme von Bienen anlockten, und schließlich einen Busch, der mehr Dornen als Blätter trug. Bernie war an leere, weite Landschaften gewöhnt, aber dinetah, ihr »Land zwischen den heiligen Bergen«, war grüner und einladender und auch nicht ganz so menschenleer. Philosophen sagen, dass einsame Landschaften freundlichen Menschen zu schaffen machen.
Eleanda erwies sich als mitfühlende Kollegin. Immer wieder hatte sie angehalten, um Bernie die Pfade zu zeigen, die von den illegalen Einwanderern benutzt wurden. Sie hatte Bernie dabei auf die Besonderheiten einiger Fußspuren aufmerksam gemacht: Tiefere Stiefelabdrücke, kürzere Schritte und ein breitbeiniger Stand ließen darauf schließen, dass sich hier Schmuggler, sogenannte Mulis, mit schweren Säcken voller Kokain oder Heroin auf dem Rücken unter die Gruppen der illegalen Einwanderer gemischt hatten, um nicht aufzufallen. Plötzlich kniete sich Eleanda am Rand des Pfades neben einem kleinen Busch hin und deutete auf einen überhängenden Zweig, in dessen Dornen sich ein winziger Fetzen Gewebe verfangen hatte.
»Das ist eine Akazie«, sagte Bernie, »eine Katzenkrallenakazie. Den lateinischen Namen habe ich vergessen. Aber was die Leute hier in ihre Gärten pflanzen, ist die Wüstenakazie. Die hat wundervolle gelbe Blüten, die sehr intensiv duften.«
Eleanda lachte. »Dann weißt du bestimmt auch, was die Ranke da drüben ist, links von dir, die mit den hübschen weißen Blüten. Das ist ein Kalifornischer Stechapfel. Du weißt schon. Der mit der halluzinogenen Wirkung. Wenn man die kleinen knopfförmigen Samen kaut oder aufbrüht und den Sud trinkt, schicken sie dir Visionen und Träume.«
»Wie bei den Zeremonien der Native American Church«, sagte Bernie. »Während meiner Zeit auf dem College habe ich mal an so einem Ritual teilgenommen.« Sie schüttelte sich unwillkürlich. »Wie kann an einer so hübschen Blume nur etwas wachsen, das so grässlich schmeckt!«
»Der Stechapfel stand ja auch lange auf der Liste verbotener Drogen«, erzählte Eleanda, »aber dann hat ein Gericht entschieden, dass er im Rahmen von bestimmten religiösen Zeremonien genutzt werden darf. Aber lassen wir jetzt mal den Stechapfel. Ich wollte dir eigentlich das Stück Stoff hier zeigen.«
»Stoff?«
»Genau. Was hier an den Akazienstacheln hängen geblieben ist, sind Jutefasern. Die Mulis verwenden nämlich ganz gewöhnliche Kartoffelsäcke, um ihre Ware zu transportieren.«
Bernie nickte.
»Wir haben es hier an der Grenze mit zwei Gruppen von Leuten zu tun«, sagte Eleanda, »mit den illegalen Immigranten und mit den Mulis. Die Illegalen sind eigentlich gute Menschen. Sie finden nur eben in Mexiko keine Arbeit, ihre Familien leiden Hunger, und da suchen sie nach einem Ausweg. Die haben auch nie Waffen bei sich. Und wenn sie welche hätten, würden sie niemanden verletzen. Aber wenn du so etwas hier siehst«, vorsichtig streifte sie eine Faser vom Dornenzweig, »dann bedeutet das, dass du hier nicht nur illegalen Einwanderern folgst, die auf der Suche nach Arbeit Richtung Norden gehen, sondern dass hier Mulis unterwegs sind, und dann musst du sehr, sehr vorsichtig sein.«
»Versprochen«, sagte Bernie und lächelte ein wenig unglücklich. »Das ist wortwörtlich das, was Sergeant Chee mir geraten hat, als ich ging: ›Sie müssen sehr, sehr vorsichtig sein.‹ Aber das war leider auch schon alles, was er mir mit auf den Weg gegeben hat.«
»Das ist der Sergeant, von dem du mir erzählt hast? Hast du mit ihm gesprochen, als du darüber nachgedacht hast, dich hierher zu melden?«
Bernie schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Du hast nicht mit ihm gesprochen? Nach dem, was du mir erzählt hast, scheint er sehr nett zu sein. Aber du bist seinetwegen weggegangen? Hat er dich verletzt?«
»Nein. Nein«, wehrte Bernie ab. »So war es nicht. Er ist wirklich sehr freundlich. Sehr …«, sie stockte. Wie sollte sie das erklären?
»Freundlich? Zu dir?«
»Nein, so habe ich das nicht gemeint. Er war schließlich mein Boss.«
»Also, freundlich zu wem?«
Bernie zuckte die Achseln. »Na ja, eigentlich zu jedem.«
»Zum Beispiel?«
»Also, ich habe das ja selbst lange nicht gemerkt«, sagte Bernie. »Es gibt da eine Geschichte, die Kollegen mir über ihn erzählt haben. Chee musste vor Jahren einmal einen ganz merkwürdigen Verkehrsunfall mit Todesfolge und Fahrerflucht bearbeiten. Ganz in der Nähe in Farmington gab es eine lokale Radiostation, bei der in ihrem ›Open Mic‹-Programm das Studio jedem offen stand. Wenn einer zum Beispiel ein Pferd verkaufen wollte, dann konnte er einfach kommen und sein Angebot gleich ins Mikrofon sprechen. Oder wenn jemand zu einer Heilungszeremonie einladen wollte oder Heuballen zu verkaufen hatte, konnte er ins Studio gehen und das Mikrofon benutzen. Und der flüchtige Unfallverursacher hat genau das getan. Er ist ins Studio gegangen und hat dort öffentlich erzählt, dass er einen Mann am Straßenrand überfahren hat, dass er ihn liegen gelassen hat und anschließend einfach weggefahren ist. Er hat gesagt, er sei zu betrunken gewesen, um überhaupt richtig mitzubekommen, was er da getan hatte, aber jetzt tue ihm das alles furchtbar leid, und er wolle jeden Monat einen Teil seines Lohnes als Entschädigung an die Familie schicken.«
»Na, so was!«, rief Eleanda. »Ich wollte, wir hätten mehr solcher Säufer. Und hat er tatsächlich Wort gehalten?«