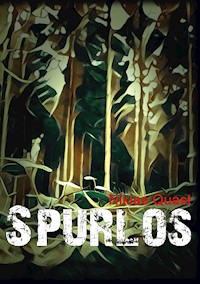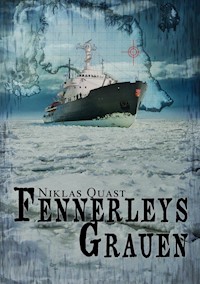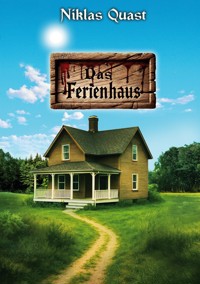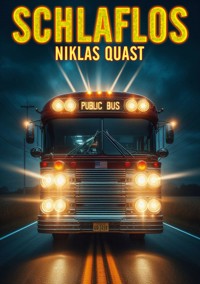Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Crethrens
- Sprache: Deutsch
Von Australien über die Antarktis bis auf die Sonneninsel Tokelau - in insgesamt drei Teilen wird die Vor- und Nachgeschichte der Gruppe beleuchtet. Zwischen Blut, Schweiß und Tränen lernen die Jugendlichen einander kennen - und stoßen an die Grenzen ihrer psychischen und physischen Kräfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 858
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum BUCH
…von New York bis in die Antarktis – die Memoiren von Jonas Grant
Die Vorbereitungen von Phase eins des großen Projektes in der Eiswüste laufen auf Hochtouren. Auf sich allein gestellt, soll Jonas der Organisation bei der Umsetzung des Ganzen helfen. Eine harte Zeit steht ihm bevor, welche ihn sowohl psychisch als auch körperlich an sein absolutes Limit treibt.
…von Washington D.C. bis nach Adelaide – die Anfänge von Oskar Ryland
Auf dem Royal Militarity College in Adelaide kommt es zum Kennenlernen der Gruppe. Siebzehn Tage harter Vorbereitung stehen bevor – eine intensive Zeit, die einerseits zusammenschweißen, andererseits aber auch aus jedem einen fähigen Einzelkämpfer bilden soll.
…vom Planeten Ehygea bis nach Tokelau – die Geschichte von Tim Anderson
Die Geschehnisse nach der Zerstörung des Planeten Ehygea. Tim, Nora und Lily schafften die Flucht und gelangten durch ein Portal über Ghiron Nagh auf die Sonneninsel Tokelau, wo es zur Konfrontation mit der Organisation rund um Abigail Scales kommt – der letzte, große Kampf steht unmittelbar bevor.
Zum AUTOR
Niklas Quast wurde am 7.3.2000 in Hamburg-Harburg geboren und wuchs im dörflichen Umland auf. Nachdem er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolvierte, arbeitet er nun in einem Familienbetrieb und widmet sich nebenbei dem Schreiben.
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
Dienstag, 23. Februar 2016
Freitag, 4. März 2016
Donnerstag, 10. März 2016
Dienstag, 15. März 2016
Samstag, 19. März 2016
TEAM 1 – Louis Jones & Fynn Seales
Sonntag, 10. April 2016
ALLE BÜCHER DES AUTOREN
VORWORT
Liebe Leserinnen & Leser,
wenn Sie dieses Buch in ihren Händen halten, dann gehe ich davon aus, dass Sie bereits die Bände 1-3 der Crethrens-Reihe gelesen haben. Dieses Werk ist eine Hommage an alle Charaktere, insbesondere natürlich an Oskar Ryland, Jonas Grant und Tim Anderson. Das ist allerdings nicht der Grund, weshalb ich, zum absolut ersten Mal, ein Vorwort schreibe – nein, mir geht es einfach darum, in ebendiesem kleinen Text auf den Umgang mit zwei sensiblen Themen innerhalb der Story hinzuweisen. Zum einen geht es um Alkoholkonsum, der im Kontext der Geschichte an einigen Stellen falsch rüberkommen kann, was keineswegs beabsichtigt ist. Die Tatsache, dass die Jugendlichen bereits alkoholische Getränke zu sich nehmen, ist keineswegs gutzuheißen – ganz im Gegenteil. Der zweite, mir persönlich sehr wichtige Punkt, ist das Thema Depressionen und die menschliche Psyche. Es gibt leider noch viel zu viele Menschen auf der Welt, die dieses Thema nicht ernst genug nehmen, doch damit ist definitiv nicht zu spaßen. Den Betroffenen sieht man es mitunter nicht an – denn sie tragen den Kampf gegen ihre inneren Dämonen meist im Verborgenen aus. Ich kann in diesem Fall nur einen Rat geben, sowohl an Betroffene als auch an Angehörige: redet miteinander. Kommunikation kann in diesem Punkt ein wertvoller Schlüssel sein, denn was nicht ausgesprochen wird, schwebt meist unsichtbar in der Luft umher. Die drei Schlüsselwörter sind Vertrauen, Mitgefühl und Zusammenhalt. Sie können eine unsichtbare Brücke spannen und oftmals ein Licht in eine allumfassende Dunkelheit bringen. Doch genug geredet: nun wünsche ich Ihnen und euch viel Spaß beim Lesen!
Dienstag, 23. Februar 2016
Es geschah an einem kühlen, regnerischen Tag. Ich verließ die Highschool durch eine der vielen Hintertüren, um über einen kurzen Umweg direkt in den Wald zu gelangen. Von dort aus wären es nur noch wenige Minuten bis zu mir nach Hause. Der Regen prasselte monoton auf das Blätterdach über meinen Köpfen, und die meisten Tropfen blieben dort oben hängen. Ich wurde von zwei Fahrrädern überholt, deren Räder tiefe Furchen im waldigen Boden hinterließen. Ich wollte mir gerade meine Kopfhörer in die Ohren stecken und etwas Musik hören, als ich plötzlich Motorengeräusche hinter mir vernahm. Ich drehte mich um und erblickte einen weißen Kastenwagen. Das Fahrzeug war nur noch wenige Meter von mir entfernt und kam stets näher. Verwundert blieb ich stehen, da ich wusste, dass dieser Weg eigentlich keine befahrbare Straße war. Ich nahm den Wagen näher in Augenschein und bekam ein schlechtes Gefühl, als er sein Tempo verlangsamte und schließlich sogar anhielt. Die Fenster waren verdunkelt, was mich daran hinderte, einen Blick ins Innere werfen zu können. Mein Magen verkrampfte sich und ich wollte schnellstmöglich weg von diesem Ort. Ich beachtete den Wagen daher nicht weiter und setzte meinen Weg fort. Plötzlich wurden die Türen aufgestoßen und ich hörte hinter mir eine Frauenstimme.
»Jonas?«
Die Stimme klang alles andere als bedrohlich, weshalb ich mich umdrehte.
»Ja, das bin ich.«
Obwohl der Regen laut auf den Waldboden prasselte, konnte ich die Frau gut verstehen. Ich wurde langsam nervös, versuchte aber, das irgendwie zu verbergen.
»Nehmt ihn mit.«
Die Stimme der Frau klang plötzlich kühl. Im nächsten Moment wurden zwei der hinteren Türen geöffnet, und zwei Männer traten auf den Waldboden hinaus. Ich wägte meine Chancen ab, sah jedoch ein, dass diese in diesem Moment nicht so groß waren. Dennoch kam in meinem Kopf nur ein einziger Befehl auf. Lauf! Meine Beine reagierten allerdings zu langsam, einer der Männer hatte mich kurze Zeit später bereits erreicht. Ich wehrte mich, jedoch war er zu kräftig. Wenig später presste er ein feuchtes Tuch auf mein Gesicht, und ich spürte, wie ich das Bewusstsein verlor.
Freitag, 26. Februar 2016
Als ich aufwachte, lag ich in einem Bett. An meinen Armen hingen mehrere Infusionsschläuche, die wahrscheinlich Beruhigungsmittel in mich hineinpumpten. Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich mich orientieren konnte und bemerkte, dass ich mich in einem Krankenhaus befand. Zumindest wirkte das Zimmer so auf mich. Die Matratze war unbequem und als Decke hatte ich ein dünnes, weißes Laken. Aus einem Schacht an der Decke strömte frische Luft in den Raum. Wenig später vernahm ich Schritte, die der Tür meines Zimmers immer näherkamen. Ich wollte mich erst aufrichten, doch als ich das tat, bemerkte ich, dass ich mich noch ziemlich schwach fühlte. Verdammt, wo bin ich hier? Nach einem kurzen Gespräch auf dem Gang, von dem ich jedoch nur unzusammenhängende Bruchstücke verstehen konnte, wurde die Tür schließlich geöffnet. In den Raum
trat die Frau, die bereits in dem weißen Kastenwagen gesessen und mich eingesammelt hatte. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und war geschätzt knapp vierzig Jahre alt. Sie trug einen weißen Kittel, auf dem ein Namensschild mit den Buchstaben A. Scales prangte. Sie trug ein Lächeln im Gesicht und wirkte auf mich nicht im Entferntesten bedrohlich.
»Hallo, Jonas. Wie geht es dir?«
Ich war verwirrt über ihre Frage und musste meine Gedanken erst einmal ordnen. Was würde sie für eine Antwort erwarten? Ich spürte Zorn in mir aufsteigen, der sich unter das Gefühl der Verwirrtheit mischte. Ich versuchte jedoch, ruhig zu bleiben, da ich wusste, dass es mir nichts bringen würde, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.
»Nicht so gut. Ich habe Kopfschmerzen und fühle mich ziemlich geplättet.«
»Okay. Das wird vergehen, genauso wie das Chaos, was in deinem Kopf gerade herrscht. Mein Name ist Abigail Scales und ich heiße dich herzlich willkommen bei uns.«
»Bei uns? Was soll das heißen? Wo bin ich?«
Ich wollte nun doch nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden und konfrontierte sie direkt mit dem, was in meinem Kopf herumschwirrte.
»Hab keine Sorge, du bist hier in Sicherheit. Wir befinden uns in einem Krankenhaus in Adelaide.«
Ich ließ die Worte langsam in meinen Kopf drängen und realisierte erst nach und nach, was das alles bedeuten musste.
»Wir sind in Australien?«
»Ja. Zumindest vorübergehend. Heute wirst du den Rest des Teams kennenlernen und morgen startet bereits ein privates Flugzeug, welches uns alle in eine Basisstation in der Antarktis bringt.«
»Wie soll das gehen?«
Ich wurde misstrauisch.
»Wir haben dir an Bord unserer Maschine immer wieder Betäubungsmittel verabreicht, welche dafür sorgten, dass du erst jetzt, nach drei Tagen, wieder das Bewusstsein erlangst.«
»Sie haben mich entführt.«
Ich sprach das aus, was in meinem Kopf herumspukte. Ich blickte in das Gesicht von Abigail und nahm zur Kenntnis, dass sich ihre Züge etwas veränderten.
»Ich möchte dich über alles aufklären, was du dir nicht erklären kannst. Am Ende wirst du sehen, dass es keineswegs so ist, wie es jetzt aussieht.«
Sie legte eine kurze Pause ein und sprach dann weiter.
»In zwei Stunden, um halb fünf, erwarte ich dich im Konferenzraum eins. Bis dahin kannst du dich hier gerne etwas umsehen. Aber bitte versuche keine Dummheiten, alle Ein- und Ausgänge sind strengstens überwacht. Du darfst das Gebäude nicht verlassen. Bis später.«
Sie verließ den Raum ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Ich löste die Infusionsschläuche von meinen Armen, setzte mich aufrecht hin und spürte, wie sich alles in meinem Kopf drehte, was die gesamte Lage noch etwas verschlimmerte. Das leise, monotone Ticken der Wanduhr war das einzige Geräusch, welches ich nun wahrnehmen konnte. Von außerhalb war nichts zu hören, weshalb ich mich schließlich dazu entschied, aufzustehen und etwas im Zimmer herum zu gehen. An der Fensterseite waren die Gardinen zugezogen und ich sah einen Schreibtisch in der Ecke stehen. Ich zog den Stuhl zurück, setzte mich, und zog die Gardinen auf. Sonnenlicht fiel in den Raum und blendete mich so sehr, dass ich meine Augen zusammenkneifen musste. Draußen gab es nicht viel zu sehen. Auf einer abgemähten Wiese befanden sich ein paar Sträucher, die an der hinteren Wand eines weiteren Gebäudekomplexes endeten. Ich wandte mich wieder ab und erkundete den Raum weiter. Hinter einer kleinen Nische entdeckte ich ein Badezimmer. Ich fühlte mich schmutzig und mir war warm, der Gedanke an eine kühle Dusche war in diesem Moment das Schönste, was ich mir vorstellen konnte. Ich legte meine Klamotten ab, stieg durch die Glaskabine ins Innere und drehte den Hahn auf. Lauwarmes Wasser lief über meinen Körper und ich drehte es etwas kälter. Ich lehnte mich mit dem Rücken an die Wand und ließ das Wasser über mein Gesicht und meine Haare laufen. Die Kopfschmerzen verzogen sich, und auch das Unwetter in meinem Kopf lichtete sich etwas. Ich war wieder in der Lage, klar zu denken und die Situation zu erfassen, in der ich mich befand. Okay, sie hatten mich gekidnappt und gegen meinen Willen nach Australien verfrachtet, doch Gefahr ging von ihnen zumindest im jetzigen Moment nicht aus. Ich wusste jedoch auch, dass ich mich auf den ersten Eindruck nicht verlassen durfte, denn dieser konnte sich im Nachhinein schnell als Täuschung herausstellen. Nach etwa einer Viertelstunde beendete ich die Dusche und suchte in den Kleiderschränken nach neuen Klamotten. Ich entdeckte ein dunkelblaues T-Shirt mit einem aufgedruckten Logo, von denen sich mehrere in meinem Schrank stapelten. Das Logo zeigte einen Igel, unter dem die Buchstaben C.O. standen. Da ich nichts anderes dort fand, streifte ich es mir über den Kopf und schlüpfte hinein. Im Schrank hingen zudem noch jede Menge andere Kleidungsstücke, die alle in meiner Größe waren, was mich schon ein bisschen verwunderte. Woher wussten die so viel von mir? Mir wurde mit jeder einzelnen Sekunde mulmiger. Ich
wusste allerdings auch, dass es nicht viel brachte, untätig im Zimmer auf und ab zu gehen, weshalb ich mich dazu entschied, das Gebäude zu erkunden – das war mir ja immerhin nicht verboten worden. Ich öffnete die Zimmertür und trat hinaus auf den mit hellbraunem Laminat belegten Flur. An der Decke hingen in regelmäßigen Abständen Lampen, die ihr schwaches, gelbes Licht verteilten. Sowohl rechts als auch links von mir erstreckten sich Türen zu beiden Seiten den Gang hinunter. Ich ging davon aus, dass dort überall weitere Krankenzimmer waren, weshalb ich kein Interesse hatte, jeden einzelnen Raum zu durchsuchen. Ich passierte gerade die zweite Tür links von mir, als ich hörte, wie sie aufging. Ruckartig drehte ich mich um und entdeckte ein Mädchen, das im selben Alter war wie ich – zumindest schätzte ich das. Sie war ziemlich groß, sogar etwas größer als ich.
»Hey«, sagte sie.
»Du musst Jonas sein, oder? Sie haben mir von deiner Anwesenheit erzählt.«
Ich wurde stutzig, und versuchte auch gar nicht erst, das zu verbergen.
»Was haben sie dir erzählt?«
»Nicht wirklich viel.«
Sie legte eine kurze Pause ein.
»Lass uns etwas reden. Mein Name ist übrigens Ruby.«
Da ich sowieso nichts anderes zu tun hatte, nickte ich nur und zuckte mit den Schultern.
»Sollte mir nur recht sein. Komm.«
Wir gingen den Flur entlang, bis wir das Ende des Ganges erreicht hatten. Ruby wirkte auf mich nicht so, als wäre sie bereits viel länger als ich hier. Sie sah sich akribisch um und suchte mit ihren Blicken die Umgebung ab.
»Wie lange bist du schon hier?«
Um das vorübergehende Schweigen zu brechen, nahm ich das Wort an mich, und stellte die Frage, die mir vor wenigen Sekunden im Kopf herumgeschwirrt war.
»Wir sind beide zur selben Zeit hier angekommen. Ich war allerdings eine Stunde vor dir wach, weshalb mir Abigail bereits einiges erzählt hat.«
»Was hat sie dir erzählt?«
»Es wirkt alles aktuell noch zusammenhanglos. Wir sollten abwarten, was wir aus dem Treffen im Konferenzraum an Informationen gewinnen können.«
Auch, wenn es mir nicht gefiel, dass sie offensichtlich mehr wusste als ich, fühlte es sich doch gut an, jemanden zu haben, mit dem ich reden konnte. So verschwand zumindest Stück für Stück dieses Gefühl der Ungewissheit, was mich seit meinem Erwachen gequält hatte.
»Weißt du, wo der Konferenzraum eins ist?«
»Nein, leider nicht. Ich war bisher auch nur auf meinem Zimmer.«
»Haben sie dir auch erzählt, dass wir morgen in die Antarktis fliegen?«
Ruby nickte.
»Ja. Ich weiß aber noch nicht, was ich davon halten soll.«
»Nun, sie haben uns entführt. Ich halte da rein gar nichts von und überlege ehrlich gesagt, gleich wieder abzuhauen.«
»Versuch das gar nicht erst.«
Ruby zog ihr langärmliges T-Shirt hoch und deutete auf eine Stelle, an der ich unter ihrer Haut einen blauen, aufleuchtenden Punkt entdeckte.
»Das ist ein Aufspürer. Durch den können sie zu jeder Zeit sehen, wo wir uns gerade aufhalten. Du trägst auch einen in dir.« Jetzt, wo sie es angesprochen hatte, spürte ich einen leichten Druck im Unterarm – ich hatte ihn zuvor ignoriert und als normal abgetan, vermutlich auch, weil das Betäubungsmittel meine Sinne noch immer ein Stück weit in Beschlag genommen hatte. Ich prüfte die Stelle direkt und sah ein, dass sie recht hatte.
»Woher weißt du das alles?«
Langsam glaubte ich nicht mehr, dass sie bloß eine Stunde früher als ich aus der Bewusstlosigkeit erwacht war. Es fühlte sich für mich irgendwie so an, als spiele sie eine größere Rolle in dem teuflischen Spiel, in das ich scheinbar durch Zufall hineingeraten war. Wir hatten mittlerweile das Ende des Ganges erreicht und befanden uns vor einer Glastür, die in ein Treppenhaus führte, in dem sich auch ein Fahrstuhl befand. Ich öffnete die Tür und betätigte den Knopf des Fahrstuhls. Es dauerte gefühlt eine halbe Ewigkeit, bis dieser die Etage erreicht hatte, in der Ruby und ich warteten. Wir stiegen ein und fuhren mehrere Stockwerke nach oben.
»Hast du ein Ziel?«, fragte ich sie.
»Nein«, antwortete sie.
»Ich möchte mich nur ein bisschen umsehen. Und ich dachte, das könnten wir ja auch gut zusammen tun.«
Wenig später öffneten sich die Türen und wir traten auf den leeren Flur im obersten Stockwerk. Am Ende eines kleinen Ganges entdeckten wir eine Stahltür, die elektronisch gesichert war. Ich betrachtete die Konstruktion genau. Der Türgriff schien augenscheinlich unter Strom zu stehen und wurde von einem Zahlencode gesichert.
»Hier kommen wir nicht weiter.«
Ruby betrachtete die Tür näher.
»Stimmt.«
Es hätte mich ehrlicherweise nicht gewundert, wenn sie plötzlich die passende Zahlenkombination eingegeben hätte. Doch sie schien, zumindest in diesem Punkt, genauso ahnungslos wie ich gewesen zu sein, auch, wenn sie sich dafür aus meiner Sicht ein wenig merkwürdig verhielt.
»Hier gibt es wohl nicht viel zu sehen. Schade.«
Wir fuhren mit dem Fahrstuhl nun eine Etage tiefer und stiegen im vierten Stockwerk aus. Diese Etage wirkte deutlich belebter, ich entdeckte am hinteren Ende des Ganges zwei Frauen, die sich unterhielten. Ruby ging voraus, und ich folgte ihr. Zu beiden Seiten erstreckten sich Türen den Gang hinunter. Wenige Schritte später hatte ich etwas entdeckt.
»Hier ist der Konferenzraum«, sagte ich zu Ruby, die schon ein paar Meter vor mir war.
Sie drehte sich um.
»Okay. Dann wissen wir ja schonmal, wo wir nachher hinmüssen.«
Wir fanden sonst nichts interessantes mehr in diesem Stockwerk. Die beiden Frauen, die ich am Anfang entdeckt hatte, waren in einem angrenzenden Raum verschwunden, bevor wir sie erreichen konnten. Der verhaltene Blick, den sie uns zuvor zugeworfen hatten, trieb mir weitere Fragezeichen in den Kopf. Ich hoffte, dass wir durch den Vortrag, der bevorstand, mehr erfahren würden, denn ich hasste nichts mehr, als im Unklaren zu sein.
»Ich habe Hunger«, meinte ich schließlich, als wir wieder in den Fahrstuhl stiegen.
»Weißt du, wo wir hier etwas zu essen bekommen?«
Ruby drückte den Knopf, der sie nach unten führen würde, und zeigte auf einen kleinen Zettel neben dem Tastenfeld, den ich zuvor noch nicht entdeckt hatte.
»Die Kantine ist im Erdgeschoss.«
Wenig später hatten wir besagte Kantine erreicht und sahen uns um. Sie war nicht gerade schlecht besucht, einige Tische waren voll mit Menschen, die sich angeregt unterhielten. An jedem von ihnen sah ich das Logo, welches auch auf dem T-Shirt, welches ich im Schrank gefunden hatte, aufgedruckt war. Wir bedienten uns am Buffet. Mir lief das Wasser im Mund zusammen als ich entdeckte, wie breit die Auswahl war. Es gab viele verschiedene Fleischsorten: Schwein, Rind, Lamm, Hähnchen und Ente. Zu den Beilagen zählten mit Speck umwickelte Bohnen, Kartoffeln, Nudeln, Reis, Pommes und Blumenkohl. Ich füllte mir von allem etwas auf den Teller und goss mit einer Kelle etwas braune Soße darüber. Mein Magen knurrte beim Geruch des Essens – in Anbetracht der Tatsache, dass ich drei Tage bewusstlos gewesen war, schien meine letzte Nahrungsaufnahme ebenfalls genauso lange her zu sein. Wir setzten uns an einen freien Tisch am Fenster gegenüber voneinander hin. Während wir aßen, warf ich Ruby immer wieder ein paar heimliche Blicke zu. Ich versuchte, aus ihrem Gesicht lesen zu können, ob sie doch mehr wusste, als sie vorgab. Doch das gelang mir nicht. Sie hatte ihren Blick starr auf das Essen gerichtet und sagte auch kein Wort, während wir beide unsere Mahlzeiten zu uns nahmen. Ich ließ mir extra viel Zeit, genoss den Geschmack einfach nur. Für einen Moment vergaß ich all das, was mich in den letzten Minuten gequält hatte. Es war fast so, als hätten sich alle Sorgen in Luft aufgelöst. Irgendwann war mein Teller leer und ich entschied mich dazu, noch etwas Nachschlag zu holen. Die Zeit verging, wir blieben noch etwas sitzen und tranken beide eine Flasche Mineralwasser. Irgendwann sagte Ruby dann:
»Wir müssen bald im Konferenzraum sein.«
Sie deutete symbolisch auf ihre Armbanduhr.
»Es ist schon kurz nach vier.«
Wir vertrieben uns die Zeit noch etwas im restlichen Gebäude, ehe wir dann pünktlich um halb fünf vor der Tür von Konferenzraum eins standen. Ruby öffnete sie. Wir wurden bereits von mehreren Personen erwartet, die alle an einem langen, wießen Tisch Platz genommen hatten. Als wir eintraten, wurden die Stühle zurückgeschoben und alle erhoben sich.
»Jonas und Ruby.«
Ein Mann übernahm das Wort.
»Setzt euch.«
Ich sah mich um und entdeckte etwas weiter hinten Abigail. Gegenüber von ihr waren nebeneinander zwei Stühle frei, weshalb Ruby und ich dort Platz nahmen. Alle Augen waren auf uns gerichtet, ich versuchte, das aufkommende Unwohlsein irgendwie zu ignorieren, schaffte das jedoch nicht. Ich fühlte mich schlecht dabei, beobachtet zu werden, und wünschte mich in diesem Moment wieder in mein Zimmer zurück. Zudem kehrten meine Kopfschmerzen zurück, zwar nur leicht, aber trotzdem beständig. Ich wollte den angekündigten Vortrag einfach nur hinter mich bringen, war aber dennoch gespannt, was dieser an Informationen bringen würde – und hoffte, dass er nicht allzu lang dauern würde.
Nun trat ein Mann nach vorne. Es war der, der uns am Anfang begrüßt hatte.
»Dann können wir ja endlich starten. Abigail?«
Abigail schob ihren Stuhl ebenfalls zurück und trat nach vorne.
An der Wand hing ein großer Bildschirm, der kurze Zeit später angeschaltet wurde und ein Bild zeigte, auf dem zunächst nicht viel zu erkennen war.
»Jonas und Ruby, wir heißen euch herzlich Willkommen bei uns. Hört uns bitte gut zu, wir werden euch in den kommenden Minuten alles erzählen, was ihr über uns wissen müsst.«
Sie legte eine kurze Pause ein und sah den Mann an, der vorne direkt neben ihr stand.
»Mikel, möchtest du beginnen?«
»Sicher doch.«
Er räusperte sich kurz, und ich sah, wie auf dem Bildschirm an der Wand ein erstes Bild auftauchte. Zu sehen war das Gebäude in dem wir uns gerade befanden – zumindest nahm ich das an.
Ich erkundete den Grundriss mit meinen Augen und wartete, bis der Mann namens Mikel begann, zu erzählen.
»Wir befinden uns hier zurzeit in einem ehemaligen Krankenhaus in Adelaide. Wir haben diese Räumlichkeiten für unsere Organisation genutzt, da sie uns einfach optimal erschienen.«
Ich wusste nicht, warum er das sagte, was er gerade sagte. Es interessierte mich schlichtweg nicht – weshalb ich mich dazu hinreißen ließ, seinen Monolog zu unterbrechen.
»Warum sind wir hier?«
Der scharfe Blick von Mikel traf mich und schüchterte mich direkt ein.
»Es ist nicht wirklich höflich, einfach so reinzureden. Warte einfach ab, was wir zu erzählen haben, und stell uns danach deine Fragen – allerdings sollte das, was wir dir sagen, alles beantworten.«
Ich nickte, da ich wusste, dass mir in diesem Moment nichts anderes übrigblieb, als seine Anweisung zu akzeptieren. Der Unterton in seiner Stimme hatte mir signalisiert, dass er es ernst meinte.
»Nun, dann fahre ich mal fort.«
Mikel nahm seinen Blick wieder von mir und richtete ihn auf einen unbestimmten Punkt im Publikum.
»Ich hoffe, ihr beide habt euch in den letzten Stunden schon etwas umsehen können. Wie ihr bereits mitbekommen habt, werden wir morgen in die Antarktis aufbrechen. Unser Aufenthalt in der Basisstation dort wird fünf Tage andauern – und ihr werdet uns dabei helfen, alles für die große Prüfung vorzubereiten.
Nach diesen fünf Tagen werden wir wieder hier nach Adelaide fliegen. Unsere Reise wird am Royal Militarity College, welches nur ein paar Straßen von hier entfernt liegt, enden. Dort werden wir nämlich auf die Testpersonen treffen, die uns dabei helfen sollen, den großen Durchbruch in der Forschung zu schaffen.«
In diesem Moment schwirrten tausend Fragezeichen durch meinen Kopf. Die Worte, die der Mann sprach, ergaben einfach gar keinen Sinn für mich. Ich war sehr erleichtert, dass es nun Ruby war, die das Wort an sich nahm.
»Was für einen Durchbruch? Worum geht es hier genau?«
Ich beobachtete Mikel genau und sah, wie sich seine Gesichtszüge kaum veränderten. Im Gegenteil – er wirkte freundlich und gefasst, während er sich eine Antwort zurechtlegte.
»Wir forschen mit Hochdruck an einem Gegenmittel für ein bestimmtes Gift. Und genau dazu kommen wir jetzt.«
Die nächste Folie der Präsentation wurde geöffnet und zeigte dieses Mal eine grüne Substanz, die sich in einer Glasschüssel abgesetzt hatte. Daneben stand eine Menge Text, den ich jedoch von meinem Platz aus nicht lesen konnte, da die Schrift zu klein war.
»Coretil ist das Gift von gigantischen Monstern, die in dunklen Höhlen leben: den Crethrens. Es reicht schon die Injektion einer kleinen Dosis, um einen Menschen schwer zu verletzen oder gar zu töten.«
Es wurde still im Raum. Mikel rief die nächste Seite auf, auf der eine Weltkarte zu sehen war, die an einigen Stellen rot eingefärbt war.
»In den Vereinigten Staaten oder in Europa seht ihr noch nichts.
Aber wenn ihr euren Blick schweifen lasst...«
Mikel fuhr mit dem Finger über die Weltkarte, und hatte ein paar Sekunden später Australien erreicht.
»Asien, Australien und die Antarktis. Die Orte, an denen sich die Crethrens ausgebreitet und fast zu einer Plage entwickelt haben. Wir kennen ihren Ursprung nicht, müssen jedoch zwingend handeln, um dafür zu sorgen, dass die Menschheit keiner Gefahr ausgesetzt ist.«
Eine weitere Folie später war ein Bild zu sehen, welches mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich sah genau das, was Mikel zuvor versucht hatte, zu erklären. Das Monster sah fast aus wie ein Eisbär, doch irgendwie auch... anders. Messerscharfe Krallen und eine Fellfarbe, die an Eis erinnerte. Im hereinfallenden Licht auf dem Bild schimmerte das Fell, ja, es glänzte fast.
»Die Crethrens sind sehr gefährlich, und schon für zahlreiche Todesfälle eben in Australien und Asien verantwortlich. Sie haben sich in tiefen Höhlen niedergelassen und jagen dort ihre Beute, zu der auch Menschen zählen. Zumindest war das bisher immer der Fall gewesen. Allerdings hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert: sie verlassen mittlerweile zur Jagd ihr Revier. Sie halten sich nicht nur in den Höhlen auf, sondern auch um sie herum, was sie brandgefährlich für uns macht.«
Er legte eine kurze Pause ein. Gerade, als ich ihm so einige Fragen stellen wollte, sprach er weiter.
»Ihr fragt euch bestimmt, warum wir ausgerechnet in die Antarktis fliegen. Und ihr fragt euch auch, was ihr beide damit zu tun habt, ist das wahr?«
Ich nickte zur Bestätigung und sah, dass Ruby das auch tat.
»Nun, das ist recht einfach gesagt. Wir haben, schon vor einiger Zeit, etwas Besonderes in Bezug auf die sonderbaren Wesen entdeckt. Ihr Hauptverbreitungsort ist die Antarktis, und wir glauben, dort ihren Ursprung ausgemacht zu haben.«
Mikel machte eine kurze Pause, schien darauf zu warten, dass weitere Fragen gestellt werden würden. Da jedoch keiner sprach, nahm ich das Heft in die Hand und begann zu reden.
»Warum wurden wir entführt?«
Die Blicke, die mich nun trafen, schüchterten mich schon etwas ein, weshalb ich mit den nächsten Worten versuchte, das Gespräch noch in eine andere Richtung zu lenken.
»Ich meine... warum ausgerechnet wir?«
Mikel verzog das Gesicht zu einem Lächeln, welches fast freundlich wirkte.
»Wir haben euch bereits längere Zeit beobachtet. Ihr seid die perfekten Testprobanden für uns. Zudem wird euch nichts passieren, wenn ihr mit uns kooperiert. Eure Familien haben dem zugestimmt, und im Gegenzug von uns eine Stange Geld erhalten – mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Sobald die Mission vorbei ist und wir unser Ziel erreicht haben, fliegen wir euch wieder nach Hause.«
Hoffnung keimte in mir auf. Auf die Situation, die mir jetzt eigentlich schon ausweglos schien, bekam ich wieder einen neuen Blickwinkel. Auch, wenn mich die Tatsache, dass mich meine Familie offenbar verkauft hatte, enorm traf.
»Wirklich?«
Mikel nickte, und in seinem Gesicht war nichts zu lesen, was auf eine Lüge hindeutete.
»Wirklich.«
Ich lehnte mich etwas zurück und entspannte mich auf dem Stuhl. Ich hatte nun erst einmal genug erfahren und war auf das gespannt, was er uns noch alles zu erzählen hatte.
»Es gibt bereits ein Gegenmittel gegen das Gift der Crethrens.
Es nennt sich Coretilyx.«
Auf der nächsten Folie war nun eine Papierverpackung zu sehen, die den Schriftzug des Medikamentes trug. Die roten Buchstaben wirkten schnörkellos auf dem weißen Hintergrund.
»Es wirkt jedoch nur ein einziges Mal, und das Problem ist, dass der menschliche Körper keine Antikörper gegen das Gift aufbauen kann. Wir haben, in Zusammenarbeit mit unserer technischen Abteilung, die für die Effekte zuständig ist, eine kleine Animation erstellt, in der dargestellt wird, was mit eurem Körper passiert, wenn ihr das Gift injiziert bekommt. Schaut euch das mal an.«
Er klickte eine Seite weiter, woraufhin ein kurzer Film über den Bildschirm flimmerte. In dem Video wurde nicht gesprochen.
Es wurde stattdessen gezeigt, wie erst das Gift der Crethrens und dann das Gegenmittel in den Körper gepumpt wurden. Das Coretilyx breitete sich im Körper aus, und ich sah, wie es sich in Windeseile verteilte. Es verdrängte das Gift und zerstörte die Zellen, die sich im Körper aufgebaut hatten. Der Bildschirm wurde ganz kurz schwarz, und es folgte eine erneute Injektion des Giftes. Dieses breitete sich nun aggressiv im Körper aus und zerstörte die inneren Organe langsam. Eine erneute Einnahme des Medikamentes veranschaulichte, dass es nicht gegen den inneren Zerfall ankam und einfach im Körper verpuffte. Ich bekam eine Gänsehaut, als das Video beendet war. Auch Ruby schien die Wirkung des kleinen Filmes erst einmal in sich aufzunehmen, sie wirkte geschockt und starrte noch weiter auf den schwarzen Bildschirm, obwohl die Animation längst beendet war.
»Wir wollten euch damit auf keinen Fall verunsichern. Aber ihr seht, die Lage ist nicht gut. Wir sind fast am Ende der Präsentation angekommen. Eine kleine, wichtige Sache muss ich euch aber noch mitteilen.«
Er schaltete den Beamer aus und kam auf Ruby und mich zu. Er blieb vor mir stehen und blickte mir direkt in die Augen.
»Zieh mal bitte deinen Ärmel hoch.«
Da ich nun bereits ahnen konnte, was kommen würde, folgte ich seiner Bitte. Er nahm meinen Arm vorsichtig in die Hand und fuhr mit zwei Fingern über meine Adern, bis er an einer Stelle einfach stehen blieb. Er erhöhte den Druck, und ich spürte, wie es unter seinen beiden Fingern pochte... etwas, was ich zuvor nicht bemerkt hatte, und was mir den genauen Punkt des Aufspürers verriet.
»Ihr tragt einen Aufspürer unter der Haut. Dieser macht es uns jederzeit möglich, euren Standort in Erfahrung zu bringen. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.«
Er wurde wieder ernst.
»Okay, es ist spät geworden. Geht auf eure Zimmer und ruht euch aus, morgen wird ein anstrengender Tag und die Reise in die Antarktis wird schon sehr früh starten. Ihr braucht euch keine Sachen einpacken. Unsere Basisstation ist gut ausgerüstet und bietet alles, was ihr braucht.«
Der Raum leerte sich nach und nach, ich blieb noch eine Weile sitzen und wartete, bis der Großteil der Menschen verschwunden war. Niemand würdigte mich eines Blickes, und ich fühlte mich schon ein bisschen wie ein Fremder – jemand, der zu einer Randgruppe gehörte, mit der niemand etwas zu tun haben wollte. Ich hatte nur Ruby – und ich war dankbar, dass es zumindest jemanden gab, der sich in der gleichen Situation wie ich befand.
Wir verließen gemeinsam den Raum und traten in den Flur hinaus. Die Menschen verschwanden hinter weißen Holztüren, die leise ins Schloss fielen. Jeder einzelne schien nun wieder seiner Arbeit nachzugehen, und ich war gespannt, wer von ihnen auf dem Flug in die Antarktis dabei sein würde. Vermutlich würde es sich dabei nur um eine kleine Gruppe handeln, die meisten würden im Hintergrund die Fäden ziehen und alles auf die kommende Woche vorbereiten, in der wir auf eine Gruppe aus dem Royal Militarity College treffen sollten. Ich verspürte kein gutes Gefühl im Bauch, während ich Ruby langsam zum Fahrstuhl folgte.
»Was denkst du?«, fragte sie, als sie den Knopf gedrückt hatte, der den Aufzug in Bewegung setzte.
Als sich die Türen öffneten, antwortete ich: »Ich weiß es nicht. Ich bin noch ziemlich platt von den ganzen Informationen. Und irgendwie fühle ich mich müde.«
Das war gar nicht mal gelogen. Die Strapazen, die mein Körper durchgemacht hatte, als ich nicht bei Bewusstsein gewesen war, hatten sich nun bemerkbar gemacht.
»Willst du noch mit auf mein Zimmer kommen? Ich möchte ungern alleine sein«, meinte Ruby.
Ich zuckte mit den Schultern. Mir war das vollkommen egal, ich hatte nichts gegen Ruby, auch, wenn ich ihr Verhalten weiterhin unergründlich fand. Obwohl ich wusste, dass die folgenden Tage anstrengend werden würden, nickte ich.
»Ist okay.«
»Danke.«
Sie lächelte, und es wirkte ehrlich. Ich folgte ihr weiter durch den Flur, ging an meinem Zimmer vorbei und trat schließlich hinter ihr durch den Rahmen in ihres. Die Einrichtung war etwas anders als bei mir, neben der Fensterbank stand eine Kommode, auf der ein kleines Licht leuchtete. Ich nahm auf einem Sessel Platz, der neben einem Tisch stand. Ruby setzte sich aufs Bett und startete dann das Gespräch.
»Hör zu. Wir kennen uns nicht, ich finde aber trotzdem, dass wir in dieser außergewöhnlichen Situation zusammenhalten sollten.«
Sie machte eine kurze Pause.
»Zudem... sollten wir ihnen auch Glauben schenken. Wenn wir die Tests erfolgreich absolvieren und ihnen damit helfen, dann werden sie uns wieder nach Hause bringen.«
Ich hoffte natürlich dasselbe, doch je mehr Zeit verging, desto weniger glaubte ich ehrlich gesagt daran. Ich warf ihr einen kritischen Blick zu und übernahm das Wort.
»Wir wissen nicht, ob das auch wirklich die Wahrheit ist. Wir wurden immerhin entführt.«
Wir redeten noch ein paar Minuten über verschiedenste Dinge, ohne auf persönliche Sachen einzugehen. Danach entschied ich mich dazu, mein Zimmer aufzusuchen und dort noch etwas alleine zu sein. Ich durchsuchte die Schränke und fand ein Buch mit Kreuzworträtseln. Um mich etwas von der Situation abzulenken, schlug ich die erste Seite auf und versuchte, das Rätsel zu lösen. Doch ich konnte meinen Kopf nicht freibekommen – und so lag ich eine halbe Stunde später mit offenen Augen im Bett, während tausend Gedanken wie ein Auto auf der Autobahn durch meinen Kopf rasten. Es dauerte lange, bis ich schließlich eingeschlafen war. Der letzte Gedanke, an den ich mich erinnern konnte, war der, ob eine Flucht und das in Kauf nehmen des Überlebens nicht eine echte Alternative wäre.
Samstag, 27. Februar 2016
Mitten in der Nacht, zumindest glaubte ich, dass dem so war - kein einziger Lichtstrahl drang durch das heruntergelassene Rollo an meinem Fenster - wurde meine Zimmertür geöffnet.
Sie schlug an der Wand an, und der Lichtschalter wurde betätigt. Eine Person, die komplett in eine Rüstung gehüllt war, trat ins Innere und blickte mich an.
»In einer halben Stunde startet der Flug.«
Mit diesen knappen Worten ließ der Wächter mich alleine. Ich versuchte zunächst, mich zu akklimatisieren, doch dazu war ich noch nicht so wirklich in der Lage. Wenige Sekunden später schlug ich schließlich die Decke zurück und trottete ins Badezimmer. Ich duschte kalt - ganz einfach aus dem Grund, dass ich möglichst schnell wach werden wollte. Die Ziffern eines digitalen Radioweckers, aus dem an der Decke leise Musik drang, verrieten mir, dass es kurz nach halb fünf in der Früh war. Ich gähnte, wusch mir die Haare, das Gesicht und meinen restlichen Körper. Da ich wusste, dass ich zumindest noch etwas Zeit hatte, setzte ich mich nachdem ich mich angezogen hatte auf mein Bett und dachte nach. Seit dem gestrigen Tage hatte sich mein gesamtes Leben auf einen Schlag verändert - ich war komplett aus meinem Umfeld gerissen worden. Meine Familie, meine Freunde, und alle, mit denen ich zu tun hatte - sie würden mich zu diesem Zeitpunkt vermissen, der Tatsache zum Trotz, dass sie mich verkauft hatten. Der Gedanke daran drehte mir den Magen um – und ich merkte, wie mir sogar einen Moment lang die Luft wegblieb. Ich fühlte nichts – weder Wut noch Trauer.
Der Gedanke löste in mir einzig und allein eine Leere aus, die sich nicht so schnell beseitigen lassen würde. Kurz darauf spürte ich, wie mir genau jetzt, um viertel vor fünf am frühen Morgen, die prekäre Lage, in der ich mich befand, aufs Gemüt schlug. Ich realisierte, wie Tränen aus meinen Augen über mein Gesicht liefen und war froh, dass das jetzt passierte. In den kommenden Stunden oder vielleicht sogar Tagen musste ich stark bleiben, ich wollte vor denen keine Schwäche zeigen, ihnen keinen Punkt geben, der mich angreifbar machen würde. Um fünf Minuten vor fünf zog ich mir den Reißverschluss meiner Jacke zu, verließ das Zimmer und trat auf den Flur. Es hatte gut getan, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, doch jetzt fühlte ich mich wieder hundeelend. Während ich über den Teppichboden in Richtung des Aufzuges schritt, hörte ich Rubys Stimme hinter mir.
»Hey.«
Ich drehte mich um und nahm wahr, dass sie ein Lächeln im Gesicht trug. Allerdings sah ich auch sofort, dass es aufgezwungen wirkte - was mich zunehmend erleichterte. Sie ist in derselben Situation wie du. Wieso sollte sie sich auch anders fühlen?
»Hey.«
Ich wartete, bis sie mich eingeholt hatte. Obwohl mir definitiv nicht nach Gesellschaft zumute war, wusste ich, dass mir nichts anders übrigblieb. Zudem war ich auch ein kleines bisschen dankbar für jede Art von Ablenkung.
»Irgendwie bin ich aufgeregt auf das, was uns bevorsteht.«
Ich nickte zunächst nur, ließ mir mit den nächsten Worten etwas Zeit.
»Ja, ich auch. Aber irgendwie kommt mir das Ganze nicht richtig vor.«
Ruby warf mir einen ernsten Blick zu.
»Denkst du etwa, mir geht es da anders?«
»Nein. Du wirkst nur… ziemlich gefasst.«
Ich wusste nicht, wie ich die Worte am besten rüberbringen konnte.
»Nun ja… Sie haben gesagt, dass wir nach dem Projekt wieder nach Hause dürfen.«
Sie legte eine kurze Pause ein.
»Aber ganz ehrlich, ich vermute, dass mehr dahintersteckt. Unsere Familien können uns doch nicht einfach so verkauft haben – die Summe des Geldes sollte dabei eigentlich keine Rolle spielen. Auch, wenn ich nie ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte«, sagte Ruby, als sich die Tür des Aufzuges öffnete.
Dieser war leer, doch auf der Knopfleiste war ein kleines Schild zu sehen, welches ihnen verriet, dass sie ins oberste Geschoss, aufs Dach, fahren mussten. Schweigen herrschte, und ich musste plötzlich wieder an meine Familie denken. Im Gegensatz zu Ruby hatte ich ein gutes Verhältnis zu dem Teil meiner Familie gehabt, der nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus, in dem wir gewohnt hatten, übriggeblieben war. Mein Vater war auf tragische Art und Weise in den Flammen ums Leben gekommen, und das, nachdem er mir, meiner Mutter und meinem kleinen Bruder das Leben gerettet hatte. Das hatte uns dann noch enger zusammengeschweißt, wir hatten miteinander gekämpft und waren zu jedem Zeitpunkt füreinander da. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, wurden wir schon von einem kühlen Wind empfangen. Der Himmel war klar, es standen keine Sterne am Firmament. In der Ferne entdeckte ich ein kleines Flugzeug, an dem die Türen bereits geöffnet waren. Auf der Startbahn waren viele Personen zu sehen, die uns empfingen. Die meisten waren in Rüstungen gehüllt, nur Abigail und Mikel zeigten ihre Gesichter. Abigail empfing uns mit einem kalten Lächeln, Mikels Miene hingegen war vollkommen reglos. Ich zog mir den Kragen meiner Jacke bis unters Kinn und wünschte mir in diesem Moment, einfach nur zu verschwinden. Die Zugangstreppe des Passagierflugzeuges war bereits ausgefahren, und im Inneren brannte ein gelbes Licht. Ruby stieg vor mir die Stufen hinauf, und ich folgte ihr. Der Innenraum war beheizt, ich suchte mir einen Fensterplatz aus und ließ mich in das weiche Polster fallen. Nach wenigen Augenblicken begann ich bereits zu schwitzen, weshalb ich meine Jacke auszog. Es dauerte noch einige Minuten, bis schließlich alle Platz genommen hatten. Ich ließ meinen Blick durch die einzelnen Sitzreihen schweifen und zählte. Neben Ruby, Abigail, Mikel und mir befanden sich noch achtzehn andere mit an Bord. Die Motoren wurden angelassen, und das Flugzeug setzte sich in Bewegung, es rollte über die kurze Startbahn und hob relativ schnell in die Luft ab. Ich spürte, wie mein Körper in den Sitz gedrückt wurde, und, wie ein merkwürdiges Gefühl in mir aufkam. Mein Magen schien sich umzudrehen, während die Maschine immer mehr an Höhe gewann. Ich warf einen Blick durch das kleine Fenster und sah unter mir die beleuchtete Stadt. Als die Lichter schließlich weniger und die Umgebung somit dunkler wurde, schlussfolgerte ich, dass wir den Ozean erreicht haben mussten. Ich lehnte mich im Sitz zurück und schloss die Augen – die Nacht auf der harten, unbequemen Matratze war definitiv zu kurz gewesen, weshalb ich noch ein wenig Schlaf nachzuholen hatte. Ich wachte erst wieder auf, als es bereits taghell war. Irgendwo hinter mir war ein Gespräch aufgekommen, von dem ich jedoch nur einzelne Wortfetzen vernehmen konnte. Allerdings konnte ich so ziemlich genau ausmachen, wer dort miteinander sprach. Ruby und Mikel. Dieser Umstand verwirrte mich etwas, doch als Mikel bald wieder aufstand und auf seinen Platz zurückging, verwarf ich jegliche Gedanken.
»Möchtest du etwas trinken?«
Die Stimme einer Frau riss mich aus meinen Gedanken. Ich zuckte zusammen und wandte ihr meinen Blick zu. Sie hatte lange, blonde Haare und trug ein freundliches, fast warmherziges Lächeln im Gesicht. Doch auch auf ihrem Oberteil prangte das Logo der Organisation, weshalb ich nur verkniffen zurücklächeln konnte. Was hast du denn erwartet? Sie gehören alle dazu.
»Ein Kakao wäre nett«, meinte ich und gähnte.
Ich fühlte mich ziemlich gerädert, auf meinen Augenlidern schien noch immer eine tonnenschwere Last zu liegen.
»Bringe ich dir direkt.«
Sie verschwand im hinteren Teil des Flugzeuges hinter einer Tür und kam wenig später mit einem dampfenden Pappbecher wieder. Der Geruch des Kakaos ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. In der anderen Hand trug sie ein graues Tablett, auf dem neben einem Korb mit zwei Brötchen auch jeweils ein Päckchen Butter und Marmelade und zwei Scheiben Wurst lagen.
»Danke«, sagte ich nur, als sie mir die Sachen reichte.
Ich klappte die Ablage von der Rückseite des Sitzes vor mir herunter und legte das Tablett ab. Die Frau verschwand wieder, ich nahm einen Schluck des warmen Kakaos und blickte aus dem Fenster. Aus der Höhe wirkte die unendliche Weite des pazifischen Ozeans gigantisch. Es herrschte ein hoher Wellengang, das Wasser kräuselte sich an vielen Stellen auf und weiße Schaumkronen schwappten durch die Gegend. Wäre meine Lage nicht so verzwickt, hätte ich den Ausblick tatsächlich genießen können. Doch es fühlte sich nicht gut an, unfreiwillig auf einer gefährlichen Mission auf dem Weg zwischen Adelaide und der Antarktis in einem Passagierflugzeug zu stecken. Ich hoffte in diesem Moment einfach nur, dass sich, entgegen meiner Erwartungen, alles noch zum Guten wenden würde – irgendwie.
Die Zeit verging im Schneckentempo. Nachdem ich mein Frühstück verzerrt hatte, wurde mir langweilig. Ich wusste nicht, wie viele Stunden wir bereits in der Luft waren, doch es dauerte mir einfach zu lange. Der Ausblick wurde bald auch schon öde, weshalb ich der Dinge einfach ausharrte. Es fühlte sich zwar nicht falsch, aber auch nicht gut an, allein zu sein. Zuhause hatte ich das nie wirklich gemocht, weshalb ich meine Freunde mehr denn je vermisste. Ich sehnte mich nach den gemeinsamen Aktivitäten, die gar nicht mal in allzu ferner Vergangenheit lagen.
Ich habe mich von niemandem verabschieden können. Kann das wirklich so gewollt gewesen sein? Nach einer gefühlten Ewigkeit gab es das zweite Mal Essen. Irgendein Fleisch in brauner Soße in einer Fertigbox mit Nudeln und Rotkohl. Auch das nahm ich dankbar entgegen und aß die Portion bis auf den letzten Bissen leer. Stunden später sah ich dann in der Ferne bereits die Antarktis unter mir. Ich spürte, wie mir das Adrenalin bis in die Haarspitzen schoss und mein Bauch zu kribbeln begann.
Wenige Minuten folgten noch, ehe das Flugzeug langsam tiefer sank. Ich legte den Gurt an und spürte kurz darauf, wie die Räder bereits auf der Startbahn aufkamen und die Maschine langsam ausrollte. Schon bei dem Anblick der draußen herrschenden Verhältnisse lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich zog mir die Jacke bis zum Kragen über den Hals und trat aus dem warmen Innenbereich ins kalte Äußere. Ich wurde sofort von einem schneidend kalten Wind empfangen, der mir Schneeflocken ins Gesicht wehte, die auf meiner Haut direkt schmolzen.
Selbst die dicke Jacke konnte die Kälte nicht komplett von mir fernhalten, weshalb ich schon bald zu frieren anfing. In der Ferne, etwa ein paar hundert Meter entfernt, befand sich ein großes Haus. Ich trottete den anderen hinterher, und nahm zur Kenntnis, dass Abigail sich umgedreht hatte und direkt auf mich zuschritt.
»Das ist unsere Basisstation.«
In ihrer Stimme schwang durchaus Stolz mit.
»Ihr beide werdet gleich erstmal auf unserer Ärztestation ein paar Tests absolvieren müssen. Alles weitere wird euch unsere Fachärztin Rhonda dann zu gegebener Zeit erklären.«
Hinter ihr erkannte ich eine dunkelhäutige Frau mit längeren Haaren. Sie war jünger als Abigail und lächelte mich an.
»Hallo, Jonas.«
Ich nickte zur Erwiderung. Ruby gesellte sich zu uns, sie hatte sich etwas abseits noch mit Mikel unterhalten. Was besprechen die beiden nur andauernd? So langsam kam mir das doch arg merkwürdig vor. Ich wog ein paar Sekunden lang ab, ob ich Ruby nicht einfach fragen sollte, entschied dann jedoch, dass dazu nicht der passende Moment war. Später. Wenn wir alleine sind, habe ich dafür noch genug Zeit.
»Hallo, Ruby.«
Rhonda wandte sich nun an meine Mitstreiterin. Ruby warf ihr, im Gegensatz zu mir, ein Lächeln zu.
»Hallo, Rhonda. Mikel hat mir schon erzählt, was uns bevorsteht.«
»Dann kommt doch direkt mal mit.«
Wir hatten das Haus nun erreicht und traten ins Innere. Abigail, Mikel und die anderen teilten sich auf, während Ruby und ich Rhonda ein Stockwerk tiefer in den Keller folgten. Dort unten erstreckte sich ein Gang mit vielen Türen zu beiden Seiten.
Rhonda führte uns direkt in den ersten Raum auf der rechten Seite, sie schaltete das Licht an und ich ließ meinen Blick schweifen.
»Legt gerne eure Kleidung ab.«
In dem Raum war es warm, ich zog Jacke und Pullover aus und hing sie über die Lehne eines Stuhls.
»Ruby, geh mal bitte ins Nebenzimmer. Ich fange mit Jonas an.«
Ruby verschwand hinter einer Tür, die sie in ein kleines Zimmer führte.
»Wie geht es dir, Jonas?«
Ihre Stimme klang sanft und einfühlsam. Sie wirkte bei weitem nicht so kalt wie Abigail und all die anderen, die mir bisher begegnet waren.
»Hm.«
Ich musste mir ihre Frage einen Augenblick lang durch den Kopf gehen lassen. Sie war freundlich zu mir, weshalb ich ihr gegenüber nicht unfreundlich sein wollte. Deshalb versuchte ich, die nächsten Worte möglichst sachlich und neutral herüberzubringen.
»Ich vermisse meine Familie.«
»Das ist menschlich.«
Rhonda seufzte.
»Ich bin mir sicher, du wirst sie bald wiedersehen.«
»Was heißt bald?«
Sie legte mir eine Hand auf die Schulter. Ich blickte ihr genau ins Gesicht. Sie war vielleicht sechs oder sieben Jahre älter als ich, also etwas über zwanzig.
»Das kann ich dir nicht genau sagen. Du musst dich einfach dem fügen, was sie sagen. Wenn du auf ihrer Seite stehst, bist du sicher.«
Mir schwirrten zu viele Fragen durch den Kopf, weshalb ich einfach nur nickte. Ich fühlte mich nicht in der Lage, sie all das zu fragen, was mich interessierte.
»Fühlst du dich körperlich fit?«
»Ja, schon. Ich… habe nur Kopfschmerzen.«
Rhonda zog eine Schublade auf und reichte mir einen Blister und ein Glas Leitungswasser.
»Du kannst dir gerne eine nehmen.«
Ich drückte mir eine Tablette heraus und spülte sie mit einem Schluck herunter.
»Der Flug war ziemlich anstrengend.«
Rhonda nickte.
»Das stimmt. Geh mal bitte zu der Wand, ich muss deine Größe und dein Gewicht aufnehmen.«
An besagter Wand erkannte ich eine Messlatte, direkt daneben stand eine Waage mit digitaler Anzeige. Langsam ging ich darauf zu, lehnte mich an die Wand und wartete, bis Rhonda die Latte auf meine Größe gestellt hatte.
»Ein Meter vierundachtzig. Jetzt geh bitte auf die Waage.«
Ich zog meine Schuhe aus und folgte ihrem Befehl.
»Neunundsechzig Kilo.«
Sie notierte die Daten auf einem Notizblock und legte diesen dann auf einer Ablage ab. Sie setzte sich auf einen Drehstuhl hinter einem Bildschirm und startete einen Computer. Es dauerte etwas, bis das Gerät hochgefahren war. Sie tippte kurz darauf die Daten ins System und wandte sich dann wieder mir zu. Sie schnallte mir ein Blutdruckmessgerät um den linken Oberarm und machte sich daran, meinen Blutdruck zu messen.
»Einhundertfünf zu sechzig. Dein systolischer Wert ist optimal, dein diastolischer recht niedrig. Aber auch das ist normal.«
Sie tippte die Daten erneut ein, während ich mich wieder auf den Stuhl setzte. Meine Kopfschmerzen hatten zwar etwas nachgelassen, doch stattdessen war leichter Schwindel aufgekommen. Ich fühlte mich nicht gut, wollte jedoch nichts dazu sagen. Ich hoffte nur, dass die Untersuchung schnell vorbeigehen und ich bald allein sein würde.
»Zieh deinen Ärmel mal bitte hoch. Ich werde jetzt eine Dopplersonographie durchführen.«
Ich zog eine Augenbraue hoch.
»Doppel was?«
Rhonda lachte.
»Eine Dopplersonographie. Aber keine Sorge, das Ganze ist harmlos. Ich muss das nur durchführen, um deine Blutflussgeschwindigkeit zu messen.«
»Wozu?«, fragte ich nur, da das für mich irgendwie alles keinen Sinn ergab. Wozu brauchten sie alle diese Daten?
»Ich muss gucken, ob du gesund bist. Dein körperlicher Zustand muss makellos sein, damit du an unserem Projekt überhaupt teilnehmen kannst.«
»Und was, wenn ich gar nicht teilnehmen will?«
Ich hatte es langsam satt.
»Wo willst du hin?«
Rhondas Blick wurde ernster, ihr Lächeln verschwand komplett.
»Denk doch einfach an deine Familie. Du kämpfst nicht nur für dich, sondern auch für sie.«
Mir wurde klar, dass sie damit recht hatte - also fügte ich mich meinem Schicksal und zog meinen Ärmel hoch.
Sie legte ein kleines Gerät auf meine Haut und fuhr mehrmals von oben nach unten. An manchen Stellen erhöhte sie den Druck, und während sie das tat, ging ein leichtes Kribbeln durch meinen Körper. Sie nickte, tippte erneut die Daten in den Computer ein und sah mich dann wieder an.
»Jetzt müsstest du deinen Oberkörper einmal freimachen.«
Ich blickte sie skeptisch an, zog dann jedoch mein T-Shirt aus und legte es auf den Stuhl. Sie hörte mich mit einem Stethoskop ab, prüfte meinen Herzschlag und tastete meine Organe ab.
»Sieht alles okay aus. Hast du irgendwo Schmerzen?«
Ich schüttelte den Kopf. Die Kopfschmerzen hatte ich bereits erwähnt, und ansonsten gab es da nur den Schmerz, der direkt aus dem Inneren, genauer gesagt aus meiner Psyche, kam. Wie eine Welle an der Hafenmauer brandete die Ungewissheit in meinem Inneren auf und hinterließ ein lähmendes Gefühl. Als nächstes prüfte Rhonda meinen Ellenbogen, meine Kniescheibe und meine Handgelenke vorsichtig mit einem Hammer.
»Ich messe deine Reflexe. All das sind Daten, die wir in unserer Akte brauchen.«
»Und wozu braucht ihr die?«, fragte ich mal wieder.
»Das lässt sich ganz einfach erklären. Ich überprüfe damit dein vegetatives Nervensystem. Zudem kann man so auch eventuelle Asymmetrien feststellen wie zum Beispiel eine Krümmung der Wirbelsäule. Aber bei dir sieht das alles sehr gut aus. Jetzt kommt nicht mehr viel, nur noch ein kurzes EKG und ein Belastungstraining. Danach bist du fertig.«
Ich ließ das EKG über mich ergehen, ehe ich auf einem Ergometer zehn Minuten strampeln musste. Meine Kondition war super - vor wenigen Tagen war ich schließlich noch beim Basketballtraining gewesen. Und jetzt bin ich in der Antarktis bei einem Gesundheitscheck. Verdammt. Ich setzte mich auf den Stuhl.
Rhonda tippte die letzten Daten ein, druckte ein Blatt Papier aus und reichte es mir.
»Das ist für dich. Das sind deine Werte.«
Ich faltete das Blatt zusammen und steckte es mir in die Hosentasche.
»Sind wir dann fertig?«
»Noch nicht ganz.«
Sie machte eine kurze Pause.
»Abigail und Mikel haben hier viel um die Ohren. Sie wollten, dass ich dir den Tagesplan der kommenden Tage mitteile, da sie das wohl nicht so ganz schaffen. Es muss noch einiges aufgebaut werden, bevor das Projekt hier seinen Anfang nehmen kann.«
Rhonda zog ein großes Blatt Papier hervor und faltete es auseinander. Es gab dort neben einer Karte auch viel Text zu sehen, der in einzelne Stichpunkte aufgeteilt war. Auf den ersten Blick konnte ich erkennen, dass es fünf Blöcke gab, die jeweils für einen Tag standen.
»Heute ist natürlich Tag eins. Da es schon kurz nach zwanzig Uhr ist, steht dir die restliche Abendgestaltung komplett frei zur Verfügung. Du kannst dich entweder in der Basisstation umsehen, was ich dir empfehlen würde, oder, du erkundest die Umgebung draußen. Dafür habe ich dir eine Karte bereitgelegt.«
Sie reichte mir besagte Karte.
»Es gibt viele Höhlen hier in der Nähe. Ach Moment, eine Sache habe ich noch vergessen.«
Sie stand aus dem Drehstuhl auf, öffnete eine Schublade in meiner Nähe und holte eine Spritze hervor. Ich spürte, wie ich beim Anblick der spitzen Nadel eine Gänsehaut bekam… dieses Gefühl rührte aus meiner frühsten Kindheit, und ich konnte nicht mal mehr sagen, woher ich diese Abneigung hatte. Im Inneren der Spritze befand sich eine klare, violette Flüssigkeit.
»Ich muss dir noch einen neuen Aufspürer verpassen. Der erste war nicht gut dosiert gewesen. Zieh bitte nochmal deine Ärmel hoch.«
Ich tat, was sie verlangte. Es fühlte sich blöd an, alles zu hinterfragen, doch ich musste es einfach tun.
»Wozu ist das gut?«
»Ich finde deine Neugier gut. Wir… besser gesagt sie… müssen wissen, wo du dich aufhältst. Sie wollen einfach nicht das Risiko eingehen, dass du einen Fluchtversuch wagst.«
Schneller, als ich reagieren konnte, stieß Rhonda die Spritze in meinen Arm und injizierte mir den Aufspürer. Ich nahm den Stich nicht war, spürte aber, wie mir das Mittel in die Blutlaufbahn gepumpt wurde. Es fühlte sich nicht gut an, es verstärkte mein Schwindelgefühl sogar noch. Sie tupfte die Einstichstelle ab und band mir ein Pflaster um den Oberarm.
»Morgen steht etwas Wichtiges und sehr Gefährliches an. Für diesen Trip musste ich auch deinen körperlichen Zustand in Erfahrung bringen.«
Sie reichte mir ein weiteres Stück Papier.
»Du wirst gemeinsam mit Ruby, Mikel, einem Team aus Technikern und einer jungen Dame namens Paz zur Todespassage aufbrechen, einem Bereich, den wir für das große Projekt vorbereiten müssen.«
»Was kommt da auf mich zu?«
»Ich kann verstehen, dass dir in diesem Moment viele Fragen verschiedenster Art im Kopf herumschwirren.«
Es war, als würde Rhonda meine Gedanken lesen können. Ich hob meinen Blick und sah ihr tief in die Augen. Sie wirkte noch immer freundlich und einfühlsam auf mich – fast, als könne sie mich verstehen. Sollte mir das etwa Grund zur Hoffnung geben? Natürlich wusste ich, dass sie trotz allem zu denen gehörte und definitiv nicht auf meiner Seite stand. Sie war niemand, dem ich mich anvertrauen konnte – das war mir absolut bewusst.
»Deine Fragen werden sich nach und nach von selbst beantworten. Und, wenn du das Gefühl hast, dass dich jemand ungerecht behandelt, oder, wenn du dringenden Redebedarf hast, darfst du mich jederzeit anrufen.«
Sie drückte mir ein einfaches Handy in die Hand. Es war eines der Marke Nokia welches man noch mit Tasten bedienen musste. Für einen kurzen Moment gab mir diese Situation Hoffnung.
Ich könnte meine Eltern anrufen! Dennoch bremste ich mich selbst, indem ich das Gerät kurz inspizierte.
»Wo ist der Haken an der Sache?«
Rhonda betrachtete mich ernst.
»Was für ein Haken?«
»Nun ja, ich könnte Hilfe holen.«
Ihre Miene veränderte sich kein bisschen. Ihr Blick wirkte weiterhin kalt und ernst, jedoch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch mitleidig.
»Das Handy ist nur auf die Nummern zugelassen, die in den Kontakten eingespeichert sind. Es handelt sich dabei quasi um ein internes Netzwerk.«
Ich hatte mir keine großen Hoffnungen gemacht – es war zu erwarten gewesen, weshalb ich auch keine Enttäuschung verspürte. Rhonda schob ihren Stuhl zurück und bedachte mich mit einem letzten Lächeln.
»Du bist entlassen. Deine Zimmernummer ist die fünfunddreißig, du findest den Raum, wenn du die Treppe hochgehst. Wir sehen uns sicherlich in den kommenden Tagen wieder. Hier, der Zimmerschlüssel, die Karte und der Plan für die kommenden Tage, das solltest du alles mitnehmen.«
Ich verabschiedete mich von ihr, trat auf den Flur und war froh, endlich allein sein zu können. Ich trottete durch den Keller und stieg wieder die Treppe hinauf, die mich ins Erdgeschoss führte.
Ich fühlte mich vollkommen ausgelaugt, der dreizehnstündige Flug und die Tatsache, dass ich in der Nacht davor nicht lange geschlafen hatte, schlugen mir ordentlich aufs Gemüt. Jeder Schritt fühlte sich anstrengend an, und als ich ein paar Minuten später die Tür meines Zimmers hinter mir geschlossen hatte, ließ ich mich direkt aufs Bett fallen. Die Matratze war angenehm weich, doch durch das dünne Holz der Tür konnte ich das Treiben auf dem Flur genau hören. Es ging hektisch zu in der Basisstation, das war mir schon auf dem Weg zum Zimmer aufgefallen. Jeder schien seiner eigenen Aufgabe nachzugehen und sich einer sinnvollen Tätigkeit zu widmen – wenn man das, was hier vor sich ging, als sinnvoll betrachten konnte. Während ich kurze Zeit später in meinen Klamotten auf meinem Bett lag, dachte ich über das nach, was ich bereits in Erfahrung gebracht hatte. Das Hauptziel des Projektes war mir noch immer unbekannt – ich hoffe, dass sich zumindest diese Tatsache in den fünf Tagen, die ich hier in der Antarktis verbringen würde, ändern würde. Es war die quälendste Frage zurzeit. Ich nahm das Nokia-Handy aus der Tasche, öffnete es und sah mir die Kontakte an. Verschiedenste Namen standen dort – doch außer Ruby, Mikel, Abigail und Rhonda kannte ich natürlich keinen.
Ich legte es wieder weg und schenkte mir ein Glas Wasser ein.
Ich hatte seit dem Kakao im Flugzeug über dem Pazifik nichts mehr getrunken, und mit jedem kleinen Schluck kehrte ein winziges Bisschen Leben und vor allem Selbstbewusstsein in meinen Körper zurück.
Sonntag, 28. Februar 2016
Am nächsten Morgen wachte ich auf und fühlte mich besser als am gestrigen Abend. Die Kopfschmerzen waren verschwunden und ich fühlte mich ausgeschlafen. Draußen war es taghell, ich vermutete, dass der Vormittag bereits angebrochen war. Ein Blick auf die Wanduhr verriet mir, dass es kurz nach neun war.
Da mir relativ schnell langweilig wurde, entschied ich mich, nachdem ich duschen war und mich frisch gemacht hatte, dazu, die Basisstation zu erkunden. Zudem knurrte mein Magen, und ich beschloss, etwas zu frühstücken – wenn ich denn die Möglichkeit dazu bekommen würde. Da auf dem Tagesplan, den Rhonda mir ausgehändigt hatte, keine genaue Uhrzeit draufstand, zu der wir die Mission in der sogenannten Todespassage beginnen würden, steckte ich mein Handy einfach ein und verließ den Raum. Ich schloss zwei Mal ab, steckte den Schlüssel in die Tasche meiner Hose und schlug den Weg ins Erdgeschoss ein. Auf dem Gang roch es nach einer Mischung aus frischgebackenem Brot und dampfenden Kaffee, was mein Hungergefühl noch verstärkte. Ich folgte dem Geruch und hatte am Ende des Ganges schließlich eine Art Kantine erreicht. Hinter einem Vorhang waren laute Stimmen zu hören, und ich wog kurz ab, ob ich nicht doch lieber etwas warten sollte. Ich wollte jetzt nicht unter Menschen gehen, es würde mir einfach nicht guttun, das wusste ich. Vorallem nicht unter Menschen, die eine unsichtbare Maske trugen und darunter ihre grausame Persönlichkeit verbargen. Letztendlich siegte der Hunger, und ich wagte mich durch den Vorhang und schritt auf das Buffet zu. Neben zwei Scheiben Vollkornbrot legte ich mir ein Ei, eine Scheibe Schinken und Wurst auf den Teller. Ich setzte mich auf einen Platz am Fenster und wollte die Mahlzeit schnell hinter mich bringen.
Niemand der Anwesenden wandte mir große Aufmerksamkeit zu, sie nahmen mich, wenn überhaupt, höchstens zur Kenntnis.
Das war mir jedoch auch ganz recht. Ich nahm einen Bissen und genoss den geräucherten, salzigen Geschmack des Schinkens.
Das Vollkornbrot war noch warm und schmeckte gut. So verging die Zeit, ich warf einen Blick aus dem Fenster und sah, dass es leicht zu schneien begonnen hatte. Der Ausblick war zugegebenermaßen atemberaubend. Direkt vor den riesigen Bergen, deren Spitzen hunderte Meter weit in den Himmel ragten, erkannte ich ein relativ großes, abgegrenztes Areal. Ein Maschendrahtzaun zog sich um eine Fläche aus Eis. Innerhalb des besagten Areals konnte ich von meiner Position aus drei schwarze Düsenjets ausmachen. Ich nahm einen weiteren Bissen Vollkornbrot und nahm mir vor, das nach dem Frühstück näher zu betrachten. Die Jets waren das Interessanteste, was ich bisher gesehen hatte – ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben einen in unmittelbarer Nähe gesehen. Ich ließ den Teller stehen und wollte gerade den Weg nach draußen antreten, als ich merkte, dass ich meine Jacke vergessen hatte. Genervt suchte ich mein Zimmer erneut auf, zog meine Winterklamotten an und verließ die Basisstation. Kalter Wind wehte mir Schneeflocken auf meine Gesichtshaut, und nach wenigen Sekunden fühlte sich diese bereits taub an. Ich biss auf die Zähne und kämpfte mich durch den Neuschnee nach vorne in Richtung des Areals. Aus der Ferne hatten die Jets fast klein gewirkt, je näher ich den Maschinen nun kam, desto gigantischer wurden sie.
»Hallo, Jonas.«
Ich vernahm eine Stimme hinter mir und drehte mich um. Es handelte sich um Mikel. Ich blieb stehen, er kam auf mich zu und ich wartete, bis er mich erreicht hatte.
»Wie geht es dir?«
Ich wunderte mich, warum so viele an meinem körperlichen Befinden interessiert waren. Rhonda gegenüber war ich unehrlich gewesen - das wollte ich bei Mikel nicht sein, da ich für ihn keinerlei Sympathien aufbringen konnte.
»Beschissen.«
»Ich bin mir sicher, du wirst mit den Begebenheiten nach und nach besser klarkommen und dich daran gewöhnen.«
Ich wollte ihm nicht antworten, da ich die Wut, die in meinem Inneren nach und nach aufgestiegen war, nicht unter Kontrolle hatte. Ich wollte einfach keinen Fehler begehen und hielt meinen Mund.
»Komm, ich zeige dir unseren Hangar.«
Ich folgte ihm. Als wir das eingezäunte Areal erreicht hatten, öffnete er eine Pforte im Zaun und führte mich hinein. Ein freigeräumter Weg, der aus Pflastersteinen gebaut war, führte uns zu den Düsenjets. Je näher ich den Maschinen kam, desto mehr Respekt empfand ich für sie. Auf schwarzem Untergrund prangte das Logo der Organisation, weiße Streifen zierten die Flügel.