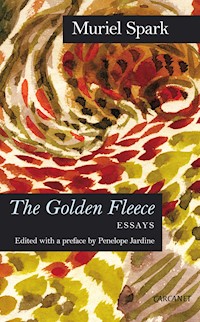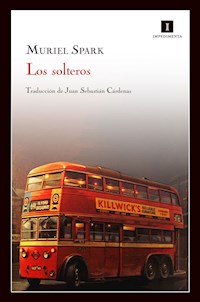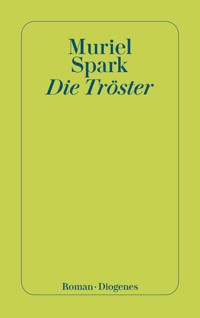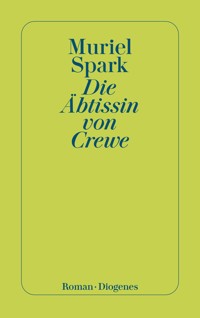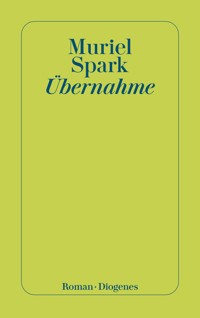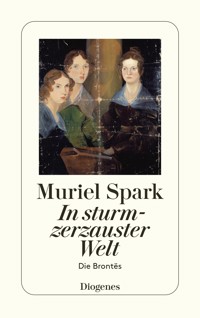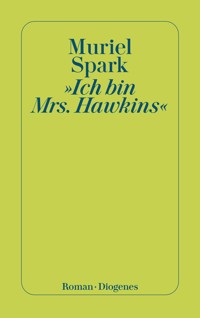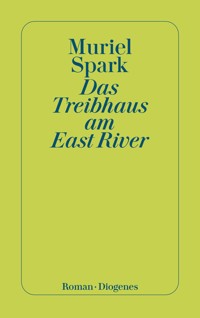7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Den Vorsatz, Schriftstellerin zu werden, faßte Muriel Spark sehr früh: Gedichte schrieb sie schon als junges Mädchen, später Studien über andere Schriftstellerleben. Für die eigenen Romane aber galt es zunächst, Erfahrungen zu sammeln. Welche Begebenheiten den Anstoß zu ihren Geschichten gaben, zeichnet ›Curriculum Vitae‹ nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Muriel Spark
Curriculum Vitae
Selbstportrait der Künstlerin als junge Frau
Aus dem Englischen von Otto Bayer
Diogenes
Vorbemerkung
Ich bin eine Sammlerin, die zweierlei bewahrt: Dokumente und vertraute Freunde. Erstere überwiegen letztere an Quantität, doch letztere übertreffen erstere an Qualität.
Mich faszinieren Details. Ich sammle für mein Leben gern Details. Auch Namen haben für mich ihren Zauber, mögen sie noch so wenig klangvoll sein. Die meisten Namen, die in dem nachstehenden Bericht über die ersten neununddreißig Jahre meines Lebens vorkommen, sind der Öffentlichkeit unbekannt. Aus demselben Grunde sind sie mir um so kostbarer.
Seit ich einen bekannten Namen habe, ist soviel Wunderliches und Falsches über Teile meines Lebens geschrieben worden, daß ich es an der Zeit fand, einiges davon richtigzustellen.
Ich nahm mir vor, nichts zu schreiben, was nicht durch Dokumente belegt oder von Augenzeugen bestätigt werden kann; auf mein Gedächtnis allein wollte ich mich nicht verlassen, und sei die Erinnerung noch so lebhaft. Das Ärgerliche an unwahren oder irrigen Behauptungen ist, daß wohlmeinende Scholaren dazu neigen, einander nachzuplappern. Lügen sind wie Flöhe, sie hüpfen hierhin und dorthin und saugen dem Verstand das Blut ab. In meinem Fall ist die Wahrheit oft weniger schmeichelhaft, weniger romantisch, oft aber doch interessanter als die Legende. Die Wahrheit an sich ist neutral und hat ihre eigene Schönheit; man sollte ihr vor allem in den Werken die Ehre erweisen, die keinen fiktiven Charakter haben. Falsche Angaben führen zu falschen Voraussetzungen und diese wiederum zu falschen Schlüssen. Gehört es sich gegenüber Literaturwissenschaftlern und ihren Studenten, sie auch nur in Nebensächlichkeiten in die Irre zu schicken? Die Verfasserin einer kürzlich erschienenen Biographie, in der sie anläßlich eines nachweisbar nie stattgefundenen Ereignisses etwas Falsches über mich berichtet hatte, gab sich verwundert über meinen Einspruch. Nach ihrem Verständnis zeigte ihr Szenarium mich doch »in einem guten Licht«. Aber selbst wenn, es stimmte eben nicht. Ich trat darin als strahlende Gastgeberin zu einer Zeit auf, als ich noch kaum bekannt und sehr arm war (und man läßt seiner früheren Armut nicht spotten). Unter meinen »Gästen« befanden sich zwei wohlbekannte Persönlichkeiten, die ich zur fraglichen Zeit noch gar nicht kannte. Welcher Schaden denn durch diese Lüge entstehe, wollte die Biographin wissen. Schaden! Die Lebensläufe dreier Menschen, meiner und zwei andere, wurden in Abschnitten verfälscht. Viel schlimmer als jeder persönliche Schaden ist jedoch der Schaden, den man damit der Wahrheit und der Wissenschaft zufügt.
Das obige Beispiel für verantwortungslose Berichterstattung ist nur eines; es kann der Literaturgeschichte nur abträglich sein. Und ich bin sicher, daß viele Biographien meiner erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen ähnliche Mängel aufweisen.
Für meine frühe Jugend ist die beste Informations- und Bestätigungsquelle mein Bruder Philip Camberg, der immerhin fünfeinhalb Jahre älter ist als ich und sich daher genauer an Namen, Orte, Daten und Fakten erinnert (eine Kindheitserinnerung aus dem vierten Lebensjahr ist nun einmal verläßlicher, wenn ein damals Neuneinhalbjähriger dieses Wissen und Erleben teilt). Mein Bruder, der als inzwischen pensionierter Chemiker in den USA lebt, hat sich mit großem Eifer bereit gefunden, meine Kindheitserinnerungen zu überprüfen.
Ebenso hat meine Kusine Violet Caro mir geholfen, meine frühen Erinnerungen zu bestätigen, und mein jüngerer Vetter Martin Uezzell hat sich die große Mühe gemacht, Einzelheiten aus der Familiengeschichte auszugraben. Mein Sohn Robin Spark hat mir noch einige Familienfotos besorgt, die das vervollständigen, was mein Bruder Philip mir geschickt hat.
Als im New Yorker erstmals Teile meiner Kindheitserlebnisse erschienen, meldeten sich zu meiner Freude viele Leute, die das Geschriebene bestätigten, präzisierten oder ergänzten. Es waren Augenzeugen oder deren Kinder. Zu meinen treuesten Korrespondentinnen gehört Barbara Below, Tochter jenes »Professor Rule«, eines Freundes meiner Eltern, der meine Phantasie sehr beschäftigte, als ich zwischen drei und vier Jahre alt war, und dessen Frau Charlotte mir Lesen und Schreiben beibrachte. Mrs. Below hat sich die endlose Mühe gemacht, Ereignisse und Daten nachzuprüfen, und mir das bezaubernde Foto von Charlotte Rule beschafft, das in diesem Buch abgebildet ist.
Und was hätte ich ohne die Hilfe meines Freundes Ian Barr und meiner Klassenkameradinnen mit meiner Schulzeit in Edinburgh angefangen? Ian Barr, inzwischen im Ruhestand, ist ein Gelehrter und Denker mit den großen Gaben der Warmherzigkeit und Unterhaltsamkeit; unermüdlich hat er mir Daten aus schwierigen Quellen besorgt. Ian Barr war nach echter schottischer Art ein junger Postbeamter, ehe er zum Vorsitzenden des Postverwaltungsrats aufstieg; so viele Jahre später konnte er sich noch immer an die Edinburgher Adresse meiner Eltern erinnern, wohin die vielen Telegramme und Sonderbotschaften gingen. Und meine Klassenkameradinnen: Frances Niven (jetzt Cowell), meine beste Freundin von damals, hat mir an allen Ecken und Enden geholfen, nicht nur mit ergänzenden Fakten, sondern auch mit dem Zuspruch einer alten, tiefen Freundschaft. Ich danke Cathie Davie (jetzt Semeonoff), die mir mit ihren unschätzbaren Erinnerungen an die Bruntsfield Links aushalf, in denen wir in unserer Jugend oft spazierengingen. Sehr herzlich danke ich Elizabeth Vance, deren Briefe mich sehr erheitert und bestärkt haben; ich zitiere aus ihren lebendigen Impressionen von unserem Leben an der James-Gillespie-Schule. Für weitere Anekdoten und lustige Erinnerungen an unsere Schulzeit danke ich Dorothy Forrester und Dorothy Forrest (jetzt Rankine).
Aus den Jahren ab 1940 besitze ich den größten Schatz an Briefen und anderen Dokumenten, und ich danke meiner ständigen Helferin und Gefährtin Penelope Jardine für das tiefe Interesse, mit dem sie dieses Archiv in den letzten vierundzwanzig Jahren gepflegt hat. Ich verdanke es ihrem intelligenten Ordnungs- und Verweissystem, daß ich jederzeit die Papiere finde, die ich sowohl zur Anregung wie zur Bestätigung meiner Erinnerungen an die Vergangenheit gerade brauche. Dank ihrem Humor konnte ich die Aufgabe, die mich anfangs schreckte, schließlich sogar genießen. Penelope Jardine schulde ich auch Dank dafür, daß ich die Zimmer ihres großen Hauses benutzen durfte, in denen sie diese Zettelsammlung zusammenstellte, ordnete und aufbewahrte.
Die vorliegenden Erinnerungen führen bis in das Jahr 1957, als ich meinen ersten Roman veröffentlichte. Berühmte Namen tauchen in diesem Abschnitt meines Lebens kaum auf, und doch war er reich und ausgefüllt. Ich hoffe, ein Bild von meinem Werdegang zur Schriftstellerin gezeichnet zu haben.
Ich hatte einmal eine Freundin in Rom, die alte Lady Berkeley (Molly), die ich manchmal in ihrer Wohnung im Palazzo Borghese besuchte. Molly lebte stilvoll. Wenn ich sie über die Vergangenheit ausfragte, von der sie gern sprach, schickte sie den Butler nach ihrem Familientagebuch, um die Fakten nachzuprüfen. Diese Idee fand ich ausgezeichnet. Wir sollten vielleicht alle unsere Erlebnisse niederschreiben, um auf unsere alten Tage nicht von der Wahrheit abzuirren.
Ich habe schon viele kleine autobiographische Abhandlungen verfaßt. Was ich da beim Schreiben und während der Arbeit an diesem Buch empfand, war das Gefühl einer vertieften Kenntnis meiner selbst. »Wer bin ich?« ist stets eine Frage für Dichter. Einmal bekam ich zu Beginn meiner Laufbahn den Auftrag, ein Theaterstück zu schreiben. Eines Abends lernte ich den Produzenten kennen, als ich den ersten Akt bei ihm ablieferte. Tags darauf kam ein Telegramm: »Darling, genau das hatten wir uns erhofft. Rufen Sie mich morgen früh um zehn an, Darling.« Gehorsam rief ich am nächsten Morgen um zehn an und nannte der Sekretärin meinen Namen. Dann meldete er sich. Ich wiederholte meinen Namen. »Und wer sind Sie, Darling?« fragte er.
Eine sehr gute Frage, fand ich damals – und finde ich heute noch. Vor all den vielen Jahren nahm ich mir vor, später einmal meine Autobiographie zu schreiben, die mir und anderem bei der Klärung der Frage helfen soll: Wer bin ich?
Zu ganz besonderem Dank bin ich dem New Yorker verpflichtet, auf dessen Seiten schon etliche der nun folgenden Kapitel erschienen sind.
Außer den bisher genannten Freunden und Verwandten, in deren Dankesschuld ich stehe, möchte ich folgenden Personen und Institutionen für die nützlichen Informationen, die sie mir bereitwillig gaben, sowie für ihr unverdrossenes Eingehen auf meine Fragen danken:
Honorable Peter Action; dem British Council, Rom; dem British Institute, Florenz; Mr. Robert L. Bates; Mr. Alan S. Bell von der Rhodes House Library; Mr. Nigel Billen; Mr. Terence C. Charman vom Imperial War Museum in London; Mr. Bill Denholm; Mr. John Dunlap von der Royal Mail in Edinburgh; Ms. Mary Durham; Mr. Tom Erhardt von Casarotto Ramsay Ltd.; Mr. Howard Gerwing von der Bibliothek der University of Victoria in British Columbia; Professor John Glavin; Mr. Chris Green von der Poetry Society in London; Ms. Jean Guild; Ms. Cathy Henderson und Ms. Sally Leach von der Harry Ransom Research Library der University of Texas in Austin; Mr. Hardwicke Holderness; Mr. Peter Hutcheon; Richter Don W. Kennedy; Professor D.R.B. Kimbell von der Musikfakultät der University of Edinburgh; der Merchant Company of Edinburgh; Mr. Charles McGrath und den Archivaren des New Yorker; der McLellan-Galerie in Glasgow; Mr. Michael Olver; Mr. Leslie A. Perowne; Mr. Terence Ranger vom St.-Anthony’s-College in Oxford; Mr. Kevin Ray von der Washington-University St. Louis in Missouri; Mr. Colin Smith vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischfang und Ernährung; Dr. Jay Snyder; Mr. Tony Strachan; Honorable Guy Strutt; Mr. Alan Taylor von Scotland on Sunday; M. Alain Vidal-Naquet; Mr. Auberon Waugh; Mr. Gerald Weiss; Mr. Anthony Whittome und Ms. Joan Winterkorn.
Oliveto, 1992
Muriel Spark
1
Brot, Butter und Florrie Forde
Immer wenn ich an meine glanzvolle Kindheit zurückzudenken versuche, sehe ich da und dort ein Stückchen durchschimmern, nie aber in der chronologischen Reihenfolge wie die Erinnerungen an meine späteren Jahre. Meine Kindheit in Edinburgh, soweit mein Gedächtnis zurückreicht (also in die Zeit vom dritten oder vierten Lebensjahr bis Schulbeginn), erscheint mir in hellen Blitzen, die mir die jeweilige Szene detailgenau ausleuchten. Es wäre eine Verfälschung, wenn ich versuchen wollte, die ersten Jahre meines Lebens in eine zusammenhängende Erzählung zu bringen.
Ich wurde 1918 in Edinburgh geboren, 160 Bruntsfield Place, Morningside.
Brot
Brot kam aus der Bäckerei Howden, das heißt aus dem Laden über den Öfen, in denen es gebacken wurde. Das Straßenpflaster vor dem Laden war warm, und aus dem Gitterrost neben dem Eingang strömte heiße Luft. Der mehlige Bäcker und sein Lehrjunge (nicht unfreundlich »der dumme Junge« genannt, denn er war von schlichtem Gemüt) waren von oben bis unten weiß, der Bäcker trug eine weiße Mütze, die oben flach war wie eine umgedrehte Pastetenform, und der Junge hatte ebenfalls eine flache Mütze auf; sie trugen darauf die Tröge mit Brot. Wenn sie mit diesen Trögen nach oben in den Laden kamen, waren ihre Gesichter und Hände und Overalls ganz weiß und ihre Schuhe mit Mehl bestäubt.
Brot gab es in vielerlei Formen, die wir High Pan, Square Pan und Cottage Loaf nannten. Von den beiden ersten konnte man je nach Bedarf einen halben oder ganzen Laib kaufen. High Pan war rechteckig und oben gewölbt, und wenn man die Scheiben diagonal durchschnitt und mit Marmelade bestrich, waren sie genau das Richtige zum Nachmittagstee. Square Pan eignete sich gut für den Lunch, den man zur Arbeit oder in die Schule mitnahm. Es machte sich auch gut als Frühstückstoast. Ein Cottage Loaf sah aus wie eine Kapelle mit Kuppeldach und einem kleinen quadratischen Anbau. Auf dem Tisch war es sehr dekorativ.
Morgens holte man vom Bäcker warme runde Brötchen, mit Mehl bestäubt, aber auch Kleieküchlein, die dreieckig und aus braunem Mehl waren – sehr kernig und gut für die Gesundheit. Noch gesünder war dreieckiger Haferzwieback. Nachmittags kamen frische Sachen vom Bäcker, manchmal Sally Lunns, ein Gebäck mit Korinthen und Rosinen. In Edinburgh aß man zum Tee am liebsten Shearer’s Bap – »Schnitterbrötchen«, denn in Schottland ist das Brötchen ein bap und der Bäcker ein bapper – ganz flach und warm. Sodabrötchen wurden im allgemeinen zu Hause gebacken, aber Bäcker Howden machte nachmittags auch mit diesen kleinen, scharf schmeckenden Teigklumpen, die nach Butter dürsteten, ein gutes Geschäft.
Butter
Butter kam von der Molkerei Buttercup – »Butterblume«.
Ein Mädchen mit rosigweißem Teint, einer Mütze über den Haaren und blütenweißem Overall, im Winter unter strahlenden Lampen, stand hinter einer Theke mit Marmorplatte, neben sich zwei riesige Butterklumpen, die ihr bis zu den Schultern reichten. Der eine Klumpen war frische Butter, der andere gesalzene. Gesalzene Butter war billiger, und manche Leute mochten sie lieber. Frische Butter kam jeden Morgen direkt von der Farm. Das rosigweiße Mädchen nahm ein Blatt Fettpapier und legte es auf die messingblinkende Waage. Dann nahm sie zwei große hölzerne Butterkellen, eine in jede Hand. Bevor sie das gewünschte halbe oder ganze Pfund Butter damit abteilte, tauchte sie die Kellen in eine blauweiße Porzellanschüssel mit kaltem Wasser. Dann legte sie die Butterklumpen mit den Kellen geschickt auf die Waage, klaubte etwas ab wie der Töpfer vom Ton oder klebte ein Stückchen an, bis das geforderte Gewicht erreicht war. Und dann kam der spannendste Teil: Das Mädchen legte die Butter mitsamt dem Papier auf die Theke, zerteilte sie, alles nur mit den Kellen, in Würfel von etwa einem viertel Pfund und formte die Würfel flink zu je einer dicken, kreisrunden Scheibe. Zuletzt nahm sie den hölzernen Butterstempel, und nachdem sie auch diesen zuerst ins Wasser getaucht hatte, ließ sie ihn laut je einmal auf die Buttermedaillons klatschen. Jede Butterscheibe trug daraufhin um den Rand die Worte »Buttercup Dairy Company«, und in der Mitte kniete ein kleines Mädchen neben einer freundlichen Kuh und hielt ihr eine Butterblume unters Kinn. (Das spielte auf einen Kinderbrauch an, bei dem man einander eine Butterblume unters Kinn hielt und fragte: »Magst du Butter?« Wenn die Haut einen schwachen gelben Schimmer zurückwarf, hieß das »ja«. Ich kann mich nicht erinnern, daß die Antwort jemals »nein« gelautet hätte.) Und dieser ganze Butterzauber dauerte nur einen Lidschlag.
Von der »Butterblume«, wie wir den Laden nannten, bezogen wir auch Eier verschiedener Güte. Frischgelegte Eier eigneten sich am besten zum Frühstück, aber konservierte, im Wasserglas eingelegte Eier waren billiger und genügten vollauf zum Kuchenbacken. Eines Tages legte die »Butterblume« sich einen faszinierenden Eierdurchleuchter zu. Darauf wurde jedes einzelne Ei vor dem Verkauf gelegt, um seine Frische zu beweisen. Wenn das Innere des Eis aufleuchtete und das Licht durchschien, war das Ei gut. Ein schlechtes Ei wäre dunkel geblieben, aber ich habe nie eines gesehen.
Bevor man den Laden (wie überhaupt jeden Laden) verließ, zählte man sein Wechselgeld genau nach, damit kein Irrtum passierte, und die Verkäuferin, die einen bedient hatte, sah einem dabei sehr aufmerksam zu.
An die »Butterblume« dachte ich immer bei Robert Louis Stevensons Versen aus meiner frühesten Kindheit:
One morning, very early, before the sun was up,
I rose and found the shiny dew on every buttercup.
(Des Morgens in der Frühe, noch eh die Sonn’ aufging,
an jeder Butterblume ein glitzernd’ Tröpfchen hing.)
Die funkelnde Morgenfrische dieses Ladens mit der jungen Butterzauberin prägte sich mir als ein Bild ein, das mich durch meine ganze Jugend begleitete.
Tee
Sechzig Jahre sind in der Geschichte eine kurze Zeit. Vor dieser kurzen Zeit pflegte ich mindestens einmal täglich für die Familie eine Kanne Tee zu machen. Es war köstlicher Tee. Jedes Schulmädchen, jeder Schuljunge verstand so einen exquisiten Tee zu machen.
Man setzte den Kessel mit Wasser auf, und kurz bevor es kochte, füllte man die Teekanne zur Hälfte, um sie zu wärmen. Wenn das Wasser dann kochte, leerte man die Teekanne wieder und tat einen gestrichenen Meßlöffel Tee pro Person und einen für die Kanne hinein. Bis zu vier Löffel Tee aus dieser süß duftenden Dose ergaben eine vollkommene Kanne Tee. Der Löffel hatte eine spezielle Form, wie eine kleine silberne Schaufel. Man trug nie den Kessel zur Kanne, sondern immer die Kanne zum Kessel, wo man sie füllte, aber nie bis zum Rand.
Dann ließ man den Tee drei Minuten »ziehen«.
Die Teetassen hatten aus Porzellan zu sein, so dünn, wie man es sich leisten konnte. Sonst ging das Aroma verloren.
Milch tat man gerade soviel hinein, daß sie die klare Flüssigkeit trübte, und wenn man »süß« war, auch Zukker. Zucker ja oder nein, das war das einzige, worüber man selbst entscheiden durfte.
Jedem, der ins Haus kam, wurde eine Tasse Tee angeboten, genau wie bei Dostojewski. Nach welcher Methode er den Tee braute, weiß ich nicht. (Tee aus dem Samowar muß etwas anderes gewesen sein, bestimmt ohne Milch, und gereicht in einem Glas, das in einem Messing- oder Silberhalter steckte.)
Tee um fünf Uhr war eine Sache für Besucher. Zuerst aß man Brot und Butter und ging dann zu Kuchen und Keksen über. Um fünf Uhr »trank« man Tee. Tee um sechs wurde »eingenommen«.
Tee um halb sieben hieß High tea und war eine volle Mahlzeit, ähnlich dem Frühstück. Man aß dazu Räucherhering, geräucherten Schellfisch (smokies), gekochten Schinken, Eier oder Würstchen. Kartoffeln gehörten nicht zu dieser Mahlzeit. Aber eine Kanne Tee mit Brot, Butter und Marmelade war immer Teil davon.
Tante Gertie und Florrie Forde
»Die Engländer« im Edinburgh meiner Kindheit galten als oberflächlich und scheinheilig. Und aufgedonnert. Meine Mutter, die Engländerin war, holte mich immer von der Schule ab. Es war meine tägliche Angst, daß sie den Mund aufmachen und ihre dubiose Herkunft verraten könnte. »Ausländer« wurden einigermaßen toleriert, aber »die Engländer« waren etwas völlig anderes. Nicht nur seine Aussprache verriet den Engländer, auch Ausdrucksweise und Redewendungen. Eines Tages hörte ich meine Mutter vor der Schule zu einer anderen Mutter sagen: »I have some shopping to do« (ich muß noch einkaufen gehen). Ich wäre fast gestorben. Sie hätte sagen sollen: »I’ve got to get the messages« (ich muß die Besorgungen holen). Jawohl, das hätte sie sagen sollen. Meine Mutter trug auch einen Wintermantel, der mit beigem Fuchspelz besetzt war, wie die damalige Herzogin von York und jetzige Königinmutter (die noch immer in aller Erhabenheit solche fuchsbesetzten Mäntel trägt). Das war völlig fehl am Platz. Meine Mutter hätte Tweed oder bei sehr großer Kälte Bisam tragen sollen. Sie trug auch pfirsichfarbene Seiden- oder Rayonstrümpfe, wo es graues Florgarn hätte sein müssen. Nur dank der ungezwungenen Liebenswürdigkeit, mit der sie jedem begegnete, den sie traf, kam sie so gerade noch durch die Zensur. Sie war glücklich, wenn sie mit Menschen zu tun hatte. Vor meiner Geburt war sie Klavierlehrerin gewesen. Ich besitze noch das Messingschild, auf dem das steht.
Mein Vater sprach mit starkem Edinburgher Tonfall, und obwohl er Jude war, Sohn schottisch-jüdischer Eltern, geboren und aufgewachsen in Edinburgh, kleidete er sich genauso wie andere Väter und redete nicht nur wie sie, sondern auch über die gleichen Themen. Er war also kein Problem. Ingenieur war er. Ich besitze noch den Vertrag über seine siebenjährige Lehrzeit, in der Schönschrift eines Schuljungen unterzeichnet mit »Bertie Camberg«.
»Schotte oder Engländer?« hieß ein Spiel, das rauhbeinige Jungen spielten. Sie banden einen Stein an eine Schnur und wirbelten ihn herum, wobei sie andere Jungen mit der Herausforderung angingen: »Bist du Schotte oder Engländer?« Man antwortete darauf unabänderlich: »Engländer« und rannte schnell weg. Sinn des Spiels war die Verfolgungsjagd und der abschließende Steinwurf. Wirkliche englische Jungen waren daran nie beteiligt.
Eine andere Version des Spiels hieß »Schotte oder Ire?«. Worauf beide zurückgingen, nannte Wordsworth einmal
… alte, unsel’ge, ferne Dinge
und längst vergangene Schlachten.
In einem alten Erinnerungsbuch (Mary Somerville, herausgegeben 1873 von ihrer Tochter Martha Somerville) erinnert die Mutter der Autorin an ein Spiel aus ihrer Kindheit, etwa um 1788, das »Schotte und Engländer« hieß und »einen Überfall auf umstrittenes Land darstellte, das Grenzland zwischen Schottland und England, wobei jede Partei die Spielsachen der anderen zu rauben versuchte. Die kleineren Mädchen mußten zwangsweise immer die Engländer spielen, denn die größeren hätten das allzu erniedrigend gefunden«.
Wenn ich zu Hause im Bad einmal das Wasser nicht abstellte, sagte meine Mutter: »Turn off the tap« (dreh den Hahn zu), während die entsprechende Anweisung meines Vaters lautete: »Turn off the well« (stell den Brunnen ab).
Brunnen statt Wasserhahn sagten auch seine jüngere Schwester, meine Tante Gertie, und ebenso unsere gottesfürchtigen Nachbarn. Tante Gertie wohnte eine Zeitlang bei uns. Wenn sie mit Freunden ausging, zog sie ein marineblaues Kostüm mit kurzem Rock an und setzte einen kirschroten Hut auf, der ihren Bubikopf eng umschloß. Die Mehrzahl ihrer Verehrer waren für sie nur Objekte der Belustigung, und wenn sie wiederkam, ergötzte sie uns mit witzigen Anekdoten. Einmal war einer mit ihr zu einer besonders schönen Aussicht gefahren, und Tante Gertie hatte in ihrer lebhaften Art gerufen: »Wie malehrisch!« Worauf ihr Freund ernst zurückfragte: »Ach, wird das so ausgesprochen?«
Wir lachten zu Hause viel über andere, und ich lernte die Kunst, höflich zu bleiben, solange die Leute da waren, und erst hinterher zu lachen, sofern es etwas zu lachen gab, oder Kritik zu üben, falls es etwas zu kritisieren gab. Ich muß damals fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Manche Leute hatten bei uns einen Spitznamen. Wie andere Goldklümpchen aus meiner frühen Kindheit funkeln sie noch heute in meinem Gemüt, obwohl ich oft gar nicht mehr weiß, wer die Leute waren, denen wir die Spitznamen anhängten. Die Freundin einer Freundin, der meine Mutter und ich oft auf dem Putting Green der Bruntsfield Links begegneten, hieß bei uns nur »Sonnenscheinchen«. Sie wohnte bei einem mit meinen Eltern bekannten Ehepaar; der Mann hatte ihnen versichert, die Dame sei ein richtiges »Sonnenscheinchen«. In Wirklichkeit sah sie immer furchtbar verkniffen aus, wenn sie sich krampfhaft bemühte, ihren Ball einzulochen. »Wir haben heute Sonnenscheinchen getroffen«, erzählte meine Mutter lachend meinem Vater, wenn wir zum Tee nach Hause kamen.
Ich hatte einen Puppenwagen bekommen, einen für Zwillinge, mit je einem Klappverdeck an beiden Enden. Meine Puppen, Red Rosie und Queenie, saßen darin einander gegenüber. Ich erinnere mich, daß ich eines Tages aus irgendeinem Grund heulte und brüllte. Mein Vater holte ein Handtuch, wischte meinen Puppen damit die Gesichter ab und redete ihnen zu, sie sollten doch nicht weinen. Ich war von seinem Auftritt so fasziniert, daß ich zu weinen aufhörte, und ich erinnere mich noch genau an so ein unbestimmtes Gefühl, das in Worte gefaßt etwa so gelautet hätte: »Der Trick beeindruckt mich überhaupt nicht, aber er ist doch ein hervorragender Kinderpsychologe!«
Etwa im Jahr 1923 muß es gewesen sein, kurz bevor ich in die Schule kam, daß ich meine erste Theatervorstellung besuchte, eine Matinée im Lyceum. Es muß ein Feiertag gewesen sein, denn Tante Gertie und mein Vater waren beide nicht zur Arbeit gegangen. Vielmehr ließen meine Eltern mich in Tante Gerties Obhut zurück und fuhren frohgemut zum Pferderennen nach Musselburgh. Vermutlich hatten sie meinen Bruder, der fünfeinhalb Jahre älter war als ich, mitgenommen oder woandershin geschickt. Jedenfalls waren Tante Gertie und ich allein. Wir nahmen unsern Lunch ein, der für uns »Dinner« war. Dann zog sie mir meine schönsten Sachen an – sie selbst war hübsch anzusehen in ihrem kirschroten Hut und kniefreien Rock – und nahm mich mit »zu Florrie Forde«.
Florrie Forde war eine Variétékünstlerin. Das Haus war zum Bersten voll. Ich war noch nie in so einem riesengroßen Raum mit so vielen Leuten gewesen, die auf Rängen über Rängen saßen. Der Vorhang ging hoch, und auf der Bühne erschien Miss Forde, eine dralle Figur im einteiligen Anzug, ähnlich den heutigen Trikotanzügen, und überladen mit goldbronzenem Flitter.
Es gab donnernden Applaus. Applaus war ich ja eigentlich gewohnt, denn meine Eltern veranstalteten oft »Musikabende«, an denen meine Mutter Klavier spielte und mein Vater ›Forever and Forever‹ sang; oder meine Mutter sang selbst ›Rose in the Bud‹; bei solchen Gelegenheiten klatschten unsere Gäste am Ende immer freundlich Beifall. Aber was da unten auf der Bühne in aller Öffentlichkeit mit Florrie Forde geschah, war derart unverblümt, daß ich nur staunen konnte, wie sie es nur machte, und sichtlich ohne verlegen zu werden.
Sie benahm sich, als ob sie auf dieser Bühne bei sich zu Hause wäre. Andere kamen auf die Bühne und gingen wieder, Männer in Abendanzügen vor allem, aber Florrie in ihrem Flitter dominierte das ganze große Haus. Sie sang zur Begleitung einer Kapelle und tanzte dazu. Nur eine ihrer Nummern ist mir im Gedächtnis geblieben. Da rekelte Miss Forde sich glitzernd mitten auf der Bühne neben einem riesengroßen Radio mit lauter bunt leuchtenden »Röhren«, die aussahen wie Glühbirnen. Radios mit Röhren waren in unseren Kreisen ein Luxus. Mein Bruder hatte erst kürzlich ein Radio gebaut, das mit einem »Kristall« funktionierte, einem unebenen Klumpen aus glänzendem Metall, sowie mit einem dünnen Draht, dem »Schnurrhaar«. Es war ein furchteinflößend komplizierter Apparat; wenn man sich Kopfhörer (dreißig Shilling) aufsetzte und den Kristall durch sanftes Streichen mit dem Schnurrhaar »einstimmte«, bekam man wacklig die BBC aus London ins Haus. Ein Radio mit »Röhren« (was damit auch immer gemeint war) lag damals außerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten.
Bei Florrie Forde war das wohl anders. Sie saß, auf einen Ellbogen gestützt, gemütlich zurückgelehnt und spielte mit der anderen Hand an den Knöpfen ihres prunkvollen Radios; dabei sang sie eine getragene Melodie: ›Dream, Daddy‹.
Tante Gertie und ich waren wieder zu Hause, bevor meine Eltern vom Rennen zurückkamen, und hatten den Küchentisch zum Teetrinken gedeckt. Wir hatten uns noch nicht gesetzt, als meine Eltern von nichts anderem als den Pferden zu reden begannen, welches gesiegt hatte und welches – mit den Worten meines Vaters – »noch im Kommen« war. Und was hatten wir denn heute so getrieben?
»Wir waren bei Florrie Forde«, sagte Tante Gertie, was meine Eltern so erheiterte, daß meine Tante mich nur mit fast kindlich staunenden Augen ansehen konnte. Meine Eltern kriegten sich vor Lachen gar nicht mehr ein. »Gertie war mit ihr bei Florrie Forde!« prustete meine Mutter endlich los.
»Die lachen sich noch mal tot«, flüsterte meine Tante.
Und warum sie da in der Küche standen und lachten und einander vor Heiterkeit in die Arme fielen, wußte ich nicht und werde ich wohl auch nie wissen.
Mrs. Rule, Fish Jean und der Kaiser
Seit meiner frühesten Jugend, soweit ich mich noch an sie erinnern kann, hat mich schon immer das Miteinander von Menschen fasziniert. Ich wüßte nicht, daß ich zu irgendeinem Zeitpunkt keine Menschenbeobachterin gewesen wäre, keine Behavioristin. Und ich war eine unersättliche Zuhörerin. Es will mir so vorkommen, als ob die Freunde meiner Eltern und andere Leute, die uns in unserer kleinen Wohnung besuchten, endlos viele gewesen wären. Dabei kann ich mich an die Namen und Gesichter von Leuten aus meiner Vorschulzeit viel besser erinnern als aus jeder anderen Phase meines Lebens.
Am meisten bedeuteten mir Mrs. Rule und ihr Mann, Professor Rule. Sie waren ein junges amerikanisches Ehepaar; er, ein gebürtiger Neuseeländer, war bereits presbyterianischer Geistlicher, studierte aber an der Universität Edinburgh noch weiter Theologie. Eine Weile wohnten sie bei uns, in dieser Zeit kam ein hübsches Baby zur Welt (geboren in einer Entbindungsklinik in Edinburgh). Ich bestaunte dieses Wunder in seiner Krippe. Ich weiß auch noch, wie tief es meine Mutter beeindruckte, daß Professor Rule die Babysachen wusch. Noch heute sehe ich Mrs. Rule mit ihren Grübchen am Kamin sitzen, einen Packen faszinierender quadratischer Kärtchen in der Hand, auf denen jeweils ein Buchstabe stand. Damit brachte sie mir Lesen bei, angefeuert von ihrem Mann. Er hieß mit vollem Namen Andrew K. Rule D.D. (Doktor Divinitatis), wie ich feststellte, als ich seinen Namen schon auf einem Briefumschlag lesen konnte. Ich war da zwischen drei und vier Jahre alt. Das war sehr früh, aber es war damals in Edinburgh nichts Ungewöhnliches, daß Kinder schon fließend lesen und schreiben konnten, bevor sie fünf waren. Der Feuerschein spielte auf Mrs. Rules Händen und Gesicht, auf Professor Rules bärtigem Lächeln sowie auf meinen beschrifteten, auf der Rückseite roten Kärtchen, die vor mir auf einem Tablett lagen, während ich auf einem gepolsterten kleinen Schemel am Feuer saß und Mrs. Rule mir erklärte, daß »t« und »h« zusammen den Zahnlaut »th« wie in thing ergäben. Die Rules kehrten dann nach Amerika zurück und schrieben von dort Briefe an meine Mutter, aber die kostbaren Karten ließen sie mir da.
Erst vor kurzem konnte ich wieder bestätigt finden, daß meine damaligen Eindrücke von diesem aufregend netten Paar der Wirklichkeit entsprachen. Mein Bruder sagt, daß Charlotte ausgezeichnet Klavier gespielt habe, was meiner Mutter große Freude gemacht haben muß. Philip kann sich auch erinnern, wie schön sie war. Charlotte Rule starb nach ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten. Barbara Below, Andrew K. Rules Tochter aus zweiter Ehe, konnte mir ebenfalls meine Kindheitserinnerungen bestätigen. Als ich ihr zum Beispiel erzählte, daß ihr Vater uns beigebracht habe, Popcorn zu machen (ich sehe immer noch die hüpfenden Maiskörner in der Pfanne, die er übers Feuer hielt), sagte Mrs. Below, daß auch ihr Vater ihr erzählt habe, wie er vor vielen, vielen Jahren seinen schottischen Freunden beigebracht habe, Popcorn zu machen.
Ich kannte so ziemlich jeden, der Briefe an meine Eltern schrieb oder uns zu Hause besuchte. Unsere Welt war klein, und meine Mutter konnte sich nie enthalten, zu allem ihren Kommentar abzugeben. Wie ich mich jedesmal freute, wenn es klingelte!
Es machte Spaß, mit meiner Mutter Leute zu besuchen. Da wurde nie eigens dafür gesorgt, daß die Kinder Unterhaltung hatten. Wir waren einfach da und hatten stillzusitzen. Nicht allen Kindern gefiel das, aber mir war es gerade recht. Ich hörte doch so gerne zu. Mir waren ja nicht nur die vielen Leute vertraut, die unsere kleine Welt bevölkerten und mich weitgehend ignorierten, hinzu kamen auch solche, die ich nur vom Hörensagen kannte, und oft kam ich mit Leuten in Berührung, die ihrerseits mit der Weltgeschichte in Berührung gekommen waren.
So jemand war Mrs. Lipetz, wie sie für uns hieß, Susan für ihren Mann. Ich wußte nur, daß sie schon älter war. Sie saß jeden Nachmittag am Erkerfenster ihrer Erdgeschoßwohnung am Bruntsfield Crescent, einer bogenförmigen Front von hohen Häusern, gebaut um 1870, die man von unseren vorderen Fenstern aus sehen konnte. Mrs. Lipetz war in Elsaß-Lothringen geboren, sprach aber ohne ausländischen Akzent. Als wir eines Tages bei ihr zu Besuch waren, hörte ich sie erzählen, wie sie und andere Schulkinder in Elsaß-Lothringen nach dem französisch-preußischen Krieg schnell ihre französischen Bücher verstecken mußten, weil der Kaiser die Schule besuchen kam. Das muß 1871 gewesen sein, nach dem Frankfurter Friedensvertrag, als Frankreich Elsaß-Lothringen an das Deutschland Kaiser Wilhelms I. abtreten mußte. Und es erfüllt mich noch immer mit Staunen, wenn ich bedenke, daß dieses Kindheitserlebnis meiner Freundin Mrs. Lipetz von 1871 mit dem Jahr zusammenfiel, in dem Middlemarchvon George Eliot, Die Abstammung des Menschen von Charles Darwin und Alice hinter den Spiegeln1 von Lewis Carroll erschienen. Damals hatte ich natürlich noch keinerlei Sinn für Historie, mich beeindruckten nur Mrs. Lipetz’ Worte: »schnell unsere französischen Bücher verstecken« und: »der Kaiser«. Eine Zeitlang verwechselte ich diesen Kaiser mit jenem anderen Kaiser, seinem Enkel, von dem die Leute noch immer redeten. Der Erste Weltkrieg war erst seit ein paar Jahren vorbei. Aber dann wurde mir erklärt, daß Mrs. Lipetz’ Kaiser schon tot sei.
Eine andere legendäre Figur, die ich durch meine späte Geburt knapp verpaßt hatte, war Fish Jean, von der mein Vater und seine Freunde sehr viel redeten. (»Erinnerst du dich noch an Fish Jean?« fragten sie oft.) Ob Fish Jean mit einer gewissen »Herrin’ Jenny«, einer Edinburgher Berühmtheit, identisch war, bezweifle ich. Mir scheint, es gab zwei davon, die wahrscheinlich erfundene Herrin’ Jenny früher als Fish Jean. Das Wunderbare an Fish Jean war nicht, daß sie wie andere Fischhändlerinnen aus dem blühenden Fischerviertel Newhaven durch die Straßen zog und ihre Waren anpries, sondern die schrille Art, in der sie es tat. Der Kutschbock ihres Fuhrwerks muß besonders breit gewesen sein, damit Fish Jeans Leibesfülle darauf Platz hatte; sie trug an allen Fingern mehrere große Diamantringe, und mit diesen reich geschmückten Händen griff sie mitten hinein in ihre Heringe und Makrelen und bediente stolz ihre Kunden.
Eine andere Frau, die ich nie persönlich kennenlernte, sondern nur vom Hörensagen kannte, war Emmeline Pankhurst, die Führerin der Frauenrechtsbewegung jener Tage. Hauptziel der Bewegung war das Wahlrecht für Frauen. Meine Großmutter mütterlicherseits, Adelaide Uezzell, gehörte der Suffragettenbewegung (wie sie sich selbst nannte) von Watford an und war an Mrs. Pankhursts Seite marschiert, wie alle mit einem Regenschirm bewaffnet. Meine Großmutter hat mir schon sehr früh von diesen Ereignissen berichtet. Aber für mich war es zu spät, um Mrs. Pankhurst noch persönlich zu erleben. Ich mußte mir die Szenen ausmalen.
Tot, beide tot: der Kaiser von Mrs. Lipetz und meines Vaters Fish Jean, noch ehe ich sie zu Gesicht bekommen konnte. Auch Großmutters Mrs. Pankhurst kannte ich nur vom Hörensagen. Das war mir unbegreiflich.
Allerlei
Mit meiner Mutter einkaufen zu gehen war wie eine Geographiestunde, was sie natürlich nicht ahnte. Da gab es die Lebensmittelläden mit ihren Säcken voll Bohnen und anderen Produkten, in denen Preisschilder steckten. Alles kam damals von irgendwoher. Reis kam aus Patna, Tee aus dem damaligen Ceylon. Speck kam aus Ayrshire oder Wiltshire, Rindfleisch aus Angus (weshalb »Angus Beef« darauf stand).
Lamm und Hammel kamen aus Wales oder Schottland, wenn nicht aus Neuseeland.
Manchmal kam auch die Butter aus Neuseeland, meist aber aus dem nahen Dumfries.
Sahne kam aus Ayrshire, Cornwall oder Devon.
Käse kam aus Cheddar. Ich kann mich aus meiner Vorschulzeit an keine andere Sorte erinnern. Später gab es auch Gorgonzola, der den weiten, weiten Weg aus Gorgonzola hinter sich hatte.
Fisch kam aus der Nordsee oder Loch Fyne (woher die besten Heringe stammten). Außer Heringen gab es Makrelen, Heringskönig, Schellfisch, Heilbutt, Steinbutt, Scholle, Flunder und Seezunge.
Caller herrin’ bedeutete grüner Hering. In einer bekannten Ballade hieß es:
Wha’ll buy my caller herrin’?
They’re bonny fish and halesome farin’.
Wha’ll buy my caller herrin’?
New drawn frae the Forth.
(Wer kauft meinen grünen Hering?
Ein prima Fisch und gesunde Kost.
Wer kauft meinen grünen Hering?
Ganz frisch gefangen im Forth.)
Baumwolle kam aus Indien oder Ägypten, Seide aus Mailand und Lyon. Florgarn (für unsere Strümpfe und Sommerunterwäsche) kam aus Lille.
Strohhüte kamen aus Livorno oder Panama.
Geld gab es als Pfundnoten (Papier) oder, im selben Wert, Sovereigns (Goldmünzen); außerdem als silberne Half-crowns (acht auf ein Pfund), silberne Florins (zehn auf ein Pfund), silberne Shillings (zwanzig ergaben ein Pfund), Sixpennies (Silbermünzen im Wert von einem halben Shilling), kleine silberne Threepenny-Münzen (ein halber Sixpence), Bronzepennies (auch Coppers genannt, von denen zwölf auf einen Shilling kamen) sowie aus demselben Metall Halfpennies (gesprochen Heipnies, halbe Pennies) und Farthings (ein halber Halfpenny). Zudem kannte man noch die vornehmen Guineen, für die es aber weder Noten noch Münzen gab. Eine Guinee bedeutete einfach ein Pfund plus ein Shilling. Ärzte rechneten in Guineen ab, ebenso Kürschner und die feinen Schneider und Hutmacher. Die besten Kleidergeschäfte zeichneten ihre Preise in Guineen aus, Kinderkleidung wurde jedoch in Pfund, Shilling und Pence berechnet, wie auch Lebensmittel und Eisenbahnfahrkarten.
Meine Eltern wußten offenbar nicht, daß auch die Kürschner nach altem Brauch in Guineen bezahlt wurden. Ich erinnere mich an eine Kürschnerin am Ort, die vollbusige Mrs. Madge Forrester, die für meine Mutter ein Pelzcape geändert hatte, und zwar zu einem vorher vereinbarten Preis, fünf Pfund, wie meine Eltern glaubten, doch die Kürschnerin verlangte Guineen. Ich sehe Mrs. Forrester in unserem Wohnzimmer am Erkerfenster sitzen, nachdem sie das geänderte Cape abgeliefert hatte; wie ein Schattenriß saß sie vor der Helligkeit und wiederholte: »Nein, nicht fünf Pfund, fünf Guineen. Fünf hab ich gesagt. Wir Kürschner meinen immer Guineen. Fünf hab ich gesagt.« Ich sehe meinen Vater noch die strittigen fünf Shilling abzählen; und seitdem hieß Mrs. Forrester für meine Eltern nur noch »Fünf hab ich gesagt«. Es wurde ihr Lieblingssatz. »Fünf hab ich gesagt« wohnte und arbeitete im Haus gegenüber, so daß wir sie oft vom Fenster aus sahen. »Guten Tag, Mrs. Forrester«, sagte meine Mutter, wenn sie ihr auf der Straße begegnete. Aber hinterher berichtete sie meinem Vater: »Ich bin heute ›Fünf hab ich gesagt‹ begegnet.«
Nachbarn
Jemandem auf der Straße zu begegnen hieß stehenbleiben und mit ihm plaudern, oder man sagte nur kurz etwas über das Wetter und ging weiter. Bei gutem Wetter sagte man wohlerzogen: »Guten Morgen, Mrs. X, ein schöner Tag.« Wenn es regnete, von Norden kräftig stürmte oder schneite, lautete der Gruß: »Guten Morgen, Mrs. X, typisches Wetter für die Jahreszeit.« Man nannte sich nicht beim Vornamen. Die älteren Damen von Edinburgh hörte man nicht selten eine verheiratete Frau mit Mistress statt Mrs . anreden. So sprach Mrs. Hardie, eine schon recht betagte, gebildete Freundin, meine Mutter in den dreißiger Jahren stets mit »Mistress Camberg« an.
Das Erdgeschoß unseres Nachbarhauses beherbergte einen Juwelierladen, und in dessen hinteren Räumen wohnten die Besitzer, die Familie Page. Sonntags morgens pflegte Mr. Page zum Mound zu gehen, dem malerischen Hyde Park Corner von Edinburgh, um dort seine Kiste aufzubauen und aus der Bibel vorzulesen oder über sie zu predigen. Welche Botschaft er da verbreitete, weiß ich nicht. Auf dem Mound durfte und darf bis heute jedermann am Sonntagmorgen über alles reden, was er will, hauptsächlich über Politik oder Religion, sofern es nicht obszön oder aufrührerisch in ziemlich weitem Sinne ist. Sonntags nachmittags setzte der rothaarige Mr. Page sich nach erfüllter Pflicht auf sein Motorrad mit Beiwagen und fuhr aufs Land hinaus. Sein rothaariger Sohn James, der noch zur Schule ging, fuhr auf dem Sozius und Mrs. Page im Beiwagen, ihr Töchterchen Isabel auf dem Schoß. Da mein Bruder und ich auch rothaarig waren, fand ich es nur recht, daß wir rothaarige Nachbarn hatten. In Schottland ist der Anteil der Rothaarigen überhaupt vergleichsweise hoch.
Isabel war genauso alt wie ich und meine erste Spielgefährtin. Aus unserer Wohnung blickte man nach hinten auf einen schönen Rasen, eine Grünanlage zwischen den Häuserrückseiten eines Straßengevierts. Dort konnten wir, sorgsam bewacht von unseren Müttern aus ihren jeweiligen Fenstern, ungefährdet spielen. Isabel und ich spielten mit unseren Puppen, schlugen improvisierte Zelte auf oder versuchten beharrlich, ein Loch nach Australien zu graben, bis es Zeit wurde, daß man uns zum Tee hineinrief. In Schottland sind die Sommertage lang. Das Wetter kann nicht immer so schön gewesen sein, daß wir draußen spielen konnten, aber wenn die Sonne schien, hörte sie nicht mehr auf. An wunderbaren Tagen öffnete Mrs. Kerr, die über uns wohnte, gegen drei Uhr nachmittags ihr Fenster und ließ uns einen Picknickkorb herunter. Ich weiß nicht mehr, was da so alles drin war, nur daß wir hocherfreut immer alles aufaßen.
Mrs. Kerr war beträchtlich älter als meine Mutter. Ihre Tochter Maudie war schon über zwanzig und wollte Sängerin werden. Sie arbeitete bei der Stadtverwaltung, aber Sängerin zu werden war ihr großer Ehrgeiz, und das bekamen wir Abend für Abend aus der Wohnung über uns zu hören. Wir beschwerten uns nie, auch nicht untereinander. Man akzeptierte, daß Maudie eben eine Auserwählte war. Mrs. Kerr erzählte uns über Maudies Ausbildung regelrechte Legenden, die Eindruck auf uns machen sollten und auch machten. Maudie sollte in einem Konzert auftreten: »Natürlich muß sie für ihre Stimme Leber essen.« Es wurden große Blumensträuße bestellt, damit man sie der blonden, blauäugigen Maudie auf der Bühne überreichen konnte. »Das ist so Sitte«, sagte Mrs. Kerr. »Sängerinnen bekommen immer einen Strauß auf die Bühne.«
Mrs. Kerr war es auch, die meine Mutter das Suppekochen lehrte. »Three brees to a bane«, sagte Mrs. Kerr, was für meine Ohren zuerst gruslig und poetisch klang, wie aus den Grenzlandballaden. Aber schnell verstand ich, was sie meinte: daß man aus jedem Knochen drei Portionen Suppe bekam.
Es fiel mir selten schwer, die Leute zu verstehen. Als ich später zur Schule ging, fragte der freundliche Polizist, der mich über die Straße führte, mich nicht: Wie heißt du? sondern: »What do they cry you?« (Wie ruft man dich?). Wir selbst drückten uns nie so aus, aber viele Leute um uns herum »riefen« das Kind beim richtigen Namen. Unsere bettlägerige Nachbarin, die arme Miss Peggy Moffat, die Arthritis hatte und einmal Malerin gewesen war, sprach normales Englisch mit schottischem Akzent, aber ihre Haushälterin, die drahtige Miss Draper, eine spöttische Wahrsagerin, sprach viel im Dialekt; als ich einmal in der Schule einen Preis gewann, lautete Miss Drapers verwirrender Kommentar: »The Deil aye kens his ain«, und ich wußte genau, was das hieß: Der Teufel kennt stets die Seinen. Ich wäre entsetzt gewesen, hätte Miss Moffat selbst so etwas je gesagt, aber da es nur Miss Draper war, wie sie leibte und lebte, nahm ich es nicht übel. Eines von Peggy Moffats Ölbildern, eine Lichtung im botanischen Garten, hing bei uns an der Wand. Daß sie nie wieder einen Pinsel führen würde, war bereits ihr Schicksal, bevor ich zur Welt kam. Ich ging sie gern besuchen und stand dann neben ihrem Bett, über dessen hohe Kante ich gerade blicken konnte.