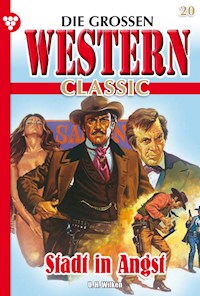3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Yellow River Zwei weiße Familien siedeln am Yellow River. Beide Familien beanspruchen das Land für sich allein. Ein blutiger Streit beginnt. Dabei gerät ein Indianerkind zwischen die Fronten und wird getötet. Die Lanzen-Bande Skrupellose Mörder überfallen abgelegene Farmen, töten die Bewohner und hinterlassen Speere und Pfeile. Jeder soll glauben, dass die Sioux diese Überfälle begangen haben. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN
YELLOW RIVER
DAN OAKLAND STORY
BUCH 27
U. H. WILKEN
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2023 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Torsten Kohlwey
Alle Rechte vorbehalten.
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-7579-5366-9
4327v1
INHALT
Einleitung
Yellow River
Die Lanzen-Bande
Anmerkung
Über den Autor
EINLEITUNG
Trapper Dan Oakland steht im Mittelpunkt dieses düsteren Kapitels der amerikanischen Geschichte: Der Vertreibung der Indianer aus ihren angestammten Gebieten. Er muss sich mit gefährlichen Flusspiraten, grausamen Büffeltötern und skrupellosen Pelzhändlern herumschlagen und gerät dabei immer wieder zwischen die Fronten von Rot und Weiß.
Ein weiteres Western-Highlight aus den 1970er Jahren!
Zunächst unregelmäßig im SILBER WESTERN erschienen, wurden die Trapper-Abenteuer von Western-Vielschreiber U.H. Wilken bald zu der gern gesammelten Heftserie DAN OAKLAND STORY, die nach über 40 Jahren in dieser TB-Edition, mit je zwei Romanen pro Band, im neuen Glanz erstrahlt!
YELLOW RIVER
Von einer Sekunde zur anderen gerieten Dan Oakland und sein Sohn Sky in Todesgefahr!
Krachend entlud sich das Gewehr des heimtückischen Schützen. Heiß schrammte das Blei über Dan Oakland hinweg und ließ ihn vom Pferd springen. Im Nu lag auch Sky am Boden.
Wieder dröhnten Schüsse durch die Abenddämmerung. Mit dumpfem Klatschen gruben sich die Kugeln in das morsche Holz der Bretterwand. Klirrend barst die Scheibe des Hauses am Fluss.
Wütend sprang der bullige Trapper auf, schwang sich auf die brüchige Veranda, rollte gegen die Tür und polterte in den halbdunklen Raum hinein. Schrill wiehernd rasten die beiden Sattelpferde hinter das Haus.
„Sky!“
Doch der Sohn antwortete nicht. Mit der Gewandtheit einer Raubkatze glitt er tiefgeduckt davon, schlängelte sich gerade über eine Bodenwelle. Nebel wallte über dem Yellow River, hüllte das alte Haus und den windschiefen Stall ein. Grimmig blickte Dan Oakland durch das zertrümmerte Fenster in den Abenddunst. Er suchte vergeblich nach dem hinterhältigen Gewehrschützen.
Der Knall der Schüsse erstarb zwischen den Hügeln jenseits des Flusses in geisterhaftem Geflüster. Totenstille lastete über der verwaisten Farm. Das Haus musste schon seit langem aufgegeben sein. Durch den brüchigen Bretterboden wucherte Gras. Staubige Spinnweben hingen in allen Ecken, bewegten sich im Wind.
„Pass auf, mein Junge“, raunte Dan Oakland besorgt.
Sky konnte seinen Vater schon lange nicht mehr hören. Der Halbblutindianer aus Dakota drang kaltblütig vor. Er schlich in weichen Mokassins lautlos um die hohen Strauchgruppen und Bäume. Das Leben in der Wildnis des Indianerlandes hatte Sky geformt. Wie ein Schatten bewegte er sich durch die Dämmerung. Der Wind kam ihm entgegen und trug den Geruch von verbranntem Pulver heran. Die sehnigen schlanken Hände des jungen Mannes hielten die Winchester fest gepackt. Mit seinen dunkelbraunen Augen spähte Sky suchend umher. Kein Muskel zuckte in seinem schmalen und sonnengebräunten Gesicht. Schwarz und glatt fiel das lange Haar auf die Schultern. Lederne Fransen säumten Ärmel und Hosenbeine seiner Hirschledertracht. Tastend setzte er die Schritte und roch jetzt stark den Pulverdampf.
Im leeren Haus wartete sein Vater mit angeschlagener Winchester und horchte angespannt in den Wind. Die Nebelschwaden formten gespenstische Gestalten, die ihn immer wieder narrten.
Er war mit seinem Sohn unterwegs in die Black Hills. Die Nacht fiel über Dakota.
Und hell funkelten die Sterne über dem Yellow River, dessen Wasser zu glänzen begannen.
Gebeugt näherte Dan Oakland sich der Tür, schnellte hinaus und warf sich in die Nebel.
Wieder peitschten Schüsse. Ein Bleigewitter prasselte gegen Veranda und Haus.
Dan Oakland stürmte wie ein wildgewordener Büffel durch die Flussniederung und lenkte den heimtückischen Schießer ab. Sky kam unbemerkt an den Schützen heran. Hart trat er ihm das rauchende Gewehr aus der Hand, riss ihn herum und warf sich auf ihn, packte die Arme, hielt sie eisern fest und presste sie zu Boden. Wild zuckte der Körper unter ihm; keuchend bäumte sich der Schütze auf. Mit ganzer Kraft presste Sky die Schenkel zusammen und drückte ihm die Luft aus dem Leib. Blitzschnell schlug Sky dann mit der Faust zu, und der Gegner erschlaffte.
Sky hatte den Gegner gestellt, doch vielleicht lauerten noch weitere Halunken in der Nähe.
Darum zerrte er den Bewusstlosen hinter sich her zwischen die Strauchgruppen.
Angespannt lauschte er dem Wispern des Windes. Im aufkommenden Mondschein konnte Sky das Gesicht des Gegners erkennen. Er zuckte betroffen zusammen. Ein dumpfer Laut der Überraschung kam über seine Lippen. Doch dann, schon nach Sekunden, handelte Sky ruhig und überlegt, holte das Gewehr des Schützen, zerrte sich den Gegner über Schulter und Rücken und trug ihn lautlos durch die Niederung zum öden Haus.
„Dad?“, raunte Sky.
„Alles in Ordnung, mein Junge?“
Schemenhaft erschien Dan Oakland im Nebel. Er kam geräuschlos näher. Der große, bullige und schwere Mann konnte sich leiser als ein Hauch und schneller als eine Wurfaxt bewegen.
„Ja, Dad, ich habe ihn“, antwortete Sky.
Dan verzog grimmig das sonst so gutmütig wirkende Gesicht.
„Schmeiß ihn über die Brüstung der Veranda, Sky! Der Kerl hat es verdient, dass man ihm ein Brandeisen auf den Hintern drückt! Wer, zum Teufel, schießt ohne jeden Grund auf uns? Wer kann so verrückt sein und dabei den Tod herausfordern? Verdammt, ich hätte ihm vielleicht sogar den Fangschuss gegeben!“
Sky hielt den Bewusstlosen noch immer auf dem Rücken und atmete tief ein. Im Mondschein schimmerte sein weiches indianisches Gesicht wie Bronze. Flüchtiges Lächeln geisterte über sein Gesicht.
„Ich lege ihn wohl besser zu Boden, Vater.“
„He, seit wann geht mein Sohn so sanft mit solchen verrückten Kerlen um? Der Kerl wollte uns glattweg erschießen! Dabei sind wir ihm noch niemals begegnet, oder?“
Dan beugte sich vor, griff in das lange schwarze Haar des Schützen und blickte in das Gesicht.
„Das ist ja ...“
„Ja, Dad, ein Mädchen, vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich. Und sie ist sehr schön, finde ich.“
Dan Oakland knurrte vor sich hin, meinte dann beiläufig: „Vergiss das, was ich von der Verandabrüstung gesagt habe“ und stapfte um das Haus.
Sky legte das Mädchen zu Boden. Unwillkürlich musste er über seinen Vater lächeln, über die brummige Art und über den rauen Ton. Aber es hätte wirklich nicht viel gefehlt, und sie hätten beide auf dieses Mädchen geschossen. Es wäre jetzt tot. Doch es lebte, lebte mit einem wilden Hass. Jäh richtete es den Oberkörper auf und griff Sky an die Gurgel. Beide rollten weg und wirbelten gegen die Bretterwand des Hauses, ruckten herum und rollten durch das nebelfeuchte Gras. Längst hätte Sky mit seinem Gegner fertigwerden können, aber diesmal wusste er ja, dass es ein Mädchen war, und darum war er auch nicht hart genug. Er konnte das Mädchen nicht schlagen.
„Ich bringe dich um!“, fauchte sie. „Ich mache dich kalt, du Hundesohn, verfluchter Bastard“
Gerade noch rechtzeitig konnte Sky ihre Hände aufhalten und die Gelenke umfassen, sonst hätte sie ihm womöglich die Augen ausgekratzt. Sie war unheimlich wild. Und weil Sky noch immer zögerte, sie hart anzupacken, brachte sie ihn wenig später in arge Not. Beide rollten erneut gegen die Bretterwand, stießen gegen die Veranda und gerieten auf die am Boden liegenden Gewehre.
Im Nu hatte das Mädchen eines der Gewehre an sich gerissen und wollte auf Sky schießen.
Da feuerte Dan Oakland. Grell flammte es neben dem Haus auf. Das Blei riss dem Mädchen das Gewehr aus der Schussbahn. Die Kugel verfehlte Sky nur um Haaresbreite. Als das Mädchen das Gewehr abermals auf Sky richten wollte, schoss Dan Oakland dem Mädchen das Gewehr aus den Händen. Schrill schrie sie auf. Die Kugel hatte sie an der Hand verletzt. Stöhnend umklammerte sie das Gelenk.
„Ihr verfluchten Schweine!“, fauchte sie. „Das sollt ihr büßen! Das vergibt euch keiner von uns!“
Mit großen Schritten war Dan Oakland heran, ließ die Zügel der beiden Pferde los und stieß das Gewehr mit dem rechten Fuß zu seinem Sohn hin. Sein Lächeln war überhaupt nicht mehr gutmütig.
„Miss, was wird hier gespielt? Hier am Yellow River durch die Gegend zu ballern, kann den Tod bedeuten! Die Indianer sind jetzt gereizt und gefährlich, besonders für ein Mädchen.“
„O ja, ich weiß!“, stieß sie gepresst und hasserfüllt hervor. „Ihr seid Indianerfreunde! Die Santee-Sioux sind aus Minnesota vertrieben worden. Ein paar haben es wohl geschafft, hierherzukommen, denn wir haben Spuren entdeckt. Ihr bringt es fertig und tötet mich!“
Dan warf seinem Sohn einen schnellen Blick zu. Sky tippte mit dem Zeigefinger an die Stirn.
„Sie ist verrückt, Dad.“
„Das glaube ich langsam auch! Verdammt, was soll das alles?“
„Nun tut doch nicht so!“ Der Zorn raubte dem Mädchen fast den Atem. „Du wirst bald verrecken, Chiricahua! Wenn ich dich nicht umbringe, dann wird das mein Bruder erledigen!“
„He, langsam“, sagte Dan mit schleppender Stimme. „Du verwechselst meinen Sohn mit einem anderen, der Chiricahua heißt, Mädchen. Sieh dir meinen Sohn mal genau an! Los, mach schon!“
Zögernd näherte sich das Mädchen Sky, der beide Gewehre an sich genommen hatte.
Sie musste sein Gesicht deutlich im Mondschein erkennen. Dennoch rieb sie sich angeekelt die Handflächen an den Hosenbeinen ab und erklärte: „Ein Halbblut! Ich hab’s doch gewusst. Ein Halbblut bleibt eben immer ein Halbblut! So oder so, er ist ein Bastard wie dieser Chiricahua!“
Stilles Lächeln legte sich um Skys Mund. Uber solche Vorurteile konnte er sich nicht empören, denn er war stolz darauf, halb Indianer und halb Weißer zu sein.
Das Mädchen spie sogar aus. Als es sich von Sky abwandte, stieß es gegen Dan Oakland.
„Du brauchst mir nicht viel zu erzählen, Mädchen“, meinte Dan sanft. „Ich möchte nur wissen, warum du auf uns geschossen hast. Well, du hast uns verwechselt mit irgendwelchen anderen Leuten, aber da schießt man doch nicht gleich, denke ich.“
Sie musste den Kopf weit in den Nacken legen, wollte sie in Dan Oaklands steingraue Augen blicken. Falten durchzogen gleich Ackerfurchen das Gesicht des Trappers. Dieses Gesicht war wie eine Landschaft, von Stürmen, Regen, Wind und Sonne gezeichnet, von einem rauen Leben hoch oben in den Rocky Mountains und den Wäldern jenseits des Quellgebietes des Missouri geprägt.
„Nein“, sagte sie leise, „Sie sind nicht John McIntire, und das Halbblut da drüben ist nicht Chiricahua. Ja, ich habe euch verwechselt! Die McIntires haben mal in dieser Bruchbude gelebt!“
„Wo sind sie jetzt?“
„Irgendwo am Yellow River. Wir kriegen sie schon noch!“
„Warum wollt ihr sie kriegen? Wer bist du?“
„Ich bin Severine Dorset! Mein Vater ist Walter Prescott Dorset! Hier am Yellow River ist nur Platz für eine weiße Familie, für uns! Wir dulden hier keine zweite Farm!“
Dan und sein Sohn tauschten schnelle Blicke, sie wussten jetzt Bescheid.
„Hier ist aber Indianerland, Miss Severine“, erinnerte Dan sie an bestehende Verträge. „Kein Siedler darf sich einfach niederlassen.“
„Ach was! In ein paar Jahren gehört dieses Land ohnehin den Weißen. Dann wird es die Indsmen erwischt haben. Also, warum dann noch lange darüber reden?“
„Die Dorsets wollen also die Indianer verjagen?“
„Nicht im großen Stil, Trapper! Wir werden uns nur verteidigen, das ist das richtige Wort dafür.“
Dan Oakland zog die Mundwinkel herab; es hatte keinen Sinn, verbohrten Menschen irgendetwas zu erklären. Severine war zwischen Dan und Sky stehengeblieben. Sie streckte die Hand in Richtung Sky aus.
„Kann ich nun endlich mein Gewehr zurückbekommen?“, fragte sie bissig.
Sky warf ihr das Gewehr vor die Füße und wandte sich ab. Sie starrte auf seinen Rücken, auf das im Wind wehende schwarze Haar, und sie nahm das Gewehr mit der unverletzten Hand aus dem feuchten Gras hervor und presste den Kolben gegen die Hüfte. Sie konnte nun auf Sky schießen.
Aber noch einmal würde Dan Oakland Severine keine Chance geben, der Schuss würde sie vermutlich töten. So ging sie mit dem Gewehr unterm Arm davon, verschwand im nächtlichen Nebel. Bald darauf hörten Dan und Sky das Hufgetrappel eines einzelnen Pferdes.
Severine Dorset ritt durch das weite zerklüftete Land am Yellow River. Nachdenklich stand Dan Oakland vor dem verwaisten alten Haus.
„Das Mädchen hätte uns umgebracht, Sky. Die Dorsets sind sicherlich eine wilde und jähzornige Sippe. Wir müssen uns vor ihnen in Acht nehmen. Besonders du, denn du scheinst diesem Chiricahua McIntire sehr ähnlich. Die Dorsets halten sich für die Herrscher am Yellow River.“
Sky nickte ernst.
„Dad, ich werde dennoch an deiner Seite bleiben. Die Lagerfeuer der Dakota werden auch noch in vielen Monden brennen.“
„Ich will bleiben, Sky, um rauszubekommen, welche Gruppe der Santee-Sioux hier an den Yellow River gekommen ist. Viele Indianer kennen noch nicht einmal den Weg in die Black Hills und Paha Sapa. Wenn sie sich hier am Yellow River festsetzen, dann werden sie zum Freiwild für Leute wie die Dorsets.“
Sky unterschätzte nicht die Gefahr, die ihm als Halbblut drohte. Er hatte sogar ein wenig Angst vor der unsichtbaren Gefahr, die im Hinterhalt lauern mochte. Doch die Zuneigung zu seinem Vater war größer als alles andere.
* * *
„Dad!“
Skys Stimme war kaum hörbar, und dennoch reagierte Dan Oakland schnell und sicher.
Sky war vorausgegangen, jetzt schnellten er und sein Vater sofort in die Deckung der Bäume.
Morgen über dem Indianerland. Und jenseits des tiefen Bergeinschnittes, zunächst kaum zu ernennen, stieg an der bewaldeten Bergflanke eine Rauchfahne empor, blass und dünn, vom Wind zerpflückt. Aus engen Augen blickte Dan auf das Rauchzeichen.
„Das können tatsächlich Santee-Sioux sein, Sky“, sagte er nachdenklich. „Jetzt geben sie ein Zeichen.“
„Kannst du es verstehen, Vater?“
„Kommt zum Fluss, dessen Ufer gelb sind.“
„Dann wollen sie sich am Yellow River versammeln?“ Sky schluckte trockenen. „Wir werden keinem Santee-Sioux begegnen, Dad, der einen Weißen in Frieden lässt. Und umgekehrt ist es genau so!“
Dan Oakland nickte. Wenn sich die Santees am Yellow River zusammenrotteten, konnte das für die Dorsets und für die McIntires den Tod bedeuten. Beide Squatter-Familien würden wohl auch auf umherstreifende einzelne Indianer losgehen. Hier am Yellow River braute sich ein gewaltiger Verdruss zusammen.
Das Rauchzeichen am Berghang war verweht. Dan und sein Sohn bewegten sich vorsichtig und mit den Pferden am Zügel um die Bäume, blieben stets in der Deckung der Sträucher. Obwohl die Santee-Sioux den Trapper und seinen Sohn gut kannten und schätzten, blieben beide im Hintergrund. Das hatte einen Grund: In den Reihen der Santee waren die Stimmen der jüngeren Krieger lauter geworden, und sie verlangten nach Krieg und weiteren blutigen Angriffen auf die Bleichgesichter. Da musste selbst Catch-the-Bear Dan Oakland vorsichtig sein! Schließlich ließen sie die Pferde zurück.
Geduckt glitten sie zum Yellow River hinab. In der Morgensonne leuchtete das Laub.
Überall am Fluss gab es Verstecke für Santee-Späher. Als Dan den fragenden Blick seines Sohnes auffing, nickte er. Wie eine Schlange schob Sky sich über die rund gewaschenen Uferfelsen und ließ sich wenig später in das Wasser gleiten. Nur mit Tomahawk und Green-River-Skalpmesser bewaffnet, schwamm Sky durch die lehmgefärbten Wasser.
Selbst ein geübter Späher hatte es nicht leicht, ihn auszumachen, denn er zog einen Strauch mit sich und verbarg sich darunter. Gleichzeitig ließ er sich von der Strömung treiben. Erst in den Strudeln zwischen den hohen Felsen im Flussbett ließ er den Strauch los und schwamm die letzten Yard schnell und voller Kraft, stieß zwischen das Ufergestrüpp und verschwand in nasser Lederkleidung.
Dan Oakland sah und hörte nichts von seinem Sohn. Der Wind trug die verhaltenen Stimmen der Indianer über den Yellow River zu ihm. Dan verließ sich ganz auf Sky, seine Ausdauer, Wachsamkeit und Naturverbundenheit. So schnell würde Sky nicht in die Falle gehen. Und mit Fallen musste Dan rechnen. Vielleicht rotteten sich dort drüben erbitterte Krieger um einen jungen, heißblütigen Häuptling zusammen. Catch-the-Bears Wort würde dann nicht zählen. Sie würden ihn und Sky ausschalten.
Um Gewissheit zu erlangen, wer sich an der Bergflanke zusammenfand und warum, riskierte Sky seine Haut. Mit der Lautlosigkeit eines indianischen Pfeils schnellte er um die Bäume und durch Licht und Schatten, so geschickt, dass etwaige Späher ihn womöglich als einen der ihren ansahen. Im Nu war Sky auf einem Pfad, der sich an der Bergflanke emporwand. Dieser Pfad musste ihn zum Versammlungsort der noch unbekannten Indianer führen. Je mehr Zeit verstrich, um so unruhiger wurde Dan, umso härter hielt er die Winchester und das Gewehr seines Sohnes gepackt. Es war nicht warm an diesem Morgen; dennoch lief ihm der Schweiß über die Stirn, perlte in die buschigen Brauen.
Sky selbst kroch indessen vom Pfad unter die Bäume und bewegte sich sehr vorsichtig um die Felsen. Die Stimmen der Indianer waren nun besser zu verstehen, doch Sky konnte noch immer nicht heraushören, ob er es mit Santee-Sioux zu tun hatte. Darum kroch er noch weiter.
Plötzlich entdeckte er rechts von sich im Unterholz einen jungen Weißen mit rotblonden Haaren. Dieser junge Mann kauerte zwischen zwei Bäumen und hielt in der Rechten einen soliden Trommelrevolver. Der Lauf zeigte noch in das knorrige Geäst. In der linken Halfter steckte ein zweiter Revolver. Noch hatte der Rotblonde ihn nicht entdeckt, da er angespannt das Geschehen vor sich beäugte, dass Sky noch nicht sehen konnte.
Dumpf schlug eine Trommel. Der Klang war so leise, dass Sky glaubte, den Herzschlag eines Menschen zu hören. Der Weiße kehrte Sky noch immer den Rücken zu. Sky konnte das Gesicht nicht erkennen. Auch Sky wollte wissen, was hinter den Bäumen geschah. Zugleich musste er dem Rotblonden auf die Pelle rücken. Behutsam arbeitete Sky sich weiter. Er musste einen kleinen Bogen machen, als er danach wieder aufblickte, war der Rotblonde verschwunden.
Noch immer schlug ein Indianer die Trommel. Der schwache Rauch qualmender Hölzer wehte über einen Platz, auf dem sich mehrere Indianer zusammengefunden hatten. Im Hintergrund konnte Sky mehrere aufgebahrte Tote erkennen, Indianer, die auf hohen Gerüsten zwischen den Bäumen ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. So überließen auch die Stämme von Dakota und alle Sioux die sterblichen Hüllen ihrer Toten dem langsamen Zerfall in den Baumwipfeln und auf den Gerüsten. Doch diese Indianer auf dem Platz vor Sky waren keine Sioux.
Sky kroch zurück. Er stieß dabei nicht mehr auf den rotblonden Mann. Unbemerkt schwamm Sky durch den Yellow River und erreichte endlich seinen Vater. Dan Oakland atmete auf.
„Nun?“
„Indianer von einem unbekannten Stamm, Vater, aber sie bestatten ihre Toten wie wir.“
„Wieviele sind es nach deiner Schätzung?“
„Höchstens dreißig, Dad. Es ist sehr schwierig, sie alle zwischen den Bäumen zu erkennen.“
Dan lauschte über den Yellow River. Er hörte nichts mehr von den Trommellauten.
„Dreißig fremde Indianer im Land der Dakota“, sprach er vor sich hin. „Das ist merkwürdig, Sky. Warum gehen sie nicht zu den Sioux und bitten um Aufnahme in den Wigwams, um ein Tal in den Black Hills oder am Big Horn River? Ja, ich frage mich, warum diese Indianer in aller Stille hier am Fluss ihre Toten aufbahren. Es gibt in diesem Land viele große Indianerfriedhöfe, heilige Stätten großer guter Geister.“ Sky zuckte die Achseln.
Dan sagte einen Atemzug später: „Wir bleiben in ihrer Nähe, Sky.“
„Ich habe noch einen jungen Weißen beobachtet, Dad, mit rotblonden Haaren. Er hat die Indianer belauert und sich dann davongemacht.“
Dan lächelte ernst. „Ich denke, Sky, dass es nicht verwunderlich ist, wenn ein Weißer Indianer beobachtet.“
„Jedenfalls ist er kein Scout und gehört nicht zur Armee, Dad. Ich glaube, dass er hier am Yellow River lebt, oder in den Bergen irgendwo dort oben.“
Sie zogen sich zurück und lagerten dann bei den Pferden in der Deckung. Immer wieder horchte Dan in den Wind. Kein ungewöhnliches Geräusch störte die Stille. Von den Indianern war nichts zu sehen. Vielleicht waren sie weitergezogen. Der Waldboden am Berghang erwärmte sich immer mehr unter der Sonne, und es war gut für einen Mann wie Dan, sich einmal ausruhen zu können. Er schlief auch ein, und Sky weckte ihn nicht. Er hielt Wache und wartete auf den Abend im Indianerland.
* * *
Lauernd schlich der Mann näher. Der Wind spielte in den Bäumen an der Bergflanke. Der rote Schein der sinkenden Sonne spiegelte sich auf dem glatten Gestein riesiger Felsplatten, die aus dem Grün am Hang im Osten emporragten. Rot wie Blut schimmerte jetzt die Wasserfläche des Yellow River. Der Mann mied das letzte Tageslicht und suchte die tiefen Schatten am Hang auf. Dennoch war zu erkennen, dass er blonde Haare hatte. Er trug die raue Kleidung der Squatter.
Tiefgeduckt, das Gewehr im Anschlag, die langen Beine voransetzend wie eine riesige Spinne, so bewegte er sich über den verlassenen Lagerplatz der Indianer. Grinsend stieg er über die erloschene Feuerstelle und spähte lauernd umher, als suchte er nach einem Opfer.
Vielleicht war es auch nur Neugierde, die ihn hierhergetrieben hatte. Doch es konnte auch Gier oder Habsucht sein.
Drüben auf der anderen Seite des Yellow River brachen um diese Zeit Dan Oakland und sein Sohn Sky auf. Sie mussten mit den Sattelpferden über einen unbefestigten Pfad und brauchten sehr viel Zeit, das Flussufer zu erreichen. Inzwischen stand schon bleich der Mond über dem Yellow River. Auf dem Lagerplatz der Indianer blieb es still, nur manchmal drang ein leises Kichern durch das Rauschen der Baumkronen.
Dann war plötzlich ein Knirschen und Platzen zu hören, so als würde altes und trockenes Büffelleder aufgerissen. Holzstangen brachen. Eingewickelte Körper fielen zu Boden. Häute platzten auseinander. Staub wallte auf. Trockene schwarze Haare, so dünn wie Spinnweben, zerfielen allein schon im Wind. Modergeruch wehte über die Bergflanke. Der weiße Mann mit dem Gewehr raffte einen länglichen Gegenstand an sich und entfernte sich dann mit leisem Auflachen. Vielleicht war er verrückt.
Dagegen sprach freilich, dass er jetzt sogar seine Spuren am Berghang sorgfältig tilgte.
Und auf einem Umweg erreichte er sein Pferd und gab sich alle Mühe, auch jetzt keine Spuren zu hinterlassen. Er ritt davon. Dan Oakland und sein Sohn Sky kamen auf den Lagerplatz der Indianer, stiegen von den Pferden und näherten sich jener Stelle am Hang, wo die Toten aufgebahrt waren. Düster blickte Dan auf die Zerstörung, die kein Indianer, kein Grizzly und kein Wolf angerichtet haben konnte.
„Nur ein Weißer tut so was, Dad.“
Skys Stimme klang belegt. Er starrte auf die Toten und wandte sich dann dem Wind zu, um nicht länger den kalten Modergeruch einatmen zu müssen. Langsam stapfte Dan umher, während Sky ihm Rückendeckung gab. Vor Dan lagen die aufgeplatzten Hüllen der Leichname. Sie bestanden aus Büffelhäuten, Fellen und Pelzen. Tote Gesichter lugten eingefallen und eingetrocknet aus den Hüllen. Dan konnte hier nichts mehr tun. Er ging zu Sky und sagte mit einem düsteren Blick auf den Friedhof der Indianer: „Das können nur Weiße getan haben, Sky. Die Indianer haben für ihre Toten sicherlich nur einen ruhigen Platz gesucht, um sie später endgültig aufzubahren. Wahrscheinlich suchen sie noch nach einem würdigen Ort. Wer das hier getan hat, ist ein Dreckskerl.“
* * *
Das zittrige Geschrei eines Babys drang durch die Stille unter den Fichten und Lärchen.
An einem glimmenden Lagerfeuer hockte reglos ein Indianer und starrte düster über die rote Glut, als wollte er einen Feind beobachten. Alte zerschlissene Tipis ragten auf. Bodenwellen und grasgefüllte Gräben durchzogen die Lichtung. Zwischen den Zelten hingen schwer und schlaff alte Büffelfelle. Sie schwangen im Nachtwind träge hin und her. Der Indianer am Feuer schien die Augen geschlossen zu haben. Sein welkes Gesicht war mit lehmgelben Farbstrichen bedeckt, die ihm ein dämonisches Aussehen gaben. Wieder schrie das Baby in der Wiege.
Eine jüngere Squaw hastete über die Lichtung, huschte in das Zelt und beugte sich beruhigend über die Wiege. Schon wenig später raschelte die Zeltplane, und ein Indianer betrat das Zelt.
Er war ein erfahrener Krieger und geachteter Häuptling. Herrisch bewegte er die Rechte und scheuchte seine Squaw hinaus. Dann trat er an die Wiege und betrachtete das Kind.
„Mein Sohn“, flüsterte der Indianer. „Dein Kriegsschrei soll später alle Bleichgesichter erzittern lassen. Schrei weiter, mein Sohn, schrei.“
Lächelnd wandte er sich ab und verließ das Tipi. Draußen erlosch das Lächeln. Aus schwarzen Augen blickte er drohend seine Squaw an, die auf ihn gewartet hatte und demütig den Kopf senkte.